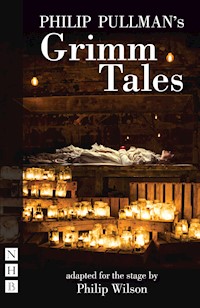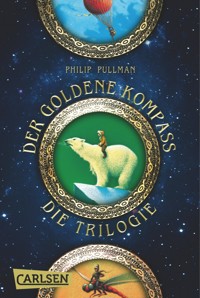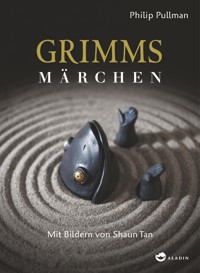
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aladin Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Es war einmal …" – mehr braucht es nicht und schon geht es los! Philip Pullman bringt das Herz der Grimm'schen Märchen zum Schlagen. Der britische Bestsellerautor leiht den Märchen seine Stimme und teilt mit seinen Lesern nicht nur seine Begeisterung für das Grimm'sche Werk, sondern offenbart ein Wissen über dessen Entstehung und Hintergründe, das – zusammen mit den einmaligen Skulpturen des australischen Ausnahmekünstlers Shaun Tan – einen unwiderstehlichen Märchenkosmos schafft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.www.aladin-verlag.de »The Book of Ephraim« aus The Changing Light at Sandover von James Merrill, Copyright © 1980, 1982 von James Merrill. Mit freundlicher Genehmigung von Alfred A. Knopf, a division of Random House, Inc. Alle deutschen Rechte bei Aladin Verlag GmbH, Hamburg 2013 Originalcopyright Text © 2012 by Philip Pullman Originalverlag: Penguin Classics, London 2012 Originaltitel: GRIMM TALES. For Young and Old Umschlagbild & Illustrationen: Shaun Tan, Copyright © bei Aladin Verlag GmbH, Hamburg 2013 Aus dem Englischen von Martina Tichy Umschlagtypografie: Steffen Meier Lektorat: Nina Horn Layout und Herstellung: Steffen Meier Lithografie: Margit Dittes Media, Hamburg Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-8489-6000-2
inhalt
Vorwort
grimms märchen
Der Froschkönig oder Der eiserne Heinrich
Kater und Maus in einem Haus (Katze und Maus in Gesellschaft)
Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
Der treue Johannes
Die zwölf Brüder
Brüderchen und Schwesterchen
Rapunzel
Die drei Männlein im Walde
Hänsel und Gretel
Die drei Schlangenblätter
Der Fischer und seine Frau (Von dem Fischer un syner Fru)
Das tapfere Schneiderlein
Aschenputtel
Das Rätsel
Die Maus, der Vogel und die Bratwurst
Rotkäppchen
Die Bremer Stadtmusikanten
Der singende Knochen
Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
Das Mädchen ohne Hände
Die Wichtelmänner
Der Räuberbräutigam
Der Gevatter Tod
Der Wacholderbaum (Von dem Machandelboom)
Dornröschen
Schneewittchen
Rumpelstilzchen
Der goldene Vogel
Das Bäuerlein (Das Bürle)
Allerleirauh
Jorinde und Joringel
Sechse kommen durch die ganze Welt
Der Spielhans (De Spielhansl)
Das singende, springende Lerchenvögelchen (Das singende, springende Löweneckerchen)
Die Gänsemagd
Der Bärenhäuter
Die beiden Wanderer
Hans-mein-Igel
Das Totenhemdchen
Die gestohlenen Groschen
Der Krautesel
Einauge, Zweiauge und Dreiauge (Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein)
Die zertanzten Schuhe
Der Eisenhans
Simeliberg
Der faule Heinz
Der starke Hans
Der Mond
Die Gänsehirtin am Brunnen
Die Nixe vom Mühlteich (Die Nixe im Teich)
Nachwort von Shaun Tan
Bibliografie
vorwort
Über-
drüssig aller Modefabelwerke unserer Zeit,
verlangt’s mich nach Geschichten ohne Beigeschmack
wie in Legenden, Märchen, rein geleckt ihr Ton
in Aberhundert Jahren von milden alten Zungen:
Großmutter spricht zum Jüngsten, abgeklärt und namenlos.
… So will auch mein Erzählen sein,
durchsichtig, ungebrochen,
mit den Figuren aus dem üblichen Bestand,
kaum je beschwert
von Eigenheiten und Erfahrung –
Einsiedler, Hexe, unschuldig-junges Liebespaar,
bekannt durch Grimm, Jung, Verdi
und Commedia dell’arte.
So lässt der amerikanische Dichter James Merrill »The Book of Ephraim« beginnen, den ersten Teil seines außergewöhnlich langen Gedichts The Changing Light at Sandover (1982), in dem er seiner Hoffnung Ausdruck verleiht, als Geschichtenerzähler einen eigenen Ton zu finden, und in diesem Zusammenhang zwei in seinen Augen besonders wichtige Charakteristika des Märchens heraushebt: die »abgeklärte, namenlose« Erzählstimme und die »Figuren aus dem üblichen Bestand«, die das Märchen bevölkern.
Mehr als »Grimm« braucht Merrill nicht zu sagen: Wir alle wissen, was gemeint ist. Seit die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm vor zweihundert Jahren erstmals gedruckt vorlagen, betrachten Leser und Schriftsteller der westlichen Hemisphäre sie als Quelle und Ursprung aller Märchen des Abendlandes; sie sind die bedeutendste, am weitesten verbreitete und meistübersetzte Sammlung dieser Art – Heimat all dessen, was wir in dieser Erzählform als einzigartig erachten.
Allerdings wäre eine solche Märchensammlung zweifellos auch ohne die Brüder Grimm zu Stande gekommen. Tatsächlich arbeiteten andere zur selben Zeit bereits an ähnlichen Projekten. Das frühe 19. Jahrhundert war für den deutschen Sprachraum eine Zeit des intellektuellen Aufschwungs, in der Rechtsgelehrte, Historiker und Philologen untersuchten und debattierten, was »Deutschsein« in einem »Deutschland« bedeutet, das es im Grunde gar nicht gab. Vielmehr bestand das Land aus rund dreihundert eigenständigen Staaten – Königreichen, Fürstentümern, Großherzogtümern, Herzogtümern, Landgrafschaften, Markgrafschaften, Kurfürstentümern, Bistümern und dergleichen mehr – den zersplitterten Überbleibseln des Heiligen Römischen Reiches.
Die Lebensumstände der Brüder Grimm sind nicht sonderlich bemerkenswert. Jacob (1785–1863) und Wilhelm (1786–1859) waren die ältesten überlebenden Söhne von Philipp Wilhelm Grimm, einem wohlhabenden Advokaten aus Hanau im Reichsfürstentum Hessen-Kassel, und seiner Frau Dorothea. Sie erhielten eine klassische Schulbildung und wurden im calvinistisch geprägten reformierten Glauben erzogen. Als aufgeweckte, fleißige und ernsthafte Schüler traten sie in die Fußstapfen ihres Vaters und hätten zweifellos glänzende Karrieren in der Jurisprudenz absolviert; doch nach seinem unerwartet frühen Tod im Jahr 1796 war die Familie mit mittlerweile sechs Kindern auf Unterstützung seitens der mütterlichen Verwandtschaft angewiesen. Mit Hilfe ihrer Tante Henriette Zimmer, einer Hofdame der Landgräfin von Hessen-Kassel, fanden Jacob und Wilhelm Aufnahme ins Lyzeum, das beide mit Bestnoten abschlossen. Die weiterhin knappen Geldmittel nötigten sie auch als Studenten an der Universität Marburg zu einer sehr bescheidenen Lebensführung.
Unter dem Einfluss des Marburger Professors Friedrich Carl von Savigny, der die Meinung vertrat, alle Gesetze erwüchsen naturgemäß aus der Sprache und Geschichte eines Volkes und sollten diesem daher nicht willkürlich aufoktroyiert werden, wandten die Brüder Grimm sich philologischen Studien zu. Durch von Savigny und seine Frau Kunigunde Brentano machten sie Bekanntschaft mit dem Kreis um Kunigundes Bruder Clemens Brentano und Achim von Arnim, der später die Schriftstellerin Bettina, eine weitere Brentano-Schwester, heiratete. Ein vorrangiges Interesse dieser Gruppe galt der deutschen Volkskunde: ein Thema, das vor allem von Arnim und Brentano begeisterte und sie zur Herausgabe ihrer berühmten Anthologie Des Knaben Wunderhorn bewegte – einer Sammlung von Volksliedern und Volksdichtungen aller Art. Der erste Band erschien 1805 und erfreute sich sogleich großer Beliebtheit.
Selbstverständlich weckte das Projekt auch das (keineswegs unkritische) Interesse der Brüder Grimm: In einem Brief vom Mai 1809 beanstandete Jacob gegenüber Wilhelm die Art und Weise, wie Brentano und von Arnim mit ihrem Material umgingen, es nach Belieben kürzten und erweiterten, modernisierten und umschrieben. Später wurden auch die Grimm-Brüder (insbesondere Wilhelm) aus weitgehend den gleichen Gründen für ihre Behandlung des Quellenmaterials zu den Kinder- und Hausmärchen kritisiert.
In jedem Fall war der Entschluss der Brüder Grimm, Märchen zu sammeln und zu veröffentlichen, kein isoliertes Phänomen, sondern Teil einer damals weitverbreiteten Bewegung.
Bei ihrer Arbeit stützten sie sich auf mündliche und schriftliche Quellen. Allerdings unternahmen sie selbst keine Streifzüge durch ländliche Gegenden, um sich von Bauern auf Feld und Hof Wort für Wort Geschichten diktieren zu lassen. Einige Grimm’sche Märchen sind unmittelbar literarischen Quellen entnommen; zwei der schönsten, »Der Fischer und seine Frau« (»Von dem Fischer un syner Fru«) und »Der Wacholderbaum« (»Von dem Machandelboom«), wurden ihnen in schriftlicher Form von dem Maler Philipp Otto Runge zugesandt und erschienen in der Sammlung so, wie Runge sie geschrieben hatte, nämlich in Plattdeutsch. Das übrige Material ist zum Großteil mündlicher Überlieferung durch verschiedenste Angehörige der Mittelschicht, unter anderem auch aus dem Freundeskreis der Familie, zu verdanken. Zu Letzterem gehörte die Apothekertochter Dortchen Wild, die spätere Ehefrau von Wilhelm Grimm. Zweihundert Jahre später lässt sich unmöglich beurteilen, wie exakt die Grimm’schen Niederschriften waren, doch gilt dies für jede Sammlung von Volksmärchen und -liedern aus der Zeit vor der Erfindung des Tonbands. Entscheidend sind die Lebendigkeit und Frische der von den Grimms veröffentlichten Versionen.
Die beiden Brüder setzten ihre Arbeit fort und machten sich weiterhin auch mit bedeutenden und nachhaltigen Beiträgen um die Philologie verdient. Das von Jacob Grimm formulierte erste Lautgesetz beschreibt bestimmte Lautverschiebungen in der Geschichte der germanischen Sprachen; außerdem arbeitete das Brüderpaar gemeinsam am ersten großen Deutschen Wörterbuch. Im Jahr 1837 kam es zu dem vermutlich dramatischsten Einschnitt in ihrem Leben: Zusammen mit fünf weiteren Universitätskollegen erhoben sie Protest gegen die widerrechtliche Aufhebung der Verfassung durch den neuen König Ernst August von Hannover. Infolgedessen verloren sie ihre Posten und mussten sich nach ihrer Ausweisung um neue Anstellungen an der Universität in Berlin bemühen.
Und doch verbindet man ihre Namen bis heute vor allem mit den Kinder- und Hausmärchen. Auf die erste, 1812 veröffentlichte Ausgabe folgten fünf weitere (bei denen Wilhelm zunehmend als Herausgeber fungierte) bis zur siebten und letzten im Jahr 1857. Um diese Zeit war die Sammlung bereits ungemein bekannt und beliebt. An Bedeutung und Einfluss im Bereich der Volksmärchen kommt ihr bis heute nur 1001 Nacht gleich. Über die diversen Ausgaben hinweg wuchs die Grimm’sche Sammlung nicht nur weiter an, auch die Märchen selbst erfuhren im Lauf des 19. Jahrhunderts Wandlungen, wurden unter Wilhelms Händen ein wenig länger, mitunter auch ausgefeilter, gelegentlich etwas prüder und definitiv frommer als zu Beginn.
Philologen und Volkskundler, Vertreter der Kultur- und Politikgeschichte, Freudianer, Jungianer, Verfechter christlicher, marxistischer, strukturalistischer, poststrukturalistischer, feministischer, postmodernistischer und sämtlicher sonst noch erdenklicher Theorien – sie alle finden in den 210 Märchen seit ihrem ersten Erscheinen mehr als reichlich Stoff für ihre Studien. Einige der für mich nützlichsten und interessantesten Schriften und Essays sind in der Bibliografie aufgelistet; zweifellos haben sie und andere mich beim Lesen und Nacherzählen in gewisser Weise beeinflusst, die ich nicht bewusst zu benennen vermag.
Doch mein vorrangiges Interesse galt immer der Frage, wie die Märchen als Geschichten funktionieren. Mit diesem Buch verfolge ich einzig und allein das Ziel, die besten und interessantesten von ihnen zu erzählen und alles aus dem Weg zu räumen, was ihren freien Lauf hindert. Ich wollte sie nicht an moderne Schauplätze verpflanzen, ihnen keine persönlichen Interpretationen überstülpen oder poetische Variationen der Originale verfassen; mir ging es schlicht und einfach um eine Version, die klar wie ein Quell daherkommt. Meine Leitfrage lautete: »Wie würde ich diese Geschichte erzählen, wenn ich sie von jemand anderem gehört hätte und sie weitergeben wollte?« Alle Veränderungen des Originaltextes sollen nur dem Zweck dienen, die Geschichte natürlicher nach meiner Stimme klingen zu lassen. Wenn ich – hier und da – eine Verbesserung für denkbar hielt, habe ich entweder kleine Eingriffe im Text selbst vorgenommen oder Vorschläge für größere in den Anmerkungen zu der jeweiligen Geschichte festgehalten (beispielsweise bei »Allerleirauh«, da mir das Originalmärchen lediglich halb fertig zu sein scheint).
»Figuren aus dem üblichen Bestand«
Psychologisches hat im Märchen nichts verloren. Die Charaktere verfügen nicht über ein ausgeprägtes Innenleben, ihre Motive sind klar und offensichtlich. Ein guter Mensch ist gut, ein böser ist böse. Wenn sich die junge Königin in »Die drei Schlangenblätter« unerklärlicherweise als undankbar erweist und von ihrem Mann abwendet, werden wir darüber prompt ins Bild gesetzt. Nichts dergleichen bleibt verborgen. Die Erschütterungen und Geheimnisse des menschlichen Seelenlebens, die Einflüsterungen der Erinnerung, die Stimmen halb durchschauter Reue, Zweifel oder Begehren, die untrennbar zur Thematik moderner Romane gehören, fehlen hier völlig. Fast ist man versucht, den Figuren eines Märchens das Bewusstsein abzusprechen.
Nur selten tragen sie Eigennamen, vielmehr werden sie nach ihrem Beruf, ihrer gesellschaftlichen Position oder einer Eigentümlichkeit ihres Aufzugs benannt: der Müller, die Prinzessin, der Schiffsführer, der Bärenhäuter oder Rotkäppchen. Und haben sie doch einen Namen, so lautet er für gewöhnlich Hans, gleichwie der Held eines jeden britischen Märchens Jack heißt.
Meinem Gefühl nach werden die meisten der im Lauf der Jahre veröffentlichten, wunderschön »realistischen« Illustrationen mit all ihren Prinzen, Prinzessinnen, Hexen etc. den Märchen ganz und gar nicht gerecht. Viel eher gleichen die Märchencharaktere den kleinen aus Pappe ausgeschnittenen Figuren des Papiertheaters, die nicht plastisch geformt, sondern flach erscheinen und nur auf einer Seite bemalt sind – die Rückseite ist quasi ein unbeschriebenes Blatt. Die Posen der Figuren veranschaulichen intensive Aktivität oder Leidenschaft, wodurch sich ihre jeweilige Rolle im Stück auch aus der Entfernung leicht erkennen lässt. Shaun Tans aussagekräftige Skulpturen sind absurd, grotesk, auf brillante Weise verblüffend und bringen das mehr und zugleich weniger Menschliche, das Märchenfiguren innewohnt, mit wunderbarer Frische und Stärke zum Ausdruck.
Einige Märchenfiguren treten gewissermaßen in Serienanfertigung auf. Die zwölf Brüder in der gleichnamigen Geschichte, die zwölf Prinzessinnen in »Die zertanzten Schuhe«, die sieben Zwerge in »Schneewittchen« – sie alle unterscheiden sich kaum, wenn überhaupt, voneinander. James Merrills Verweis auf die Commedia dell’arte lässt in diesem Zusammenhang an eine berühmte Serie von Zeichnungen des Malers Giandomenico Tiepolo (1727–1804) denken: Er stellt die Commedia-Figur des Pulcinella nicht als Individuum dar, sondern als einen Haufen identischer Tölpel. So sieht man auf einer Zeichnung ein Dutzend oder mehr Pulcinelle, die alle zur gleichen Zeit Suppe kochen wollen oder verdutzt einen Vogel Strauß begaffen. Dergleichen Vervielfältigungen sind mit Realismus nicht zu vereinbaren; die zwölf Prinzessinnen, die sich jede Nacht zusammen aufmachen und ihre Schuhe in Stücke tanzen, die Seite an Seite in ihren Betten schlafenden sieben Zwerge – sie alle existieren in einer völlig anderen Sphäre, irgendwo zwischen dem Unheimlichen und dem Absurden.
Rasanz
Das Tempo zählt zu den großen Vorzügen eines guten Märchens: Mit buchstäblich traumhafter Geschwindigkeit folgt ein Ereignis dem anderen und wird nur so weit kommentiert wie unbedingt nötig. Die besten Märchen sind Musterbeispiele dafür, was man braucht und was nicht – um mit Rudyard Kipling zu sprechen: Feuer, die hell lodern, weil alle Asche ausgekehrt ist.
Man betrachte nur den Anfang eines Märchens. »Es war einmal …« – mehr bedarf es nicht, schon ist man mittendrin:
Es war einmal ein armer Mann, der konnte seinen einzigen Sohn nicht länger ernähren. Der Sohn merkte das wohl und sagte: »Vater, was soll ich noch länger hierbleiben und dir zur Last fallen. Ich will mich aufmachen und zusehen, für mich selbst zu sorgen.«
(»Die drei Schlangenblätter«)
Ein paar Abschnitte später ist er bereits mit einer Königstochter verheiratet.
Ein anderes Beispiel:
Es war einmal ein Bauer, der hatte so viel Geld und Land, wie er sich nur wünschen konnte, doch bei allem Reichtum fehlte ihm eins im Leben: Er hatte mit seiner Frau keine Kinder. Traf er andere Bauern im Ort oder auf dem Markt, machten sie sich gern über ihn lustig und fragten, wieso er und seine Frau nicht zu Stande brächten, was ihr Vieh doch alle Tage täte. Ob sie nicht wüssten, wie sie es anstellen sollten? Schließlich geriet er in Zorn und schwor sich, als er nach Hause kam: »Ich werde ein Kind haben, und wenn es ein Igel ist.«
(»Hans-mein-Igel«)
Das Tempo ist berauschend. So schnell kommt man allerdings nur voran, wenn man mit leichtem Gepäck reist; darum ist von dem, wonach man in einem neuzeitlichen erzählenden Werk suchen würde – Namen, äußeres Erscheinungsbild, Hintergrund, sozialer Kontext etc. –, hier nichts vorhanden. Und daraus erklärt sich natürlich in Teilen die Flächigkeit der Figuren. Im Märchen geht es vielmehr darum, was mit ihnen geschieht oder was sie geschehen machen, als um ihre persönlichen Eigenheiten.
Beim Verfassen einer solchen Erzählung ist es nicht immer leicht zu entscheiden, welche Ereignisse notwendig und welche überflüssig sind. Wer wissen will, was zum Geschichtenerzählen dazugehört, ist gut beraten, sich »Die Bremer Stadtmusikanten« vorzunehmen – zugleich eine verrückte Räuberpistole und ein Meisterwerk, dessen Handlung kein Gramm zu viel trägt. Jeder Abschnitt treibt die Geschichte weiter voran.
Bildsprache und Beschreibung
Im Märchen beschränkt sich die Bildsprache auf das Offensichtlichste. So weiß wie Schnee, so rot wie Blut: das ist schon so ziemlich alles. Und es finden sich auch keine ausführlicheren Beschreibungen von Natur und Mensch. Ein Wald ist tief, die Prinzessin ist schön, ihr Haar ist golden; mehr braucht es nicht. Wer wissen will, wie es weitergeht, ist von hübschen, deskriptiven Sprachspielereien nur irritiert.
In einer Geschichte jedoch verknüpft sich eine poetische Beschreibung mit der Schilderung der Abläufe auf so gelungene Weise, dass eins ohne das andere nicht zu denken ist. Es handelt sich um die Geschichte »Der Wacholderbaum« (»Von dem Machandelboom«), und der Abschnitt, den ich meine, folgt auf den Wunsch der Frau nach einem Kind, so rot wie Blut und so weiß wie Schnee. Hier findet die Schwangerschaft ihre Entsprechung im Fortgang der Jahreszeiten:
Ein Monat verging, und der Schnee schmolz dahin.
Zwei Monate vergingen, und es wurde grün.
Drei Monate vergingen, und Blumen erblühten aus der Erde.
Vier Monate vergingen, und die Zweige an den Bäumen im Wald hatten wieder Saft und Kraft und rückten zusammen, und die Vögel sangen so laut, dass es im Wald widerhallte, und die Blüten fielen von den Bäumen.
Fünf Monate vergingen, und die Frau stand unter dem Wacholderbaum. Er duftete so süß, da hüpfte ihr das Herz in der Brust, und vor Freude fiel sie auf die Knie nieder.
Sechs Monate vergingen, und die Früchte reiften fest und schwer heran, und die Frau wurde still.
Als sieben Monate vergangen waren, pflückte sie die Wacholderbeeren und aß, bis sie krank und traurig wurde.
Nachdem der achte Monat herum war, rief sie ihren Mann, weinte und sprach: »Wenn ich sterbe, begrabe mich unter dem Wacholderbaum.«
Das ist wunderschön, aber bei aller Schönheit auch äußerst eigentümlich: Wer immer dieses Märchen erzählt, es lässt sich kaum ein Jota daran verbessern. Es muss genau so wiedergegeben werden wie hier – wo nicht, müssten zumindest die verschiedenen Monate mit gleichermaßen unterschiedlichen Merkmalen belegt und sorgsam auf dieselbe bedeutsame Weise mit dem Heranwachsen des Kindes im Schoß seiner Mutter verknüpft werden – und dieses Heranwachsen wiederum mit dem Wacholderbaum, der später bei der Wiedererweckung des Kindes eine so entscheidende Rolle spielen wird.
Doch ist dies eine der ganz wenigen großen Ausnahmen. In den meisten Märchen bleiben nicht nur die Figuren flach, es fehlt auch jegliche Beschreibung. Zwar erzählt Wilhelm Grimm in den späteren Ausgaben ein wenig blumiger und fantasievoller, doch das eigentliche Anliegen gilt weiterhin dem, was bisher geschah und als Nächstes geschehen wird. Die Strickmuster sind so einheitlich, das mangelnde Interesse an Besonderheiten so ausgeprägt, dass man förmlich erschrickt, wenn man einen Satz wie den folgenden in »Jorinde und Joringel« liest:
Es war ein schöner Abend; die Sonne warf ihr warmes Licht auf die Stämme der Bäume im dunklen, grünen Wald, und Turteltauben gurrten Klagelieder in den alten Buchen.
Das klingt mit einem Mal nicht mehr nach einem Märchen, sondern so, als hätte es ein Schriftsteller der Romantik wie Novalis oder Jean Paul verfasst. Die abgeklärte, namenlose Schilderung der Abläufe gibt einen Satz lang Raum für individuelles Wahrnehmungsvermögen: eine einzelne fühlende Seele hat diesen Natureindruck empfangen, diese Einzelheiten vor ihrem inneren Auge gesehen und zu Papier gebracht. Die Beherrschung der Bildsprache und die Gabe zur Beschreibung zählen zu den »Alleinstellungsmerkmalen« eines Autors, aber Märchen entspringen nun einmal nicht fix und fertig den Köpfen individueller Schriftsteller; »Alleinstellungsmerkmale« und Originalität sind für sie ohne Bedeutung.
Dies ist kein Text
Literarische Werke wie beispielsweise The Prelude (Präludium) von William Wordsworth oder Ulysses von James Joyce sind zunächst einmal: ein Text. Mit Wörtern beschriebene Seiten, Punkt, aus. Aufgabe von Lektoren oder Rezensenten ist es, den genauen Wortlaut sowie Abweichungen in verschiedenen Stadien der Überarbeitung festzuhalten und somit sicherzustellen, dass der Leser genau den Text vorfindet, der das Werk ausmacht.
Aber ein Märchen ist kein Text in diesem Sinn. Es ist die ein- oder mehrmals erfolgte Niederschrift der mündlichen Erzählung durch einen der Erzähler. Und natürlich ist der Wortlaut bis dahin diversen Einflüssen ausgesetzt. Je nach Stimmung oder Ermüdungszustand des Erzählers mag eine Geschichte am einen Tag opulenter und ausufernder ausfallen als am folgenden. Wer sie festhalten will, verzweifelt womöglich am eigenen Rüstzeug: Schon eine simple Erkältung erschwert das Zuhören oder unterbricht die Niederschrift durch Niesen und Husten. Beeinträchtigen mag eine gute Geschichte auch der Umstand, dass sie von einem nicht eben begnadeten Erzähler zum Besten gegeben wird.
Das spielt eine gewaltige Rolle – unterscheiden sich Erzähler doch sowohl in ihrem Talent, ihrer Technik und ihrer ganzen Einstellung zum Erzählvorgang. Dorothea Viehmann, der die Grimms viele mündlich überlieferte Geschichten verdankten, imponierte den Brüdern zutiefst durch ihre Fähigkeit, ein Märchen Wort für Wort exakt zu wiederholen, so dass es sich leicht niederschreiben ließ; die von ihr stammenden Märchen sind für gewöhnlich mit fabelhafter Sorgfalt und Präzision strukturiert und beeindruckten mich bei der Arbeit an diesem Buch ebenso wie damals die Grimms.
Des Weiteren hat der eine Erzähler vielleicht eine komödiantische Begabung, der andere beherrscht Spannung und Dramatik, der dritte Pathos und Gefühlsbetonung. Verständlicherweise werden sie sich jene Märchen aussuchen, die ihr Talent am besten zur Geltung bringen. Wenn X, der großartige Komiker, ein Märchen erzählt, wird er witzige Details oder lustige Episoden hinzuerfinden, die in Erinnerung bleiben und weitergegeben werden, so dass seine Erzählweise das Märchen ein wenig abwandelt; und wenn Y, die Meisterin des Spannungsbogens, eine Schreckensgeschichte erzählt, wird sie ihrerseits manches hinzuerfinden. Ihre Einfälle und Abänderungen werden in die traditionelle Erzählweise dieses Märchens eingehen und im Lauf der Zeit vergessen, weiter ausgeschmückt oder vervollständigt werden.
Das Märchen befindet sich fortwährend im Werden und in der Umgestaltung. An einer einzigen Version oder Übersetzung festzuhalten heißt, einen »Hänfling, der im Bauer singt«, festzusetzen.1 Wenn die Leser dieses Buches Lust verspüren, eins der Märchen nachzuerzählen, werden sie dabei hoffentlich so frei vorgehen, wie es ihnen beliebt. Es ist ihnen vollkommen unbenommen, in Einzelheiten von dem abzuweichen, was ich hier beibehalten oder neu eingestreut habe. Tatsächlich ist es ihnen nicht nur unbenommen, sie sind geradezu verpflichtet, sich die Geschichte ganz und gar zu eigen zu machen.2 Ein Märchen ist kein Text.
»Rein geleckt ihr Ton«
Wer immer eine neue Version eines Märchens schreibt, wird er je James Merrills idealem Ton nahe kommen, »abgeklärt und namenlos«? Natürlich mag der jeweilige Verfasser dies gar nicht erstrebenswert finden. Von diesen Märchen bestehen viele Versionen (und werden noch viele weitere entstehen), in denen vor allem die düsteren Obsessionen, die schillernde Persönlichkeit oder die politischen Leidenschaften des jeweiligen Autors zum Ausdruck kommen. Die Märchen können das vertragen. Doch selbst wenn wir abgeklärt und namenlos sein wollen, werden wir dies wohl kaum je vollständig erreichen, weil jeder Absatz unseren persönlichen stilistischen Fingerabdruck trägt, ohne dass wir uns dessen bewusst wären.
Mir scheint, es bleibt nichts anderes übrig, als sich um Klarheit zu bemühen und sich nicht zu viele Sorgen zu machen. Es wäre schade, sich die Wonne des Geschichtenerzählens mit allerlei Befürchtungen zu verderben. Eine ungeheure Erleichterung und Freude – wie das laue Lüftchen, das den jungen Grafen in »Die Gänsehirtin am Brunnen« erfrischt, als er sich niederlegt, um auszuruhen – überkommt den Autor, wenn er erkennt, dass es nicht nötig ist, etwas zu erfinden: Die Essenz des Märchens ist ja schon da, ebenso wie für den Jazzmusiker die Abfolge von Akkorden in einem Stück schon vorhanden ist; und unsere Aufgabe besteht darin, von Akkord zu Akkord, von Ereignis zu Ereignis zu wandeln, so leicht und beschwingt wir es vermögen. Jazz und Geschichtenerzählen sind darstellende Künste, und auch das Schreiben ist nichts anderes als Darstellung.
Zum Schluss möchte ich allen, die diese Märchen nacherzählen wollen, noch eines sagen: Seid ungescheut abergläubisch. Wenn ihr einen Glücksstift habt, nehmt ihn zur Hand. Wenn ihr mit einer roten Socke am linken Fuß und mit einer blauen am rechten eindrücklicher und witziger sprecht, dann zieht euch so an. Ich selber bin während des Arbeitsprozesses höchst abergläubisch, und zwar in Bezug auf die Stimme, die die Geschichte ans Tageslicht bringt. Ich glaube fest daran, dass jede Geschichte mit ihrem eigenen Elementargeist daherkommt, dessen Stimme wir beim Erzählen verkörpern, und das gelingt uns umso besser, wenn wir uns dem Elementargeist mit einem gewissen Maß an Respekt und Höflichkeit nähern. Diese Geister sind zugleich alt und jung, männlich und weiblich, sentimental und zynisch, skeptisch und gutgläubig und so weiter, vor allem aber sind sie völlig amoralisch: Wie die Luftgeister, die dem starken Hans halfen, aus der Höhle zu entkommen, dienen die Geschichten-Geister willig jedem, der den Ring trägt, jedem, der die Geschichte erzählt. Auf den Vorwurf, das sei alles blühender Unsinn und zum Geschichtenerzählen brauche ein Mensch lediglich Fantasie, erwidere ich: »Ja, natürlich, und genau so funktioniert eben meine Fantasie.«
So geben wir denn unser Bestes mit diesen Märchen – und stellen vielleicht fest, dass es immer noch nicht gut genug ist. Ich hege den Verdacht, dass auf die schönsten aller Märchen zutrifft, was der große Pianist Artur Schnabel einmal über die Sonaten von Mozart gesagt hat: Sie seien zu leicht für Kinder und zu schwer für Erwachsene.
Und diese fünfzig Märchen sind, für mein Gefühl, die Crème de la Crème der Kinder- und Hausmärchen. Ich gab mein Bestes für die Elementargeister, die jedem einzelnen innewohnen, so wie es vor mir Dorothea Viehmann, Philipp Otto Runge, Dortchen Wild und all die anderen Erzähler getan haben, deren Werke von den großen Brüdern Grimm bewahrt wurden. Und ich hoffe, wir alle, Erzähler und Zuhörer gleichermaßen, leben glücklich bis ans Ende unserer Tage.
Philip Pullman, 2012
1
der froschkönig oder der eiserne heinrich
In den alten Zeiten, als das Wünschen noch gewirkt hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, doch die jüngste war so entzückend, dass selbst die Sonne, die schon vieles gesehen hat, jedes Mal staunte, wenn sie ihr ins Gesicht schien. Nicht weit vom Schloss des Königs lag ein tiefer, dunkler Wald, und unter einer Linde in dem Wald war ein Brunnen. In der Mittagshitze ging die Prinzessin gern dorthin und saß am Rand des Brunnens, aus dem es sie wunderbar kühl anwehte.
Zum Zeitvertreib hatte sie eine goldene Kugel dabei, die warf sie immer wieder hoch und fing sie auf. Das war ihr Lieblingsspiel. Eines Tages geschah es, dass sie die Kugel ein wenig achtlos in die Luft warf und nicht mehr fangen konnte. Sie rollte ihr zum Brunnen davon und weiter bis über den Rand und war auch schon darin verschwunden.
Die Prinzessin lief ihr nach und blickte hinunter ins Wasser, aber es war so tief, dass sie die Kugel nirgends erspähte. Unmöglich konnte sie bis zum Grund des Brunnens sehen.
Da begann sie zu weinen, lauter und immer lauter, war ganz und gar untröstlich. Und während sie so jammerte und schluchzte, rief jemand: »Was ist mit dir, Prinzessin? Du weinst ja so bitterlich, dass es einen Stein erweichen könnte.«
Sie sah sich um, woher die Stimme wohl kam, und entdeckte einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser reckte.
»Ach, du bist’s, alter Pritschler«, sagte sie. »Ich weine, weil mir meine goldene Kugel ins Wasser gefallen ist, und es ist so tief und ich sehe sie nirgends.«
»Lass es gut sein mit dem Weinen«, sagte der Frosch. »Ich kann dir schon helfen, aber was gibst du mir, wenn ich dir deine Kugel hole?«
»Was du willst, Frosch! Alles! Meine Kleider, meine Perlen, meine Edelsteine, sogar die goldene Krone, die ich trage.«
»Deine Kleider will ich nicht und deine Edelsteine und deine goldene Krone kann ich nicht brauchen, aber wenn du mich lieb haben willst und ich dein Gefährte und dein Spielkamerad sein kann, wenn ich neben dir am Tisch sitzen darf und von deinem Teller essen und aus deinem Becher trinken und in deinem Bett schlafen, dann tauche ich hinunter und hole dir deine goldene Kugel.«
Die Prinzessin dachte: »Was redet der dumme Frosch da? Soll er denken, was er will, er muss doch im Wasser bleiben, wo er hingehört. Vielleicht bekommt er ja meine Kugel zu fassen.« Aber das sagte sie natürlich nicht. Nein, sie sagte: »Ja, ja, all das verspreche ich dir, wenn du mir nur meine Kugel bringst.«
Kaum hatte der Frosch ihr »Ja« gehört, steckte er den Kopf unter Wasser und tauchte bis zum Grund. Gleich darauf schwamm er wieder empor, mit der Kugel im Maul, und warf sie ins Gras.
Die Prinzessin freute sich über die Maßen, schnappte sich die Kugel und sauste sogleich davon.
»Warte, warte!«, rief der Frosch. »Nimm mich mit! So schnell, wie du läufst, kann ich nicht springen!«
Doch sie achtete nicht auf ihn, eilte nach Hause und vergaß den armen Frosch, der wieder hinunter in seinen Brunnen musste.
Tags darauf saß die Prinzessin mit ihrem Vater, dem König, und allen Hofleuten am Tisch und aß von ihrem goldenen Teller, als etwas die Marmorstufen hinaufgehopst kam: plipp, plopp, plipp, plopp. Oben angelangt, klopfte es an die Tür und rief: »Prinzessin! Jüngstes Königskind! Mach mir die Tür auf!«
Sie lief hin, um nachzusehen, wer es sei, und öffnete die Tür, und da saß der Frosch.
Erschrocken schlug sie die Tür wieder zu und lief zurück zum Tisch.
Der König sah, wie heftig ihr Herz pochte, und fragte: »Wovor fürchtest du dich, mein Kind? Steht da ein Riese vor der Tür?«
»Oh nein«, sagte sie, »kein Riese, es ist ein grässlicher Frosch.«
»Und was will der Frosch von dir?«
»Ach, Papa, gestern habe ich im Wald beim Brunnen gespielt, und da ist mir meine goldene Kugel ins Wasser gefallen. Und da habe ich angefangen zu weinen, und weil ich so furchtbar geweint habe, hat der Frosch sie mir wiedergebracht, und weil er so unbedingt darauf bestand, musste ich ihm versprechen, dass er mein Gefährte sein darf. Ich hätte doch nicht im Ernst gedacht, dass er je aus dem Wasser herauskommt. Aber jetzt steht er draußen vor der Tür und will herein!«
Und da klopfte es zum zweiten Mal und eine Stimme rief:
»Königstochter, Königskind,
mach mir auf und lass mich ein!
Die Worte dein am Wasser sind
sonst nicht mehr als hohler Schein.
Halt dein Versprechen, Königskind,
mach mir auf und lass mich ein!«
Der König sagte: »Was man verspricht, muss man auch halten. Geh und lass ihn ein.«
Sie machte die Tür auf und der Frosch hopste herein. Und hopste weiter, bis zu ihrem Stuhl.
»Heb mich hoch«, sagte er. »Ich will neben dir sitzen.«
Das gefiel ihr ganz und gar nicht, aber der König sagte: »Nur zu. Tu, was er sagt.«
Also hob sie den Frosch hoch zu sich auf den Stuhl. Doch von dort wollte er auf den Tisch, also musste sie ihn auch da noch hinaufheben, und dann sagte er: »Schieb deinen goldenen Teller ein bisschen näher her, damit ich auch davon essen kann.«
Sie tat es, doch jeder konnte sehen, dass es ihr keine Freude bereitete. Dem Frosch dagegen sehr wohl: Er aß mit großem Vergnügen von ihren Speisen, der Prinzessin aber schien jeder Bissen im Hals stecken zu bleiben.
Schließlich sagte der Frosch: »So, danke, jetzt bin ich satt und möchte gern zu Bett gehen. Trag mich hinauf in dein Zimmer und mach dein seidenes Bett bereit, damit wir uns schlafen legen können.«
Die Prinzessin begann zu weinen, denn ihr grauste vor dem Frosch mit seiner kalten Haut. Sie erschauerte bei dem Gedanken, ihn in ihr schönes sauberes Bett zu lassen. Doch der König runzelte die Stirn und sagte: »Wer dir in der Not geholfen hat, den sollst du nicht verachten!«
Sie nahm den Frosch zwischen Daumen und Zeigefinger, setzte ihn vor ihrer Schlafzimmertür ab und machte sie fest zu.
Doch er klopfte und klopfte und rief: »Lass mich ein! Lass mich ein!«
Da öffnete sie die Tür und sagte: »Also gut! Komm herein, aber du musst auf dem Boden schlafen.«
Wie befohlen, streckte er sich am Fußende ihres Bettes aus, rief aber weiter: »Lass mich hinauf! Lass mich hinauf zu dir! Ich bin ebenso müde wie du.«
»Ach, zum Kuckuck noch mal!«, sagte sie, hob ihn hoch und setzte ihn aufs äußerste Eck ihres Kopfkissens.
»Näher! Näher!«, sagte er.
Doch das war zu viel. Flammend vor Zorn griff sie sich den Frosch und warf ihn gegen die Wand. Als er aber ins Bett zurückfiel, welche Überraschung! Da war er kein Frosch mehr, sondern ein junger Mann, ein Prinz, mit schönen, lächelnden Augen.
Und sie hatte ihn lieb und nahm ihn zu ihrem Gefährten, so wie der König es sich gewünscht hätte. Der Prinz berichtete ihr, eine böse Hexe habe ihn verzaubert, und nur sie, die Prinzessin, habe ihn aus dem Brunnen befreien können. Im Übrigen werde am folgenden Tag eine Kutsche kommen und sie beide ins Königreich des Prinzen bringen. Dann schliefen sie Seite an Seite ein.
Und am anderen Morgen, kaum hatte die Sonne sie geweckt, hielt eine Kutsche vor dem Palast, genau wie der Prinz es gesagt hatte. Gezogen wurde sie von acht Pferden mit wippenden Straußenfedern auf den Köpfen und goldglänzenden Ketten im Geschirr. Hinten auf der Kutsche stand der treue Heinrich. Er war der Diener des Prinzen, und die Nachricht von der Verwandlung seines Herrn in einen Frosch hatte ihn so betrübt, dass er auf der Stelle zum Schmied ging und drei eiserne Bänder bestellte; die hatte er sich ums Herz gelegt, damit es nicht vor Kummer zersprang.
Der treue Heinrich half ihnen in die Kutsche und nahm seinen Platz dahinter ein, überglücklich, den Prinzen wieder leibhaftig vor sich zu sehen.
Als sie ein Stückchen gefahren waren, hörte der Prinz von hinten einen Donnerkrach. Er drehte sich um und rief: »Heinrich, die Kutsche bricht!«
»Nein, nein, Herr, das ist nur mein Herz. Als Ihr im Brunnen haustet, als Ihr ein Frosch wart, litt ich so große Schmerzen, dass ich eiserne Bänder um mein Herz legte, damit es nicht bricht, denn Eisen ist stärker als Kummer. Aber Liebe ist stärker als Eisen, und nun, da Ihr wieder ein Mensch seid, fallen die eisernen Bänder ab.«
Zweimal noch hörten sie es krachen und meinten, es sei die Kutsche, doch da irrten sie sich: Es waren die eisernen Bänder, die vom Herzen des treuen Heinrich losbrachen, weil sein Herr nun glücklich heimgekehrt war.
Märchentyp: ATU 440, »Froschkönig« Quelle: mündlich überliefert durch die Familie Wild Ähnliche Erzählungen: Katharine M. Briggs: »The Frog«, »The Frog Prince«, »The Frog Sweetheart«, »The Paddo« (Folk Tales of Britain)
Eines der bekanntesten Grimm-Märchen überhaupt. Der Grundgedanke – die Verwandlung des abstoßenden Froschs in einen Prinzen – ist so reizvoll und zugleich so reich an moralischen Anklängen, dass sie zur Metapher für eine zentrale menschliche Erfahrung geworden ist. Der Allgemeinheit ist die Geschichte so in Erinnerung, dass der Frosch zum Prinzen wird, nachdem die Prinzessin ihn geküsst hat. Die Grimm’schen Geschichtenzuträger berichten es anders, ebenso wie die Erzähler der Versionen bei Briggs, wo der Frosch von der königlichen Maid geköpft werden muss, um in verwandelter Gestalt zu erscheinen. Allerdings spricht doch auch einiges für den Kuss. Schließlich hat er mittlerweile Aufnahme in den volkskundlichen Kanon gefunden, und was sollte sonst hinter dem Wunsch des Froschs stehen, das Bett mit der Prinzessin zu teilen?
Ohne Zweifel wird der Frosch zum Prinzen (»ein Königssohn«), trotz des Märchentitels, der ihn zum (Frosch-)König macht. Vielleicht ist ihm das Froschsein ja so nachhaltig in die Glieder gefahren, dass er den Namen beibehalten hat, als er das Königreich erbte. Eine solche Verwandlung vergisst man nicht.
Der eiserne Heinrich taucht zum Ende des Märchens aus heiterem Himmel auf und hat so wenig mit der restlichen Geschichte zu tun, dass er häufig vergessen wird, obwohl man ihn offenbar als bedeutend genug erachtet hat, um ihn in den Titel aufzunehmen. Die eisernen Bänder um sein Herz sind ein unglaublich sprechendes Bild, das im Grunde eine eigene Geschichte verdient hätte.
2
kater und maus in einem haus
Es war einmal ein Kater, der wollte Freundschaft mit einer Maus schließen. Unermüdlich redete er auf sie ein, wie gern er sie doch habe, wie liebenswürdig sie sei, wie besonnen, wie geschickt sie ihren Schwanz um sich zwirble und so weiter und so fort, bis die Maus schließlich einwilligte, mit ihm zusammen zu hausen.
»Aber wir müssen Vorsorge für den Winter treffen«, sagte der Kater. »Sonst leiden wir Hunger, wenn wir das Essen am nötigsten haben. Und ein Mäuslein wie du kann in der Kälte nicht einfach hamstern gehen. Entweder macht dich der Frost zunichte, oder du endest in einer Falle.«
Den Ratschlag fand die Maus ganz vorzüglich und sie legten zusammen und kauften einen Topf Schmalz. Doch nun wohin damit? Nach langem Hin und Her sagte der Kater: »Weißt du was, am sichersten ist es immer noch in der Kirche. Da traut sich keiner was wegzustehlen. Wir stellen den Topf unter den Altar und gehen erst dann daran, wenn es wirklich nötig ist.«
Also versteckten sie den Topf in der Kirche. Doch schon bald lechzte der Kater nach dem köstlichen Schmalz, und so sagte er zu der Maus: »Ach, übrigens, was ich dir erzählen wollte: Meine Kusine hat ein Katerchen bekommen, das ist weiß und braun gefleckt.«
»Oh, wie hübsch!«, sagte die Maus.
»Ja, und sie haben mich gefragt, ob ich nicht Pate sein will. Hättest du etwas dagegen, wenn ich den Haushalt für einen Tag dir überlasse und den Kleinen übers Taufbecken halte?«
»Nein, ganz gewiss nicht«, sagte die Maus. »Danach gibt es sicher gute Sachen zu essen. Wenn du den Mund voller Leckerbissen hast, denk an mich. Den süßen roten Taufwein würd ich für mein Leben gern probieren.«
Was der Kater da verzapfte, war natürlich erstunken und erlogen. Er hatte weit und breit keine einzige Kusine, und wer ihn kannte, wäre nie und nimmer darauf verfallen, ihn zum Paten zu ernennen. Er marschierte stracks zur Kirche, kroch unter den Altar, stupste den Deckel vom Schmalztopf und schleckte die Haut ab.
Dann machte er sich in aller Seelenruhe davon und drehte seine Runde über die Dächer. Dort legte er sich in die Sonne, leckte sich den Schnurrbart und hing genüsslich den Erinnerungen an das Schmalz nach. Erst mit Einbruch der Dunkelheit begab er sich nach Hause.
»Willkommen daheim!«, sagte die Maus. »Und, war es schön? Wie heißt das Kind denn nun?«
»Haut-ab«, sagte der Kater, ohne die Miene zu verziehen, und betrachtete eingehend seine Krallen.
»Haut-ab? Das ist aber ein komischer Name für ein Kätzchen«, sagte die Maus. »Heißen sie in der Familie schon immer so?«
»Ich weiß nicht, was daran so besonders sein soll«, sagte der Kater. »Ist auch nicht seltsamer als Krümelklauer, und das sagt man doch zu all deinen Patenkindern.«
Bald darauf verlangte es den Kater wieder nach dem Schmalz, und er sagte zu der Maus: »Meine Liebe, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich soll wieder für ein Kätzchen Pate stehen, und da es einen weißen Ring um den Hals hat, darf ich es nicht abschlagen. Kannst du dich noch einmal um Haus und Hof kümmern? Ich bin abends wieder zurück.«
Die gute Maus sagte Ja und Amen, ihr sei es recht, und wünschte dem Kätzchen alles Gute. Huschdipusch, war der Kater zur Tür hinaus, schlich hinter der Stadtmauer zur Kirche und schleckte da den halben Topf aus.
»Es schmeckt doch immer am besten, was man selbst verputzt«, dachte er.
Als er zu Hause eintraf, fragte die Maus: »Und, wie haben sie das Kind getauft?«
»Halb-aus«, sagte der Kater.
»Halb-aus? Was ist denn das für ein Name? Davon hab ich ja noch nie gehört. Der steht ganz sicher nicht im Heiligenkalender.«
Beim Gedanken an das köstlich weiche Schmalz lief dem Kater bald aufs Neue das Wasser im Mund zusammen.
»Aller guten Dinge sind drei«, sagte er zu der Maus. »Stell dir vor, ich soll schon wieder Pate sein. Diesmal ist das Kind kohlrabenschwarz – kein weißes Haar am Leib, abgesehen von seinen Pfoten. Das kommt sehr selten vor, weißt du, nur alle paar Jahre einmal. Da lässt du mich doch gehen, oder?«
»Haut-ab? Halb-aus?«, sagte die Maus. »Äußerst merkwürdige Namen haben sie in deiner Familie! Da mache ich mir schon so meine Gedanken.«
»Ach, papperlapapp«, sagte der Kater. »Du hockst von morgens bis abends im Haus und drehst Schwänzchen, davon bekommst du Flausen in den Kopf. Du solltest auch einmal hinaus an die frische Luft.«
Die Maus wusste nicht recht, was sie davon halten sollte, doch als der Kater fort war, rackerte sie sich redlich ab, machte Hausputz und brachte alles in schönste Ordnung.
Derweil schleckte der Kater in der Kirche eifrig den Schmalztopf aus. Den letzten Rest musste er mit den Pfoten herauskratzen, dann saß er da und bewunderte sein Spiegelbild im Topfboden.
»So süß tut Topfausleeren weh«, dachte er.
Spät in der Nacht watschelte er nach Hause. Kaum kam er zur Tür herein, fragte die Maus, welchen Namen das dritte Katzenkind bekommen habe.
»Der wird dir wohl auch nicht gefallen«, sagte der Kater. »Es heißt Ganz-aus.«
»Ganz-aus!«, rief die Maus. »Oje, oje, ich muss schon sagen, das gibt mir schwer zu denken! Solch einen Namen hab ich noch nie gedruckt gesehen. Was mag er nur bedeuten?«
Dann wickelte sie ihren Schwanz um sich und schlief ein.
Von da an bat keiner mehr den Kater, Pate zu sein. Und als der Winter kam und sich draußen nichts mehr zu fressen fand, dachte die Maus an den Topf mit dem leckeren Schmalz, der gut versteckt unterm Altar in der Kirche stand.
»Komm, Kater«, sagte sie, »holen wir uns etwas aus dem Schmalztopf, den wir beiseitegestellt haben. Denk nur, wie gut es uns schmecken wird.«
»Ja«, sagte der Kater. »Das wird dir so gut schmecken, wie wenn du deine niedliche kleine Zunge da aus dem Fenster streckst.«
So machten sie sich auf den Weg. Und als sie zur Kirche kamen, war der Topf wohl noch da, aber natürlich leer.
»Oh! Oh! Oh!«, sagte die Maus. »So langsam fügt sich eins zum anderen. Jetzt weiß ich, was für ein feiner Freund du bist. Du bist gar nicht Pate geworden! Du bist hierher und hast alles weggeschleckt. Erst die Haut ab –«
»Vorsicht!«, sagte der Kater.
»Dann halb aus –«
»Ich warne dich!«
»Dann ganz –«
»Ein Wort noch und ich fresse dich ebenfalls!«
»– aus!«, sagte die Maus, aber es war zu spät: Der Kater machte einen Satz und verschlang sie mit einem Happs.
Tja, was hast du erwartet? So geht es nun einmal zu in der Welt.
Märchentyp: ATU 15, »Gevatter stehen« Quelle: mündlich überliefert durch Gretchen Wild Ähnliche Erzählungen: Italo Calvino: »Mrs Fox and Mr Wolf« (Italian Folktales); Joel Chandler Harris: »Mr Rabbit Nibbles Up the Butter« (The Complete Tales of Uncle Remus)
Eine schlichte und sehr verbreitete Fabel. Etliche Varianten bedienen sich derb aus dem Analbereich: Der wahre Missetäter schmiert dem schlafenden Hausgenossen Butter unter den Schwanz, um dessen Schuld zu demonstrieren. Die Idee mit dem Spiegelbild im Topfboden habe ich der Geschichte von Onkel Remus3 entlehnt, die wie meine Version mit einem Schulterzucken angesichts der Ungerechtigkeit auf Erden endet: »Kummer und Leid sind um die nächste Ecke und warten bloß drauf, dass sie uns zu fassen kriegen, so sieht’s aus.«
3
von einem, der auszog, das fürchten zu lernen
Es war einmal ein Vater, der hatte zwei Söhne. Der ältere war gescheit und aufgeweckt und brachte alles fertig, aber der jüngere hatte einen trüben Kopf, in den nichts hineinging. Wer sie kannte, sagte: »Mit dem Jungen wird der Vater noch seine liebe Not haben.«
Stets musste der ältere Sohn heran, wenn es eine Arbeit zu verrichten galt. Doch eines gab es, das wollte er nicht tun: Wenn er bei Einbruch der Nacht oder in tiefer Finsternis Besorgungen für seinen Vater erledigen sollte und der Weg ihn über den Friedhof oder zu sonst einem unheimlichen Ort führte, dann sagte er: »Oh nein, Vater, da gehe ich nicht hin, da schaudert’s mich.«
Und wenn abends alle ums Feuer saßen und Geschichten von Spuk und Gespenstern erzählten, dann sagte wohl auch der eine oder andere Zuhörer von Zeit zu Zeit: »Oh, mich schaudert’s.«
Der jüngere Sohn saß immer in der Ecke und lauschte, wusste aber nicht, was es mit dem Schaudern auf sich hatte. »Alle sagen sie: ›Mich schaudert’s, mich schaudert’s!‹ Was reden sie da nur? Mich schaudert’s nicht, und ich habe ebenso gut zugehört wie sie.«
Eines Tages sagte sein Vater zu ihm: »Hör zu, Junge, du bist groß und stark geworden. Bald bist du erwachsen, und es ist an der Zeit, dass du dir dein Brot verdienst. Sieh dir deinen Bruder an! Er hat gelernt, schwer zu arbeiten, du aber hast gar nichts gelernt, so will mir scheinen.«
»Oh ja, Vater«, sagte der Jüngere. »Ich will mir gern mein Brot verdienen, von Herzen gern. Wenn ich nur wüsste, wie man das Schaudern lernt. Davon verstehe ich rein gar nichts.«
Sein älterer Bruder hörte das und lachte. »Was für ein Holzkopf!«, dachte er. »Aus dem wird nie was Rechtes. Aus einem Schweinsohr ist kein Seidenbeutel zu machen.«
Der Vater seufzte verzagt. »Je nun, es wird dir nicht schaden, wenn du erfährst, was es mit dem Schaudern auf sich hat«, sagte er, »aber dein Brot wirst du dir damit nicht verdienen.«
Einige Tage später fand sich der Küster zu einem Schwätzchen ein. Der Vater konnte nicht anders, er schüttete ihm sein Herz aus: Wie töricht sein jüngerer Sohn doch sei, nicht imstande, auch nur das kleinste bisschen zu lernen und zu begreifen.
»Ich nenne dir ein Beispiel«, sagte er. »Als ich ihn gefragt habe, womit er sein Brot verdienen will, hat er geantwortet, er möchte gern das Schaudern lernen.«
»Wenn er das möchte«, sagte der Küster, »dann schick ihn nur zu mir. Ich will ihn ordentlich schaudern lassen. Höchste Zeit, dass ihm jemand den Kopf zurechtrückt.«
»Das ist ein guter Einfall«, sagte der Vater nachdenklich. »Womöglich nimmt der Junge es besser auf, wenn es von einem anderen kommt. Jedenfalls wird es ihm guttun.«
Also nahm der Küster den jüngeren Sohn mit zu sich nach Hause und brachte ihm bei, die Kirchenglocke zu läuten. Als der Junge den Bogen heraushatte, weckte ihn der Küster einmal um Mitternacht und wies ihn an, in den Kirchturm hinaufzusteigen und die Glocke zu läuten.
»Nun sollst du lernen, was Schaudern heißt«, dachte er und schlich sich, derweil der Junge in seine Kleider schlüpfte, vor ihm in den Turm hinauf.
Wie der Junge in den Glockenstuhl kam und sich nach dem Seil umwandte, sah er oben an der Treppe gegenüber vom Schallloch eine weiße Gestalt.
»Was haben wir denn da?«, fragte er.
Die Gestalt blieb stumm und still.
»Gib mir gefälligst Antwort«, rief der Junge. »Du hast hier nichts verloren, mitten in der Nacht.«
Der Küster tat keinen Mucks. Der Junge werde ihn für einen Geist halten, dessen war er sich gewiss.
Der Junge erhob abermals die Stimme: »Ich warne dich. Gib mir Antwort, oder ich werfe dich die Treppe hinunter. Wer bist du und was willst du?«
Der Küster dachte: »Nie und nimmer wird er mich die Treppe hinunterwerfen.«
Und er stand weiter da wie ein Stein und gab keinen Laut von sich.
Der Junge rief ihn ein drittes Mal an und brüllte, als er wieder keine Antwort bekam: »Na gut, du willst es nicht anders, da hast du es!«
Und er stürzte sich auf die weiße Gestalt und gab ihr einen kräftigen Schubs. Der Geist polterte die Treppe hinab und blieb als stöhnendes Häufchen Elend an ihrem Ende liegen. Als der Junge sah, dass von ihm kein Ärger mehr drohte, läutete er die Glocke, wie ihm aufgetragen war, und ging wieder zu Bett.
Die Frau des Küsters hatte unterdessen gewartet und sorgte sich, weil ihr Mann so lange ausblieb. Schließlich weckte sie den Jungen.
»Wo ist mein Mann?«, fragte sie. »Hast du ihn nicht gesehen? Er ist vor dir in den Turm hinaufgestiegen.«
»Was weiß ich«, sagte der Junge. »Ich hab ihn nicht gesehen. Da stand einer mit einem weißen Betttuch über dem Kopf beim Schallloch und er wollte mir keine Antwort geben und nicht fortgehen, da dachte ich mir, der führt nichts Gutes im Schilde, und hab ihn die Treppe hinuntergestoßen. Geh hin und schau nach – vielleicht liegt er ja noch da. Es täte mir leid, wenn er es wäre. Es hat ordentlich gerumst, als er die Stufen hinuntergepurzelt ist.«
Die Frau lief hinaus und fand ihren Mann vor Schmerzen ächzend und mit gebrochenem Bein. Sie schleppte ihn nach Hause, rannte schnurstracks zum Vater des Jungen und schrie Zeter und Mordio.
»Dein Sohn, dieser Dummkopf!«, kreischte sie. »Weißt du, was er angestellt hat? Meinen Mann vom Glockenturm gestürzt, das hat er! Der arme Kerl hat sich das Bein gebrochen, und es sollte mich nicht wundern, wenn sein halbes Gestell in Stücke geschlagen ist! Schaff mir diesen elenden Tunichtgut aus dem Haus, bevor er uns auch das noch über dem Kopf zusammenfallen lässt. Ich will ihn nie wieder sehen.«
Der Vater erschrak gewaltig. Er lief zum Haus des Küsters und rüttelte den Jungen wach.
»Verflixt noch eins, was heckst du da aus?«, fuhr er ihn an. »Spielst dem Küster gottlose Streiche? Das muss dir der Teufel eingegeben haben!«
»Nicht doch, Vater«, sagte der Junge, »mich trifft keine Schuld. Ich wusste ja nicht, dass es der Küster war. Er stand dort beim Schallloch mit einem weißen Betttuch über dem Kopf. Wie sollte ich da erkennen, wer es war? Und ich habe ihn dreimal gemahnt.«
»Herrgott im Himmel!«, sagte der Vater. »Mit dir hat man nichts als Ärger. Geh mir aus den Augen, los, fort mit dir. Lass dich hier nie wieder blicken.«
»Nichts lieber als das«, sagte der Junge. »Ich will noch bleiben, bis der Tag anbricht, dann ziehe ich hinaus in die Welt und lasse dir deinen Frieden. Wenn ich herausfinde, was es mit dem Schaudern auf sich hat, dann weiß ich was und kann ich was und verdiene mir endlich mein Brot.«
»Du und dein Schaudern! Ach, mach doch, was du willst, mir ist es gleich. Da hast du fünfzig Taler. Nimm sie und zieh hinaus in die weite Welt, aber verrate ja niemandem, woher du kommst und wer dein Vater ist. Da müsste ich mich zu Tode schämen.«
»Ja, Vater, ist recht, ganz wie du wünschst. Wenn’s weiter nichts ist, das werde ich leicht behalten können.«
Und sobald es Morgen wurde, steckte der Junge die fünfzig Taler ein und machte sich auf die Socken. Unterwegs sprach er immer so vor sich hin: »Ich wünschte, es würde mich schaudern! Ach, wenn’s mich doch nur schauderte!«
Es ging aber ein Mann denselben Weg und hörte, was der Junge sprach. Bald darauf kamen sie zu einem Galgen.
»Hör zu«, redete der Mann ihn an, »ich sag dir was. Siehst du den Galgen dort? Sieben Mann haben da schon mit der Seilmacherstochter Hochzeit gehalten und nun lernen sie fliegen. Setz dich darunter und warte ab, bis es Nacht wird, dann wird’s dich wohl schaudern.«
»Ist das wahr?«, sagte der Junge. »So leicht soll das gehen? Nun, dann werde ich es bald gelernt haben. Wenn’s mich vor dem Morgengrauen schaudert, kannst du meine fünfzig Taler haben. Komm um die Zeit nur wieder her und sieh nach mir.«
Er setzte sich unter den Galgen und wartete, dass es Nacht würde. Weil er fror, machte er ein Feuer, doch gegen Mitternacht kam ein Wind auf, und so kräftig die Scheite auch loderten, ihm wollte nicht warm werden. Der Wind schaukelte die Gehenkten hin und her, dass die Leiber aneinanderstießen, und der Junge dachte: »Wenn ich hier unten am Feuer friere, wie kalt muss erst den armen Burschen da oben sein?« Er stellte eine Leiter auf und stieg empor, band einen nach dem anderen los und schaffte alle sieben nach unten.
Dann legte er noch ein paar Scheite nach und setzte die Toten rings um die Flammen, damit sie sich wärmten; doch sie saßen nur stocksteif da und rührten sich nicht einmal, als nach einer Weile ihre Kleider Feuer fingen.
»He, aufgepasst!«, sagte er. »Wenn ihr euch nicht vorseht, hänge ich euch wieder zurück.«
Natürlich würdigten sie ihn keines Blickes, stierten nur weiter vor sich hin, derweil ihre Kleider munter brannten.
Der Junge geriet in Zorn. »Ihr sollt euch vorsehen, habe ich gesagt!«, rief er. »Ich will nicht in Flammen stehen, nur weil ihr zu faul seid, eure Beine vom Feuer wegzuziehen.«
So hängte er sie denn alle nebeneinander wieder auf und legte sich an seinem Feuer schlafen.
Am nächsten Morgen stand der Mann vor ihm und verlangte seine fünfzig Taler.
»Dich hat’s doch in der Nacht ordentlich geschaudert, oder?«, fragte er.
»Nein«, sagte der Junge. »Was soll ich von solchen Hornochsen lernen, die kein Wort reden und nur dasitzen, wenn ihre Hosen Feuer fangen?«
Da sah der Mann, dass hier für ihn keine fünfzig Taler zu holen waren, und gab auf. »Was für ein Narr!«, grummelte er im Gehen. »So ein Schwachkopf ist mir mein Lebtag noch nicht untergekommen.«
Der Junge ging seines Weges und murmelte wieder vor sich hin: »Ach, wenn’s mich doch nur schauderte! Ach, wenn’s mich doch nur schauderte!«
Ein Fuhrmann kam ihm nach und hörte, was er sprach. Als er ihn eingeholt hatte, fragte er: »Wer bist du?«
»Weiß nicht«, sagte der Junge.
»Wo kommst du her, hm?«
»Weiß nicht.«
»Wer ist denn dein Vater?«
»Darf ich nicht sagen.«
»Und was murmelst du da immer vor dich hin?«
»Ach«, sagte der Junge, »ich möchte so gern, dass es mich schaudert, aber niemand kann’s mir beibringen.«
»Du armer Einfaltspinsel«, sagte der Fuhrmann. »Schließ dich mir an, ich will dir wenigstens zu einer Unterkunft verhelfen.«
Der Junge ging mit, und des Abends kamen sie zu einem Gasthaus, wo sie übernachten wollten. Als sie in die Wirtsstube traten, sagte der Junge wieder: »Wenn’s mich doch nur schauderte! Ach, wenn’s mich doch nur schauderte!«
Das hörte der Wirt, der lachte und sagte: »Da hast du’s hier glücklich getroffen. Ganz in der Nähe findest du Gelegenheit dazu.«
»Still«, sagte die Wirtsfrau, »kein Wort davon. Denk an all die armen Burschen, die ihr Leben gelassen haben. Es wäre doch schade drum, wenn auch noch dieser Jüngling mit seinen hübschen Augen nie wieder das Licht des Tages erblickte.«
»Aber ich will das Schaudern lernen«, sagte der Junge. »Darum bin ich von zu Hause fort. Was steckt hinter deinen Worten? Was ist das für eine Gelegenheit, von der du gesprochen hast? Wo finde ich sie?«
Er ließ dem Wirt keine Ruhe, bis er ihm verriet, unweit vom Gasthaus gebe es ein Schloss, in dem es spuke; dort könne einer mit Leichtigkeit das Schaudern lernen, er müsse nur drei Nächte im Schloss Wache halten.
»Dem, der das wagt, hat der König seine Tochter zur Frau versprochen«, sagte der Wirt, »und ich schwöre dir, die Prinzessin ist das schönste Mädchen, das je auf Erden gelebt hat. Dazu liegen noch Berge von Schätzen im Schloss, die von bösen Geistern bewacht werden. Wenn du drei Nächte dort ausharrst, gehören die Schätze dir – es ist genug da, um jedermann reich zu machen. Viele junge Männer sind schon zum Schloss gezogen und wollten es versuchen, aber nicht einer von ihnen ist zurückgekommen.«
Am anderen Morgen ging der Junge zum König und sagte: »Mit Eurer Erlaubnis will ich gern drei Nächte in dem Spukschloss ausharren.«
Der König besah ihn sich genau und fand Gefallen an dem jungen Mann. Darum sagte er: »Ich gestatte dir, drei Dinge mit ins Schloss zu nehmen, aber sie dürfen nicht lebendig sein.«
Der Junge sagte: »Wenn das so ist, dann hätte ich gern Zeug zum Feuermachen, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit einem Messer dazu.«
Der König befahl, all das bei Tageslicht ins Schloss zu schaffen. Als es Nacht wurde, entfachte der Junge in einem Zimmer ein helles Feuer, schleifte die Schnitzbank mit dem Messer herbei und setzte sich an die Drehbank.
»Ach, wenn’s mich doch nur schauderte!«, sagte er. »Aber hier sieht es mir auch nicht danach aus.«
Um die Mitternachtsstunde schürte er das Feuer und blies kräftig hinein. Da hörte er aus einem Eck im Zimmer Stimmen.
»Miau, miau! Uns ist so kalt!«, riefen sie.
»Was jammert ihr da herum?«, sagte er und wandte den Kopf. »Wenn euch kalt ist, kommt her und setzt euch ans Feuer.«
Im Nu sprangen zwei gewaltige schwarze Katzen aus dem Schatten, setzten sich links und rechts von ihm und starrten ihn aus glühend roten Augen an.
»Eine Partie Karten gefällig?«, fragten sie.
»Warum nicht?«, gab er zur Antwort. »Aber zuvor lasst mich eure Krallen sehen.«
Sie streckten ihm die Pfoten entgegen.
»Du lieber Gott«, sagte er, »was habt ihr nur für lange Nägel. Die muss ich erst stutzen, bevor wir uns ans Spiel machen.«
Er packte die Katzen beim Genick, setzte sie auf die Schnitzbank und spannte ihre Pfoten in den Klemmbock.
»Die wollen mir gar nicht gefallen«, sagte er. »Bei dem Anblick vergeht einem gleich die Lust am Kartenspielen.«
Und er schlug sie beide tot und warf sie in den Schlossgraben.
Kaum hatte er sich wieder hingesetzt, da kamen aus allen Ecken schwarze Katzen und Hunde mit glühend roten Halsbändern an glühend roten Ketten. Mehr und mehr drängten hinzu, aus jedem Winkel, bis der Junge sich nicht mehr rühren konnte. Sie heulten und kläfften, stießen grässliche Schreie aus, sprangen ins Feuer und verstreuten die brennenden Scheite ringsumher.
Ein Weilchen sah er neugierig zu, doch endlich riss ihm der Geduldsfaden. Er griff nach seinem Messer und rief: »Hinaus mit euch, ihr Lumpenpack!«
Und er hackte lustig drauflos. Etlichen machte er den Garaus, die anderen liefen davon. Als alle, die noch lebten, Reißaus genommen hatten, warf er die toten gleichfalls in den Schlossgraben und ging wieder hinein, um sich zu wärmen.
Doch seine Augen wollten nicht länger offen bleiben, darum trat er zu dem großen Bett, das in einer Ecke stand.
»Das sieht behaglich aus«, dachte er. »Gerade recht für mich!«
Aber kaum hatte er sich niedergelegt, setzte sich das Bett in Bewegung. Es ruckelte zur Tür, die mit einem Schlag aufging, und rollte durchs ganze Schloss, bis es nur so dahinsauste.
»Nicht übel«, sagte der Junge, »von mir aus kann es noch schneller gehen.«
Da schnurrte es weiter wie von sechs prächtigen Pferden gezogen, durch die Gänge, die Treppen hinauf und wieder hinab, bis es sich – pardauz! mit einem Mal umkehrte und den Jungen unter sich begrub. Es lag auf ihm wie ein Berg.
Er aber warf Decken und Kissen beiseite und zwängte sich hinaus.
»Mit dem Bett bin ich fertig«, rief er aus. »Das kann haben, wer will.«
Und er legte sich ans Feuer und schlief friedlich ein.
Als der König am Morgen kam und ihn da fand, sagte er: »Ach, welch ein Jammer. Die Geister haben ihn umgebracht. Dabei war er so ein hübscher junger Mann!«
Der Junge hörte ihn und war sogleich auf den Beinen. »Noch haben sie mich nicht umgebracht, Eure Majestät«, sagte er.
»Oh! Du lebst!«, sagte der König. »Das freut mich sehr. Wie hast du dich geschlagen?«
»Recht gut«, sagte der Junge. »Eine Nacht hinter mir, zwei vor mir.«
Als er zurück ins Gasthaus kam, staunte der Wirt nicht schlecht.
»Du lebst! Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wieder zu sehen bekäme. Und, hat’s dich geschaudert?«
»Nicht ein einziges Mal. Ich will hoffen, dass mich heute Nacht was schaudern macht.«
Am zweiten Abend ging er wieder hinauf zum Schloss, entzündete ein Feuer und setzte sich daran.
»Ach!«, sagte er. »Wenn mich doch jemand schaudern machte.«
Gegen Mitternacht hörte er ein Rumoren im Schornstein. Es polterte und plärrte, schurrte und knurrte, und schließlich fiel unter gellendem Geschrei das Unterteil eines Mannes in den Kamin.
»Was tust du da?«, fragte der Junge. »Wo ist der Rest von dir?«
Doch der halbe Mann, der ja keine Augen und Ohren hatte, konnte weder hören noch sehen; er lief im Zimmer umher, stieß gegen dies und das, schlug lang hin und rappelte sich wieder auf.
Dann lärmte es wieder im Schornstein, und in einer Rußwolke kam die fehlende obere Hälfte herunter und kroch aus dem Feuer.
»Ist es dir vielleicht nicht heiß genug?«, fragte der Junge.
»Beine! Beine! Hierher! Her zu mir!«, rief die obere Hälfte, aber die untere hörte noch immer nichts und tappte weiter herum, bis der Junge sie um die Knie zu fassen bekam. Die obere Hälfte war mit einem Satz zur Stelle, und schon wurden sie wieder ein Mann. Der war ganz scheußlich anzusehen und setzte sich nahe zum Feuer auf die Bank und wollte nicht weichen, da schubste der Junge ihn grob herunter und nahm seinen Platz ein.
Abermals war großes Getöse zu hören, und einer nach dem anderen purzelten ein halbes Dutzend Toter durch den Schornstein herab. Sie hatten neun Schenkelknochen und zwei Schädel dabei, mit denen wollten sie kegeln.
»Kann ich mitspielen?«, fragte der Junge.
»Hast du denn Geld?«
»Reichlich«, sagte er. »Aber eure Kugeln sind mir nicht rund genug.«
Er nahm die Schädel und schliff sie an seiner Drehbank kugelrund.
»So ist es besser«, sagte er. »Jetzt rollen sie ordentlich. Das wird ein Spaß!«
Er spielte eine Weile mit den Toten und verlor einiges Geld dabei. Schlag Mitternacht verschwanden die Besucher alle miteinander. Der Junge legte sich in Seelenruhe hin und schlief ein.
Am nächsten Morgen kam der König wieder, um nach ihm zu sehen.
»Wie ist es dir diesmal ergangen?«, fragte er.
»Ich habe Kegeln gespielt«, sagte der Junge. »Und ein hübsches Sümmchen dabei verloren.«
»Und, hat es dich geschaudert?«
»Nicht die Spur«, gab er zur Antwort. »Lustig war’s, das Spiel, aber weiter auch nichts. Wenn es mich doch nur schauderte!«
Am dritten Abend setzte er sich wieder auf seine Bank beim Feuer und seufzte. »Es bleibt nur noch eine Nacht«, sagte er. »Hoffentlich lerne ich dann endlich das Schaudern.«
Nicht lang vor Mitternacht hörte er schwere Schritte langsam näher kommen, und es traten sechs riesenhafte Männer ein, die trugen einen Sarg.
»Ach, da ist wohl wer tot?«, fragte der Junge. »Das ist sicher mein Vetter, der ist vor ein paar Tagen gestorben.«
Er pfiff durch die Zähne, winkte mit dem Finger und sagte: »Komm heraus! Komm und begrüß deinen Vetter!«
Die sechs Männer stellten den Sarg hin und gingen hinaus. Der Junge schlug den Deckel zurück und sah den Toten, der darin lag. Er befühlte sein Gesicht, aber natürlich war es kalt wie Eis.
»Mach dir nichts daraus«, sagte er. »Ich will dich schon aufwärmen.«