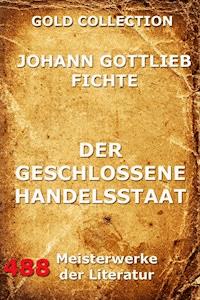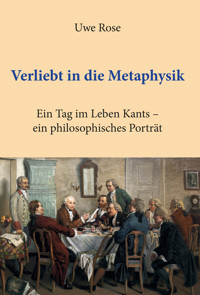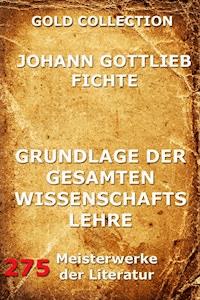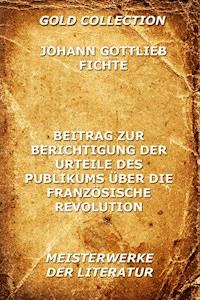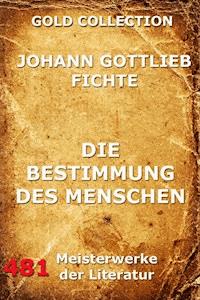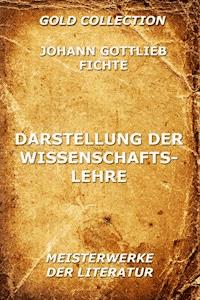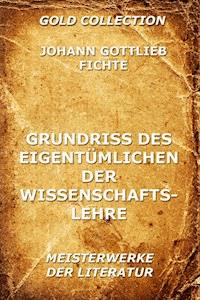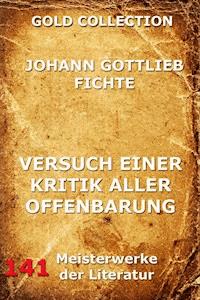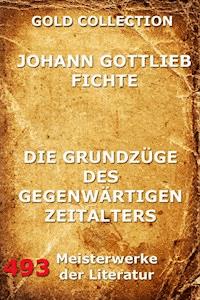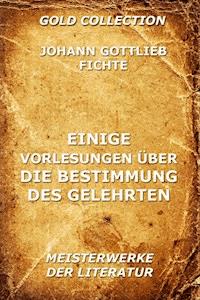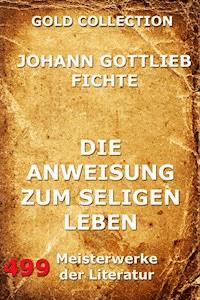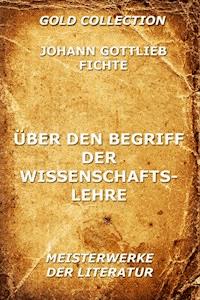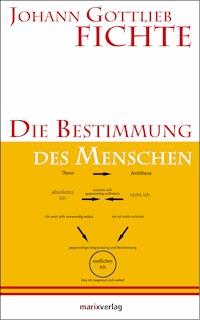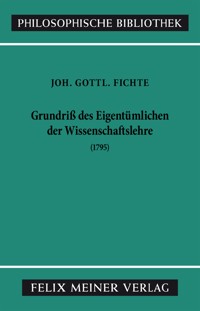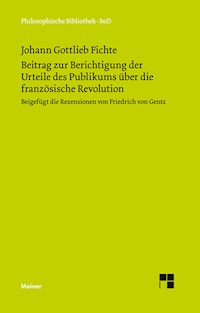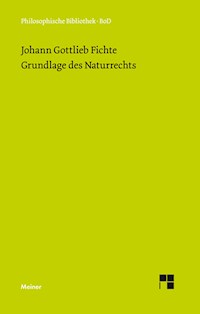0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre" präsentiert Johann Gottlieb Fichte ein tiefgehendes philosophisches System, das den Idealismus begründet und die Grenzen des menschlichen Wissens reflektiert. In drei Bänden entfaltet Fichte seine Überlegungen zur Subjektivität, zur Rolle des Ichs und zur Beziehung zwischen Denken und Sein. Mit einer klaren, oft leidenschaftlichen Prosa kombiniert Fichte metaphysische Fragestellungen mit praktischen Implikationen, wodurch er ein Werk schafft, das sowohl für Zeitgenossen als auch für zukünftige Denkströmungen von zentraler Bedeutung ist. Der Text verweist auf den Kontext der Aufklärung und der deutschen idealistischen Philosophie, wobei er die Problematik des Bewusstseins und der Wahrnehmung versiert thematisiert. Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) gilt als einer der bedeutendsten deutschen Philosophen und Wegbereiter des Idealismus. Sein Werdegang als Student der Theologie und später als Lehrer hat ihn früh mit den Fragen der Metaphysik und der Erkenntnistheorie konfrontiert. Fichtes eigenen Erfahrungen als Mitglied der Aufklärung und sein Engagement für die Selbstständigkeit des Individuums influierten seine Gedanken und forderten eine neuartige Auffassung von Wissen und Realität. Fichte war auch politisch aktiv und sah im Wissen ein Mittel zur Emanzipation des Menschen. Die "Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre" ist ein unverzichtbares Werk für alle, die sich mit philosophischen Grundfragen beschäftigen. Leser finden hier nicht nur eine theoretische Fundierung, sondern auch einen Anreiz, über das Selbstverständnis des Menschen nachzudenken. Fichtes prägnante Argumentation und seine Herausforderungen an das Denken machen dieses Buch zu einem Schlüsseltext, der sowohl die Philosophie als auch die Geisteswissenschaften nachhaltig beeinflusst hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (Alle 3 Bände)
Inhaltsverzeichnis
Vorbericht zur zweiten Auflage.
Während der Ausarbeitung einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre hat es sich dem Urheber dieser Wissenschaft abermals deutlich ergeben, dass die gegenwärtige erste Darstellung vorläufig noch durch keine neue völlig überflüssig und entbehrlich gemacht werden könne. Noch scheint der grössere Theil des philosophirenden Publicums für die neue Ansicht nicht so vorbereitet, dass es ihm nicht nützlich seyn sollte, denselben Inhalt in zwei sehr verschiedenen Formen zu finden, und als denselben wieder zu erkennen; ferner ist in der gegenwärtigen Darstellung ein Gang gehalten, auf welchen die in der neuen Darstellung zu beobachtende, mehr auf Fasslichkeit berechnete Methode zurückzuführen, bis zu der einstigen Erscheinung einer streng scientifischen Darstellung immer sehr gut seyn wird; endlich sind in ihr mehrere Hauptpuncte mit einer Ausführlichkeit und einer Klarheit vorgestellt, welche je zu übertreffender Verfasser keine Hoffnung hat. Er wird auf mehrere Stücke dieser Art in der neuen Darstellung sich beziehen müssen.
Dieser Gründe halber haben wir einen neuen unveränderten Abdruck dieser ersten Darstellung, welche sich vergriffen hatte, besorgt.
Die neue Darstellung wird im künftigen Jahre erscheinen. Berlin im Augustmonat 1801.
Fichte.
Vorbericht zur ersten Auflage.
Ich würde vor diesem Buche, das nicht eigentlich für das Publicum bestimmt war, demselben nichts zu sagen gehabt haben, wenn es nicht, sogar ungeendigt, auf die indiscreteste Weise vor einen Theil desselben wäre gezogen worden. Ueber Dinge der Art vor der Hand nur soviel! –
Ich glaubte, und glaube noch, den Weg entdeckt zu haben, auf welchem die Philosophie sich zum Range einer evidenten Wissenschaft erheben muss. Ich kündigte dies1 bescheiden an, legte dar, wie ich nach dieser Idee gearbeitet haben würde, wie ich nun nach veränderter Lage nach ihr arbeiten müsste, und fing an den Plan ins Werk zu setzen. Dies war natürlich. Es war aber ebenso natürlich, dass andere Kenner und Bearbeiter der Wissenschaft meine Idee untersuchten, prüften, beurtheilten, dass sie, sie mochten nun innere oder äussere Gründe haben, sich den Weg nicht gefallen zu lassen, den ich die Wissenschaft führen wollte, mich zu widerlegen suchten. Aber wozu es dienen sollte, das, was ich behauptet, geradezu ohne alle Prüfung zu verwerfen, höchstens sich die Mühe zu nehmen, es zu verdrehen, jede Gelegenheit herbeizuziehen, um es auf die leidenschaftlichste Weise zu schmähen und zu verschreien, lässt sich nicht einsehen. Was mag doch jene Beurtheiler so ganz aus ihrer Fassung gebracht haben, Sollte ich von Nachbeterei und Seichtigkeit mit Achtung sprechen, da ich dieselben doch gar nicht achte? Was hätte dazu mich verbinden sollen? – besonders, da ich mehr zu thun hatte, und vor mir jeder Stümper ruhig seinen Weg hätte gehen mögen, wenn er mich nicht nöthigte, durch Aufdeckung seiner Stümperei mir selbst Platz zu machen.
Oder hat ihr feindseliges Benehmen noch einen anderen Grund? – Für ehrliche Leute sey folgendes gesagt, für welche allein es einen Sinn hat. – Was auch meine Lehre sey, ob ächte Philosophie, oder Schwärmerei und Unsinn, so verschlägt dies meiner Person nichts, wenn ich redlich geforscht habe. Ich würde durch das Glück, die erstere entdeckt zu haben, meinen persönlichen Werth so wenig gehoben, als durch das Unglück, neue Irrthümer auf die Irrthümer aller Zeiten aufgebaut zu haben, denselben erniedrigt glauben. An meine Person denke ich überall nicht; aber für die Wahrheit bin ich entflammt, und was ich für wahr halte, das werde ich immer so stark und so entscheidend sagen, als ich es vermag.
Im gegenwärtigen Buche, wenn man die Schrift: Grundriss des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Vermögen mit dazu nimmt, glaube ich mein System so weit verfolgt zu haben, dass jeder Kenner sowohl den Grund und Umfang desselben, als auch die Art, wie auf jenen weiter aufgebaut werden muss, vollständig übersehen könne. Meine Lage erlaubt mir nicht, ein bestimmtes Versprechen abzulegen, wann und wie ich die Bearbeitung desselben fortsetzen werde.
Die Darstellung erkläre ich selbst für höchst unvollkommen und mangelhaft, theils weil sie für meine Zuhörer, wo ich durch den mündlichen Vortrag nachhelfen konnte, in einzelnen Bogen, so wie ich für meine Vorlesungen eines bedurfte, erscheinen musste; theils weil ich eine feste Terminologie – das bequemste Mittel für Buchstäbler, jedes System seines Geistes zu berauben, und es in ein trockenes Geripp zu verwandeln – so viel möglich zu vermeiden suchte. Ich werde dieser Maxime auch bei künftigen Bearbeitungen des Systems, bis zur endlichen vollendeten Darstellung desselben, treu bleiben. Ich will jetzt noch gar nicht zubauen, sondern möchte nur das Publicum veranlassen, mit mir den künftigen Bau zu überschlagen. Man wird aus dem Zusammenhange erklären, und sich erst eine Uebersicht des Ganzen verschaffen müssen, ehe man sich einen einzelnen Satz scharf bestimmt; eine Methode, die freilich den guten Willen voraussetzt, dem Systeme Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, nicht die Absicht, nur Fehler an ihm zu finden.
Ich habe viele Klagen über die Dunkelheit und Unverständlichkeit des bis jetzt auswärts bekannten Theils dieses Buchs, wie auch der Schrift: Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre, gehört.
Gehen die die letztere Schrift betreffenden Klagen insbesondere auf § 8. derselben, so kann ich allerdings Unrecht gehabt haben, dass ich die bei mir durch das ganze System bestimmten Grundsätze desselben hingab, ohne das System; und mir von den Lesern und Beurtheilern die Geduld versprach, alles so unbestimmt zu lassen, als ich es gelassen hatte. Gehen sie auf die ganze Schrift, so bekenne ich im voraus, dass ich im Fache der Speculation für diejenigen nie etwas verständliches werde schreiben können, denen sie unverständlich war. Ist jene Schrift die Grenze ihres Verstehens, so ist sie die Grenze meiner Verständlichkeit; unsere Geister sind durch diese Grenze von einander geschieden, und ich ersuche sie mit dem Lesen meiner Schriften nicht die Zeit zu verderben. – Habe dieses Nichtverstehen einen Grund, welchen es wolle, es liegt in der Wissenschaftslehre selbst ein Grund, warum sie gewissen Lesern immer unverständlich bleiben muss: der, dass sie das Vermögen der Freiheit der inneren Anschauung voraussetzt. – Dann verlangt jeder philosophische Schriftsteller mit Recht, dass der Leser den Faden des Raisonnements festhalte, und nichts vorhergegangenes vergessen habe, wenn er bei dem folgenden steht. Etwas, das unter diesen Bedingungen nicht verstanden werden könnte, und nicht nothwendig richtig verstanden werden müsste in diesen Schriften – ist mir wenigstens nicht bekannt; und ich glaube allerdings, dass der Verfasser eines Buchs selbst bei Beantwortung dieser Frage eine Stimme habe. Was vollkommen klar gedacht worden ist, ist verständlich; und ich bin mir bewusst, alles vollkommen klar gedacht zu haben, so dass ich jede Behauptung zu jedem beliebigen Grade der Klarheit erheben wollte, wenn mir Zeit und Raum genug gegeben ist.
Besonders halte ich für nöthig zu erinnern, dass ich nicht alles sagen, sondern meinem Leser auch etwas zum Denken überlassen wollte. Es sind mehrere Misverständnisse, die ich sicher voraussehe, und denen ich mit ein paar Worten hätte abhelfen können. Ich habe auch diese paar Worte nicht gesagt, weil ich das Selbstdenken unterstützen möchte. Die Wissenschaftslehre soll sich überhaupt nicht aufdringen, sondern sie soll Bedürfniss seyn, wie sie es ihrem Verfasser war.
Die künftigen Beurtheiler dieser Schrift ersuche ich auf das Ganze einzugehen, und jeden einzelnen Gedanken aus dem Gesichtspuncte des Ganzen anzusehen. Der Hallische Recensent äussert seine Vermuthung, dass ich bloss einen Scherz habe treiben wollen; die anderen Beurtheiler der Schrift: Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre, scheinen dies gleichfalls geglaubt zu haben; so leicht gehen sie über die Sache hin, und so spasshaft sind ihre Erinnerungen, als ob sie Scherz durch Scherz zu erwiedern hätten.
Ich kann zu Folge der Erfahrung, dass ich beim dreimaligen Durcharbeiten dieses Systems meine Gedanken über einzelne Sätze desselben jedesmal anders modificirt gefunden, erwarten, dass sie bei fortgesetztem Nachdenken sich immer weiter verändern und bilden werden. Ich werde selbst am sorgfältigsten daran arbeiten, und jede brauchbare Erinnerung; von anderen wird mir willkommen seyn. – Ferner, so innig ich überzeugt bin, dass die Grundsätze, auf welchen dieses ganze System ruht, unumstösslich sind, und so stark ich auch hier und da diese Ueberzeugung mit meinem vollen Rechte geäussert habe, so wäre es doch eine mir bis jetzt freilich undenkbare Möglichkeit, dass sie dennoch umgestossen würden. Auch das würde mir willkommen seyn, weil die Wahrheit dadurch gewinnen würde. Man lasse sich nur ein auf dieselben, und versuche es, sie umzustossen.
Was mein System eigentlich sey, und unter welche Klasse man es bringen könne, ob ächter durchgeführter Kriticismus, wie ich glaube, oder wie man es sonst nennen wolle, thut nichts zur Sache. Ich zweifle nicht, dass man ihm mancherlei Namen finden, und es mehrerer einander gerade zuwiderlaufenden Ketzereien beschuldigen werde. Dies mag man; nur verweise man mich nicht an alte Widerlegungen, sondern widerlege selbst. Jena zur Ostermesse 1796.
Fußnoten
1 In der Schrift: Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre, oder der sogenannter Philosophie: Weimar im Verlage des Industrie-Comptoirs, 1794.
Erster Theil. Grundsätze der gesammten Wissenschaftslehre.
§ 1. Erster, schlechthin unbedingter Grundsatz.
Wir haben den absolut-ersten, schlechthin unbedingten Grundsatz alles menschlichen Wissens aufzusuchen. Beweisen oder bestimmen lässt er sich nicht, wenn er absolut-erster Grundsatz seyn soll.
Er soll diejenige Thathandlung ausdrücken, welche unter den empirischen Bestimmungen unseres Bewusstseyns nicht vorkommt, noch vorkommen kann, sondern vielmehr allem Bewusstseyn zum Grunde liegt, und allein es möglich macht2. Bei Darstellung dieser Thathandlung ist weniger zu befürchten, dass man sich in etwa dabei dasjenige nicht denken werde, was man sich zu denken hat – dafür ist durch die Natur unseres Geistes schon gesorgt – als dass man sich dabei denken werde, was man nicht zu denken hat. Dies macht eine Reflexion über dasjenige, was man etwa zunächst dafür halten könnte, und eine Abstraction von allem, was nicht wirklich dazu gehört, nothwendig.
Selbst vermittelst dieser abstrahirenden Reflexion nicht – kann Thatsache des Bewusstseyns werden, was an sich keine ist; aber es wird durch sie erkannt, dass man jene Thathandlung, als Grundlage alles Bewusstseyns, nothwendig denken müsse.
Die Gesetze3, nach denen man jene Thathandlung sich als Grundlage des menschlichen Wissens schlechterdings denken muss, oder – welches das gleiche ist – die Regeln, nach welchen jene Reflexion angestellt wird, sind noch nicht als gültig erwiesen, sondern sie werden stillschweigend, als bekannt und ausgemacht, vorausgesetzt. Erst tiefer unten werden sie von dem Grundsatze, dessen Aufstellung bloss unter Bedingung ihrer Richtigkeit richtig ist, abgeleitet. Dies ist ein Cirkel; aber es ist ein unvermeidlicher Cirkel. (S. über den Begriff der Wissenschaftslehre § 7) Da er nun unvermeidlich, und frei zugestanden ist, so darf man auch bei Aufstellung des höchsten Grundsatzes auf alle Gesetze der allgemeinen Logik sich berufen.
Wir müssen auf dem Wege der anzustellenden Reflexion von irgend einem Satze ausgehen, den uns Jeder ohne Widerrede zugiebt. Dergleichen Sätze dürfte es wohl auch mehrere geben. Die Reflexion ist frei; und es kommt nicht darauf an, von welchem Puncte sie ausgeht. Wir wählen denjenigen, von welchem aus der Weg zu unserem Ziele am kürzesten ist.
So wie dieser Satz zugestanden wird, muss zugleich dasjenige, was wir der ganzen Wissenschaftslehre zum Grunde legen wollen, als Thathandlung zugestanden seyn: und es muss aus der Reflexion sich ergeben, dass es als solche, zugleich mit jenem Satze, zugestanden sey. – Irgend eine Thatsache des empirischen Bewusstseyns wird aufgestellt; und es wird eine empirische Bestimmung nach der anderen von ihr abgesondert, so lange bis dasjenige, was sich schlechthin selbst nicht wegdenken und wovon sich weiter nichts absondern lässt, rein zurückbleibt.
Wenn aber Jemand einen Beweis desselben fordern sollte, so würde man sich auf einen solchen Beweis gar nicht einlassen, sondern behaupten, jener Satz sey schlechthin, d. i. ohne allen weiteren Grund, gewiss: und indem man dieses, ohne Zweifel mit allgemeiner Beistimmung, thut, schreibt man sich das Vermögen zu, etwas schlechthin zu setzen.
2) Man setzt durch die Behauptung, dass obiger Satz an sich gewiss sey, nicht, dass A sey. Der Satz: A ist A ist gar nicht gleichgeltend dem: A ist, oder: es ist ein A. (Seyn, ohne Prädicat gesetzt, drückt etwas ganz anderes aus, als seyn mit einem Prädicate; worüber weiter unten.) Man nehme an, A bedeute einen in zwei gerade Linien eingeschlossenen Raum, so bleibt jener Satz immer richtig; obgleich der Satz: A ist, offenbar falsch wäre. Sondern man setzt: wenn A sey, so sey A. Mithin ist davon, ob überhaupt A sey oder nicht, gar nicht die Frage. Es ist nicht die Frage vom Gehalte des Satzes, sondern bloss von seiner Form; nicht von dem, wovon man etwas weiss, sondern von dem, was man weiss, von irgend einem Gegenstande, welcher es auch seyn möge.
3) In Rücksicht auf A selbst aber, ob es sey oder nicht, ist dadurch noch nichts gesetzt. Es entsteht also die Frage: unter welcher Bedingung ist denn A?
a. X wenigstens ist im Ich, und durch das Ich gesetzt – denn das Ich ist es, welches im obigen Satze urtheilt, und zwar nach X als einem Gesetze urtheilt; welches mithin dem Ich gegeben, und da es schlechthin und ohne allen weiteren Grund aufgestellt wird, dem Ich durch das Ich selbst gegeben seyn muss.
b. Ob, und wie A überhaupt gesetzt sey, wissen wir nicht; aber da X einen Zusammenhang zwischen einem unbekannten Setzen des A, und einem unter der Bedingung jenes Setzens absoluten Setzen desselben A bezeichnen soll, so ist, wenigstens insofern jener Zusammenhang gesetzt wird, A in dem Ich, und durch das Ich gesetzt, so wie X; X ist nur in Beziehung auf ein A möglich; nun ist X im Ich wirklich gesetzt: mithin muss auch A im Ich gesetzt sein, insofern X darauf bezogen wird.
c. X bezieht sich auf dasjenige A, welches im obigen Satze die logische Stelle des Subjects einnimmt, ebenso wie auf dasjenige, welches für das des Prädicats steht; denn beide werden durch X vereinigt. Beide also sind, insofern sie gesetzt sind, im Ich gesetzt; und das im Prädicate wird, unter der Bedingung, dass das im Subjecte gesetzt sey, schlechthin gesetzt; und der obige Satz lässt demnach sich auch so ausdrücken: Wenn A im Ich gesetzt ist, so ist es gesetzt; oder – so ist es.
5) Durch diese Operation sind wir schon unvermerkt zu dem Satze: Ich bin (zwar nicht als Ausdruck einer Thathandlung, aber doch einer Thatsache) angekommen. Denn X ist schlechthin gesetzt; das ist Thatsache des empirischen Bewusstseyns. Nun ist X gleich dem Satze: Ich bin Ich; mithin ist auch dieser schlechthin gesetzt.
Aber der Satz: Ich bin Ich, hat eine ganz andere Bedeutung als der Satz: A ist A. – Nemlich der letztere hat nur unter einer gewissen Bedingung einen Gehalt. Wenn A gesetzt ist, so ist es freilich als A, mit dem Prädicate A gesetzt. Es ist aber durch jenen Satz noch gar nicht ausgemacht, ob es überhaupt gesetzt, mithin, ob es mit irgend einem Prädicate gesetzt sey. Der Satz: Ich bin Ich, aber gilt unbedingt und schlechthin, denn er ist gleich dem Satze X; er gilt nicht nur der Form, er gilt auch seinem Gehalte nach. In ihm ist das Ich, nicht unter Bedingung, sondern schlechthin, mit dem Prädicate der Gleichheit mit sich selbst gesetzt; es ist also gesetzt; und der Satz lässt sich auch ausdrücken: Ich bin.
6) Wir gehen auf den Punct zurück, von welchem wir ausgingen.
c. Demnach ist das schlechthin gesetzte, und auf sich selbst gegründete – Grund eines gewissen (durch die ganze Wissenschaftslehre wird sich ergeben, alles) Handelns des menschlichen Geistes, mithin sein reiner Charakter; der reine Charakter der Thätigkeit an sich abgesehen von den besonderen empirischen Bedingungen derselben.
Also das Setzen des Ich durch sich selbst ist die reine Thätigkeit desselben. – Das Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge dieses blossen Setzens durch sich selbst; und umgekehrt: das Ich ist, und es setzt sein Seyn, vermöge seines blossen Seyns. – Es ist zugleich das Handelnde, und das Product der Handlung; das Thätige, und das, was durch die Thätigkeit hervorgebracht wird; Handlung und That sind Eins und ebendasselbe; und daher ist das: Ich bin, Ausdruck einer Thathandlung; aber auch der einzig-möglichen, wie sich aus der ganzen Wissenschaftslehre ergeben muss.
7) Wir betrachten jetzt noch einmal den Satz: Ich bin Ich.
a. Das Ich ist schlechthin gesetzt. Man nehme an, dass das im obigen Satze in der Stelle des formalen Subjects4stehende Ich das schlechthin gesetzte; das in der Stelle des Prädicats aber das seyende bedeute; so wird durch das schlechthin gültige Urtheil, dass beide völlig Eins seyen, ausgesagt, oder schlechthin gesetzt; das Ich sey, weil es sich gesetzt habe.
b. Das Ich in der ersteren, und das in der zweiten Bedeutung sollen sich schlechthin gleich seyn. Man kann demnach den obigen Satz auch umkehren und sagen: das Ich setzt sich selbst, schlechthin weil es ist. Es setzt sich durch sein blosses Seyn, und ist durch sein blosses Gesetztseyn.
Und dies macht es denn völlig klar, in welchem Sinne wir hier das Wort Ich brauchen, und führt uns auf eine bestimmte Erklärung des Ich, als absoluten Subjects. Dasjenige, dessen Seyn (Wesen) bloss darin besteht, dass es sich selbst als seyend setzt, ist das Ich, als absolutes Subject. So wie es sich setzt, ist es; und so wie es ist, setzt es sich; und das Ich ist demnach für das Ich schlechthin und nothwendig. Was für sich selbst nicht ist, ist kein Ich.
(Zur Erläuterung! Man hört wohl die Frage aufwerfen: was war ich wohl, ehe ich zum Selbstbewusstseyn kam? Die natürliche Antwort darauf ist: ich war gar nicht; denn ich war nicht Ich. Das Ich ist nur insofern, inwiefern es sich seiner bewusst ist. – Die Möglichkeit jener Frage gründet sich auf eine Verwirrung zwischen dem Ich als Subject; und dem Ich als Object der Reflexion des absoluten Subjects, und ist an sich völlig unstatthaft. Das Ich stellt sich selbst vor, nimmt insofern sich selbst in die Form der Vorstellung auf und ist erst nun Etwas, ein Object; das Bewusstseyn bekommt in dieser Form ein Substrat, welches ist, auch ohne wirkliches Bewusstseyn, und noch dazu körperlich gedacht wird. Man denkt sich einen solchen Zustand, und fragt: Was war damals das Ich; d.h. was ist das Substrat des Bewusstseyns. Aber auch dann denkt man unvermerkt das absolute Subject, als jenes Substrat anschauend, mit hinzu; man denkt also unvermerkt gerade dasjenige hinzu, wovon man abstrahirt zu haben vorgab; und widerspricht sich selbst. Man kann gar nichts denken, ohne sein Ich, als sich seiner selbst bewusst, mit hinzu zu denken; man kann von seinem Selbstbewusstseyn nie abstrahiren: mithin sind alle Fragen von der obigen Art nicht zu beantworten; denn sie sind, wenn man sich selbst wohl versteht, nicht aufzuwerfen).
8) Ist das Ich nur, insofern es sich setzt, sonst es auch nur für das setzende, und setzt nur für das seyende. – Das Ich ist für das Ich, – setzt es aber sich selbst, schlechthin, so wie es ist, so setzt es sich nothwendig und ist nothwendig für das Ich. Ich bin nur für Mich; aber für Mich bin ich nothwendig, (indem ich sage für Mich, setze ich schon mein Seyn).
9) Sich selbst setzen und Seyn sind, vom Ich gebraucht, völlig gleich. Der Satz: Ich bin, weil ich mich selbst gesetzt habe, kann demnach auch so ausgedrückt werden: Ich bin schlechthin, weil ich bin.
Ferner, das sich setzende Ich, und das seyende Ich sind völlig gleich, Ein und ebendasselbe. Das Ich ist dasjenige, als was es sich setzt; und es setzt sich als dasjenige, was es ist. Also: Ich bin schlechthin, was ich bin.
10) Der unmittelbare Ausdruck der jetzt entwickelten Thathandlung wäre folgende Formel: Ich bin schlechthin, d. i. ich bin schlechthin, weil ich bin; und bin schlechthin, was ich bin; beides für das Ich.
Denkt man sich die Erzählung von dieser Thathandlung an die Spitze einer Wissenschaftslehre, so müsste sie etwa folgendermaassen ausgedrückt werden: Das Ich setzt ursprünglich schlechthin sein eigenes Seyn.5
Wir sind von dem Satze A=A ausgegangen; nicht, als ob der Satz: Ich bin, sich aus ihm erweisen liesse, sondern weil wir von irgend einem, im empirischen Bewusstseyn gegebenen gewissen, ausgehen mussten. Aber selbst in unserer Erörterung hat sich erheben, dass nicht der Satz: A=A den Satz Ich bin, sondern dass vielmehr der letztere den ersteren begründe.
Wird im Satze Ich bin von dem bestimmten Gehalte, dem Ich, abstrahirt, und die blosse Form, welche mit jenem Gehalte gegeben ist, die Form der Folgerung vom Gesetztseyn auf das Seyn, übrig gelassen; wie es zum Behuf der Logik (S. Begriff d. W. L. § 6.) geschehen muss; so erhält man als Grundsatz der Logik den Satz A=A, der nur durch die Wissenschaftslehre erwiesen und bestimmt werden kann. Erwiesen: A ist A, weil das Ich, welches A gesetzt hat, gleich ist demjenigen, in welchem es gesetzt ist: bestimmt; alles was ist, ist nur insofern, als es im Ich gesetzt ist, und ausser dem Ich ist nichts. Kein mögliches A im obigen Satze (kein Ding) kann etwas anderes seyn, als ein im Ich gesetztes.
Abstrahirt man ferner von allem Urtheilen, als bestimmtem Handeln, und sieht bloss auf die durch jene Form gegebene Handlungsart des menschlichen Geistes überhaupt, so hat man die Kategorie der Realität. Alles, worauf der Satz A= A anwendbar ist, hat, inwiefern derselbe darauf anwendbar ist, Realität. Dasjenige, was durch das blosse Setzen irgend eines Dinges (eines im ich gesetzten) gesetzt ist, ist in ihm Realität, ist sein Wesen.
(Der Maimonsche Skepticismus gründet sich zuletzt auf die Frage über unsere Befugniss zur Anwendung der Kategorie der Realität. Diese Befugniss lässt sich aus keiner anderen ableiten, sondern wir sind dazu schlechthin befugt. Vielmehr müssen aus ihr alle möglichen übrigen abgeleitet werden; und selbst der Maimonsche Skepticismus setzt sie unvermerkt voraus, indem er die Richtigkeit der allgemeinen Logik anerkennt. Aber es lässt sich etwas aufzeigen, wovon jede Kategorie selbst abgeleitet ist: das Ich, als absolutes Subject. Für alles mögliche Übrige, worauf sie angewendet werden soll, muss gezeigt werden, dass aus dem Ich Realität darauf übertragen werde: – dass es seyn müsse, wofern das Ich sey).
Auf unseren Satz, als absoluten Grundsatz alles Wissens hat gedeutet Kant in seiner Deduction der Kategorien; er hat ihn aber nie als Grundsatz bestimmt aufgestellt. Vor ihm hat Cartes einen ähnlichen angegeben: cogito, ergo sum, welches nicht eben der Untersatz und die Schlussfolge eines Syllogism seyn muss, dessen Obersatz hiesse: quodcunque cogitat, est; sondern welches er auch sehr wohl als unmittelbare Thatsache des Bewusstseyns betrachtet haben kann. Dann hiesse es soviel, als cogitans sum, ergo sum (wie wir sagen würden, sum, ergo sum). Aber dann ist der Zusatz cogitans völlig überflüssig; man denkt nicht nothwendig, wenn man ist, aber man ist nothwendig, wenn man denkt. Das Denken ist gar nicht das Wesen, sondern nur eine besondere Bestimmung des Seyns; und es giebt ausser jener noch manche andere Bestimmungen unseres Seyns. – Reinhold stellt den Satz der Vorstellung auf, und in der Cartesischen Form würde sein Grundsatz heissen: repraesento, ergo sum, oder richtiger repraesentans sum, ergo sum. Er geht um ein beträchtliches weiter als Cartes; aber wenn er nur die Wissenschaft selbst und nicht etwa bloss die Propädeutik derselben aufstellen will, nicht weit genug; denn auch das Vorstellen ist nicht das Wesen des Seyns, sondern eine besondere Bestimmung desselben; und es giebt ausser dieser noch andere Bestimmungen unseres Seyns, ob sie gleich durch das Medium der Vorstellung hindurch gehen müssen, um zum empirischen Bewusstseyn zu gelangen.
Ueber unseren Satz, in dem angezeigten Sinne, hinausgegangen ist Spinoza. Er läugnet nicht die Einheit des empirischen Bewusstseyns, aber er läugnet gänzlich das reine Bewusstseyn. Nach ihm verhält sich die ganze Reihe der Vorstellungen eines empirischen Subjects zum einzigen reinen Subjecte, wie eine Vorstellung zur Reihe. Ihm ist das Ich (dasjenige, was Er sein Ich nennt, oder ich mein Ich nenne) nicht schlechthin, weil es ist; sondern weil etwas andere, ist. – Das Ich ist nach ihm zwar für das Ich – Ich, aber er fragt, was es für etwas ausser dem Ich seyn würde. Ein solches, »ausser dem Ich« wäre gleichfalls ein Ich, von welchem das gesetzte Ich (z.B. mein Ich) und alle mögliche setzbare Ich Modificationen wären. Er trennt das reine, und das empirische Bewusstseyn. Das erstere setzt er in Gott, der seiner sich nie bewusst wird, da das reine Bewusstseyn nie zum Bewusstseyn gelangt; das letzte in die besonderen Modificationen der Gottheit. So aufgestellt ist sein System völlig consequent und unwiderlegbar, weil er in einem Felde sich befindet, auf welches die Vernunft ihm nicht weiter folgen kann; aber es ist grundlos; denn was berechtigte ihn denn über das im empirischen Bewusstseyn gegebene reine Bewusstseyn hinaus zu gehen? – – Was ihn auf sein System trieb, lässt sich wohl aufzeigen: nemlich das nothwendige Streben, die höchste Einheit in der menschlichen Erkenntniss hervorzubringen. Diese Einheit ist in seinem System; und der Fehler ist bloss darin, dass er aus theoretischen Vernunftgründen zu schliessen glaubte, wo er doch bloss durch ein praktisches Bedürfniss getrieben wurde: dass er etwas wirklich gegebenes aufzustellen glaubte, da er doch bloss ein vorgestecktes, aber nie zu erreichendes Ideal aufstellte. Seine höchste Einheit werden wir in der Wissenschaftslehre wieder finden; aber nicht als etwas, das ist, sondern als etwas, das durch uns hervorgebracht werden soll, aber nicht kann. – – Ich bemerke noch, dass man, wenn man das Ich bin überschreitet, nothwendig auf den Spinozismus kommen muss! (dass das Leibnitzische System, in seiner Vollendung gedacht, nichts anderes sey, als Spinozismus, zeigt in einer sehr lesenswerthen Abhandlung: Ueber die Progressen der Philosophie u.s.w. Salomo Maimon) und dass es nur zwei völlig consequente Systeme giebt; das kritische, welches diese Grenze anerkennt, und das spinozische, welches sie überspringt.
Fußnoten
2 Dies haben alle diejenigen übersehen, die da erinnern, entweder was der erste Grundsatz besage, komme unter den Thatsachen des Bewusstseyns nicht vor, oder es widerspreche denselben. [Anm. der 2ten Ausg.]
3 Die der allgemeinen Logik. – [2te Ausg.]
5 Dies Alles heisst nun mit anderen Worten, mit denen ich es seitdem ausgedrückt habe. Ich ist nothwendig Identität des Subjects und Objects: Subject-Object; und dies ist es schlechthin ohne weitere Vermittelung. Dies, sage ich, beisst es; ohnerachtet dieser Satz nicht so leicht eingesehen und nach seiner hohen, vor der W. L. durchgängig vernachlässigten Wichtigkeit erwogen ist, als man denken möchte; daher die vorhergehenden Erörterungen desselben nicht erlassen werden können. [Anm. zur 2ten Ausg.]
§ 2. Zweiter, seinem Gehalte nach bedingter Grundsatz.
Aus dem gleichen Grunde, aus welchem der erste Grundsatz nicht bewiesen, noch abgeleitet werden konnte, kann es auch der zweite nicht. Wir gehen daher auch hier, gerade wie oben, von einer Thatsache des empirischen Bewusstseyns aus, und verfahren mit derselben aus der gleichen Befugniss auf die gleiche Art.
4) Es bleibt gänzlich unberührt die Frage: Ist denn, und unter welcher Bedingung der Form der blossen Handlung ist denn das Gegentheil von A gesetzt. Diese Bedingung ist es, die sich vom Satze A – A müsste ableiten lassen, wenn der oben aufgestellte Satz selbst ein abgeleiteter seyn sollte. Aber eine dergleichen Bedingung kann sich aus ihm gar nicht ergeben, da die Form des Gegensetzens in der Form des Setzens so wenig enthalten wird, dass sie ihr vielmehr selbst entgegengesetzt ist. Es wird demnach ohne alle Bedingung und schlechthin entgegengesetzt. – A ist, als solches, gesetzt schlechthin, weil es gesetzt ist.
5) Durch diese absolute Handlung nun, und schlechthin durch sie, wird das entgegengesetzte, insofern es ein entgegengesetztes ist (als blosses Gegentheil überhaupt) gesetzt. Jedes Gegentheil, insofern es das ist, ist schlechthin, kraft einer Handlung des Ich, und aus keinem allderen Grunde. Das Entgegengesetztseyn überhaupt ist schlechthin durch das Ich gesetzt.
6) Soll irgend ein – A gesetzt werden, so muss ein A gesetzt seyn. Demnach ist die Handlung des Entgegensetzens in einer anderen Rücksicht auch bedingt. Ob überhaupt eine Handlung möglich ist, hängt von einer anderen Handlung ab; die Handlung ist demnach der Materie nach, als ein Handeln überhaupt, bedingt; es ist ein Handeln in Beziehung auf ein anderes Handeln. Dass eben so, und nicht anders gehandelt wird, ist unbedingt; die Handlung ist ihrer Form nach, (in Absicht des Wie) unbedingt.
(Das Entgegensetzen ist nur möglich unter Bedingung der Einheit des Bewusstseyns des setzenden, und des entgegensetzenden. Hinge das Bewusstseyn der ersten Handlung nicht mit dem Bewusstseyn der zweiten zusammen; so wäre das zweite Setzen kein Gegensetzen, sondern ein Setzen schlechthin. Erst durch Beziehung auf ein Setzen wird es ein Gegensetzen).
Wir können im – A abermals zweierlei unterscheiden; die Form desselben, und die Materie. Durch die Form wird bestimmt, dass es überhaupt ein Gegentheil sey (von irgend einem X). Ist es einem bestimmten A entgegensesetzt, so hat es Materie; es ist irgend etwas Bestimmtes nicht.
8) Die Form von – A wird bestimmt durch die Handlung schlechthin; es ist ein Gegentheil, weil es Product eines Gegensetzens ist: die Materie durch A; es ist nicht, was A ist; und sein ganzes Wesen besteht darin, dass es nicht ist, was A ist. – Ich weiss von – A, dass es von irgend einem A das Gegentheil sey –. Was aber dasjenige sey, von welchem ich jenes weiss, kann ich nur unter der Bedingung wissen, dass ich A kenne.
11) Von allem, was dem Ich zukommt, muss kraft der blossen Gegensetzung dem Nicht-Ich das Gegentheil zukommen.
(Es ist die gewöhnliche Meinung, dass der Begriff des Nicht-Ich ein discursiver, durch Abstraction von allem Vorgestellten entstandener Begriff sey. Aber die Seichtigkeit dieser Erklärung lässt sich leicht darthun. So wie ich irgend etwas vorstellen soll, muss ich es dem Vorstellenden entgegensetzen. Nun kann und muss allerdings in dem Objecte der Vorstellung, irgend ein X liegen, wodurch es sich als ein Vorzustellendes, nicht aber als das Vorstellende entdeckt; aber dass alles, worin dieses X liege, nicht das Vorstellende, sondern ein Vorzustellendes sey, kann ich durch keinen Gegenstand lernen; vielmehr siebt es nur unter Voraussetzung, jenes Gesetzes erst überhaupt einen Gegenstand).
§ 3. Dritter, seiner Form nach bedingter Grundsatz.
Er wird der Form nach bestimmt, und ist bloss dem Gehalte nach unbedingt – heisst: die Aufgabe für die Handlung, die durch ihn aufgestellt wird, ist bestimmt durch die vorhergehenden zwei Sätze gegeben, nicht aber die Lösung derselben. Die letztere geschieht unbedingt und schlechthin durch einen Machtspruch der Vernunft.
Wir heben demnach mit einer Deduction an, und gehen mit ihr, so weit wir können. Die Unmöglichkeit sie fortzusetzen wird uns ohne Zweifel zeigen, wo wir sie abzubrechen, und uns auf jenen unbedingten Machtspruch der Vernunft, der sich aus der Aufgabe ergeben wird, zu berufen haben.
A.
1) Insofern das Nicht-Ich gesetzt ist, ist das Ich nicht gesetzt; denn durch das Nicht-Ich wird das Ich völlig aufgehoben.
Nun ist das Nicht-Ich im Ich gesetzt: denn es ist entgegengesetzte aber alles Entgegensetzen setzt die Identität des Ich, in welchem gesetzt, und dem gesetzten entgegengesetzt wird, voraus.
Mithin ist das Ich im Ich nicht gesetzt, insofern das Nicht-Ich darin gesetzt ist.
2) Aber das Nicht-Ich kann nur insofern gesetzt werden, inwiefern im Ich (in dem identischen Bewusstseyn) ein Ich gesetzt ist, dem es entgegengesetzt werden kann.
Nun soll das Nicht-Ich im identischen Bewusstseyn gesetzt werden.
Mithin muss in demselben, insofern das Nicht – Ich gesetzt seyn soll, auch das Ich gesetzt seyn.
3) Beide Schlussfolgen sind sich entgegengesetzt: beide sind aus dem zweiten Grundsatze durch eine Analyse entwickelt, und mithin liegen beide in ihm. Also ist der zweite Grundsatz sich selbst entgegengesetzt, und hebt sich selbst auf.
4) Aber er hebt sich selbst nur insofern auf, inwiefern das gesetzte durch das entgegengesetzte aufgehoben wird, mithin, inwiefern er selbst Gültigkeit hat. Nun soll er durch sich selbst aufgehoben seyn, und keine Gültigkeit haben.
Mithin hebt er sich nicht auf.
Der zweite Grundsatz hebt sich auf; und er hebt sich auch nicht auf.
5) Wenn es sich mit dem zweiten Grundsatze so verhält, so verhält es sich auch mit dem ersten nicht anders Er hebt sich selbst auf, und hebt sich auch nicht auf Denn
Nun soll der zweite Grundsatz im Ich gesetzt seyn, und auch nicht im Ich gesetzt seyn.
B.