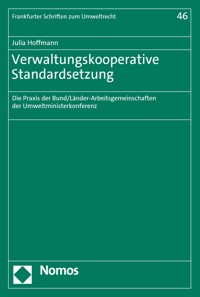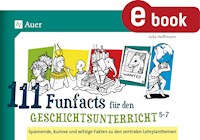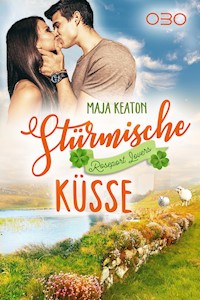Grundlegende Funktionen der Arbeit für den Menschen in der heutigen Arbeitsgesellschaft E-Book
Julia Hoffmann
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Soziologie - Arbeit, Ausbildung, Organisation, Note: 1,3, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin, Veranstaltung: Wirtschaft - Soziologie, Sprache: Deutsch, Abstract: „Arbeit gibt uns mehr als den Lebensunterhalt: sie gibt uns das Leben.“ 1 Henry Ford Bereits in diesem Zitat von Ford erkennt man die Relevanz der Thematik „Funktionen der Arbeit“. Arbeit hat den Menschen schon immer beschäftigt. Doch gibt die Arbeit uns wirklich mehr als den Lebensunterhalt und wenn dem so ist, was sind die Aspekte, die durch die Arbeit generiert werden? Braucht der Mensch die Arbeit, um zu leben, wie Ford sagt, oder ist die Arbeit eher ein lästiges, aber notwendiges Übel? Um diese Fragen beantworten zu können, werde ich mich im Folgenden mit der Sicht der wohl bekanntesten Soziologin auf diesem Gebiet, Marie Jahoda, und ihrer Auffassung über die Funktionen der Erwerbsarbeit kritisch auseinandersetzen. Auch wenn ihre Untersuchungen auf den Daten der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts basieren, haben ihre Erkenntnisse bis zur heutigen Zeit an Aktualität nichts eingebüßt, was man anhand der Auseinandersetzung mit der Thematik verschiedener Soziologen erkennen kann. Ihre Studie bildet das Fundament für die Analyse der Funktionen von Arbeit und man findet keine Literatur im Rahmen dieser Thematik, in der Jahoda nicht herangezogen wird. Zwar gibt es Kritikansätze, allerdings hat niemand die Funktionen Jahodas vollständig negiert und gänzlich neue Funktionen aufgestellt. Als Grundlage für diese Auseinandersetzung mit den Funktionen von Arbeit bedarf es einer Definition der Arbeit und der Unterscheidung zwischen Arbeit und Erwerbsarbeit. Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem Aspekt der Erwerbsarbeit. Die Auseinandersetzung mit der Erwerbslosigkeit dient dazu, Rückschlüsse auf die Funktionen der Erwerbstätigkeit zu ziehen, indem ich mich mit den Auswirkungen, die es hat, wenn keine Erwerbsarbeit vorhanden ist, beschäftige. In diesem Zusammenhang wird es auch Aufgabe sein, Alternativen zur Erwerbsarbeit zu prüfen und zu untersuchen, ob diese die zuvor ermittelten Funktionen der Erwerbsarbeit ersetzen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Page 2
Page 4
III.3 DER EINFLUSSDER GESELLSCHAFTLICH ERWARTETENERWERBSBIOGRAPHIEAUF DASLEBENDESMENSCHEN 58
III.4 DAS BILDDESERWERBSLOSENIN DERGESELLSCHAFT -EIN„SOZIALERSCHMAROTZER“? 61
III.5 ALTERNATIVENZURERWERBSARBEIT 66
III.5.1 Bereiche der Schattenwirtschaft: Darstellung und Statistik 67
III.5.2 Schwarzarbeit-ein Ausweg? 73III.6 FAZIT 77
IV. SCHLUSSBETRACHTUNG 82 V. QUELLEN 88 VI. ANHANG 93
Page 5
I. Einleitung
I.1 Einleitung
„Arbeit gibt uns mehr als den Lebensunterhalt: sie gibt uns das Leben.“1Henry Ford
Bereits in diesem Zitat von Ford erkennt man die Relevanz der Thematik „Funktionen der Arbeit“. Arbeit hat denMenschen schon immer beschäftigt. Doch gibt die Arbeit uns wirklich mehr als den Lebensunterhalt und wenn dem so ist, was sind die Aspekte, die durch die Arbeit generiert werden? Braucht der Mensch die Arbeit, um zu leben, wie Ford sagt, oder ist die Arbeit eher ein lästiges, aber notwendiges Übel?
Um diese Fragen beantworten zu können, werde ich mich im Folgenden mit der Sicht der wohl bekanntesten Soziologin auf diesem Gebiet, Marie Jahoda, und ihrer Auffassung über die Funktionen der Erwerbsarbeit kritisch auseinandersetzen. Auch wenn ihre Untersuchungen auf den Daten der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts basieren, haben ihre Erkenntnisse bis zur heutigen Zeit an Aktualität nichts eingebüßt, was man anhand der Auseinandersetzung mit der Thematik verschiedener Soziologen erkennen kann. Ihre Studie bildet das Fundament für die Analyse der Funktionen von Arbeit und man findet keine Literatur im Rahmen dieser Thematik, in der Jahoda nicht herangezogen wird. Zwar gibt es Kritikansätze, allerdings hat niemand die Funktionen Jahodas vollständig negiert und gänzlich neue Funktionen aufgestellt.
Als Grundlage für diese Auseinandersetzung mit den Funktionen von Arbeit bedarf es einer Definition der Arbeit und der Unterscheidung zwischen Arbeit und Erwerbsarbeit. Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem Aspekt der Erwerbsarbeit. Die Auseinandersetzung mit der Erwerbslosigkeit dient dazu, Rückschlüsse auf die Funktionen der Erwerbstätigkeit zu ziehen, indem ich mich mit den Auswirkungen, die es hat, wenn keine Erwerbsarbeit vorhanden ist, beschäftige. In diesem Zusammenhang wird es auch Aufgabe sein, Alternativen zur Erwerbsarbeit zu prüfen und zu untersuchen, ob diese die zuvor ermittelten Funktionen der Erwerbsarbeit ersetzen können.
1Ford, H., Online verfügbar: http://kalender-365.de/sms-sprueche/arbeit.php
Page 6
I.2 Definition: Arbeit und Erwerbstätigkeit
Voraussetzung für die Erläuterung der grundlegenden Funktionen der Arbeit für den Menschen ist eine Klärung des Begriffs Arbeit. Der Begriff der Arbeit ist in den letzten Jahrzehnten viel und kontrovers diskutiert worden. Es gibt unzählige Meinungen, Studien und Ansätze in Bezug auf die Arbeit an sich, ihren Sinn und ihre Folgen. Die beiden extremen Ansätze bezüglich der Arbeit lauten auf der einen Seite, der Mensch könne ohne den Faktor Arbeit nicht überleben, und auf der anderen Seite, der Mensch müsse von der Arbeit befreit werden, da diese unmenschlich sei. So zahlreich die Meinungen zu den Funktionen und Auswirkungen der Arbeit sind, so unterschiedlich sind auch die Definitionen, die in diesem Rahmen gegeben werden.
Was ist eigentlich Arbeit und wie kann man Arbeit von der häufig in der Literatur genannten Erwerbsarbeit2unterscheiden?
Betrachtet man die soziologische Definition von Arbeit, wird deutlich, weswegendie Thematik „Arbeit“ als eine grundlegende betrachtet wird. Viele Soziologen beschreiben Arbeit als Merkmal, das den Menschen vom Tier abgrenzt: „Men-schenarbeiten, Tiere arbeitennicht.“3Bereits an dieser Stelle werden erste Stimmen laut, die diese Verallgemeinerung als unzutreffend bezeichnen. Mikl-Horke stellt beispielsweise heraus, dass bestimmte Tiere für ihren Fleiß in Bezug auf die Arbeit bekannt sind, so z.B. Bienen. Dieser Einwand erscheint in Anbetracht des Beispiels als durchaus angebracht. So kommt Mikl-Horke zu dem Schluss, dass die Unterscheidung konkretisiert werden muss. Menschliche Arbeit sei demnach„geplant“, „rational“ und „nicht-instinktgeleitet“4.
2Die Relevanz der Thematik kann man auch anhand der Statistiken zu den Erwerbspersonen und der Arbeitslosenquote sehen (siehe hierfür Anhang), an denen man die hohe Zahl der Erwerbslosen erkennen kann. Zwar scheint die Arbeitslosenquote zu sinken, doch ergibt sich bei der Arbeitslosenquote die Problematik der Manipulierbarkeit. Man kann sehen, dass diese je nach Definition der Arbeitslosenzahlen und der Erwerbspersonen stark differiert (vgl. Pickartz, E. (2009), Warum eigentlich gibt es so viele verschiedene Arbeitslosenquoten für Deutschland?, in: Wirtschaftswoche (2009), Hrsg., Überarbeitet von Losse, B. (2009), S.35 (12.1.2009)). Eine genaue Auseinandersetzung mit dieser Problematik ist aber im Rahmen dieser Arbeit für das Verständnis nicht notwendig.
3Mikl-Horke, G., Industrie- und Arbeitssoziologie, 5. Auflage, München, 2000, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, S.1
4Ebd.
Page 7
Löst man sich von dieser Betrachtungsweise und beleuchtet das philosophische„Weise des Seins des Menschen in der Welt“5. Diese Aussage drückt die Bedeutung der Arbeit für den Menschen aus. In dieser verwirklicht der Mensch sichselbst und „verewigt“ sich im besten Fall in Form der Dinge, die er durch die Ar-beitschafft und die Endlichkeit des Menschen als solches wird in gewisser Weise entschärft, denn der Mensch kann etwas von sich selbst hinterlassen. Dabei kann es sich im geringen Sinne beispielsweise um die Vererbung des Hab und Guts an die Hinterbliebenen oder im größeren wie etwa bei einer physikalischen Erfindung handeln, die den Namen der Person in die Zukunft trägt und somit zumin-desteinen Teil des Menschen in Form einer Erinnerung „unsterblich“ macht. Da-mitwird die Vergänglichkeit des Individuums partiell ausgehoben. Der zweite Punkt neben der eben genannten„Sinnschaffung“ ist das Verständnisdes Individuums als Subjekt.6Das Individuum vollzieht nach Mikl-Horke eine
Bewusstseinsbildung durch die Arbeit am Objekt, denn durch diese nimmt sich das Individuum als Subjekt wahr.7Auch diese Aussage stellt eine These dar und sollte kritisch betrachtet werden. Diese Behauptung würde nämlich im Extremfall bedeuten, dass ohne die Arbeit am Objekt kein bzw. nur ein sehr schlechtes Bewusstsein entstehen kann. Speziell in der heutigen Zeit ist nicht jedes Individuum mit einer Tätigkeit an einem Objekt beschäftigt. Daraus ergibt sich die Frage, ob es aus diesem Grund in Bezug auf die Objekt-Subjekt-Beziehung schlechter ge-stelltist? In Zeiten der Dienstleistungen wird ein „Handwerk“ im eigentlichenSinne nicht mehr allzuhäufig „ausgelebt“. Die direkte Arbeit an einem Objekt istnicht immer für jedes Subjekt durch den Beruf oder auch im privaten Bereich gegeben. Aber auch der Begriff des Objekts bietet die Möglichkeit zahlreicher Interpretationen. Ein Objekt kann z.B. ein Schuh sein, der vom Schuster direkt bearbeitet wird und das innerhalb seines Berufs. Aber auch fast jede Tätigkeit im Haushalt, wie beispielsweise das Kochen stellt eine Arbeit am Objekt dar, hängt aber nicht unbedingt mit dem Beruf zusammen, so dass eine Arbeit an einem Objekt auch unabhängig von dem Beruf wahrscheinlich von jedem Menschen ausgeführt werden kann. Dies gibt nach Mikl-Horkes Definition jedem Menschen die Möglichkeit ein Selbstbewusstsein aufzubauen-dem einen, wenn er viele Möglichkeiten zur Tätigkeit am Objekt zur Verfügung gestellt bekommt, demzufolge
5Ebd.
6Tatschmurat, C. (1980), Arbeit und Identität, Zum Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen und weiblicher Identitätsfindung, Frankfurt/Main, 1980, Campus Verlag GmbH, S.52
7Mikl-Horke, a.a.O., S.1
Page 8
mehr, dem anderen, dem nur wenige solcher Tätigkeiten ermöglicht werden, weniger.
Betrachtet man den marxistischen Ansatz bzgl. der Arbeit fällt auf, dass diese Artder „Vermenschlichung“ bereits Marx bemerkt hat. Er schreibt: „in der Arbeit verwirklicht sich der Mensch“8. Gemeint ist hiermit, ähnlich wie beschrieben, dass das entstehende Produkt der Tätigkeiten dem Menschen sein eigenes Wesenals bearbeitendes Individuum näherbringt. „Durch dieVergegenständlichung in einem Produkt werden Menschen sich zugleich ihrer Menschlichkeit, ihrer men-schlichenFähigkeit bewusst.“9Der Mensch macht sich natürliche Stoffe untertan, für sich nutzbar. Dies ist heute keine generell zutreffende These mehr, denn nicht jeder produzierende Mensch besitzt auch die Möglichkeit sein Produkt zu behalten bzw. zu nutzen. Zumeist erarbeitet man in der heutigen Zeit die Dinge für eine andere Person, wodurch zwar auf der einen Seite die menschlichen Fähigkeiten nach wie vor deutlich werden, auf der anderen aber die Nutzbarkeit Einschrän-kungenerfährt. Interessant in diesem Zusammenhang wird Marx’ Aussage: „[…]Die Vergegenständlichung erscheint so sehr als Verlust des Gegenstands, dass der Arbeiter der notwendigsten Gegenstände, nicht nur des Lebens, sondern auch derArbeitsgegenstände beraubt ist …“.10Hiermit meint Marx die Entfremdung von Produkt, Arbeitgegenstand und Arbeit an sich.
Löst man sich ein wenig von dem zuvor behandelten sehr philosophischen Zugriff auf das Thema Arbeit und betrachtet Arbeit aus einer anderen Perspektive, erscheint das dreigliedrige Model von Wacker überzeugend. Wacker geht von drei Dimensionen der Arbeit aus: Als erste Dimension nennt er die sofort nachvoll-ziehbareFunktion der „Daseinsvorsorge“11. Die zweite stellt für ihn die Schaffung eines sozialen Zusammenhangs dar-der Austausch mit anderen. Die dritte Funktion bezieht sich auf das Individuum selbst. Hier geht es ähnlich wie in der philosophischen Ansicht um die Entwicklung persönlicher Anlagen und des eigenen Wesens.12
In all diesen Meinungen kristallisiert sich heraus, dass Arbeit eine wichtige Rolle im Leben eines Menschen spielt und nicht unwesentlich an der Formung desselben beteiligt ist. Aber auch hier gibt es gegenteilige Meinungen. Deren Vertreter
8Nach Fetscher, I. (1984), Entfremdung und Partizipation, in: Niess, F. (1984), Hrsg., Leben wir, um zu arbeiten? Die Arbeitswelt im Umbruch, Köln, 1984, Bund-Verlag GmbH, S.46
9Ebd.
10Nach Ebd.
11Nach Mikl-Horke, a.a.O., S.2
12Vgl. Ebd.
Page 9
sehen Arbeit lediglich als Mittel zum Zweck. Vergleicht man diesen Ansatz mitdem Model von Wacker, so hätte Arbeit lediglich die Funktion „Daseinsvorsorge“ und „Sicherung des Überlebens“ zu sein. Demnach hätte Arbeit keinen Sinn fürdieIdentitätsbildung, sondern wäre ausschließlich als „Folge der modernen Industrie“ zu einer Grundlage geformt worden.13
Auch Jahoda beschäftigt sich mit der Rolle der Arbeit in Bezug auf die Identität. Dieser Punkt wird im Folgenden noch ausführlich dargestellt werden, wenn es um die von ihr aufgestellten Funktionen der Erwerbsarbeit geht. Jahoda unterscheidet Arbeit von Erwerbsarbeit, was im Folgenden allerdings Synonym verwendet wird. Es ist jedoch stets die Erwerbsarbeit gemeint. Auch bei vielen anderen Soziologen finden wir diese Differenzierung wieder. Die Unterscheidung zwischen Arbeit und Erwerbsarbeit liegt nach Atteslander beispielsweise in der Veränderung und Erschaffung neuer Technologien. Erst hierdurch kam es in der Vergangenheit nach Atteslander zu einer Arbeitsteilung, die die Erwerbsarbeit als eigenständige Arbeitsform hervorbrachte.14
In der Soziologie wird der Arbeitsbegriff z.B. von Dubin ähnlich verstanden wie in der später genauer erläuterten Sichtweise Jahodas. Auch bei ihm geht es um den Begriff der Arbeit als Erwerbsarbeit in Hinblick auf die Ausübung eines Be-rufs,d.h. „private Arbeit“ wird ausgeschlossen. Ähnlich definiert auch AndreGorz die Arbeit und impliziert, dass Arbeit für einen Dritten im Austausch von Lohn ausgeübt wird. Die Arbeit wird nach dieser Definition nicht für einen selbst ausgeführt, sondern im Auftrag eines anderen, der daraus einen Nutzen zieht.15Ob dies in selbstständiger bzw. selbstbestimmter Form oder in abhängiger bzw. fremdbestimmter Beschäftigung stattfindet, spielt nach Kronauer nicht unbedingt eine Rolle. Vielmehr ist es wichtig, dass es sich bei Erwerbsarbeit um Arbeit gegen Bezahlung handelt und damit eine direkte Abgrenzung zu allem erfährt, das um seiner selbst willen durchgeführt wird. Arbeit verfolgt einen Zweck. Auch hier wird festgehalten, dass die Erwerbsarbeit über den privaten Bereich hinausgeht. Mit Hilfe dieser werden Produkte erschaffen, die zumindest theoretisch von jedem erstanden werden können, sofern ihm die Mittel dafür zur Verfügung stehen.16
13Nach Mikl-Horke, a.a.O., S.2 f.
14Vgl. Atteslander, P., Von der Arbeits- zur Tätigkeitsgesellschaft, in: Niess, F. (1984), Hrsg., Leben wir, um zu arbeiten? Die Arbeitswelt im Umbruch, Köln, 1984, Bund-Verlag GmbH, S.125
15Vgl. Mikl-Horke, a.a.O., S.6 f.
16Vgl. Kronauer, M. u.a., Im Schatten der Arbeitsgesellschaft. Arbeitslose und die Dynamik sozialer Ausgrenzung, Frankfurt/Main, 1993, Campus Verlag GmbH, S. 26 und S. 37
Page 10
Betrachtet man nun nicht die Möglichkeit des Erstehens von Produkten, sondern die des Erschaffens, findet man folgende interessante Definition der Arbeit. Einige moderne Ökonomen sehen alle Tätigkeiten als Arbeit, bei denen für eine bestimmte Tätigkeit jede Person mit ähnlicher Qualifikation eingesetzt werden kann. Hierbei gilt, dass das Ergebnis unabhängig von der ausführenden Person ist und identisch bleibt. Dies bedeutet, dass alle Tätigkeiten aus der Definition ausgeschlossen werden, bei denen eine Veränderung des Ergebnisses stattfindet, sofern eine andere Person diese ausführt, so z.B. bei künstlerischen Aktivitäten. An dieser Stelle wird keine Unterscheidung zwischen Erwerbsarbeit und Arbeit als solcher getroffen, wie Jahoda und andere es tun.17Der Aspekt der Erwerbsarbeit, wie Jahoda sie begreift, wird im Folgenden näher erläutert.Generell formuliert, begreift die Soziologie Arbeit als „Beziehung zwischen Menschen und ihren Einstellungen und ihrem Handeln“18In unserer modernen Industriegesellschaft, wie Mikl-Horke schreibt, wird Arbeit durch die Menschen, die Organisationen und die Form der Gesellschaft bestimmt.19Innerhalb einer Arbeiterschaft, die als eigenes soziales Gefüge gesehen werden muss, grenzt sich der einzelne Arbeiter vom Rest der Gesellschaft bzw. anderen Gruppen ab.20Dies geschieht nicht bewusst, sondern ist ein automatischer Pro-zess.Die Gesellschaft wird in „Arbeiter“ und „Nicht-Arbeiter“ unterteilt. Das istdie erste Form der Gruppenbildung. Die zweite Form der Gruppenbildung erfolgt dann über die Art des ausgeübten Berufs. Somit bildet die Arbeiterschaft ein eigenes soziales Gefüge. Diese Einordnung determiniert den Menschen und gibt ihm gewisse Handlungsrichtungen durch an ihn gestellte Erwartungen vor. Der Arbeiter wird außerdem durch die Mitbewerber auf dem Arbeitsmarkt beeinflusst, die den einzelnen ggf. allein durch ihr Vorhandensein in eine bestimmte Richtung der Entwicklung leiten, genauso wie jeder Teilnehmer am Arbeitsmarkt Einfluss auf die anderen Individuen ausübt. Ist beispielsweise ein sehr starker Konkurrenzdruck vorhanden zwischen den Teilnehmern am Arbeitsmarkt, wird das Individuum sich anders verhalten, als wenn dieser Druck nicht vorhanden wäre. Somit prägt der Rest der Gesellschaft die Verhaltensweisen des Einzelnen. Der einzelne, der wiederum von außen betrachtet auch ein Teil des durch die Arbeit entstande-
17Jahoda,M. (1995), Wieviel Arbeit braucht der Mensch? Arbeit und Arbeitslosigkeit im 20. Jahrhundert, Reprint, Neu herausgegeben und eingeleitet von Dieter Frey, Weinheim, 1995, Psychologie Verlags Union, S.25 f.
18Vgl. Mikl-Horke, a.a.O., S.6
19Vgl. Ebd.
20Vgl. Mikl-Horke, a.a.O., S.7
Page 11
nen sozialen Gefüges darstellt, bildet mit dem „Rest der Arbeiterschaft“ wiederumeinen Einflussfaktor auf die anderen Menschen. Der Mensch, der eigentlich nur mit einer Person oder einer Firma einen Arbeitsvertrag abschließt, schließt indirekt einen viel stärker auf sein Leben Einfluss nehmenden Vertrag ab, denn er ordnet sich selbst in die Gesellschaft ein.
„Durch diese gesellschaftlich definierte, ökonomisch undgesetzlich institutionalisierte Arbeitsbeziehung [z.B. Arbeitsvertrag] wird die Arbeit aus dem Zusammenhang des Lebens des einzelnen und der Gemeinschaft hinaus verlagert und„vergesellschaftlicht“.“21Die Verknüpfungen innerhalb der Gesellschaft werden zu einem ausschlaggebenden Rahmen in Bezug auf die Arbeit, ihre Struktur und das Individuum.
Nach Mikl-Horkeist die Arbeit eine „von anderen Lebensbereichen getrennte und spezifisch definierte Dimension des öffentlichen Lebens der Gesellschaft“22und es gilt die Zusammenhänge und Einflüsse in Bezug auf den Menschen zu erkennen.
Abschließend kann man sagen, dass „das Denken über Arbeit […] Formen und Inhalte der Arbeit und die durch sie bestimmten sozialen Beziehungen […] sichim gesellschaftlich-kulturellenWandel [verändern]“23, so dass man nicht eindeutig formulieren und festlegen kann, was Arbeit genau impliziert. Außerdem wird die Definition der Arbeit durch die ständigen Veränderungen der Inhalte erschwert. Betrachtet man die letzten 50 Jahre, kann man erkennen, dass ein Wandel in Bezug auf die körperliche Belastung während der Arbeit stattgefunden hat, was z.B. durch die Verringerung von schwerer Industriearbeit mittels hoch technologisierter Maschinen vollzogen wurde. Ob dies eine generelle Verbesserung für den Menschen darstellt oder sich durch die eventuell und scheinbar stärker werdenden psychischen Belastungen, die oft in der Literatur erwähnt werden, wieder aufhebt oder gar verschlimmert, bleibt dahingestellt. Oft wird erwähnt, dass die Schere zwischen den ungelernten bzw. schlecht qualifizierten Arbeitskräften und den wenigen Personen mit gut bezahlten Arbeitsplätzen tendenziell weiter wird. Für diejenigen mit guter Qualifikation wird der Druck, diese noch auszuweiten durch die immer weitere Anhebung der Anforderungen in Bezug auf die erwarteten Qualifi-
21Ebd.
22Mikl-Horke, a.a.O., S.8
23Vgl. Mikl-Horke, a.a.O., S.4