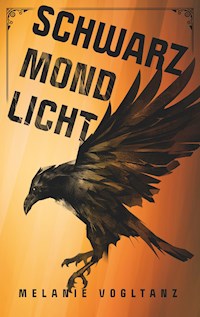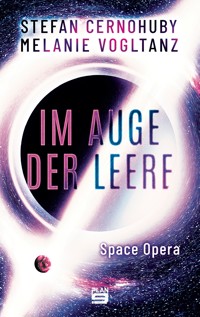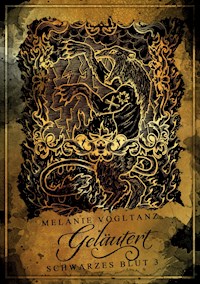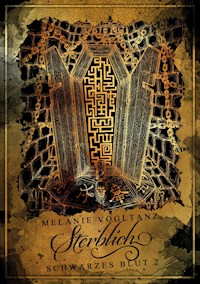Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Grusel Thriller
- Sprache: Deutsch
Können Sie Ihren Sinnen wirklich trauen? Seit seiner Kindheit erscheint Martin Riedmann eine hundsköpfige Gestalt, die außer ihm niemand sonst wahrnimmt. Sie spricht nicht, sie handelt nicht, doch auf jeden ihrer Besuche folgt eine Katastrophe. Unfälle ereignen sich, Menschen sterben. Ist die Erscheinung Warnung oder Verursacher? Fluch oder Segen? Oder haben die Menschen in Martins Umfeld recht? Ist das, was er sieht, nur das Ergebnis einer unbehandelten Psychose? Martin lernt, mit der ständigen Bedrohung zu leben, bis ihm klar wird, dass diese Erscheinungen einen Countdown darstellen. Und die Zeit läuft ab. Eine surrealistische Horrorerfahrung, in der nichts ist, wie es scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Melanie VogltanzDIE LETZTE ERSCHEINUNG
In dieser Reihe bisher erschienen:
3401 Jörg Kleudgen & Michael Knoke Batcave
3402 Ina Elbracht Der Todesengel
3403 Jörg Kleudgen & E. L. Brecht Der Fluch des blinden Königs
3404 Thomas Tippner Heimkehr
3405 Melanie Vogltanz Die letzte Erscheinung
Melanie Vogltanz
Die letzte Erscheinung
Ein Grusel-Thriller
Melanie Vogltanz hat ihren Magister in Deutscher Philologie, Anglistik und LehrerInnenbildung an der Universität Wien gemacht. Sie wurde 1992 in Wien geboren und hat den berühmt-berüchtigten Wiener Galgenhumor praktisch mit der Muttermilch aufgesogen. Dem klassischen Happy End sagt sie im Großteil ihrer Geschichten den Kampf an, denn auch das Leben endet selten gut.
2007 veröffentlichte sie ihr Romandebüt; weitere Veröffentlichungen im Bereich der Dunklen Phantastik folgten. 2016 wurde sie mit dem Encouragement Award der European Science Fiction Society ausgezeichnet. Ihr Roman Shape Me wurde für den Deutschen Science Fiction-Preis und den Kurd-Laßwitz-Preis nominiert.
Mehr Informationen auf: www.melanie-vogltanz.net
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Eric HantschTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: iStock.com/Hein NouwensSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-958-4Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
1. Kapitel
Ich war acht, als ich den Gmork zum ersten Mal sah. Sein Anblick überraschte mich nicht. Mein Blick streifte ihn, diese Gestalt in einem knittrigen, billigen Anzug, auf dessen Schultern nicht der Kopf eines Menschen, sondern das breite Haupt eines braunen Hundes unbestimmter Rasse thronte, die menschliche Hand wie zum Gruß erhoben, und ich zuckte nicht einmal zusammen.
Als ich einen Herzschlag später ein zweites Mal hinsah, genauer diesmal, war er nicht mehr da. Stattdessen stand dort eine Frau im biederen Hosenanzug, die mir den Rücken zugewandt hatte. Die Rückseite ihres Kopfes, ein Spiel von Licht und Schatten und meine überreizte Phantasie schienen den Gmork in meinem Geist heraufbeschworen zu haben. Es war nur eine Sinnestäuschung, wie man sie täglich Dutzende Male erlebt, wenn auch meist in kleinerem Ausmaß.
Ich tat die Erscheinung mit einem Schulterzucken ab und verschwendete keinen Gedanken mehr daran. Wahrscheinlich wäre mir dieses Aufblitzen des starrenden, hundsköpfigen Wesens zwischen den Schatten einer davonschleichenden Dämmerung nicht einmal im Gedächtnis geblieben, hätte nicht wenige Minuten später der Fahrer eines Busses meinem Leben eine klaffende Wunde geschlagen.
Als mir der Gmork zum ersten Mal erschien, starben sechs Menschen, darunter meine kleine Schwester Tina.
Es war halb acht Uhr morgens. Ich war auf dem Schulweg, Tina auf dem Weg zum Kindergarten. Ich sah – und ignorierte – den Gmork direkt vor unserem Wohnbau, kurz bevor wir zu meiner Mutter ins Auto stiegen.
„Los, los, macht schon, wir kommen zu spät!“ Meine Mutter scheuchte uns vor sich her wie brütende Hühner, die man von ihren Nestern vertreiben musste, um an ihre Eier zu gelangen. Nachdem sie uns die rückseitige Tür ihres VWs geöffnet hatte, setzte sie sich nach vorn ans Steuer, ohne zu kontrollieren, was wir auf der Rückbank taten.
Tina, pflichtbewusst und akribisch, wie sie all die kleinen Alltagsbewegungen ausführte, die man ihr beigebracht hatte, schnallte sich an. Ich nicht. Damals lamentierten Autos noch nicht, wenn sich Insassen nicht ausreichend sicherten. Als Erziehungsberechtigter musste man diese Aufgabe schon selbst erledigen, und normalerweise warf meine Mutter auch immer einen sichernden Blick nach hinten, um sich davon zu überzeugen, dass wir die Gurte angelegt hatten. Doch an diesem Morgen schien sie mit ihren Gedanken woanders zu sein. Erst Jahre später, an Tinas fünftem Todestag, würde ich zufällig bei einem hitzigen Gespräch meiner Eltern aufschnappen, dass sie und mein Vater sich die Nacht davor heftig gestritten hatten.
Meine Mutter setzte rücklings aus der Parklücke zurück, während Tina quengelnd nach dem Benjamin-Blümchen-Hörspiel verlangte, das seit Mai im Kassettendeck des Wagens steckte und sicherstellte, dass das jüngste Familienmitglied sich während der Fahrt friedlich verhielt. Ich glaube, meine Mutter und ich hassten das fröhliche Intro mittlerweile beide gleichermaßen, aber das Hörspiel war erheblich weniger lästig als eine Fünfjährige, die versucht, sich selbst zu unterhalten.
„Törö, törö!“, forderte Tina verstockt und schüttelte ihre kleinen Fäustchen.
„Jetzt nicht, Schatz. Wir fahren ja nur ein paar Minuten.“
„Törö!!!“
„Halt doch mal den Schlappen, du blöde Kuh!“, schrie ich sie an, da ich mir irrtümlicherweise erheblich reifer vorkam als Tina.
Das waren die letzten Worte, die ich je an meine Schwester richtete.
Als ich den Bus auf der Gegenfahrbahn im Innenspiegel auf uns zu trudeln sah, verlangsamte sich der Fluss der Zeit in meinem Empfinden. Ich hatte keine Angst. Ich war nur ein Kind – voller Vertrauen und Zuversicht, dass die Welt alles Unbill von mir fernhalten würde, denn wie sollte die Welt ohne mich weiterexistieren, wo ich doch ihr Mittelpunkt war?
Der Aufprall traf unseren Wagen am Heck und schleuderte ihn aus der Spur. Ich wurde ruckartig vorwärtskatapultiert. Meine Mutter und die Bremsen kreischten synchron, während ich in den Fußraum geschleudert wurde wie eine ungeliebte Puppe und auf mehreren zerquetschten Pappbechern und McDonalds-Tüten landete, die sich dort über die Jahre angesammelt hatten. Auch Tina setzte zu einem Schrei an, der jedoch abrupt abgewürgt wurde und in einem fast komischen Quieken endete. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob ich das trockene Knacken wie das Brechen eines Zweiges unter einem unvorsichtigen Wanderstiefel tatsächlich hörte oder ob es erst später durch wiederholte Albträume meinen Erinnerungen hinzugefügt wurde. So oder so ist es sehr real in meinem Kopf, und so oder so ist es grauenhaft.
Als das Auto endlich zum Stehen kam, kletterte ich mit schmerzenden Beinen und Schultern zurück auf meinen Sitz. Dabei traf mein Blick auf Tina. Das Bild, wie sie, nach vorne geneigt und schlaff, im Gurt hing, verfolgt mich bis heute.
Die Rettungskräfte sagten später, Tina wäre sofort tot gewesen. Durch das Fehlen eines Kindersitzes hatte der blockierende Sicherheitsgurt ihr, als sie so wie ich durch den Aufprall nach vorne gerissen wurde, das Genick gebrochen. „Sie hat nicht sehr gelitten“, versicherten sie. Als wäre das irgendein Trost. Sie war gottverdammte fünf Jahre alt!
Fünf Menschen in dem Unfallbus fanden ebenfalls den Tod. Das erste Opfer war der Busfahrer. Herzinfarkt. Der ziepende Schmerz in seinem linken Arm, den er laut Aussage seiner Frau seit dem frühen Morgen gespürt hatte, explodierte in seiner Brust, sorgte dafür, dass er nach Luft schnappte und sich in seinem Hemd verkrallte, als könnte er den Schmerz auf diese Weise aus seinem Körper ziehen. Sein Herzmuskel wurde wie von einer Stahlklammer zusammengepresst, seine Lippen färbten sich blau, und innerhalb von Sekunden kippte er vom Sitz. Der führerlose Bus geriet außer Kontrolle, driftete in die falsche Spur, rammte uns, drehte sich durch den Aufprall erneut und krachte dann in die Leitplanke. Zwei Fahrgäste starben, bevor die Rettung eintraf, nachdem sie sich die Schädel an den Seitenfenstern eingeschlagen hatten, einer erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und verstarb auf dem Weg ins Spital, der letzte, der durch die Wucht des abrupten Stopps nach vorn und durch die Frontscheibe geschleudert wurde, starb auf dem Operationstisch, während sie noch versuchten, seine zertrümmerten Knochen zu richten und ihm die zahlreichen Scherben aus dem Torso und dem Gesicht zu ziehen.
Woher ich das so genau weiß? Ich habe die Zeitungsartikel zu dem Unglück alle sorgfältig ausgeschnitten und aufbewahrt, in der Hoffnung, einen klaren Schuldigen ausfindig machen zu können, habe jedes noch so kleine Interview und jeden Bericht gelesen, der je über den Unfall veröffentlicht wurde.
Die Wahrheit ist: Niemand hatte Schuld. Nicht direkt. Der Fahrer war kein unverantwortlicher Bastard, hatte den Unfall weder durch Alkohol noch mangelnden Schlaf herbeigeführt. Er war einfach nur ein Mann mit Übergewicht, dessen einzige Verfehlung in einer ungesunden und cholesterinreichen Ernährung bestand. Er hatte nicht fahrlässig gehandelt – hatte nichts getan, das man vor Gericht hätte anprangern können, hätte er überlebt, um zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Auch meiner Mutter kann ich nicht die Schuld geben. Der gesetzlich vorgeschriebene Kindersitz für Tina hätte ihren Tod vielleicht verhindert, aber das wissen wir nicht sicher. Wir werden es niemals sicher wissen. Vielleicht hätte der Aufprall ihr Genick trotzdem geknickt wie ein Schilfrohr. Vielleicht hätte sie ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten und wäre ihr restliches Leben geistig oder körperlich behindert gewesen. Niemand weiß, was geschehen wäre.
Nein. Nach Jahren der Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen: Niemand hatte Schuld daran. Niemand – außer der Gmork.
Ich erzählte niemandem, was ich gesehen hatte. Nicht meinen Eltern und auch keinem meiner Freunde oder Lehrer. Ich denke, ich war damals auch noch gar nicht in der Lage, diese beiden Ereignisse in einen kausalen Zusammenhang zu setzen. Es hätte nichts weiter sein können als ein makabrer Zufall.
Auf Tinas Beerdigung war es mir unmöglich zu weinen. Eine der zahlreichen Tanten, die ich bis zu diesem Tag noch nie gesehen hatte, informierte mich darüber, dass sich das nicht gehörte – dass man weinen musste, wenn man jemanden verloren hatte, ganz besonders vor anderen Menschen, damit diese nicht dachten, der Verstorbene wäre einem gleichgültig gewesen. Sie schien sich hervorragend mit den Gedanken anderer auszukennen.
Sie gab mir das Gefühl, ein schlechter Bruder zu sein, weil ich nur in unserem nun so schmerzhaft leeren gemeinsamen Zimmer weinen konnte, und nicht vor all den schwarz gekleideten Fremden, die extra aus allen entfernten Ecken des Landes angereist waren, um mich und meine Eltern weinen zu sehen. Weil der leere Kassettenrekorder und die Hüllen der Kinderhörspiele die Erinnerungen an meine Schwester viel intensiver weckten als der kleine, weiße Kindersarg es konnte. Dieses Gefühl, ein schlechter Bruder zu sein, verstärkte sich, je mehr ich mit den Verwandten über den Unfall sprach. Unablässig wiederholten sie, welch Glück ich gehabt hätte, weil ich selbst so glimpflich davongekommen war, während Tina ...
„Da hat wohl ein Schutzengel seine Hand über dich gehalten“, sagte ein Onkel zu mir, der streng nach Medizin roch.
Danach fühlte ich mich schrecklich. Denn wieso hatte der Engel mich beschützt anstelle von Tina? Warum nicht uns beide?
Warum mich?
2. Kapitel
Als mir der Gmork zum zweiten Mal erschien, tötete ich einen Menschen und zwei Freundschaften.
Jahre waren vergangen. Ich hatte die unheimliche Gestalt mit dem starren Hundekopf mit den glasigen Augen fast wieder vergessen, so wie ich beinahe meine Schwester vergessen hatte, die von einem realen Menschen, mit dem ich ein Zimmer und eine Badewanne geteilt hatte, zu einem Foto auf der Fernsehanrichte und einem Trauerdatum im Kalender zusammenschrumpfte. Nur in meinen Albträumen besuchten mich beide regelmäßig, ließen mich schweißgebadet und mit tränenfeuchten Wangen und schweißnassen Laken aus dem Schlaf hochschrecken. Es war in diesen Träumen, in denen ich der Erscheinung mit dem Hundekopf einen Namen gab: der Gmork – wie der wölfische, unbarmherzige Verfolger von Atreju in der Unendlichen Geschichte, ein Fabelwesen, das mir als Kind solche Angst einjagte, dass ich aus dem Zimmer floh, sobald es auf dem Bildschirm erschien. Es war dieses Gefühl der widersinnigen, blinden Angst, der er seinen Namen verdankte, denn sein Aussehen glich in nichts dem Phantasiewesen von Michael Ende, abgesehen vielleicht von der Tatsache, dass beide Canidae waren.
Bei unserer zweiten Begegnung war ich schon fast erwachsen, zumindest fühlte ich mich damals so. Ich war sechzehn und ausgesprochen stolz auf meinen Bartwuchs, sodass ich gar nicht bemerkte, wie lachhaft mein spärliches Kinnbärtchen wirkte, das ich mit großer Hingabe pflegte. Noch hatte ich keinen Sex gehabt, war jedoch mit Mina Schneider verdammt nahe dran gewesen.
Mina Schneider ... Wenn ich diesen Namen höre, schmecke ich noch immer den fruchtigen Apfelkaugummi, den sie immer im Mund hatte, rieche ich noch immer ihr Waschmittel, dessen satter, sauberer Geruch nach einer intakten Familie auf meine eigene Secondhand-Kleidung abzufärben begann, wenn ich sie nur lange genug an mich gedrückt hielt. Mina Schneider, die als Erste in unserer Klasse mit einem Tamagotchi auftauchte, deren Kleider mit wohlklingenden Markennamen bedruckt waren und die über meine Witze lachte, wenn es sonst keiner tat.
An jenem denkwürdigen Abend kamen wir uns am Weihnachtsmarkt hinter einem Stand mit Schneekugeln näher. Wir tänzelten bereits seit drei Wochen schüchtern umeinander herum, was in Teenagerjahren einer Ewigkeit entspricht. Nachdem wir zwei Stunden lang über den stimmungsvoll beleuchteten Platz geschlendert waren, ließen wir uns auf einer abgelegenen Parkbank nieder. Sie lehnte sich an mich. Eine Weile verharrten wir so, dann schob ich meine Hände unter ihren daunengefütterten Parka und sie ließ es zu, wich auch dann nicht zurück, als ich mit meiner Zunge zögerlich ihre Lippen aufschob. Erst, als meine Hände unter ihren Pullover krochen, fest entschlossen, das Geheimnis ihres Büstenhalters zu lüften, schob sie mich weg.
„Deine Hände sind total kalt“, kicherte sie und versteckte sich rasch hinter ihrem Beerenpunsch.
Wie es sich für einen reifen, verantwortungsbewussten jungen Mann gehörte, bedrängte ich sie nicht weiter, sondern legte ihr lediglich einen Arm um die Schultern und wärmte sie, während wir in einvernehmlichem Schweigen unsere Punschtassen leerten. Ringsum dudelte Weihnachtsmusik, es duftete nach Bierteig aus der Fritteuse, gebrannten Mandeln und süßem, warmem Alkohol.
Als uns kalt wurde, verließen wir die Parkbank. An dem Stand, hinter dem wir gesessen hatten, entdeckte Mina eine Schneekugel mit einer Miniatur von Paris darin. „Sieh mal, ist die nicht hübsch?“
Der Standbetreiber nickte mir vielsagend zu. Ich schluckte ein wenig, als ich den ausgeschriebenen Preis sah, doch ich fasste mir ein Herz und holte mein Portemonnaie heraus. Obwohl die Schneekugel fast meine gesamten Ersparnisse aufzehrte und Mina sie sich problemlos selbst hätte leisten können, kaufte ich sie für sie, weil ich der Ansicht war, dass ein Gentleman so etwas tat. Das Strahlen in ihrem von der Kälte geröteten Gesicht entschädigte mich für den finanziellen Verlust.
„Danke, Martin!“ Sie drückte mir einen Kuss auf die Wange, nachdem ich meine nun deutlich schmalere Brieftasche wieder weggepackt hatte.
„Die ist so hübsch!“ Begeistert schüttelte sie die Kugel, während wir wieder in die Menge der Weihnachtsmarktbesucher eintauchten. „Sieh mal, die kleinen Lichter am Eiffelturm! Fast wie in echt.“
„Das ist kein Geschenk, es ist ein Versprechen. Eines Tages fahren wir gemeinsam dahin“, behauptete ich. „Ins richtige Paris.“
„Du bist so albern.“ Sie versetzte mir einen spielerischen Schlag gegen den Oberarm.
„Soll ich dich noch nach Hause begleiten?“
„Gern.“ Sie hängte sich bei mir ein, die Schneekugel mit dem bezuckerten Minieiffelturm in der freien Hand, und mein Herz schlug härter und schneller. Als eifriger Konsument amerikanischer Filme wusste ich, wofür nach Hause bringen das Codewort war.
Ob ich Mina Schneider geliebt habe? Ich kann es heute nicht mehr sagen. Ich nehme an, ich habe die Idee geliebt – den Gedanken an die Liebe. Ich glaube, dass es allen Jugendlichen so geht, die sich das erste Mal an einen Menschen binden. Deswegen lieben sie so intensiv und kompromisslos. Weil die erste Liebe immer der Liebe selbst gilt, diesem Ideal eines Gefühls, nie einer realen Person mit ihren Fehlern und Makeln.
Vor Minas Haus küssten wir uns ein weiteres Mal, und wieder waren es Filme, die mir verrieten, was nun folgen würde. Sie würde fragen: „Willst du noch mit reinkommen?“ Und ich würde verschämt nicken – bescheiden, aber bestimmt. Wir würden uns gegenseitig aus unseren zahlreichen Schichten von Winterkleidern schälen, und sie würden wie von selbst von unseren Körpern fallen, und dann ...
„Gute Nacht, Martin. Es war echt nett mit dir.“
In der nächsten Sekunde fand ich mich vor der geschlossenen Tür wieder – allein in der Kälte. Ich war so verdattert, dass ich so lange reglos im festgetrampelten Schnee stand, bis die Bewegungsmelderlampe auf der Terrasse erlosch und mich in eine Dunkelheit hüllte, die nur von den Lichterketten an den festlich geschmückten Fenstern ringsum durchbrochen wurde.
Noch bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr war ich der festen Überzeugung, an diesem Abend knapp am Verlust meiner Jungfräulichkeit vorbeigeschrammt zu sein.
„Lass sie zu dir kommen“, riet mir mein Kumpel Richard, als ich ihm am nächsten Tag von meiner Erkundungstour in Mina Schneiders Parka erzählte. „Wenn du willst, dass dich ein Mädel ranlässt, musst du dich rarmachen.“
Richard und ich waren bereits unser halbes Leben lang Freunde – seit er mir in der Grundschule bei einem Ballspiel im Hof versehentlich den linken Ringfinger gebrochen hatte. Er hatte damals ein so schlechtes Gewissen gehabt, dass er mir über mehrere Wochen hinweg einen nicht geringen Teil seines Spielzeugs geschenkt hatte. Die Taktik war erfolgreich – ich konnte niemandem lange zürnen, der mich mit Ninja-Turtle-Figuren eindeckte. Vor etwa zwei Jahren war der ehemals kleine, etwas dickliche Junge von einem Wachstumsschub in einen großen, schlaksigen jungen Mann verwandelt worden. Dennoch fiel es mir schwer, ihn anzusehen und nicht das ungeschickte, plumpe Kind in ihm zu sehen, mit dem ich nach der Schule stundenlang Mario Kart gezockt und Pausenbrote getauscht hatte. Seine altklugen Ratschläge in Liebesdingen änderten daran nichts.
„Seit wann bist du Experte auf dem Gebiet?“, gab ich ein wenig angesäuert zurück. „Als hättest du schon jemals einen weggesteckt.“
„Dutzende Male“, behauptete Richard.
„Ja? Mit wem?“
„Du kennst sie nicht.“
„Sag mir einen Namen.“
„Alter, ein Gentleman genießt und schweigt.“
„Klar, verstehe schon.“ Ich fasste nach seinem Arm, und wir rangelten kurz miteinander, als wären wir keine beinahe erwachsenen Teenager mehr, sondern wieder zwölf. „Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Richards Freundin“, sagte ich zu seiner rechten Hand, während ich seinen Arm unterm Ellbogen eingeklemmt hatte.
Richard riss sich los. „Du bist ein echtes Arschloch, Martin.“
Ich lachte nur.
Absurd, wie einem Hormone und Jugend das Gefühl geben, unsterblich zu sein.
Aus meiner Sicht fehlte mir damals nur noch eine einzige Sache, die mich vom endgültigen Eintritt ins Erwachsenenalter trennte: die Lizenz, ein Kraftfahrzeug zu lenken. Grenzenlose Unabhängigkeit! So verkaufte es uns die Werbung, und ich schluckte bereitwillig alles, was die Spots in Fernsehen und Radio zu bieten hatten.
Es war derselbe Winter, in dem meine Zunge Bekanntschaft mit der von Mina Schneider machte. Ich hatte bereits alle Fahrstunden absolviert und auch die Theorieprüfung bestanden, durfte jedoch ausschließlich in Begleitung eines Erwachsenen ans Steuer – eine Maßnahme, die ich für völlig überflüssig hielt, da ich bereits knapp die Hälfte der 3.000 zu fahrenden Kilometer unfallfrei hinter mich gebracht hatte, die ich vor meiner Praxisprüfung gefahren sein musste. Ich sah darin nichts anderes als lästige, schikanierende Bürokratie, ein letzter Schienbeintritt der Erwachsenenwelt, bevor ich endgültig in ihre erlauchten Kreise eingeführt wurde, und ich wollte einen Teufel tun und mich von solchen Nichtigkeiten ausbremsen lassen.
So kam es, dass ich in einer Samstagnacht abwartete, bis meine Eltern schliefen, und mich dann aus der Wohnung schlich. Ich wusste, dass Minas Eltern verreist waren, also hatte ich freies Feld. Mina selbst kündigte ich meinen Besuch nicht an. Ich hielt das für romantisch. Ich Vollidiot.
An den Autoschlüssel zu gelangen, war das geringste Problem. Mein Vater bewahrte ihn immer an derselben Stelle auf, an der er alle seine Schlüssel aufbewahrte: am Schlüsselbord im Flur. In dieser Hinsicht war er pedantisch, fast neurotisch. Meine Mutter war seit dem Unfall, der meiner Schwester das Genick gebrochen hatte, nie wieder gefahren. Vielleicht wirkt die Verbindung zwischen den beiden Vorfällen logisch, doch als ich mich in Vorfreude auf Mina Schneiders weichen Busen aus dem Gemeindebau schlich, lag mir kein Gedanke ferner als die starren toten Augen meiner Schwester, wie sie leblos und mit schiefem Hals neben mir im Gurt hing (törö).