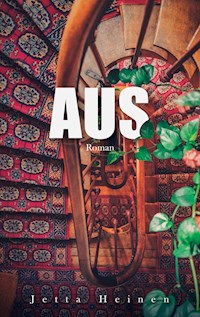Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was glaubst du, wie viele Menschen es da draußen gibt, die uns guttun und von denen wir nicht einmal wissen, dass es sie gibt? Über Prag wollte die junge Lehrerin Elise aus Berlin ursprünglich nicht nach Zürich, doch auf ihrer Zugfahrt lernt sie die Künstlerin Babette kennen. Nach einer Zugpanne hinter Dresden beschließen die beiden Frauen in der kalten Winternacht alleine weiterzuziehen und schon bald wird Elise klar, dass mit dieser Frau alles ein großes Abenteuer ist. Was sie nicht weiß, Babette trägt ein schmerzhaftes Geheimnis in sich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jetta Heinen, 1994 geboren, lebt in ihrer Heimatstadt Köln. GRÜSS GÖTTIN ist ihr Debütroman.
www.instagram.com/iam_jetta
www.jettaheinen.com
Für Rita, meine Babette Auf dass es da, wo Du bist, mindestens genauso schön ist wie an Deinem geliebten Gardasee. Wenn ich irgendwann nachkomme, habe ich ein Glas Nutella dabei. Wie früher. Versprochen.
Die auf den Seiten → und → frei übersetzten Liedzeilen sind dem Lied Time To Wonder von Fury in the Slaughterhouse entnommen.
Die auf der Seite → zitierten Liedzeilen sind dem Lied Im Schneckenhaus von Joris entnommen.
Was glaubst du, wie viele Menschen es da draußen gibt, die uns guttun und von denen wir nicht einmal wissen, dass es sie gibt?
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1.
Ein Abenteuer beginnt meist ziemlich unbequem. Das pflegte meine Oma Lotte zu sagen und dieses Abenteuer – das größte, das ich je erleben würde –, begann äußerst ziemlich unbequem.
Berlin war Atlantis, eine Stadt versunken im Schnee. Und ich suchte das Glück, wusste nicht, wo ich es finden sollte, ahnte, es nicht in Berlin finden zu können und stieg in einen großen braunen Zug, der seine Endhaltestelle in Zürich haben sollte. Ich drückte meinen Rucksack fest vor meine Brust und hoffte, das Richtige zu tun.
Der Zug war alt, aber majestätisch. Er spielte mit seinem mittelalterlichen Charme, ließ die Wände knarren, die Beleuchtung flackern und hin und wieder die Motoren aufheulen. Ich glaubte, er machte sich lustig über uns, über all die Menschen, die sich bei dieser Wetterlage aus dem Haus wagten, weil sie irgendetwas antrieb. Irgendetwas, das so stark war, dass es sie nicht in der Sicherheit hielt. Zugegebenermaßen hatte ich ein mulmiges Gefühl im Bauch, denn Berlin war für mich immer der sichere Hafen gewesen und der Ort, an dem ich glaubte, alles zu haben.
Nicht auf Anhieb fand ich einen Sitzplatz, stellte meinen Rucksack auf meine Knie und ließ ihn nicht los. Er war mein Schutzschild. Kein Krieger bricht in ein Abenteuer auf, ohne etwas zu haben, mit dem er sich zur Wehr setzen kann. Die Passagiere um mich herum lasen in dicken, abgegriffenen Büchern, kämpften mit dem Sportteil einer Zeitung oder tippten emsig auf die Tastatur ihres Laptops. Neben mir saß eine Frau, die hektisch Unterlagen sortierte und sich mit einem Kugelschreiber Notizen machte. Mir gegenüber saßen zwei junge Männer; der eine trug Kopfhörer und kaute laut auf seinem Kaugummi herum, der andere stierte schüchtern durch seine rahmenlose Brille. Ich beobachtete die ungleichen Erscheinungen eine Weile und erschrak, als der Typ mit den Kopfhörern seinen Kaugummi zerplatzen ließ. In der Vierersitzgruppe jenseits des Ganges saßen drei Frauen um die Dreißig, die ihrer Sprache nach aus Tschechien oder Polen kamen und die warme Wintermützen trugen.
Die Fensterscheiben des alten Zuges waren beschlagen, hin und wieder erkannte ich zuckende Lichter. Ich konzentrierte mich auf das Gespräch der drei Damen neben mir und verstand seltsam betonte Berliner Orte wie Reichstag, Brandenburger Tor, Hackescher Markt oder Fernsehturm. Eine der Dreien tippte, während sie sprach, auf ihrem riesengroßen Handy herum und nur wenn sie auflachte, löste sie den Blick von dem Bildschirm.
Dresden. Die beiden jungen Männer, die mir gegenübergesessen hatten, stiegen aus und ich erlaubte mir, meine Beine auszustrecken. Mir war kalt und ich war müde, es war kurz vor elf am Abend. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich die neuzugestiegenen Passagiere. Viele schirmten sich mit Kopfhörern von der Umwelt ab, viele Blicke trafen sich nur flüchtig.
„Grüß Göttin“, hörte ich plötzlich eine Stimme neben mir. Eine Frau hatte sich vor den Vierersitz gestellt, auf dem ich saß und zeigte auf den Platz mir gegenüber. „Ist hier noch frei?“ Sie strahlte in einer Intensität, die sie von den anderen Zugpassagieren völlig unterschied.
„Ja“, sagte ich freundlich.
Sie sah aus wie eine Katze. Zumindest ihre Augen waren katzenartig, oval, grau-grün und aufmerksam. Sie setzte sich mir gegenüber, lächelte mich mehrmals dankbar an und begann, sich die vereisten Schneeflocken aus den braunen Haaren zu ziehen. Sie legte ihren Rucksack auf den Fensterplatz und ich ertappte mich dabei, sie unentwegt anzustarren. Ich zwang mich, wegzusehen. Es war faszinierend, nein, sie war faszinierend. Ihre Ausstrahlung war einnehmend, ohne einzuschränken, einschüchternd, ohne zu distanzieren. Sie kam in diesen Zug um kurz vor elf und für eine winzige Sekunde blieb die Zeit stehen.
Nachdem der Zug losgefahren war, dauerte es ungefähr eine halbe Stunde, bis er langsamer wurde, zweimal stockte, als versuchte er zu bremsen, und dann nach weiteren zwanzig Minuten Schleichfahrt anhielt. Das Licht der dämmrigen Lampen an der Decke flackerte, ging aus und flackerte erneut geheimnisvoll. In dem Abteil begannen die Passagiere miteinander zu tuscheln, vereinzelt standen sie auf, um die Gänge hinunterzusehen. Irgendwo weiter entfernt schrie ein kleines Kind.
Die Katzenfrau legte ein braunes Buch auf ihren Schoß und sah sich amüsiert um. „Was ist das denn?“, fragte sie belustigt, wobei ihre Augen fröhlich funkelten. Sie sah mich an. Die Farben ihrer Augen waren unheimlich, mal grau, mal leuchtend grün.
„Geht bestimmt gleich weiter“, sagte ich und erwiderte ihr Lächeln.
„Ich hoffe, es geht gleich weiter. Ich habe wichtige Termine. Wir haben sowieso schon achtzehn Minuten Verspätung.“ Die Frau, die mit ihren Unterlagen neben mir saß, wischte genervt mit dem Ärmel ihrer Jacke über die Fensterscheibe, um nach draußen sehen zu können. Es war stockdunkel und mittlerweile kurz vor Mitternacht. Über ihre Schulter hinweg erkannte ich nur den leuchtenden Mondschein.
Für einen Augenblick bereute ich, hier zu sein. Hier und nicht zu Hause in meinem geliebten Berlin. Bei Mats. Ich ärgerte mich, dass ich so viel aufs Spiel setzte, um einem alten Traum zu folgen, den ich als junges Mädchen einmal geträumt hatte.
„Seit wann bist du im Zug?“, fragte mich die Katzenfrau und riss mich aus meinen Gedanken. Im ersten Moment war ich überrascht, dass sie mit mir sprach.
„Berlin“, sagte ich, lächelte und fragte mich, wie ein Mensch so grüne Augen haben konnte.
„Schöne Stadt. So laut, wild und bunt.“ Sie riss bei jedem Adjektiv, mit dem sie Berlin beschrieb, die Augen ein Stückchen weiter auf. „Ich habe für eine kurze Zeit selbst dort gelebt. Rosenthaler Platz, Torstraße. Magische Orte.“
„Friedrichshain“, sagte ich und merkte, dass sie mich musterte. Nicht auf diese kritische, skeptische Art, auf die man sich manchmal beobachtet fühlt, sondern auf eine liebenswürdige, liebevolle Weise. Für eine kurze Zeit schien sie in Gedanken zu schwelgen, aber dann fand sie ins Hier und Jetzt zurück und lächelte wieder ihr eigenes, ganz spezielles Katzenlächeln.
Ich merkte, wie ich mich für sie interessierte und dass ich mich fragte, wer diese Frau war. Diese Frau, die so ganz anders war, anders als diejenigen, die mir heute schon begegnet waren, anders als diejenigen, die mit mir in diesem Zug saßen. Sie hatte eine ganz besondere Art, die Menschen anzusehen. Als wäre das ihre einzige Aufgabe auf dieser Welt, Menschen anzusehen und ihnen – wenn auch nur für einen kurzen Augenblick – ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wer war diese Frau? Warum fuhr sie mit diesem Zug? Wo wollte sie hin?
„Ich werde mich bei der Deutschen Bahn beschweren. So geht das ja nicht!“, keifte die Frau, mit der sich die Katze und ich den Sitz teilten, in meine Gedanken.
Die Katzenfrau warf der hektischen Frau einen verständnisvollen und mir einen belustigten Blick zu. Ich fand sie sympathisch.
Mit einem Knacken eingeleitet sprach die Stimme des Zugführers durch kleine flache Lautsprecher, die über uns hingen, zu uns. „Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten den unverhofften Zwischenstopp vielmals zu entschuldigen. In wenigen Minuten erhalten wir Informationen aus dem Kontrollcenter der Deutschen Bahn und melden uns unverzüglich bei Ihnen, wann es weitergeht.“
„Das ist ja die Höhe! Wann es weitergeht? Ich habe wichtige Termine“, schrie die Frau neben mir in die Richtung der Lautsprecher.
Jetzt war ich es, die der Katze einen amüsierten Blick zuwarf, den sie belustigt erwiderte.
„Darf ich mal bitte vorbei?“ Mit ihren Unterlagen unter dem einen und ihrer Tasche unter dem anderen Arm erhob sich unsere Sitznachbarin. Als die Geschäftsfrau davongerauscht war, stellte ich meinen Rucksack auf den Platz, auf dem sie gesessen hatte.
„Wohin fährst du, wenn ich fragen darf?“ Die Katze hatte ihren Kopf leicht gesenkt und sah mich von unten nach oben an.
„Ich habe ein Vorstellungsgespräch in Zürich“, sagte ich freundlich. Ich freute mich, dass sie ein Gespräch mit mir beginnen wollte.
„Als was stellst du dich vor?“
„Lektorin“, antwortete ich.
Sie nickte interessiert und beobachtete mich kurz.
„Willst du auch in die Schweiz?“, fragte ich.
„Ja“, sagte sie ohne weiteren Erklärungen und ließ das Leuchten ihrer Augen für sich sprechen.
Kurz darauf knackte der Lautsprecher über uns ein zweites Mal: „Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte Sie nochmal um Ihre Aufmerksamkeit. Wir können die Weiterfahrt zum aktuellen Zeitpunkt nicht wieder aufnehmen. Techniker der Deutschen Bahn sind auf dem Weg zu uns.“ Es gab Gemurmel im Hintergrund. Der Sprecher räusperte sich. „Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und wir versprechen Ihnen, alles in unserer Machtstehende zu tun, damit wir bald weiterfahren können. Die Wetterbedingungen erschweren es uns, schnelle Hilfe zu erhalten. Wir melden uns mit weiteren Informationen.“
Die Stimmen der Passagiere im Abteil wurden lauter, erzürnter. Die Leute wollten ankommen. Ein Mann zog eine Zigarettenschachtel aus seiner Tasche, öffnete die Tür des Abteils und sprang die Stufen hinunter in den Schnee. Ein paar andere taten es ihm gleich.
„Frische Luft könnte ich jetzt auch gut vertragen“, sagte ich mehr zu mir selbst als zu der Katze. Ich beobachtete die Leute, die dem Mann nach draußen folgten.
„Wollen wir auch raus?“, fragte mich die Katze. Ich sah ihr an, dass sie dasselbe Bedürfnis nach kühler Luft hatte wie ich.
Wir packten unsere Rucksäcke und verließen den Zug. Auf dem Feld, auf dem der Zug gehalten hatte, standen mehrere Personen. Auch Männer und Frauen, die die Uniformen der Deutschen Bahn trugen, unterhielten sich und rauchten.
„Was für eine köstliche Sternennacht“, sagte die Katzenfrau, als wir die kühle Winterluft einatmeten.
Ich wusste nicht recht, was ich zu ihr sagen sollte. Es war nicht so, als hätte ich nicht gewusst, was ich sie hätte fragen sollen, aber ich fühlte mich auf eine merkwürdige Art und Weise von ihr berührt. Nach kurzer Zeit überwand ich mich: „Mein Freund, Mats, ist gegen diese Reise. Er ist mit seinem Job an Berlin gebunden und er hat Angst, dass ich gehe.“ Ich atmete tief die kalte Nachtluft ein und als ich ausatmete, bildete sich ein kleines Wölkchen, das sich schnell wieder auflöste.
„Weshalb ist es dir so wichtig, dich dort vorzustellen?“, fragte mich die Katzenfrau.
Ich zuckte mit den Achseln und fühlte mich seltsam, weil ich ihr diese Frage nicht gleich beantworten konnte. „Vielleicht, weil ich eine Herausforderung suche. Oder ein Abenteuer.“ Ich lachte über meine eigenen Worte.
„Ein Abenteuer“, sagte die Katzenfrau in einem ganz seltsamen Tonfall. Als ich zu ihr sah, sprühten ihre Augen Funken. Ich hatte noch nie eine solche Regung bei einem Menschen gesehen. Es war, als würde sie von innen heraus explodieren. „Abenteuer sind wunderbar. Abenteuer heißt auch immer wagen, verrückt sein. Wir könnten einfach losgehen. Nach da!“ Die Katze zeigte in eine Richtung, in der Bäume standen. Sie überlegte noch etwas hinzuzufügen, aber sie ließ es.
Ich schmunzelte leise und riss gleichzeitig erschrocken die Augen auf. Ihr Vorschlag war bescheuert und völlig absurd, aber er traf mich. Das war genau, wie ich immer sein wollte: Einfach los und mal sehen, was passiert. Solche Menschen hatte ich immer beneidet, ihre Leben hatte ich mir so aufregend vorgestellt. Aber das war nicht ich, Elise Rose.
Die Katze sah, dass sie mich damit packte, aber sie drehte sich zur Zugtüre um und deutete nach drinnen. „Ich glaube, sie verteilen Tee.“
Ich zögerte einen Moment, ich stand näher am Eingang als sie, also ergriff ich die Stange, an der ich mich auf die erste Stufe ziehen konnte. Doch plötzlich fasste sie meinen Arm.
„Wovor hast...“ Die Katze zögerte einen Augenblick, aber als sie weitersprach, klang sie entschlossen, die richtigen Worte gefunden zu haben. „Wovor hast du mehr Angst? Vor Sicherheit oder vor Freiheit?“
Ich ließ die Stange los als hätte mich ein elektrischer Schlag getroffen. Eine eiserne Faust bohrte sich in meinen Magen. Ich fühlte mich als müsste ich nach Luft schnappen, um nicht zu ersticken. Alles um mich herum schien sich in rasender Geschwindigkeit zu bewegen. Als wäre ich der Mittelpunkt der Welt und alles andere geriete außer Kontrolle.
Sie wusste, dass ich das nicht ohne weiteres und schon gar nicht, ohne darüber nachzudenken, beantworten konnte. Und sie wusste auch, dass ich mich bei dieser Frage nicht auf mein Bauchgefühl verlassen würde.
Wir standen unter einem glitzernden Sternenhimmel. Die Nacht war nicht zu kalt. Neben uns der eigentlich wunderschöne alte dunkelbraune, in der Dunkelheit fast schwarze Zug, einer von denen, die man heute nur noch selten sieht. Es war der perfekte Moment für ein Abenteuer.
Die Katze hielt mir ihre Hand hin. „Ich bin Babette“, flüsterte sie.
2.
Vom ersten Moment an war Mats gegen diese Reise gewesen – genau wie Paula, meine beste Freundin. Ich aber war nicht davon abzubringen.
Freitags kam der Brief. Ich war abgekämpft von einem anstrengenden Tag in der Schule, hatte mir beim Chinesen um die Ecke Mittagessen gekauft und leerte den Briefkasten. Ich warf vier Briefe und zwei Prospekte in den Korb mit der roten Schleife, in dem ich die Erörterungen der Klasse 7c zu Goethes Zauberlehrling gesammelt hatte und im Aufzug überflog ich die Briefe. Zwei waren an Mats Berger adressiert, zwei an mich. In einem der beiden Briefe vermutete ich meine Gehaltsabrechnung, den zweiten helleren Brief konnte ich nicht zuordnen. Er hatte ein kleines Eselsohr an der linken unteren Ecke und oben rechts klebten mehrere Briefmarken. Ich stieg aus dem Fahrstuhl, schloss die Wohnungstür auf und stellte Korb und Mittagessen auf dem Küchentisch ab.
Schweiz.
Für einen Schlag setzte mein Herz aus, um dann in doppelter Geschwindigkeit meinen Brustkorb zu sprengen. Ich schrieb dem Inhalt dieses Briefes die Bedeutung zu, mein Leben komplett verändern zu können. Behutsam, aber mit bebenden Fingern öffnete ich das Kuvert. Ein unangenehmes Ziehen breitete sich in meinem Bauch aus. Bevor ich den Brief wie eine Ziehharmonika auseinanderfaltete, atmete ich zweimal tief ein und aus. „Es ist nur Papier, Elise“, sagte ich zitternd zu mir.
Mit angehaltenem Atem zog ich den Brief auseinander. „Sehr geehrte Frau Rose, vielen Dank für Ihre Bewerbung in unserem Verlagshaus.“
Ich musste mich an einem der Küchenstühle festhalten, um nicht umzufallen.
„Wir würden Sie gerne persönlich kennenlernen und Sie aus diesem Grund am dritten März um 16 Uhr zu einem Vorstellungsgespräch einladen!“
Mit zitternden Händen fächerte ich mir Luft zu. „Ein Vorstellungsgespräch“, keuchte ich. Ich presste meine Zähne in meine linke Faust, um nicht loszuschreien. Ich las den obersten Satz einmal, zweimal, zehnmal. „Dritter März um 16 Uhr!“
Ich stürmte zum Kühlschrank, an dem ein Kalender und Mats’ Dienstplan hingen. „Aber das ist ja schon nächste Woche!“ Atemlos presste ich meinen Finger auf den ersten Donnerstag des kommenden Monats.
Auf dem Kalender waren die Tage von Montag bis Freitag farbig markiert, weil zu der Zeit die Projektwoche Lernen sattfinden würde. In meinem Kopf kreisten die Gedanken. Ich konnte in der Schule nicht blaumachen, aber ich wollte unbedingt in die Schweiz. Meine Hysterie flaute ab. Es war aussichtslos. Ich konnte den Termin nicht wahrnehmen. Wie denn auch? Selbst wenn ich in der Schule fehlen würde, wie sollte ich Mats beibringen, ein Vorstellungsgespräch in der Schweiz zu haben? Ich hatte ihm ja nicht einmal erzählt, dass ich mich dort beworben hatte, beziehungsweise dass ich das überhaupt vorhatte.
Ein paar Minuten lang saß ich regungslos am Küchentisch, dann zog ich die weiße Plastiktüte vom Chinesen zu mir heran und knotete sie auf. Das Essen war mittlerweile nur noch lauwarm. In einen Styroporbehälter hatte Tian, der Restaurantbesitzer, Reis, in einen anderen gebratene Ente und Gemüse und in einen dritten scharfe Soße gepackt. Ein bisschen Soße war in die Tüte getropft und unten hatte sich eine kleine Pfütze gebildet, in der ein Päckchen schwamm. Ich fischte es heraus und grinste. Ein Glückskeks.
Vorsichtig riss ich die Verpackungsfolie auf und zerbröselte den Keks. Ich faltete den kleinen Papierschnipsel auseinander und strich ihn auf der Tischplatte glatt. Auf der Seite, die mir zugewandt war, standen chinesische Schriftzeichen. Ich drehte den Zettel um: Es tun sich Dir neue Wege auf. Folge Deinem Herzen.
Ich war zu feige für ein richtiges Abenteuer und deshalb stiegen Babette und ich wieder ein. Als wir uns wieder auf unsere Plätze setzten, fühlte ich mich seltsam. Als hätte ich eine Chance verstreichen lassen. Es war mittlerweile halb eins, wir nippten an unseren Teebechern, um uns aufzuwärmen.
Babette sah blass aus, sie hatte ihren Kopf an die Lehne des Sitzes gelehnt und ihre Augen geschlossen. Dadurch, dass ihre Haut so blass war, leuchteten ihre roten Lippen. Ich nutzte die Gelegenheit, sie genauer anzusehen. Ihre Haare waren ein wenig lockig, ihre Wimpern lang. Sie trug eine dunkle Jacke, eine Jeans und feste Schuhe. Weil ihre Augen geschlossen waren, sah ich die Farbe ihrer Augen nicht, aber dennoch strahlte sie etwas Mysteriöses aus. Ich wollte immer mehr über diesen Menschen wissen, der mir da gegenüber saß, aber ich ließ sie schlafen.
Mit dieser Zugfahrt ließ ich alles, was beständig gewesen war, hinter mir. Meinen Job, meine Familie, meinen Freund. Ich versuchte nicht daran zu denken, wie Mats auf den Brief reagiert hatte, aber es ging nicht anders.
„Was ist das?“, hatte er Samstagmorgen gefragt, als ich in einer Zeitschrift blätterte und Kaffee trank. Er legte den Brief auf das Magazin.
Am Abend zuvor hatten wir uns heftig gestritten, weil er – mal wieder – spät aus der Klinik kam. Ich hatte ihm vorgeworfen, eine andere zu haben und mich zu betrügen, er hatte versucht, mich zu besänftigen. Seit Wochen glaubte ich, ihn zu verlieren, ob an eine andere Frau oder an seine Arbeit im Krankenhaus, ich war verzweifelt, ich wollte, dass er bemerkt, wie sehr ich unter seiner Abwesenheit litt. Es waren absurde Vorwürfe, die keine Grundlage hatten, ich sagte böse Dinge zu ihm.
„Wann wolltest du mit mir darüber reden?“, fragte er mit einem seltsamen Unterton in der Stimme und deutete auf den Brief.
Aus purer Verzweiflung entschied ich mich für einen Gegenangriff. „Wann denn? Du bist ja nie da.“
„Ich arbeite, Liz. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig es ist, sich einen guten Ruf aufzubauen. Die Konkurrenz...“ Er senkte den Blick, bevor er mich erschöpft ansah. „Man muss gut sein, Liz. Die Phase jetzt ist die allerwichtigste für mich. Ich mache das für uns, damit es uns gut geht.“
„Geht es mir mit meinem Beruf nicht gut?“ Ich spürte die Tränen, aber ich kämpfte gegen sie an. „Du fragst nie, wie es mir geht, Mats. NIE!“
„Das stimmt nicht, Liz,“
Ich wusste, dass es nicht stimmte, deswegen verschränkte ich wie ein trotziges Kind die Arme vor der Brust. Man kann sich lieben wie verrückt, aber manchmal reicht das nicht.
„Wie geht’s dir denn?“ Mats’ Stimme war leise.
Als ich schluckte, merkte ich, dass ein Kloß in meinem Hals steckte. „Ich bin total unzufrieden, wie es läuft. Ich bin 29, bin eine Lehrerin, die im System gefangen ist, bin weder verheiratet, noch Mutter. Meine Beziehung besteht immer nur aus warten!“ Ich verletzte ihn damit.
„Fällt dir was auf?“, fragte Mats. „Immer nur ich, ich, ich. Such’ die Fehler nicht immer bei den Anderen.“ Das schwebte einen Moment über uns. „Was ist mit deiner Schule? Und uns, wenn wir schon mal dabei sind?“ Er deutete wieder auf den Brief. „Wieso sprichst du so etwas Wichtiges nicht mit mir ab.“
„Du hättest es mir ausgeredet.“
„Stimmt, hätte ich.“
„Ich habe aber meine Gründe, weswegen ich mich da beworben habe.“
„Und die wären?“
„Eigenverantwortung zu übernehmen, zum Beispiel.“
Mats schüttelte den Kopf.
„Du hast gerade selbst gesagt, dass ich die Fehler nicht immer bei den Anderen suchen soll.“
Er verließ daraufhin die Wohnung, um den Kopf freizukriegen. Dass er nichts mehr dazu gesagt hatte, tat noch mehr weh, als hätte er mich in Grund und Boden geschrien.
Und jetzt? Ich saß in einem Zug, der genauso stillstand wie mein Leben. Ich war irgendwo zwischen Drinnen und Draußen. Irgendwo zwischen den Stühlen. Ich wusste nicht, wohin ich gehörte, was ich wollte. Ich war am Anfang, aber vielleicht war ich auch am Ende.
Während Babette schlief, dachte ich immer wieder daran, wie sie von einem Abenteuer gesprochen hatte. Wieso saß Babette mir gegenüber? Wieso nicht einer anderen Person? Sollte sie meine Prüfung sein?
Nach einer halben Stunde schlug Babette wieder die Augen auf und lächelte mich an. „Stehen wir immer noch?“, fragte sie, beantwortete sich die Frage aber selbst, in dem sie nach draußen schaute.
„Wovor hast du denn mehr Angst?“, fragte ich sie. Es war mir unangenehm, ihr ihre eigene Frage zu stellen. Es war schließlich ihre Frage, die sie an mich gerichtet hatte.
Babettes Augen erhielten einen besonderen Schein. „Im Leben gibt es nichts, wovor man sich fürchten müsste. Es ist das kostbarste Geschenk. Angst ist undankbar. Sie verzeiht nicht.“
Ich spürte, dass diese Frau ein besonderes Verhältnis zum Leben hatte. Dass sie es auf eine besondere Art liebte, mit unfassbarer Leidenschaft lebte. „Du würdest das machen, oder? Einfach raus und los?“ Sie hörte sicher, wie sehr sie mich faszinierte. Ich merkte, dass ich richtig aufgeregt war.
„Was hätte ich zu verlieren?“, lächelte sie.
„Dein Leben eventuell? Es ist arschkalt draußen und du hättest keinen Plan, wohin.“ Ich klang widerlich vernünftig.
Babette lachte. „Das verliere ich sowieso früher oder später.“
Touché.
„Du bist schon ein bisschen verrückt, oder?“, neckte ich sie liebevoll.
„Verrückt sein ist das Beste, was man sein kann.“