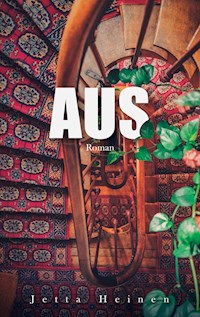4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paula, Marta, David, Rafa und Ben: fünf Freunde, die sich während ihrer Schulzeit kennengelernt haben. Ein tragischer Unfall reißt sie auseinander. Nach acht Jahren stehen Paula, Marta und David an Bens Grab. Ohne Rafa. In Bens Nachlass die Zeile: Ich wünschte, wir wären noch Freunde. "Ich wünschte, wir wären noch Freunde" ist eine Geschichte darüber, wie alte Freunde unser gegenwärtiges Leben prägen und wie es ist, sich nach einer Ewigkeit wiederzusehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jetta Heinen, 1994, lebt in ihrer Heimatstadt Köln. Ich wünschte, wir wären noch Freunde ist ihr zweiter Roman.
www.instagram.com/iam_jetta
www.jettaheinen.com
Für meine Freunde. Für die, die kommen. Für die, die gehen. Für die, die bleiben, vom Anfang bis zuletzt.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
2020 - Paula
2003
2020 - Marta
2003
2020 - David
2020
2020 - Paula
2020 - Rafa
2006
2020 - David
2003
2020 - Marta
2020 - Paula
2007
2020 - Rafa
2020 - David
2009
2020 - Paula
2020 - Rafa
2009
2020 - Marta
2020 - David
2020 - Rafa
2011
2020 - Marta
2020 - David
2010
2020 - Paula
2020 - David
2020 - Rafa
2020 - Marta
2020
Prolog
Freundschaft hebt dich in die Luft. Sie ist dein Flügel und dein Wind. Dein Segel auf der See. Sie ist manchmal leise und manchmal laut. Sie ist alt und jung, fest und lose, aber sie ist da.
Freundschaft ist Luft und Liebe. Sie ist Vertrauen und Geborgenheit. Sie ist auch das, was sie nicht zu sein vermag.
Sie ist tief und oberflächlich, unwirsch und klar, sie ist da. Freundschaft ist Liebe und Leben. Sie ist Ruhe und Glück. Sie ist das, was übrig bleibt. Sie ist oben und unten, rechts und links. Sie ist da.
2020 Paula
Totenstille.
Alles, was ich höre, ist mein eigener Atem, der mir wie ein Eindringling in dieser Kulisse vorkommt. Ich stehe auf dem Kiesweg, den Blick zwischen die Tannen gerichtet, die wie versteinerte Soldaten willkürlich platziert auf der Lichtung stehen. Mein Körper ist ebenso versteinert; vielleicht hat jemand einen Zauberspruch ausgesandt, der jede Bewegung erlischt. Selbst der Wind ist regungslos, selbst das Licht. Nur das Gras nicht, das rechts und links neben dem Kiesweg wächst. Es schreit, es scheint seine kleinen Finger nach mir auszustrecken und meine Knöchel umfassen zu wollen. Der Kies schützt mich nicht. Er ist lediglich ein stummer Beobachter in dieser Szene.
Von irgendwoher kommt ein Glockenläuten. Nicht von irgendwoher, von der kleinen Kapelle, die zwischen den Tannen steht. Meine Hände frieren, die Kälte frisst sich meine Unterarme hinauf, als hätte ich metertief in eisigem Schnee gegraben. Ich könnte einfach weglaufen, aber mir klebt Teer unter den Sohlen, Teer, der in den vergangenen Jahren immer mehr geworden ist, sodass ich jetzt nicht mehr gehen kann. Ich stand zu lange an diesem Fleck auf dem Kiesweg, jetzt ist er zwischen die Steine gelaufen und ich stehe hier für immer.
Zwischen den Tannen bewegen sich Menschen. Zahlreiche sind es, in Schwarz gekleidet. Männer und Frauen. Gesichtslos sind sie. Nur der Mann, der einen schwarzen langen Talar trägt, schaut in meine Richtung, ohne zu mir zu sehen. Er steht der Gruppe zugewandt, hält eine Bibel in der Hand. Ich hätte auch gerne irgendetwas in der Hand, an dem ich mich festhalten kann, auch wenn es nur ein Buch ist.
Plötzlich schubst mich der Teer unter meinen Sohlen nach vorne, ich stolpere zwei Schritte, dann bläst mich eine starke Böe von dem Weg. Ich trete ins Gras, schaue hinunter auf meine Füße und beeile mich wieder auf den Kiesweg zu kommen.
„Der Boden ist Lava.“ Bens Stimme in meinem Ohr. Ich schreie auf, ganz kurz nur, ganz leise. Niemand hört mich.
Langsam gehe ich auf die Tannen zu, die sich zur Seite zu schieben scheinen, die den Blick immer weiter freigeben auf dieses Loch im Boden, um das die Gruppe herumsteht. Um dieses tiefe, schwarze Loch, das von hier bis zum Erdkern führt.
Ich höre nicht, was der Pfarrer sagt. Ich stelle mich hinter einen großen Mann und kann an ihm vorbei auf den Grabstein sehen.
Ben Schüttler * 22. April 1990 † 10. Oktober 2020
Ich presse meine Lippen aufeinander, um meine Tränen zurückzuhalten. Als ginge das so einfach, als gäbe es einen Mechanismus, der verhindern kann, dass ich weine. Es funktioniert nicht. Die Tränen kriechen über meine Wangen bis zu meinem Kinn, absprungbereit. Ich versuche mich auf die Worte des Pfarrers zu konzentrieren, aber er bewegt nur seine Lippen. Mehr nicht. Es kommt kein einziger Ton aus seinem Mund. Mit einem Mal herrscht tosender Lärm in meinem Kopf, ganz so, als würde ich auf dem Randstreifen einer Autobahn stehen. Ich will mir die Ohren zuhalten, aber dann höre ich den Mann in seinem Talar noch weniger. Ich bin mir sicher, dass es wichtig ist; das, was er sagen will. Bestimmt ist es wichtig, denn in den Gesichtern, die ich jetzt doch erkennen kann, sehe ich dieselbe Regung; und Worte, die eine einzige Regung auslösen, müssen wichtig sein. Bedauern. Ich glaube, dass man das Gefühl so nennt. Bedauern oder Liebe.
Als hätte mich jemand mit einem Fingerzeig darauf hingewiesen, bemerke ich Blicke auf mir. Als ich den Kopf zur Seite drehe, sehe ich sie. Sie hat den Kopf gesenkt und doch sieht sie zu mir. Ihr Blick ist unergründlich, ihre dunklen Augen verraten mir, dass sie auf mich gewartet hat, dass sie es mir nicht verziehen hätte, wenn ich nicht gekommen wäre. Sie hat ihre dunklen, wilden Locken gezähmt, gebändigt mit einem dicken schwarzen Zopfgummi. Sie hat ihre Augen nicht geschminkt, vielleicht hat sie geweint. Sie sieht aus, als hätte sie hundert Jahre lang geschlafen. Oder als hätte sie hundert Jahre lang nicht geschlafen. Sicher bin ich mir nicht.
Schnell wende ich den Blick ab. Erst schaue ich auf meine Hände, dann auf den Boden, als müsste ich mich vergewissern, dass er mir nicht unter den Füßen weggezogen wurde. Ich wusste ja, dass sie kommt. Ich war mir fast sicher. Als ich wieder zu ihr blicke, erkenne ich ihn. Natürlich neben ihr. Er hat seine Haare raspelkurz. Ich hätte ihn fast nicht erkannt, weil er nicht lacht. David hat immer gelacht. Nur jetzt nicht. Er lächelt nicht einmal. Er sieht nicht zu mir. Er starrt auf das Loch. Das unendlich tiefe. Er trägt einen Anzug. Schwarz. Marta neben ihm einen schwarzen langen Mantel. Was sie darunter anhat, kann ich nicht erkennen. Bestimmt sind sie zusammen gekommen. Irgendwie wünsche ich es mir.
Die Frau links von mir drückt ihr Taschentuch an die Nase und schluchzt, ich habe das Gefühl, ich müsste es ihr gleichtun. Als sei das, was sie dort tut, ein Ausschnitt aus einer Choreographie, aus deren Takt ich nicht kommen darf. Marta hat kein Taschentuch in der Hand. David auch nicht. Vielleicht ist es nicht schlimm, wenn ich aus dem Rhythmus komme. Vielleicht gehöre ich auch nicht hinein. In den Takt.
2003
Montags in der ersten Stunde stand Mathe auf dem Stundenplan. Wahrscheinlich weil die Konzentration von Zwölfjährigen in der ersten Stunde noch am höchsten ist und der Lehrer so zumindest die Chance hat, etwas zu erklären, was eventuell verstanden wird. Erst seit Freitag gab es eine neue Sitzordnung, die Paula, Marta, David und Rafa auseinandergerissen hatte. Vorher hatten sie so gesessen, dass sie ihre Tische, wenn Gruppenarbeit angesagt war, aneinanderschieben konnten. Paula neben Marta, David neben Rafa. Jetzt saß Marta neben Gerrit, der ihr pausenlos in den Ausschnitt glotzte; David saß direkt vor dem Pult an einem Einzelplatz und Rafa ganz rechts an der Wand neben Max, mit dem er zusammen Fußball spielte. Diese Kombi hatte der Lehrer skeptisch beäugt, aber sich wohl dazu entschieden, abzuwarten, was die Zeit brachte. Paula saß genau in der Mitte der Klasse neben der dicken Anne, die immer nach Wurstbrot roch, weil ihr Vater Metzger war.
Es war ungefähr viertel nach acht, als es an der Tür zum Klassenzimmer klopfte, dann kam der Direktor herein. Ihm auf den Fersen ein Junge; er hatte ein Piercing in der Nase und seine Tasche locker über seine linke Schulter gehängt. Ihn schien es keineswegs zu beeindrucken, vor einer fremden Klasse zu stehen. Vielmehr warf er den Mitschülern einen abschätzigen Blick zu. Der Direktor stellte ihn als Ben Schüttler vor, er war hergezogen. Als er von hergezogen sprach, schien er sich unsicher über seine Wortwahl zu sein, aber Ben nickte nur lässig.
„Wo setzen wir dich denn hin?“, überlegte der Mathelehrer laut, als der Direktor das Klassenzimmer verlassen hatte. Er scannte die Sitzreihen und sein Blick blieb an der dicken Anne hängen. David in der ersten Reihe folgte seinem Blick und grinste Paula an, die so tat, als würde sie die Patrone in ihrem Füller wechseln. „Anne, setz du dich doch mal eine Reihe nach hinten“, schlug der Lehrer vor, dann berührte er den Neuen an der Schulter. „Setz dich neben unsere liebe Paula.“
Paula zuckte zusammen, als sie ihren Namen hörte. Anne neben ihr sortierte ihre Buntstifte in ihr Federmäppchen, klemmte sich ihre Hefte unter den wulstigen Arm und schnaufte zum hinteren Tisch. David grinste noch immer und sah Ben dabei zu, wie er durch den Gang schlurfte und den Stuhl, auf dem Anne gesessen hatte, ein Stück weiter nach hinten zog. Am liebsten hätte Paula sich zu Marta umgedreht, um ihre Reaktion erkennen zu können, aber weil Ben jetzt direkt neben ihr stand, wagte sie es nicht. Als er sich neben ihr auf den Stuhl fallen ließ, hielt Paula die Luft an, dabei hatte sie gerade erst bemerkt, dass er nach Zigarettenqualm und einem sehr herben Parfum roch. Billig roch das Parfum, billig und animalisch. Vielleicht sollte es den Zigarettengeruch überlagern, vielleicht sollte es aber auch einfach nur so einschüchternd wirken, wie Paula es empfand.
Der Lehrer setzte seinen Unterricht fort. Ben stellte seinen Rucksack unter den Tisch, lehnte sich im Stuhl zurück und fing an zu kippeln. Paula wusste, wie die Lehrer, die in ihrer Klasse unterrichteten, auf Stuhlkippeln reagierten und wartete auf eine Verwarnung, die jedoch ausblieb. Stattdessen sagte der Lehrer an, dass eine Aufgabe aus dem Buch bearbeitet werden sollte. Paula schlug das Buch auf, überlegte, es in die Mitte zu legen, damit ihr neuer Mitschüler mit hineingucken konnte. Er regte sich nicht, verschränkte nur die Arme vor der Brust und schien abzuwarten, wie Paula sich entschied. Sie legte es in die Mitte des Tisches, schlug ihr Heft auf und fing an zu rechnen. Der Lehrer beäugte den neuen Schüler, sagte aber wieder nichts. Scheinbar konnte er sich Stuhlkippeln und Arbeitsverweigerung erlauben.
Paula hatte gerade die zweite Aufgabe gerechnet, da bemerkte sie, dass Ben mit fast apathischem Blick aus dem Fenster schaute. Vor dem Klassenzimmer im ersten Stock des Schulgebäudes standen alte dicke Eichenbäume, deren Blätter in Anbetracht der Jahreszeit blühten.
„Hast du noch kein Schulbuch?“
Paula hatte gar nicht bemerkt, dass der Lehrer plötzlich vor Ben stand, der nicht auf seine Frage reagierte. Sein Blick veränderte sich nicht, blieb starr auf einen fernen Punkt gerichtet, von dem sich Paula sicher war, niemand anderes würde ihn sehen.
„Wie war sein Name noch gleich?“, wandte sich der Lehrer an sie.
„Ben“, sagte Paula leise.
„Richtig.“ Der Lehrer nickte, als hätte sie die Lösung für eine mathematische Formel gegeben. „Ben?“ Er tippte zweimal auf die Tischplatte.
Mit einem Mal erwachte Ben aus seiner Trance. „Bitte?“, fragte er gepresst. Seine Stimme war tief, tiefer als Paula es erwartet hätte. Als er sprach, verstärkte sich der Geruch nach Zigaretten.
„Hast du noch kein Buch?“, wiederholte der Lehrer geduldig seine Frage.
Ben schaute von ihm zur Tischplatte, auf der keine Materialien lagen, dann zu Paula, die sich unter seinem Blick duckte. „Nein“, sagte er und es klang mehr nach einer Frage. Als wüsste er nicht, dass er in der Schule ein Buch brauchte. Ein Buch und Hefte. Stifte. Radiergummis. Er sah seinen Lehrer an, als würde er ihn gar nicht richtig erkennen und als würde er sich fragen, ob er diesen Menschen jemals vorher gesehen hatte.
„Am Mittwoch hast du ein Schulbuch“, sagte der Lehrer, aber seine Strenge war aufgesetzt. Der Neue machte ihn nachdenklich, er wusste nicht recht, wie er einzuschätzen war. Und so ging es Paula auch. Sie wusste nicht, ob sie sich vor ihm fürchten sollte oder ob er ihr imponierte. Er wirkte exotisch. Anders.
Als es zum Stundenende klingelte, zuckte Ben zusammen. Er nahm seinen Rucksack unter dem Tisch hervor, schulterte ihn auf die gleiche Weise wie vorhin und verließ, ohne einen der anderen eines Blickes zu würdigen, das Klassenzimmer.
2020 Marta
Paula ist anzusehen, dass ihr der Weg hierher schwergefallen ist. Die Porzellanpuppe mit ihrer hellen Haut, den dunkelbraunen, fast schwarzen Augen, den vielen Sommersprossen. Handbemalt wirkt sie noch immer. Als hätte sich jemand Zeit genommen, um sie zu erschaffen. Sie wirkt gleichzeitig wie ein verschrecktes Tier, ein Reh, das auf einer Landstraße vor ein Auto läuft und Glück hat, dass der Fahrer rechtzeitig bremst. Als sie mich sieht, zuckt sie zusammen, als wäre sie versehentlich gegen einen elektrischen Weidezaun gelaufen. Sie wirkt jung. Jung und naiv, als hätte die Zeit entschieden, sie nicht altern zu lassen.
Ich spüre, wann David sie entdeckt. Es ist noch immer so, als hielten uns unsichtbare Bänder zusammen. Bänder, die einst zerschnitten worden waren. Vielleicht auch zerrissen sind.
Der Pfarrer findet schöne Worte, aber ich höre ihm nicht zu. In der Kapelle vorhin hat er von einem Fremden gesprochen. Den Ben, den er verabschiedet hat, kannte ich nicht; das war ein Ben aus einem anderen Leben, einem Leben nach uns. David hört zu; er war einmal alles, was ich im Leben hatte und jetzt ist er ein Komparse, der beiläufig dieses Set durchstreift, ohne Aufgabe, ohne groß Beachtung zu erwarten.
Die Leute, die sich hier versammelt haben, passen nicht zu Ben. Wenn sie Weggefährten von ihm waren, dann Weggefährten aus den letzten acht Jahren. Niemanden von ihnen habe ich je gesehen, niemanden von ihnen hier erwartet. Sie sind adrett gekleidet, herausgeputzt, so war Ben nie, mit Leuten wie diesen hat er sich nicht abgegeben. Ich frage mich, ob ich am richtigen Grab stehe.
Ich sehe hinüber zu dem Notar in seinem schwarzen Anzug. Er wirkt von der ganzen Szenerie wenig berührt. Er hat eine betretene Miene aufgesetzt, die ich ihm beinahe abkaufe. Vorhin hat er David und mich angesprochen. Als wir die Kapelle verlassen haben, stand er im Eingang und lächelte uns an.
„Sind Sie Frau Neuhauser und Herr Steiner?“, hatte er gefragt. Mit einer Stimme, der man gerne zuhört.
David hatte für uns beide geantwortet und der Notar hatte sich vorgestellt, uns ein Foto gezeigt. Paula war auf dem Foto. Neben ihr Rafa, daneben Ben, David, ich. Das Foto war ein Fausthieb in die Magengrube. Es ist viel passiert, seit dieses Bild entstanden ist.
Jetzt beobachtet der Notar Paula, die er sicher von dem Bild wiedererkennt und ich habe das Bedürfnis, sie vor seinen Blicken zu beschützen. Er hatte gefragt, ob sie hier sei. Sie und Rafa. Ich hatte verneint. Er hatte uns gebeten, nach dem Begräbnis zu ihm zu kommen. Was er wollte, hatte er nicht gesagt.
Paula steht maximal drei Meter von uns entfernt, als das Begräbnis zu Ende ist. Sie sieht zu uns hinüber, ich höre sie denken; sie überlegt, welche Reaktion angemessen ist. Sie steckt sich eine Strähne hinter ihr Ohr und als wir einen Schritt auf sie zumachen, macht sie zwei in unsere Richtung.
Es fühlt sich seltsam an, beieinander zu stehen. Die Begrüßung ist fad. Lose. Als müsste man sie gut festhalten, damit sie überhaupt hält. Wir halten Abstand zueinander, umarmen uns nicht, geben uns nicht die Hand. Sagen „Hi“, ohne zu fragen, wie es uns geht. Sicherheitsabstand. Von einem Fuß auf den anderen zu treten ist leichter, als die Hürde zu überwinden, die zwischen uns aufgebaut worden ist.
„Er will mit uns reden“, höre ich mich sagen und zeige auf den Notar, der zu uns hinübersieht.
„Okay“, sagt Paula schnell, so schnell, als wäre sie auf der Flucht. Vor uns.
Bevor wir zu ihm hinübergehen, nimmt David sie doch in den Arm. Umständlich, es sieht aus wie ein Versehen. Und um die Situation nicht noch peinlicher zu machen, entscheide ich mich dagegen, es ihm gleichzutun.
„Frau Körner?“ Der Notar reicht Paula seine Hand. Es ist seltsam ihren Namen zu hören. Als sei er in Vergessenheit geraten. Die Erinnerung tut weh, aber das gestehe ich mir nicht ein. Ich habe meine Rüstung an. Nicht erst seit ich Paula gesehen habe, seit ein paar Tagen. Seit die Nachricht kam, dass Ben nicht mehr lebt. Ich habe sie in Lichtgeschwindigkeit angezogen, sonst wäre ich verbrannt.
Paula wirkt überrascht davon, was dieser Mann von uns will und mir geht es ähnlich. Nein, mir geht es genauso. David steckt seine Hände in seine Hosentaschen, er ist älter geworden, obwohl ich mitbekommen habe, wie er gealtert ist. Wir wohnen in unterschiedlichen Städten, aber wir haben regelmäßig Kontakt. Regelmäßigkeit ist nicht mit Kontinuität zu verwechseln. Regelmäßig ist auch, sich zum Geburtstag und zu Weihnachten zu schreiben. Lockere Unterhaltungen, Smalltalk auf höchstem Niveau. Genauso wie ich es nicht leiden kann, aber besser als nichts. Er hat sich seinen Tarnumhang angezogen; ich erkenne seine wahren Gefühle nicht, wenn ich ihn ansehe; ich spüre sie nur, wenn er nah genug bei mir steht. David, der immer ein Bruder für mich war. Der mich gerettet hat. Ohne den ich nicht wüsste, wo ich bin.
„Kommen Sie“, sagt der Notar und geht mit uns über die Kieswege zum Trauerhaus. Dort hält er uns die Tür auf und wir finden uns in einem kleinen Büro ein. Es gibt nicht genügend Stühle, also bleiben wir alle stehen. Der Notar geht um einen Tisch herum und holt das Foto von uns aus dem Jackett. Als er es zwischen uns legt, weitet Paula die Augen. Ich erkenne eintausend Gefühle in ihrem Blick, ich lese unsere Geschichte in einem einzigen ihrer Wimpernschläge ab. Ihre Reaktion geht mir nah. Näher als die Beerdigung, bei der ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Fehl am Platz. Hätte das Schwarz-weiß-Foto von Ben nicht vorne im dunklen Rahmen am Altar gestanden, hätte ich nicht gewusst, von wem die Rede ist. Um wen es geht. Das Foto, sein Name und sein Geburtsdatum, alles, was von ihm geblieben ist.
„Herr Gonzales ist heute nicht anwesend?“, fragt der Notar, als wollte er sichergehen.
David zuckt mit den Achseln. Als sein Name fällt, wendet Paula den Blick von dem Foto auf dem Tisch ab.
„Wie auch immer. Herr Schüttler bat mich, im Falle seines Todes diesen Zettel an Sie auszuhändigen“, er greift sich ein zweites Mal in das Jackett und zieht einen cremefarbenen Umschlag hervor. Er legt den Umschlag neben das Foto.
Ich fixiere den Umschlag mit meinem Blick und warte darauf, dass er in Flammen aufgeht. Dass er zerfällt. Dass er schmilzt und eine Pfütze auf der Tischplatte hinterlässt.
„Wusste Ben, dass er sterben wird?“ David tut so, als gäbe es den Brief gar nicht.
Der Notar senkt den Blick, dann hebt er die Augenbrauen. „Wissen Sie, Herr Schüttler litt unter schweren Depressionen, für die sein Drogenkonsum ursächlich zu sein scheint. Er hat in den letzten Jahren mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen. Letztes Jahr war er wieder in einer Klinik...“ Er sieht uns erwartungsvoll an. Ich erkenne den Vorwurf in seinem Blick.
Ich nehme den Umschlag vom Tisch, neben mir hält Paula die Luft an. „Will jemand?“, frage ich und schaue von ihr zu David. Beide schütteln den Kopf.
Ich reiße den Umschlag auf und greife in das Kuvert. Es liegt ein gefalteter Zettel darin. Ich ziehe ihn auseinander. Bens Handschrift. Kaum leserlich. Ein Satz steht auf dem Papier.
Ich wünschte, wir wären noch Freunde.
„Das ist alles?“, frage ich den Notar, der träge nickt. Er kennt den Inhalt.