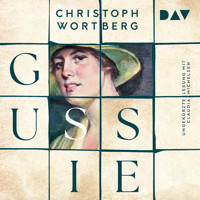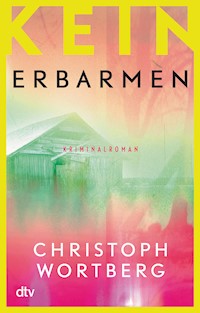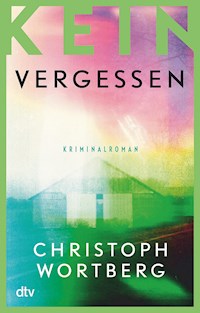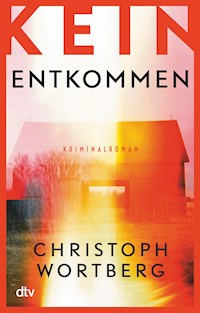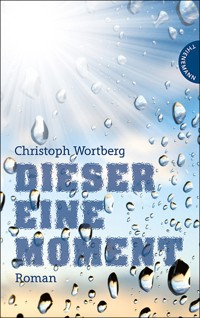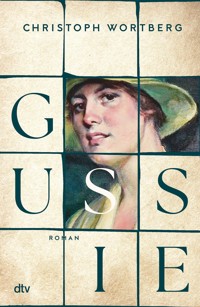
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um ihre Töchter zu retten, verriet sie ihren Mann Ein berührender Roman über das Schicksal einer außergewöhnlichen Frau: Auguste »Gussie« Adenauer, die zweite Frau Konrad Adenauers. 1948. Die Frau im Bonner Johannes-Hospital weiß, dass sie nur noch wenige Tage zu leben hat. Auf dem Sterbebett lässt sie Szenen ihres Lebens an sich vorbeiziehen. Gussie Zinsser ist 24, als sie den 19 Jahre älteren Witwer Konrad Adenauer heiratet und zur Stiefmutter seiner drei Kinder wird. Sie schenkt fünf Kindern das Leben, doch ihr Erstgeborener stirbt nach nur vier Tagen. Als Frau des Kölner Oberbürgermeisters steht sie in der Öffentlichkeit und engagiert sich eigenständig sozial und politisch. Hitlers Machtübernahme verändert alles. Adenauer muss sich vor den Nazis verstecken. Allein gelassen mit ihren Kindern, versucht Gussie, das schwierige Leben im Dritten Reich zu bewältigen. Bis sie von der Gestapo vor eine unmenschliche Wahl gestellt wird. »›Konrad‹, sagt sie leise und tastet nach seiner Hand. Sie fühlt den Ring, den er nie abgenommen hat, nicht einen einzigen Tag in neunundzwanzig Jahren. Er sitzt neben ihr auf einem Stuhl, den Rücken durchgedrückt, die Beine übereinandergeschlagen. Sein dunkler Anzug, die schwarz glänzenden Schuhe. Er schaut sie an und in sie hinein, so wie auch sie in ihn hineinschaut. Es sind nicht die Blicke, die zählen, es kommt auf die Gedanken an. Sie kann lesen, was er denkt, vom ersten Tag an konnte sie es. Er schweigt, so wie er immer schweigt, wenn ihm das Herz übergeht. Sie ist froh, dass er den Augenblick nicht mit Worten zerstört. Vor ihm kannte sie nur die Worte, er hat sie das Schweigen gelehrt.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Der Mann, den sie liebt, ist zwanzig Jahre älter als sie, verwitwet und Vater dreier Kinder. Nichts spricht für diese Verbindung. Doch sie setzt sich durch. Gegen ihre Eltern, gegen alle Konventionen. Ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs heiratet Gussie Zinsser den Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer. Die Unterschiede zwischen den beiden könnten größer nicht sein. Ihre Lebenslust prallt auf seine Verschlossenheit. Aber Gussie lässt sich nicht unterkriegen. Sie gewinnt die Herzen ihrer Stiefkinder, bekommt fünf eigene Kinder und engagiert sich politisch und sozial. Dann kommt Hitler an die Macht und verwandelt ihr erfülltes Leben in einen Albtraum. Immer wieder muss sich ihr Mann vor den Nazis verstecken. Verzweifelt versucht Gussie, ihre Familie zusammenzuhalten – bis sie von der Gestapo verhaftet und vor eine unmenschliche Wahl gestellt wird.
Christoph Wortberg
Gussie
Roman
Für Toni
All men should strive to learn before they die,
what they are running from, and to, and why.
James Thurber
Jeder Mensch eine halboffne Tür
die in ein Zimmer für alle führt.
Tomas Tranströmer
1
»… und soll Dich ganz herzlich von Deinen Eltern grüßen. Sie sorgen sich sehr um ihre Tochter. Und ebenso sorge ich mich, Gussie, meine gute, liebe Frau. Was soll nur werden, wenn du nicht mehr bist?«
Konrad Adenauer an Gussie Adenauer, Rhöndorf, 12. Februar 1948
Sie schaut auf ihre Hände mit dem goldenen Ring, bläuliche Adern unter welker Haut. Gussie, hört sie ihn sagen. Dieses leichte Singen, das Bemühen, den rheinischen Zungenschlag zu unterdrücken. Es ist ihm nie gelungen, sein Leben lang nicht.
Ein Zimmer im Johannes-Hospital in Bonn, im Mai wird der Krieg seit drei Jahren vorbei sein. Seit Tagen liegt sie hier, allein mit sich und ihrem vergehenden Leben, zu schwach, um das Bett zu verlassen. Ihr Rücken schmerzt unaufhörlich, ein gnadenloses Stechen zwischen den Wirbeln. Jedes Einatmen eine Qual, jedes Ausatmen begleitet von einem Hustenreiz, der ihr die Brust zuschnürt, sie kann ihn kaum unterdrücken.
Wenn sie sich erleichtern muss, schiebt ihr die Schwester eine Bettpfanne unter. Die ersten Male waren demütigend, danach hat sie sich damit abgefunden.
Sie weiß, dass sie sterben wird. Alle wissen es. Die Ärzte können nichts mehr für sie tun. Ein paar Wochen noch, vielleicht ein paar Tage mehr, dann wird er sie begra-ben müssen, so wie er schon seine erste Frau begraben musste.
Es fällt ihr nicht schwer zurückzuschauen, aber sie hat keine Macht über das, was sie sieht. Ihre Erinnerungen kommen und gehen, Bilder tauchen auf und verschwinden wieder, flüchtig wie Rauch. Die glatte Oberfläche eines Sees, sie sieht hinab bis auf den Grund. Wind zieht auf, und was eben noch klar war, wird trüb und verschwimmt vor ihren Augen. Dann, Minuten später oder auch Stunden, ein neues Bild, ebenso klar wie das vorherige. Bekannte Orte, vertraute Gesichter. Augen, die sich mit Lachen füllen oder mit Kummer, Räume, die sich öffnen und wieder schließen.
Sie denkt: Was wir erinnern, ist nicht das, was geschehen ist. Was geschieht, ist allein dem Moment vorbehalten. Was bleibt, ist nur eine Wahrheit unter tausend Wahrheiten, erfundenen oder erträumten.
Die Uhr ihres Lebens, rieselnder Sand. Jedes Sandkörnchen ein Stück von ihr, gelebte Zeit. Was geschehen ist, lässt sich nicht rückgängig machen. Nur ein einziges Mal haben sie darüber geredet, der Rest war Schweigen. Sie haben sich beide geschämt, jeder auf seine Art.
Konrad, mein Konrad!
»Lass gut sein, Gussie«, hatte er gesagt, als sie sich zum ersten Mal wiedergesehen hatten, an einem sonnigen Tag im Spätherbst, die Tage der Haft wie ein bleischwerer Mantel um ihre Schultern. »Wir stehen alle in Gottes Hand.«
Und sie hatte gedacht: Was ist das für ein Gott, der zulässt, dass eine Frau ihren Mann verrät?
Wie sehr man doch am Leben hängt, denkt sie jetzt. Man will nicht wahrhaben, dass man zerbrochen wurde. Man versucht die Bruchstücke zusammenzufügen, die nie wieder ein Ganzes werden können. Alles ist verbrannt, ein Stochern in der erkalteten Asche, ein neues Haus auf einem morschen Fundament, inmitten der Schemen des alten. Die Steine wollen nicht zueinanderpassen, keine Tür führt hinein und keine hinaus.
2
»Nicht mehr lange, und die Waffen werden endlich schweigen. Da draußen eine untergegangene Welt und in mir ein blühender Garten. Und der Grund dafür, wertes Fräulein Zinsser, sind allein Sie.«
Konrad Adenauer an Gussie Zinsser, Köln, 11. Oktober 1918
Sie stand in der Tür zur Bibliothek und hörte den Männern zu. Gestärkte Hemden mit Vatermörderkrägen, schwarze Anzüge, die Schuhe glänzend gewichst. Seit Jahren dasselbe Thema. Die verfahrene Lage im Westen, der Vorstoß im Osten. Und noch immer der Glaube, der Krieg wäre zu gewinnen. In Treue fest und unverbrüchlich. Für Kaiser, Volk und Vaterland.
Sie dachte: Was reden die da?
Der den Russen aufgezwungene Friedensvertrag, der das Sterben in Frankreich nur sinnlos verlängerte. Die gescheiterte Frühjahrsoffensive an der Somme und im Juli die verlorene zweite Marne-Schlacht, durch die sich das Blatt endgültig gewendet hatte. Seitdem ging es nur noch bergab. Aber keiner von ihnen sprach aus, was alle wussten: Die Niederlage war nur noch eine Frage der Zeit. Sie saßen rauchend da, schwenkten ihre Cognacgläser und redeten um das Unvermeidliche herum. Priesen die Tapferkeit derer, die – halb so alt wie sie selbst – in den Gräben der Westfront zu Zehntausenden verreckten, und dachten dabei an die Sicherung des eigenen Wohlstands. Lasen zwischen den Zeilen und schätzten ihre Möglichkeiten ein. Wägten ab, was das Danach ihnen bringen würde.
Und in ihrer Mitte, groß und hager, mit ausgeprägten hohen Wangenknochen und abstehenden Ohren an dem dünn behaarten Schädel, der Einzige, der wirklich etwas zu sagen gehabt hätte, Dr. Adenauer, Kölner Oberbürgermeister und Mitglied des Preußischen Herrenhauses. Er hörte zu und schwieg.
Hinter ihr im Wohnzimmer die Ehefrauen, Abendkleider und teurer Schmuck, selbst im Angesicht der drohenden Katastrophe zeigte man, was man hatte. Auch hier ging es um den Krieg, wenngleich nicht um das große Ganze. Die Damen jammerten. Über die Einschränkungen im Privaten, die Schwierigkeiten einer angemessenen Haushaltsführung, die Beschaffung spezieller Lebensmittel, die nur noch zu völlig überhöhten Preisen zu bekommen waren.
Erst gestern war sie mit ihrer Mutter in der Stadt gewesen. Ein Besuch bei der Schneiderin. An den Häuserecken saßen bettelnde Soldaten, blind geworden von den Senfgasangriffen, umgeschlagene leere Hosenbeine oder Mantelarme, wo vor Kurzem noch Gliedmaßen gewesen waren. Junge Männer mit versehrten Gesichtern, weggeschossene Unterkiefer, zwei Löcher statt einer Nase. Oder die Zitternden, denen der Granatschock die Kontrolle über ihren Körper genommen hatte. Heimgekehrte ohne Hoffnung.
»Schau da nicht hin«, hatte ihre Mutter gesagt und sie weitergezogen.
Mein Gott, wie absurd das alles. Da draußen Verzweiflung, Hunger, Elend, und hier in ihrem Elternhaus ein zwangloses Abendessen mit Freunden und Bekannten. Professor Zinsser und Gattin geben sich die Ehre. Die Räume warm und behaglich, das Essen gut und reichlich, über dem Tisch der Lüster aus Kristallglas, funkelnd und hell, und vor den Fenstern der große Garten, den sie so liebte. Der alte Gärtner kam noch immer, einmal im Monat, sein Enkel war in Verdun geblieben. An den einen ging der Krieg vorbei, den anderen kroch er bis in den eigenen Leib.
»Genug des Trübsinns, meine Herren«, sagte ihr Vater und erhob sich. »Wenn ich Sie dann herüberbitten darf. Meine Tochter wird uns etwas spielen.«
Während die Gäste sich im Wohnzimmer versammelten, neugierig auf das, was sie erwartete, und ihre Mutter verkrampft in die Runde lächelte, ein Zucken um die Mundwinkel – Beschäme uns nicht, Gussie! –, nahm sie ihre Geige aus dem Kasten.
Dr. Adenauer saß in der ersten Reihe, neben ihrem Vater, das Gesicht unbewegt. Ein Witwer und Vater dreier Kinder, der mit seinen lebendigen dunklen Augen jede ihrer Bewegungen verfolgte. Das Ansetzen der Violine, das Spannen des Bogens, das Stimmen der Saiten. Ihre Blicke trafen sich, sie sah etwas, das sie nicht einordnen konnte. Sie dachte: Wie anders er doch ist. Wir kennen uns, aber ich weiß nichts über ihn. Er verrät sich nicht. Niemals.
Sie begann zu spielen. Ein wenig Brahms, etwas von Dvořák und natürlich Beethoven. Ihre Finger auf dem Griffbrett, der Bogen auf den Saiten, sie ließ sich fallen, ins Irgendwo. Die Musik verwandelte ihre Sehnsucht in Wirklichkeit, alles war Klang und Licht, eine zauberhafte, wortlose Sprache. Kein Krieg mehr und keine Not, die Zeit löste sich auf. Ein letztes Aufbäumen der Melodie, ein zartes Verklingen, dann war es vorbei.
Der Applaus wärmte sie, ihre Mutter strahlte, in den Augen des Vaters lag Stolz. Sie wusste, dass sie es gut gemacht hatte. Vor anderen zu spielen, hieß immer auch, etwas von sich selbst wegzugeben.
Danach sprach er sie an.
»Ich bin beeindruckt«, sagte er. »Ihr Spiel besitzt große Klarheit und erstaunliche Tiefe.«
Hinter der Förmlichkeit seiner Worte verbarg sich echte Anerkennung. Die Art, wie er sie anschaute, verriet ihr, dass er in ihr nicht länger das Mädchen sah, als das er sie kennengelernt hatte, wenige Jahre zuvor, als er sie zum ersten Mal hatte spielen hören, in seiner Villa in der Max-Bruch-Straße, keinen Steinwurf von ihrem Elternhaus entfernt.
3
»So danke ich Ihnen von Herzen für Ihre freundliche Einladung zum gemeinsamen Musizieren, die meine Mutter mir übermittelt hat und deren Ausführung ich mit Freude entgegensehe.«
Gussie Zinsser an Emma Adenauer, Köln, 19. Juli 1915
Seine Frau Emma hatte sie an der Haustür empfan-gen, war vor ihr her ins Wohnzimmer gegangen, eine wunderschöne Frau in einem dunklen Kleid aus Seidentaft, das bei jedem Schritt leise rauschte. Ihr gerader Rücken, ihr schlanker Hals, die rotblonden Haare hochgesteckt.
»Wollen wir?«, fragte sie und setzte sich an den Flügel. Alles an ihr war selbstverständlich und natürlich. Die Art, wie sie sich bewegte, wie sie die Finger auf die Tasten legte, wie sie ihr zulächelte. Als würden sie sich schon jahrelang kennen.
Auf dem Flügel waren neben einem Stapel Noten gerahmte Fotografien aufgestellt, Bilder der drei gemeinsamen Kinder und ein Porträt von Emma und ihrem Mann. Sie sitzend, er hinter ihr stehend, seine Hände ruhten auf ihren Schultern. Ernst und unnahbar blickte er in die Kamera, in sich verschlossen. Ganz anders als seine Frau in ihrer bezwingenden Leichtigkeit.
Wie geht das, dachte sie, während sie den Bogen spannte und über das Kolophonium zog, wie passt so etwas zusammen?
»Was ist?«, fragte Emma.
»Nichts«, sagte sie und spürte, wie sie errötete.
»Er ist nicht so, wie du denkst«, sagte Emma.
»Bitte entschuldigen Sie«, stammelte sie. Das alles war ihr furchtbar unangenehm.
»Gibt doch gar keinen Grund«, sagte Emma und deutete auf den Notenstapel. »Suchst du uns was aus?«
Sie legte Bogen und Kolophonium beiseite und begann zögernd die Noten durchzublättern. »Vielleicht das hier«, sagte sie und zog Rachmaninoffs Elegie Opus 3, Nummer 1 aus dem Stapel.
Schatten und Licht, Sehnsucht und Melancholie, sie verstanden sich sofort. Ihre Instrumente sprachen miteinander, ein wortloser Einklang. Danach die Ungarischen Tänze von Brahms, alle einundzwanzig, in einer Bearbeitung für Klavier und Violine, draußen wurde es langsam dunkel, die Zeit verging wie im Flug.
Und dann sah sie ihn plötzlich dastehen, in seinem schwarzen Anzug, die Aktentasche unter dem Arm, ein nach Hause gekommener Ehemann, der in der geöffneten Tür des Wohnzimmers ihr gemeinsames Spiel verfolgte, die Augen geschlossen.
Der Strich ihres Bogens stockte, kaum merklich, aber deutlich genug, um Emma von den Tasten aufblicken zu lassen.
»Konrad«, sagte sie. Und zu ihr: »Hat sich einfach reingeschlichen wie ein Dieb.« Dann wieder zu ihm: »Darf ich dir das Fräulein Zinsser vorstellen?«
»Die Tochter von Professor Zinsser?«
»Auguste«, sagte Emma.
»Sie können mich Gussie nennen«, sagte sie. »Alle nennen mich so.«
»Gussie«, sagte er und lächelte.
Kein Jahr später hatte er Emma begraben müssen. Ihre Nieren hatten nicht richtig funktioniert, die Geburten der Kinder hatten das Leiden verstärkt, die zunehmende Erschöpfung hatte sie immer wieder ans Bett gefesselt. Eine Pilzvergiftung hatte ihrem Leben schließlich ein Ende gesetzt. Die Kinder hatten nach dem Verzehr nur ein leichtes Unwohlsein verspürt, für Emma und ihren angegriffenen Organismus war es zu viel gewesen.
Er müsse sie sehr geliebt haben, hatte ihre Mutter nach der Beerdigung gesagt, reglos habe er am Grab gestanden, seine Kinder im Arm, sein Körper wie versteinert, die Trauer wie eingemeißelt in seinem Gesicht. Und dazu dieser Regen, ein unaufhörliches Prasseln auf die aufgespannten schwarzen Schirme. Der Pfarrer, sein eigener Bruder, sei kaum zu verstehen gewesen, was allerdings kein Verlust gewesen sei, ein Katholik eben.
4
»Weißt du noch, Papa? Ein Vater, der seiner staunenden kleinen Tochter die Wunder der Welt zeigte. Ich denke oft daran, ich weiß nicht warum. Mein Leben neigt sich seinem Ende zu, und die Kindheit kehrt zu mir zurück.«
Gussie Adenauer an Konrad Adenauer, Bonn, 14. Februar 1948
Sie stand auf der Terrasse ihres Elternhauses und tauchte den Stock mit der Drahtschlinge in die Flüssigkeit, die ihr Vater in einer Küchenschüssel mit Wasser angerührt hatte.
Seine feingliedrigen Hände, mit denen er ein Stück Kernseife über eine Reibe gezogen hatte, hin und her, die Seifenflocken waren in der Schüssel gelandet neben weiteren geheimnisvollen Zutaten, er hatte von Natriumchlorid gesprochen und Glycerin und der veränderten Oberflächenspannung des Wassers, merkwürdige Wörter und Sätze, die sie nicht verstand.
»Das ist Chemie«, hatte er gesagt, und auch das hatte sie nicht verstanden.
Ihre Mutter hatte ungehalten den Kopf geschüttelt. »Sie ist fünf Jahre alt, Ferdinand, und ein Mädchen!«
Woraufhin er entgegnet hatte: »Sie hat ein Gehirn wie alle Menschen. Und das wächst nur, wenn man es benutzt.«
Er hatte ein Stück Draht zu einer Schlinge gebogen und sie an der Spitze eines Stockes befestigt. Und dann hatte er lächelnd zu ihr gesagt: »Jetzt wirst du zaubern, Gussie.«
Sie bewegte den Stock mehrmals in der Schüssel hin und her, so wie er es ihr gezeigt hatte, dann hob sie ihn vorsichtig hoch, zwischen der Drahtschlinge ein klebriges Etwas, durchsichtig wie Glas und von bunten Streifen durchzogen.
Langsam schwang sie den Stock von sich weg. Das klebrige Etwas begann sich zu wölben, wurde rund und runder, bis es sich von der Schlinge löste und durch den Garten schwebte, eine kleine, vom Wind bewegte Seifenblase, das Sonnenlicht brach sich in ihr und ließ sie wie einen Regenbogen schillern. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals etwas so Schönes gesehen zu haben.
Wie war das nur möglich?
Sie folgte der schwebenden Kugel mit den Augen, hielt die Schlinge daran, um sie wieder einzufangen, doch als der Draht sie berührte, zerstob sie in winzige Tropfen.
Sie machte eine neue Seifenblase. Diesmal landete die Kugel nach kurzem Flug auf der Lehne eines Gartenstuhls, wie von einer geheimen Macht angezogen, nur um dann ebenfalls zu zerspringen, genau wie die erste.
Und wieder hielt sie den Stock in die Schüssel, führte ihn langsam durch die Luft, bis auch die dritte Blase sich von der Schlinge löste. Sie nahm einen anderen Weg als die vorhergehenden, nicht vom Haus weg, sondern mitten hinein, auf die beiden Sessel zu, die gegenüber vom Sofa standen, zwischen ihnen ein kleiner Beistelltisch voller Bücher.
Die Augen fest auf die Seifenblase gerichtet, folgte sie ihr ins Wohnzimmer, gespannt, wo das Wunder aus Wasser und Seife und all den anderen geheimnisvollen Zutaten landen würde und ob es ihr diesmal gelingen würde, sie vorher mit der Schlinge einzufangen und vor dem Zerplatzen zu bewahren.
Sie hatte die schwebende Kugel fast erreicht, noch eine Armlänge, nicht mehr, als sie über den Rand des Teppichs stolperte. Ihre schwarzen Lackschuhe, der Riemen über dem Spann, die weißen Kniestrümpfe unter ihrem Lieblingskleid mit den roten Bändern, zu Schleifen gebunden an den gerafften Ärmeln und hinten in der Taille, ihre nach der Seifenblase ausgestreckten Hände. Schlagartig wurde ihr klar, dass ein Sturz unvermeidlich war. Sie würde mit dem Mund auf die Kante des Beistelltisches schlagen, ihre Lippen würden aufplatzen, die Haut unter ihrem Kinn, sie würde sich die Spitze der Zunge abbeißen, ihre Zähne würden im Holz stecken bleiben.
Doch dann schnellte die Hand ihres Vaters hinter der Lehne eines der beiden Sessel hervor und griff nach ihr. Sie hatte ihn nicht bemerkt, so sehr hatte sie sich auf die Seifenblase konzentriert. Das Buch, in dem er gelesen hatte, fiel zu Boden. Sie fiel nicht. Das Auffangen und Heranziehen war eine einzige fließende Bewegung, so schnell ging es.
»Das war knapp, Fräulein«, sagte er.
Sie schaute sich um. Die Seifenblase war verschwunden. Sie drückte sich an ihn. Der weiche Wollstoff seiner Hose war von Nadelstreifen durchzogen, die Krawatte gemustert, die Manschettenknöpfe seines gestärkten Hemdes trugen seine Initialen. Er strich ihr liebevoll durch die Haare, sie konnte seinen Siegelring auf ihrer Kopfhaut spüren.
»Ich wollte sie doch nur retten«, sagte sie.
»Du könntest eine neue machen«, sagte er.
»Das ist nicht dasselbe.«
»Da hast du recht«, gab er zurück. »Dasselbe ist es nicht. Aber immerhin so ähnlich.«
»Warum gehen sie so leicht kaputt?«
»Schönheit ist immer zerbrechlich.«
»Ist das auch Chemie?«
»Nein«, sagte er. »Das liegt in der Natur der Dinge.«
Sie hat ihre Kindheit geliebt. Es gab keine Grenzen, alles war möglich. Das Haus in der Haydnstraße, oben im Giebel ein rundes Fenster, das hinausging auf den Park gegenüber, ein Bullauge in die Welt. Und sie mittendrin, ein neugieriges kleines Mädchen, die Arme auf ein Kissen gestützt, die Kinderaugen in die Ferne gerichtet.
Die Neugier hat sie immer begleitet, das Unbekannte hat ihr nie Angst gemacht. Auch jetzt macht es ihr keine Angst. Das einzige Unbekannte, das noch vor ihr liegt, ist der Tod. Sie weiß nicht, was danach kommt. Aber wenn es etwas gibt, wird es gut sein.
Die sichtbare und die unsichtbare Welt. So viele Fragen, so wenige Antworten. Ihr Vater sagte immer: »Es kommt nicht auf die Antworten an, es kommt darauf an, die richtigen Fragen zu stellen.«
Damals hat sie das nicht verstanden, jetzt weiß sie, was er damit meinte.
Ein warmer Sommerabend, das Rot der untergehenden Sonne strich über die Fenster, fing sich in den Vorhängen des Arbeitszimmers. Sie saß auf dem Schoß ihres Vaters, hing an seinen Lippen.
Er sagte: »Der menschliche Körper ist ein Abbild der ganzen Welt.«
Dann begann er zu erklären. Von außen nach innen. Das, was man sehen konnte und das Verborgene darunter. Er beschrieb ihr die verschiedenen Schichten der Haut, ließ sie mit einer Lupe über ihre Arme wandern. Er zeigte ihr Abbildungen in medizinischen Lehrbüchern, anatomische Zeichnungen. Den Blutkreislauf, das Nervensystem, den Aufbau der Muskeln.
Er sagte: »Alles hängt mit allem zusammen, und alles ist für etwas gut. Das Herz, das Gehirn, die inneren Organe.«
Sie staunte und dachte: Der Mensch ist wie eine Landschaft. Häuser, Straßen, Bäume.
Sie fragte: »Und all das ist in mir drin?«
Er lachte. »In dir, in mir, in uns allen. Und der größte Teil davon ist Wasser, genau wie auf der Erde.«
Er schlug einen Atlas auf und zeigte ihr eine Weltkarte. Die atlantische Seite und die pazifische und dazwischen die Kontinente, klein wie Inseln in einem riesigen blauen Meer.
»Wir sind nicht die Krone der Schöpfung«, sagte er, »wir sind nur ein kleiner Teil davon, nicht besser oder schlechter als alle anderen Teile.«
Sie sah ihn mit großen Augen an.
Er fragte: »Verstehst du, was ich meine?«
Sie nickte, obwohl sie nicht das Allergeringste verstand.
»Und die Seele«, wollte sie wissen, »wo sitzt die?«
»Überall und nirgends.«
»Kann man sie deswegen nicht sehen?«
»Ja«, sagte er. »Genau deswegen.«
5
»Dass Du Dir Sorgen machst, verstehe ich. Aber was nicht zu ändern ist, muss man hinnehmen. Also gräme dich nicht, mein lieber Schatz. Dich gehabt zu haben, ist mein allergrößter Trost.«
Gussie Adenauer an Konrad Adenauer, Bonn, 14. Februar 1948
Sie schaut aus dem Fenster, lauscht dem Rauschen der Stadt, der Frühling lässt sich Zeit in diesem Jahr. Wenn sie sich fragt, was bleibt, ist die Antwort immer dieselbe: die Kinder. Und die Musik.
Sie wartet auf die Töne in ihrem Kopf, das Fließen einer Melodie, eine Abfolge von Harmonien. Aber in ihrem Kopf ist Stille, und hinter der Stille nur das Flüstern ihrer Gedanken.
Was wäre aus ihr geworden, wenn er ihr keinen Antrag gemacht hätte? Für die großen Konzertsäle hätte es nicht gereicht. Vielleicht hätte sie sich als Geigenlehrerin wiedergefunden. Das Fräulein Zinsser im Haus des Herrn Kommerzienrat, ein kleiner Junge, der sich im Musikzimmer mit einer Etüde von Ševčík quält, sie, die sich mit dem Jungen quält, während sie sich wegträumt auf eine große Bühne, vor ihr der bis auf den letzten Platz gefüllte Saal, hinter ihr das Orchester, und schon morgen eine andere Stadt, Beethovens D-Dur-Violinkonzert oder Schuberts Konzertstück in d-Moll. Brahms, Mozart, Bach, vor allem Bach.
Das Leben zwingt die Träume dazu, sich anzupassen.
Sie hätte so gerne studiert. Geografie oder Medizin, so wie ihr Vater. Die Entdeckung der Welt oder die des Körpers. Die Musik in den Dingen. Oder eine Ausbildung als Gärtnerin, ein Leben in der Natur. Es ist nicht dazu gekommen. Sie und ihre Schwester blieben die Mädchen, höhere Töchter, für die Ehe bestimmt.
Sie war ihren Eltern nie böse deswegen. Sie waren Kinder ihrer Zeit, so wie sie selbst. Sie denkt: Wir werden von unseren Wurzeln geleitet, wir geben weiter, was uns geprägt hat, und am Ende gehen wir dorthin, wo wir herkommen.
Sie hört Schritte auf dem Gang, gedämpfte Stimmen. Die Tür öffnet sich. Schon beim Hereinkommen merkt sie dem Professor sein Unbehagen an. Die tägliche Visite, er ist ernster als sonst. Auch wenn er geübt ist im Verkünden unangenehmer Neuigkeiten, was er zu sagen hat, fällt ihm nicht leicht. Umstanden von zwei Assistenzärzten und einer Schwester, teilt er ihr mit, dass er sich entschlossen habe, ihr Morphium verabreichen zu lassen gegen die Schmerzen, er bitte um ihre Einwilligung, es mache ja keinen Sinn, das alles ohne jede Betäubung zu ertragen, wo man doch in der Lage sei, ihre allgemeine Situation wenigstens in Teilen erträglicher zu gestalten.
Ihre allgemeine Situation – was für eine alberne Umschreibung für ihr unvermeidliches Sterben. Sie spürt das Bedürfnis, laut loszulachen, aber das würde ihn nur beleidigen.
»Ich danke Ihnen«, sagt sie stattdessen. »Für alles.«
»Ich wünschte, es wäre mehr«, gibt er zurück, in seinem weißen Kittel, das Haar sorgfältig gescheitelt, auf seinem Hinterkopf eine kahle Stelle.
Gefolgt von den Assistenzärzten verlässt er das Zimmer. Die Schwester bleibt zurück, auf dem Rollwagen vor ihr liegt eine aufgezogene Spritze, die bräunliche Flüssigkeit im Inneren des Kolbens wie schlammiges Wasser in einer Pfütze.
Der Gummischlauch, den sie ihr um den Oberarm legt, fühlt sich kühl und fremd an. Genauso kühl und fremd wie die Nadel, die ihr durch die Haut fährt, sie kann das Einströmen des Morphiums in ihre Blutbahn spüren. Und fragt sich, ob sie das wirklich will, den Schmerz nicht länger zu fühlen. Und selbst wenn sie es wollte – was ihr in Wahrheit die Brust zuschnürt, könnte auch alles Morphium dieser Welt nicht lösen.
In den Augen der Schwester spiegelt sich Mitleid. Sie umklammert den Griff ihres Rollwagens. Beim Hinausgehen quietschen die Räder leise auf dem grauen Linoleum. Ihr Rücken wirkt angespannt, die unter der Haube hochgesteckten blonden Haare kräuseln sich am Ansatz ihres Halses, ein goldfarbener Schimmer. Sie ist so jung und schön. Vor ihr liegt ein ganzes Leben. Alles.
6
»Und wenn auch noch so vieles dagegensprechen mag, so spricht doch auch Wesentliches dafür: die vollkommene Aufrichtigkeit meiner Gefühle und – wenn ich die Zeichen richtig deute – auch die der Ihren.«
Konrad Adenauer an Gussie Zinsser, Köln, 17. Mai 1919
Mit einem Strauß Frühlingsblumen erschien er an einem Sonntagnachmittag im Haus ihrer Eltern. Schwertlilien, Narzissen und Ranunkeln, von ihm selbst geschnitten und gebunden. Sie wusste, warum er da war, alle wussten es. Ihr Bruder Ernst machte Witze, ihre Mutter rang um Fassung.
Seit dem Abendessen, bei dem sie Geige gespielt hatte, schrieb er ihr Briefe, zart und unbeholfen zugleich, voll versteckter Sehnsucht, ein verwitweter Mann, neunzehn Jahre älter als sie, in der Mitte seines Lebens und an diesem Leben verzweifelnd, trotz aller beruflichen Erfolge. Da war ein Ton in seinen Zeilen, der sie anrührte und ihr das Herz aufschloss, sie konnte nicht sagen, warum.
Sie schrieb ihm zurück, die unerwartete Vertrautheit zwischen ihnen erschreckte sie. Mit dem Blick folgte sie ihrer Feder, die wie von selbst Worte auf dem Papier entstehen ließ, während sie dachte, dass sie sich ihrem Schicksal entgegenschrieb. Die Tochter eines Professors für Dermatologie und der Oberbürgermeister der Stadt Köln. Dass er drei Kinder hatte von seiner verstorbenen Frau, war ihr egal. Ob sie verliebt war, fragte sie sich nicht. Es hätte nichts geändert.
Er war ihre Zukunft.
Mit der ihm eigenen Förmlichkeit überreichte er ihr das bunte Bukett, ruhig und sachlich, im geprägten Rand des Papiers ein gestanztes Lochmuster.
Ihr Vater bat ihn nach oben in sein Arbeitszimmer, sie blieb mit ihrer aufgeregten Mutter und ihren jüngeren Geschwistern im Wohnzimmer zurück.
Fritz und Charlotte sagten keinen Ton. Der hochaufgeschossene Ernst ließ sich in einen der Sessel fallen, seine langen Beine hingen über der Armlehne.
»Bis dass der Tod euch scheidet«, spöttelte er und faltete die Hände vor der Brust zusammen, als wollte er beten.
»Bist ja nur neidisch«, sagte sie und sah die beiden Männer vor sich, die hinter einer verschlossenen Eichenholztür im ersten Stock über ihre Zukunft sprachen. Der eine, dem sie bisher anvertraut war, der andere, dem sie ihr kommendes Leben anvertrauen wollte.
Bis dass der Tod euch scheidet. Ihn hatte der Tod schon einmal geschieden, sein halbes Leben lag hinter ihm, während ihres noch gar nicht richtig begonnen hatte. Ich lege mein Leben in deine Hände. Würde er sein Leben auch in ihre Hände legen?
»Er ist fast doppelt so alt wie du«, sagte Ernst.
»Du übertreibst.«
»Nur ein Jahr jünger als Papa.«
»Na und?«
»Vielleicht solltest du mit der Hochzeit auch gleich die Beerdigungsmodalitäten klären.«
»Bitte!«, mahnte ihre Mutter.
»Und einen Vertrag aushandeln, der dir für die weitere Zukunft einen jüngeren Liebhaber zusichert.«
»Wirklich witzig«, sagte sie.
»Nicht zu vergessen, seine Kinder«, stichelte er weiter. »Ich werde Onkel, und mein ältester Neffe ist nur zwei Jahre jünger als ich.«
»Das reicht jetzt!«, sagte ihre Mutter.
»Ist doch wahr«, sagte Ernst.
Er hat recht, dachte sie, Emmas Kinder könnten meine Geschwister sein.
Sie würde an die Stelle einer toten Mutter treten. Was mit ihr gestorben war, ließ sich nicht ersetzen. Sie würde nur helfen können, es zu überwinden. Sie würde in dem Haus leben, in dem er mit Emma gelebt hatte, in dem Bett schlafen, in dem er mit Emma geschlafen hatte. Räume voller Erinnerungen, durchwirkt vom Geist einer Toten. Die Ahnung ihres Parfums, die Spur ihrer Finger auf den Tasten des Flügels, der Nachklang ihres Lachens. Und das Einzige, was sie dem entgegenzusetzen hätte, würde ihr eigenes Lachen sein.
»Eine Mutter von drei Kindern«, sagte Ernst. »Von jetzt auf gleich, ohne je selbst eins geboren zu haben.«
Nicht seine Worte taten ihr weh, sondern das, was er damit meinte. Ihr Muttersein wäre nicht mehr als eine Behauptung, eine vorgespielte Rolle, eine leere Hülle. Die Kinder würden sie Mama nennen, nicht weil sie es wollten, sondern weil ihr Vater es von ihnen verlangte. Um ihre verstorbene Mutter nicht zu verraten, würden sie die neue insgeheim ablehnen. Sie würde immer nur die Andere sein, die zweite Frau, eine Fremde im eigenen Haus.
Nein, dachte sie, so wird es nicht kommen. Seine Kinder würden sich an sie gewöhnen und Vertrauen zu ihr fassen. Was sie anzubieten hatte, war sie selbst. Alles andere hatte sie nicht in der Hand.
Sie war mit Worten groß geworden. Im Haus ihrer Eltern war immer über alles geredet worden. Man war, was man dachte. Je freier man dachte, desto freier war man. Denken war Klang, und Klang war Musik. Was sie geben konnte, waren ihre Freiheit und die Musik.
»Und was ist mit seinem Glauben?«, fragte Ernst. »Oder hast du den vergessen?«
»Hab ich nicht.«
»Und wie soll das gehen?«
Die Frage war begründet. Sie war Protestantin, er war Katholik. Seine Kinder waren katholisch getauft worden. Sie würde konvertieren müssen, eine andere Möglichkeit gab es nicht. Aber hatte ihr Vater ihr nicht immer wieder gesagt: Hindernisse sind da, um sie zu überwinden?
Zwei Kirchen, ein Gott, dachte sie. Ein Graben, so tief wie das Meer.
Und wenn sie darin ertrinken würde? Wenn ihr Lachen verhallen und die Musik in ihr verstummen würde? Wenn seine Kinder ihr fremd blieben und das neue Haus ihr keine Heimat werden würde?
Was, wenn es nicht gutginge?
Ernst feixte. Sie hätte ihm am liebsten ins Gesicht geschlagen. Fritz und Charlotte schwiegen noch immer.
»Noch ist ja gar nichts entschieden«, sagte ihre Mutter. Sie saß auf dem Sofa, den Blick hinaus in den Garten gerichtet, die Hände an ihrer Perlenkette, mit den Fingern über die schimmernden Kugeln streichend, als betete sie einen Rosenkranz. In ihren Augen stand die Sorge um das Glück ihrer Tochter, die Angst vor dem drohendem Scheitern.
Schritte auf der Treppe, die höfliche Verabschiedung der beiden Männer. Die Stille nach dem Zufallen der Haustür kam ihr endlos vor.
»Gussie!«
Die Art, wie ihr Vater ihren Namen rief. Ihre Mutter zuckte unmerklich zusammen, Ernst sah sie grinsend an und sagte: »Das Jüngste Gericht hat getagt.«
Sie folgte ihrem Vater die Treppe hinauf ins Arbeitszimmer. Er schloss die Tür hinter ihr, setzte sich an den Schreibtisch und ließ die Sekunden verstreichen, schweigend, wie er es immer tat, wenn er den Dingen Gewicht verleihen wollte. Sein Gesicht unter der goldgeränderten Brille zeigte nichts als die übliche Gleichmütigkeit, aber natürlich wusste sie, dass das alles nur gespielt war. Begleitet vom Ticken der Standuhr in der Ecke neben dem Fenster, zog er den Augenblick immer weiter in die Länge. Und sie, noch immer stehend und deshalb ein gutes Stück größer als er, übte sich in Geduld. Sie wusste ja, was kommen würde.
Unter anderen Umständen hätten sie beide laut losgelacht, ein Vater und seine Tochter, im gemeinsamen Wissen um die hier aufgeführte Komödie. Aber ein Lachen wäre seiner Rolle nicht angemessen gewesen, nicht nach dem vorangegangenen Besuch und dem, worum es dabei gegangen war.
Er nahm seine Brille ab, hielt sie prüfend gegen das Licht, zog das Einstecktuch aus der Brusttasche seines Jacketts und entfaltete es.
»Das ist keine leichte Entscheidung«, sagte er, während er die Gläser zu putzen begann, eins nach dem anderen, ein routiniertes Reiben zwischen Daumen und Zeigefinger. »Es geht um deine Zukunft, dein ganzes Leben.«
Sie fragte sich, was das sein sollte: ihr ganzes Leben? Zeit war etwas Flüchtiges, nicht zu greifen, aber im Überfluss vorhanden. Was man heute verlor, gewann man morgen zurück. Alles passte in einen Tag, manchmal sogar in eine Stunde. Die Zukunft war ein einziges großes Versprechen, ein unscharfes Bild ohne Ränder.
»Und um deine Freiheit«, sagte er und prüfte die Gläser im Gegenlicht. »Willst du wirklich darauf verzichten?«
Er setzte die Brille wieder auf und schaute sie fragend an, in den Augen eine Schwermut, die sie erschreckte. Es war ihm ernst mit dem, was er sagte. Er sorgte sich, dass das, was sie aufgab, schwerer wog als das, was sie gewann. Oder fürchtete er sich einfach nur davor, sie zu verlieren, seine kleine Gussie, die ihm näher war als alles sonst auf der Welt?
»Willst du mich warnen, Papa?«
Er hob abwehrend die linke Hand, während er mit der rechten das Einstecktuch zurück in seine Brusttasche schob. »Ich will nur, dass du dir über die Konsequenzen im Klaren bist.«
»Traust du mir das nicht zu?«
»Ich traue dir alles zu. Das ist es ja gerade. Deine Unbändigkeit. Die Fähigkeit dich zu begeistern. Deine Neigung, dich von dieser Begeisterung davontragen zu lassen.«
Da wusste sie, dass sie gewonnen hatte. Ohne es auszusprechen, hatte er ihr gesagt: Es ist dein Leben, nicht meins, also entscheide selbst. Niemand kannte sie so gut wie er, und niemand wollte ihr so wenig im Weg stehen.
»Und jetzt lass uns schlau sein«, sagte er. »Geben wir deiner Mutter noch ein paar Minuten, bevor wir es ihr verkünden.«
Sie verstand sofort, was er meinte. Auch das war ein Spiel zwischen ihnen. Es sollte so aussehen, als hätte es ein Ringen gegeben. Schließlich musste er der Mutter sagen können, er habe alles versucht, aber seine Überzeugungskraft sei dem Dickkopf seiner ältesten Tochter nicht gewachsen gewesen. Und dass man seine Gussie nicht zu etwas zwingen könne, sei ja nun auch keine neue Erkenntnis.
7
»Die dunklen Jahre sind vorbei, Gussie. Es gibt keinen Grund zu zögern. Richte ihm das von mir aus. Sein Weg liegt klar vor ihm, dieses Land braucht ihn, die Deutschen brauchen ihn!«
Ferdinand Zinsser an Gussie Adenauer, Tübingen, 15. Februar 1948
Die Nacht hat sich über ihr Zimmer gelegt. Und mit der Nacht die Einsamkeit. Die Welt um sie herum schläft. Sie kann schon lange nicht mehr schlafen. Mitunter dämmert sie weg, ein Hinabgleiten ins Halbbewusste, bis sie das Rasseln in ihrer Brust wieder aufschrecken lässt.
Ihr Körper hat Angst vor dem Sterben, ihr Gehirn hat keine Macht über ihn. Losgelöst von ihrem Denken und Fühlen, will er weiterleben. Anders als ihr Geist ist er noch nicht bereit.
Nach dem Abendessen kam Konrad. Seit sie hier liegt und auf ihr Ende wartet, haben sie nicht ein einziges Mal über ihre Krankheit gesprochen. Sie will es nicht, er kann es nicht. Er versucht, sich auf ihr Ende vorzubereiten, aber er weiß nicht, wie.
Er setzte sich neben ihr Bett und hielt ihre Hand. Die Traurigkeit hinter seinem sich mühsam abgerungenen Lächeln erschreckte sie. Eingegraben in den Furchen seines Gesichts das, was hinter ihm lag, die Landkarte seines gelebten Lebens. Was vor ihm lag, war ungewiss.
Wie üblich begann er zu erzählen. Ein Tag voller Sitzungen. Ein informelles Treffen mit der britischen Militärverwaltung. Neuigkeiten über den Verlauf der Londoner Sechsmächtekonferenz, die Spannungen zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion, alles inoffiziell natürlich. Wohin würde die Reise gehen? Für ihn, für seine Partei, für sein Land?
»Was soll ich tun, Gussie?«
»Das, was du immer getan hast. Politik machen.«
»Auf meine Art.«
»Auf welche sonst?«
Sie blickt hinaus ins Dunkel und denkt: mein Deutschland, das Land der Mörder, der Wiederaufbau einer Wüste. Das Alte ist noch nicht vorbei, und das Neue hat noch nicht begonnen.
Sie war achtzehn, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Vier Jahre später gab es die Welt, in die sie hineingeboren war, nicht mehr. Dass sich die Katastrophe wiederholen würde, erschien undenkbar. Was folgen würde, konnte niemand vorhersehen. Als sich das Vorhersehbare nicht länger leugnen ließ, war es zu spät. Jetzt ist sie zweiundfünfzig. Die Katastrophe hat sich nicht nur wiederholt, sie hat sich übertroffen. Sechs Jahre lang haben sich die Grenzen des Denkbaren immer weiter verschoben. Bis zu jenem Augusttag vor zweieinhalb Jahren, als eine einzige Bombe die Leben von Zehntausenden Japanern auslöschte. Die Uhren in Hiroshima blieben um acht Uhr fünfzehn stehen. Seitdem ist alles denkbar.