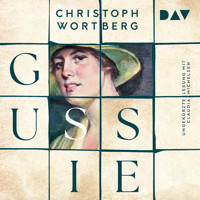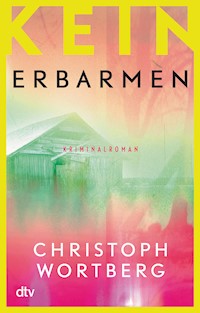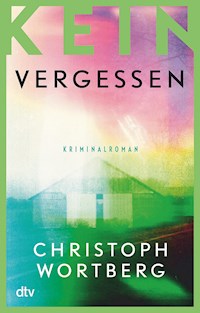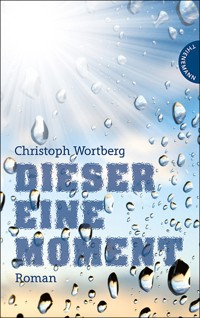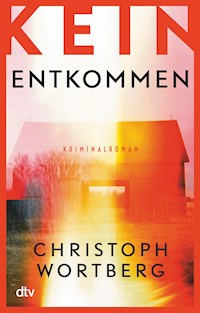
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Trauma-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Packender erster Fall für Kommissarin Katja Sand Zwei Tote, der eine ertrunken in einem See, der andere erstickt in einem Kühlschrank. Doch handelt es sich wirklich um Suizide, wie es die Obduktion nahelegt und der Psychoanalytiker Dr. Hanning, bei dem beide Männer in Behandlung waren, bestätigt? Genau das bezweifelt die Münchner Mordermittlerin Katja Sand und gräbt sich mit Assistent Rudi Dorfmüller tiefer in die Fälle. Die beiden stoßen auf einen vertuschten Skandal in der Bundesmarine. Je mehr schmutzige Details Katja ans Tageslicht bringt, desto mehr wächst der Druck von oben. Bis ihr die Fälle entzogen werden und Katja vor einer folgenschweren Entscheidung steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Zwei Tote, der eine ertrunken in einem See, der andere erstickt in einem Kühlschrank. Doch handelt es sich wirklich um Suizide, wie es die Obduktion nahelegt und der Psychoanalytiker Dr. Hanning, bei dem beide Männer in Behandlung waren, bestätigt? Genau das bezweifelt die Münchner Mordermittlerin Katja Sand und gräbt sich mit Assistent Rudi Dorfmüller tiefer in die Fälle. Die beiden stoßen auf einen vertuschten Skandal in der Bundesmarine. Je mehr schmutzige Details Katja ans Tageslicht bringt, desto mehr wächst der Druck von oben. Bis ihr die Fälle entzogen werden und Katja vor einer folgenschweren Entscheidung steht.
Dieser Band ist unter dem Titel ›Trauma – Kein Entkommen‹ 2021 bei dtv erschienen.
Von Christoph Wortberg sind bei dtv außerdem erschienen:
Kein Vergessen
Kein Erbarmen
CHRISTOPH WORTBERG
KEIN ENTKOMMEN
Katja Sands erster Fall
Kriminalroman
The itsy bitsy spider
climbed up the waterspout.
Down came the rain
and washed the spider out.
Out came the sun
and dried up all the rain
and the itsy bitsy spider
climbed up the spout again.
Alter Kinderreim
Erster Teil WASSER
Das kleine Kind lag in seinem Gitterbett. Es presste den Stoffhasen an sich, den die Mutter ihm geschenkt hatte. Der Hase hatte lange Ohren aus Frottee, mit denen sich das Kind über das Gesicht strich. Tief saugte es den vertrauten Geruch ein, dieses so eigene Gemisch aus Speichel und Schweiß, aus eingetrockneten Speiseresten und dem Bohnerwachs, mit dem die Mutter die Holzböden im Haus behandelte. Der Geruch gab ihm Sicherheit.
Ein einziges Mal hatte die Mutter den Hasen gewaschen. Danach hatte er nicht mehr nach Hase gerochen, nur noch nach Waschmittel. Das Kind war verzweifelt gewesen, hatte geschrien und um sich getreten. Es hatte sich erst beruhigt, als die Mutter ihm versprach, den Hasen nie wieder zu waschen. Seitdem nahm das Kind ihn mit, egal, wohin. Es ließ ihn nicht mehr allein. Der Hase war alles, was es besaß. Es musste ihn davor beschützen, gewaschen zu werden, es musste seinen Geruch bewahren, ohne den es nicht sein konnte, weil dann die Angst kam, die so groß war, dass sie das Kind erdrückte.
Abends brachte die Mutter das kleine Kind ins Bett. Sie beugte sich über sein Gesicht, strich ihm liebevoll übers Haar und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Die Bienen und Schmetterlinge auf dem Schirm der Nachttischlampe leuchteten. Die Mutter ging hinaus. Die Lampe ließ sie eingeschaltet, die Tür lehnte sie an, damit das Kind hören konnte, dass es nicht allein im Haus war. Das beruhigte das Kind. Es drehte sich auf die Seite, den kleinen Kinderdaumen im Mund, den Kopf im Kissen vergraben. Es schaute auf die Bienen und die Schmetterlinge auf dem Lampenschirm, es hielt den Hasen im Arm und drückte ihn an sich, die langen Ohren lagen auf seinen Wangen. Die Bettdecke hüllte das Kind ein, die Welt roch nach Hase, alles war gut. Dann fielen ihm die Augen zu, wie von selbst, und es schlief ein.
So war es sonst, aber an diesem Abend war es anders. An diesem Abend konnte das Kind nicht einschlafen. Die Lampe war nicht eingeschaltet, die Tür war geschlossen, die zugezogenen Vorhänge ließen kein Licht von draußen herein. Die Angst war größer als jede Müdigkeit.
Nicht die Mutter hatte das Kind ins Bett gebracht, sondern der Vater. In der Hand hatte er eine Flasche gehalten, seine Augen waren gerötet gewesen, sein Atem hatte nach Wut und Ärger gerochen. Das Kind hatte die Luft angehalten, um seinen beißenden Atem nicht riechen zu müssen. Der Vater hatte es mit seiner freien Hand gepackt und über die Gitterstäbe in das Kinderbett gehoben. Dabei hatte er kein Wort gesagt. Das Kind hatte sich nicht getraut, ihn anzuschauen. Es hatte nach seinem Hasen gegriffen, war unter die Decke geschlüpft und hatte die Augen zugepresst. Den Kopf zur Wand gedreht, hatte es gehört, wie der Vater die Vorhänge zuzog, die Lampe mit den Bienen und Schmetterlingen ausschaltete, die Tür hinter sich schloss. Erst als seine Schritte verklungen waren, hatte das Kind gewagt, die Augen wieder zu öffnen.
Jetzt lag es da und sah nichts. Nur nachtschwarze Dunkelheit. Nicht mal der Hase tröstete es und der Daumen in seinem Mund. Das Kind rührte sich nicht, sein Körper versteifte sich. Dann spürte es etwas Warmes aus sich herauslaufen. Es hatte gelernt, dass das falsch war, mehr als einmal hatte der Vater in das Kind hineingeprügelt, dass das falsch war. Aber das Kind konnte es nicht zurückhalten, die Flüssigkeit lief zwischen seinen Beinen heraus, in seinen Pyjama und weiter in das Laken.
Das Kind griff nach den hölzernen Stäben des Gitterbettes. Den Hasen an sich gepresst, tastete es sich an den Stäben entlang. Am Fußende war eine Lücke. Durch die schob es sich hinaus in die Schwärze des Zimmers, es spürte die Dielen des Bodens unter seinen nackten Fußsohlen, der nasse Stoff des Pyjamas rieb an seinen Beinen. Das Kind tastete sich durch die Dunkelheit zur Tür. Es wusste ja, wo sie sein musste. Mit der Hand suchte es nach der Klinke, drückte sie herunter und zog die Tür auf.
Auch der Flur war dunkel, aber von der Treppe her fiel Licht herauf. Das Kind lauschte. Von unten drangen merkwürdige Geräusche an sein Ohr. Irgendetwas knallte. Dann hörte es die Mutter wimmern.
Das Kind ging zögernd die Treppe hinunter. Stufe um Stufe folgte es dem Licht und den Geräuschen, die aus dem Wohnzimmer kamen. Das Wimmern der Mutter wurde lauter. Auch der Vater war jetzt zu hören. Er grunzte. Und dann war da ein gleichmäßiges Klatschen, das sich nicht zuordnen ließ.
Das Kind erreichte die Wohnzimmertür. Auf dem Boden eine leere Flasche in einer Lache aus Bier. Der Vater lag auf der Mutter. Ihre Hose und ihr Slip waren bis auf die Kniekehlen heruntergezogen. Das Becken des Vaters hob und senkte sich, schnell und immer schneller. In seinen Mundwinkeln sammelten sich Speichelfäden. Die Mutter wimmerte unter seinem massigen Leib. Seine merkwürdigen Bewegungen schienen sich in ihren Körper fortzusetzen. Sie hatte die Augen geschlossen, schwarze Tränen liefen ihr aus den Augenwinkeln die Wangen herab.
Das Kind stand da und begriff nichts.
Die Mutter öffnete die Augen, als würde sie spüren, dass das Kind da stand, in der Wohnzimmertür, nur ein paar Meter von ihr entfernt. Sie schaute es an mit ihren weinenden Augen und schüttelte kaum merklich den Kopf. Das Kind verstand nicht, dass das eine Warnung war, dass die Mutter es mit ihrem Blick anflehte, das Zimmer zu verlassen. Es blieb weiter stehen, den Hasen fest an sich gedrückt, und schaute auf die Mutter und den Vater und auf das, was er mit ihr machte.
Der Vater hielt unvermittelt inne. Er hatte die Anwesenheit des Kindes bemerkt. Er drehte den Kopf zur Tür, seine blutunterlaufenen Augen fixierten das Kind, sein Mund stand halb offen. Er leckte sich den Speichel von den Lippen, schaute an dem Kind hinunter, sein Blick verharrte auf dem dunklen Fleck zwischen seinen Beinen. Er wälzte sich von der weinenden Mutter herunter und stand auf, schob sein erschlafftes Glied zurück in die Hose, dann griff er nach dem Gürtel.
Das Kind starrte auf den Gürtel in der Hand des Vaters. Der Gürtel sagte: Was machst du hier, du kleines Stück Scheiße? Warum bist du nicht im Bett? Und was soll dieser verdammte Fleck zwischen deinen Beinen? Kannst du deine Pisse nicht zurückhalten, du verdammte Missgeburt?
Die Mutter blickte den Vater flehend an. Ihre Augen sagten: Mach das nicht, bitte! Aber der Vater ging auf das Kind zu, er zog den Gürtel durch seine Hand, und seine Wut schien mit jedem Schritt größer zu werden.
Das Kind drehte sich um und rannte los. Seine nackten Füße flogen über den Holzfußboden. Durch den Flur in die Küche und weiter zur Tür in den Garten. Seine Hände streckten sich nach der Klinke, sie war kalt. Seine Finger drückten sie herunter, während der Vater immer näher kam, den Gürtel in der Hand, in den Augen diese unfassbare Wut.
Das Kind öffnete die Tür. Eisige Kälte schlug ihm entgegen, prallte wie eine Faust auf sein angstgeweitetes Gesicht, seinen winzigen Kinderkörper, den Fleck zwischen seinen Beinen. Es hörte, wie der Gürtel auf den Küchentisch knallte, den Herd, ein gnadenloses Peitschen. Es rannte hinaus in die Nacht, über die schneebedeckte Wiese, seine Füße hinterließen Abdrücke im gefrorenen Weiß. Das Kind musste den Schuppen erreichen, bevor der Gürtel das Kind erreichte. Die Kälte fuhr in seine kleine Lunge, der Schmerz zerriss es fast, es schnappte nach Luft, seine Füße brannten.
Bleib stehen, du Sau!, rief der Gürtel, aber das Kind rannte weiter, riss die Tür zum Schuppen auf, kroch unter die alte Werkbank, kauerte sich in die hinterste Ecke. Metallspähne bohrten sich durch den Stoff seines Pyjamas. Das Kind presste den Hasen an sich. Es rührte sich nicht und hoffte, dass es unsichtbar war und das alles nicht wahr war, auch wenn es nicht wusste, was Hoffnung bedeutete, weil es das Wort noch gar nicht kannte.
Der Vater stand in der Schuppentür, das Kind konnte seine Füße sehen. Wo bist du!, schrie sein Gürtel, der durch die Luft sauste und eine Dose mit Nägeln von der Werkbank fegte.
Das Kind hielt die Luft an, aber das nützte ihm nichts, weil der Vater es entdeckt hatte. Eine kurze Ewigkeit lang passierte nichts, der Gürtel schwieg, nur das wutgetränkte Atmen des Vaters durchschnitt die Stille, dann sah das Kind seine Hand auf sich zukommen, die nach Zigaretten roch und nach Gewalt. Die Hand tastete über seine Beine, seinen Bauch, in dieser plötzlichen Stille, die schlimmer war als das Peitschen des Gürtels oder die merkwürdigen Geräusche, die der Vater gemacht hatte, als er auf der Mutter gelegen hatte.
Die Hand erreichte den Hasen und hielt inne. Dann packte sie zu und riss das Stofftier an sich. Das Kind wollte schreien, aber es konnte nicht. Der Vater beugte sich hinunter, kniete sich hin, er starrte das Kind unter der Werkbank an, dann schnellte seine Hand erneut vor. Mit einem einzigen Ruck zog er das Kind aus seinem Versteck.
Der Hase lag auf der Werkbank, daneben der Gürtel. Das Kind wartete darauf, dass der Vater mit dem Gürtel zuschlagen würde, aber stattdessen nahm er einen kleine Kanister aus dem Regal und schraubte den Deckel ab, langsam, ohne jede Eile. Sein Mund verzog sich zu einem schiefen Grinsen.
Das Kind kannte den Geruch, der aus dem Kanister stieg. Es war derselbe Geruch, der ihm in die Nase stieg, wenn der Vater mit ihm zur Tankstelle fuhr. Eigentlich mochte das Kind diesen Geruch, sehr sogar, aber jetzt machte er ihm Angst.
Der Vater grinste noch immer. Er nahm den Hasen hoch. Dabei schaute er das Kind an. Er griff nach dem Kanister und goß den Inhalt über den Hasen. Wieder wollte das Kind schreien, wieder blieb es stumm. Der Vater zog ein Feuerzeug aus seiner Hosentasche.
Das Kind wollte sich wegdrehen, aber der Vater packte es an den Haaren. Schau gut hin, schrien seine Augen. Dann betätigte er das Feuerzeug und hielt die Flamme an den Hasen.
Der Hase fing an zu brennen, lichterloh brannte er, seine Beine, sein Körper, seine langen Ohren aus Frottee. Und mit ihm verbrannte alles, was dem kleinen Kind lieb war. Der Vater schleuderte den brennenden Hasen hinaus in die Nacht, die Flammen fraßen sich durch seinen weichen Körper. Langsam schrumpfte er in sich zusammen, bis er nur noch ein rauchender Klumpen aus verbranntem Stoff war, das gebrochene Herz eines dreijährigen Kindes inmitten eines kleinen Sees aus geschmolzenem Schnee.
1
Bleischwer liegt der Himmel über der Stadt. Ein Sonntagvormittag Ende August, die Wolken so tief, dass sie die Dächer der Hochhäuser zu streifen scheinen. Alles ist grau. Selbst die bunten Firmenlogos der Konzerne, die Geschäftsreklamen in den Fußgängerzonen, die Tankstellenschilder an den Ausfallstraßen.
Seit Wochen leidet München unter einer extremen Hitzewelle. Die Rasenflächen in den Parks sind verdorrt, die Isar nur noch ein trauriges Rinnsal, der Asphalt auf den Straßen so weich, dass er beim Überfahren nachzugeben scheint. Die Menschen sind der Sonne überdrüssig, sehnen sich nach Regen. Jetzt ist er endlich da.
Katja Sand sitzt in einem Kombi vor dem Einkaufszentrum in Neuperlach. Die Tropfen prasseln auf die Windschutzscheibe, laufen am Glas entlang. Das Armaturenbrett ist mit Staub überzogen, die Gummimatten im Fußraum sind spröde und rissig. In der Ablage der Fahrertür liegt ein leerer Kaffeebecher, daneben die zusammengeknüllte Papiertüte einer Fastfoodkette. Der Wagen riecht nach kaltem Schweiß und Nikotin. Es ist verboten, in den Dienstwagen zu rauchen, aber keiner der Kollegen hält sich daran.
Weder der Regen noch der schäbige Zustand des Kombis interessieren Katja. Sie schaut zu Fink, der entspannt neben ihr auf dem Beifahrersitz sitzt, eine Hand am Türgriff, die andere auf seinem Knie. Lange Finger, vom Sommer gebräunt, die Nägel gepflegt. Eine schöne Hand. Sanft und trotzdem männlich. Sie mag die ruhige Art, mit der er eine Sache durchzieht, wenn es darauf ankommt, entschlossen und klar. Zweifel sind ihm fremd. Anders als ihr.
»Was ist?«, fragt er.
»Was soll sein?«
»Nervös?«
»Du leitest den Einsatz.« Ihre Stimme klingt rau, Fink muss ihr die Verunsicherung anhören.
»Wir können jederzeit abbrechen, wenn du willst«, sagt er und deutet auf das Funkgerät, das auf der Mittelkonsole liegt. »Deine Entscheidung.«
Sie antwortet nicht. Sie sieht Jenny vor sich. Der Zweifel zerreißt sie, aber besser eine falsche Entscheidung treffen als keine. Hier geht es nicht um sie, hier geht es um die Zukunft ihrer Tochter. Eine Mutter muss ihr Kind beschützen, egal, wie.
»Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten, um jetzt einen Rückzieher zu machen«, sagt sie.
Er legt seine Hand auf ihren Unterarm. Ihr Körper spannt sich an, Sehnsucht überflutet sie. Der Hunger nach Berührung. Sie hat ihn vor zwei Jahren bei einem Einsatz kennengelernt. In einem Hinterhof in Solln war ein Drogentoter gefunden worden. Katja war hinzugezogen worden, weil der Verdacht auf Gewalteinwirkung bestand. Die Nähe zwischen ihr und Fink war von Anfang an greifbar. Dabei ist es geblieben, auch nach dem Ende der Ermittlungen. Jedesmal, wenn sie sich treffen, ist da diese unausgesprochene Anziehung. Mehr als einmal hat sie sich gefragt, was daraus geworden wäre, wenn sie sich früher begegnet wären.
Er schaut sie an. Das schlechte Gewissen steht ihr ins Gesicht geschrieben. Sie weiß: Mit dem, was sie hier tut, überschreitet sie eine Grenze, hinter die sie nie wieder zurückkann. »Wenn es um meine Tochter ginge, würde ich dasselbe tun«, sagt Fink.
»Du hast keine.«
»Ich kann eben nur Söhne.« Er lächelt.
Sie beneidet ihn um seine Fähigkeit, den Dingen Leichtigkeit zu geben, in allem etwas Positives zu finden. Er wäre der Richtige für sie gewesen. Der Fels in der Brandung, der Anker in der Strömung. »Kann doch auch an deiner Frau liegen«, sagt sie und schaut auf den Ehering an seinem Finger. Ein schmaler Streifen aus Gold, eine unüberwindliche Grenze.
Er antwortet nicht. Sie kann ihm ansehen, wie es in ihm arbeitet. Die Stimmung zwischen ihnen verändert sich. Eine winzige, kaum spürbare Verschiebung.
»Was?«, fragt sie.
Langsam dreht er ihr den Kopf zu. Seine Frage kommt aus dem Nichts und trifft sie wie ein Schlag. »Würdest du mit ihr tauschen?«
Ihre Blicke treffen sich. Er hat das ausgesprochen, was sie gedacht hat. Sie hat das Gefühl zu taumeln. Als würde der Sitz unter ihr nachgeben. »Nicht dein Ernst.«
»Seit ich dich kenne. Hast es bloß nicht bemerkt.«
Katja versucht, in seinem Gesicht zu lesen. Die Leichtigkeit ist verschwunden, in seinen Augen liegen Traurigkeit und Schmerz. Zwei Menschen, die einen Ausweg aus ihrer Einsamkeit suchen. »Vielleicht wollte ich es nicht bemerken«, sagt sie.
»Oder so«, sagt er und versucht erfolglos, seine Niedergeschlagenheit wegzulächeln.
»Ich wusste nicht, dass es nicht gut läuft zwischen euch.«
»Kennst du einen Polizisten, dessen Ehe gut läuft?«
Nein, denkt sie, kenne ich nicht. Und fragt sich, warum das Leben so voller Klischees ist und warum so viele dieser Klischees einen wahren Kern haben.
»Sie betrügt mich«, sagt Fink und schaut hinaus in den Regen. »Schon seit Monaten. Ein Elektriker aus Laim. Eine eigene Firma, drei Angestellte. Wir haben ihn und seine Frau letztes Jahr im Urlaub kennengelernt. Der Campingplatz in Kroatien, wo wir immer hinfahren. Sie glaubt, ich weiß von nichts. Nur Augen für den Job und so. Manchmal denke ich, es wäre besser, blind zu sein.«
Ja, denkt sie, manchmal wäre das besser. Die Tage einfach so an sich vorbeiziehen zu lassen, ohne hinschauen zu müssen.
»Da ist er«, sagt sie und deutet auf den Rückspiegel.
Er ist neunzehn. Groß und schlank, das markante Gesicht mit den hohen Wangenknochen eingerahmt von halb langen blonden Haaren und dem Schatten eines Dreitagebartes. Er sieht aus wie Jesus.
»Sieht aus wie Jesus«, sagt Fink.
»Ja«, sagt Katja.
Er geht am Wagen vorbei, ohne sie zu bemerken. Er heißt Joshua. Jenny nennt ihn Josh. Katja wundert sich, dass sie ihm gegenüber keine Feindseligkeit verspürt. Im Gegenteil. Die Art, wie er geht, hat etwas Argloses an sich, eine liebenswerte Unbeholfenheit. Katja versteht ihre Tochter. In ihrem Alter hat sie einen ganz ähnlichen Geschmack gehabt.
Fink greift nach dem Funkgerät. »Okay?«
»Okay«, sagt Katja und spürt die Trockenheit in ihrem Mund.
Fink drückt die Sprechtaste. »Macht euch bereit, es geht los.«
Er hat seine Selbstsicherheit zurückgewonnen. Alles Private zwischen ihnen ist verschwunden. Jetzt zählt nur noch eins: die Sache durchzuziehen. Sie kennt das von sich selbst. Die Eigendynamik einer Entscheidung. Vielleicht ist sie auch deshalb zur Kriminalpolizei gegangen. Die eindeutige Trennung zwischen Gut und Böse, kein Platz für persönliche Zweifel. Und doch sind es vor allem ihre Zweifel, die zu ihrem beruflichen Erfolg beitragen. Weil sie Katja zwingen, offen zu bleiben. Sich einzulassen auf die Grauzone zwischen Schwarz und Weiß. Nur so lässt sich mit den Abgründen leben, in die sie täglich blicken muss: das Erschrecken der Täter, einen Mord begangen zu haben, die grausame Erkenntnis, die Tat nie wieder loszuwerden. Schlimmer als einen Menschen gewaltsam aus dem Leben zu reißen, ist nur, mit der daraus erwachsenden Schuld leben zu müssen.
Sie versucht, sich auf den Einsatz zu konzentrieren. Was hier passiert, ist ein Betrug, das ist ihr klar, auch wenn sie ihn aus Verantwortung begeht. Mutter und Tochter, ein fragiles Gebilde aus Liebe und Ablehnung. Katja, die von Jenny Respekt einfordert und von ihrer eigenen Hilflosigkeit überwältigt wird. Jennys wütende Urgewalt, die an ihren Vater erinnert. Ein über ihnen schwebender Schatten, verführerisch für die Tochter, bedrohlich für die Mutter.
Katja blickt durch den Regen zu Neumaier hinüber, den die Kollegen wegen seines jugendlichen Aussehens »Baby« nennen. Ein ausgemergelter, ständig nervöser Drogenfahnder, der den Kunden spielt und den Kontakt zu dem Jungen hergestellt hat. Ein paar Telefonate mit Informanten, ein erstes Treffen in einer der einschlägigen Kneipen, danach die Verabredung zum Kauf. Crystal und Ketamin. Für den Anfang eine überschaubare Menge. Falls die Qualität stimmt, gerne auch mehr.
Als Joshua ihn sieht, bleibt er stehen. Er streicht sich das nasse Haar aus der Stirn, schaut sich um, als wäre er plötzlich unschlüssig. Dann geht er weiter und nickt Baby zu, auf seinen Schultern die Spuren der Nässe.
Widerstreitende Gefühle, die an ihr zerren, die sie zerreißen: Du darfst das nicht tun, du musst das tun! Ihr wird schlecht. Der Impuls, wegzurennen, der Wunsch, vor der Verantwortung zu fliehen. Vielleicht hätte sie doch auf Finks Angebot eingehen und die Aktion abbrechen sollen. Jetzt ist es zu spät.
Joshua hat Baby inzwischen erreicht. Die beiden reden miteinander, ohne sich anzuschauen. Die ritualisierte Abwicklung eines Deals, eine Szene wie im Film, keine zwanzig Meter von Katja entfernt. Durch die getönten, verregneten Scheiben des Kombis sieht sie die Plastiktütchen in Joshuas Hand.
Fink schaut sie an, sie nickt ihm zu.
»Zugriff!«, sagt er ins Funkgerät.
Katja sieht einen weiteren Kollegen von Fink aus einem parkenden Auto springen und dem überrumpelten Jungen die Hände auf den Rücken drehen, während Neumaier alias Baby verabredungsgemäß davonläuft.
»Wir sehen uns später«, sagt Fink und steigt aus. Er tritt zu dem Kollegen, zückt seinen Dienstausweis und legt Joshua Handschellen an. Zu zweit schieben sie den Jungen in den Wagen des Kollegen. Joshuas Gesicht ist schmerzverzerrt, seine Augen glasig vor Angst.
Kein Jesus mehr, denkt Katja, nur noch ein vom Regen durchnässter Neunzehnjähriger, den sie um jeden Preis von ihrer Tochter fernhalten muss, damit er sie nicht mit sich in den Abgrund reißt. Sie fragt sich, wie Jenny reagieren wird. Wenn alles gutgeht, wird sie glauben, dass er sich nichts mehr aus ihr macht. Sie wird sich die Augen aus dem Leib heulen und sich irgendwann, ein paar Wochen oder Monate später, in einen anderen verlieben.
Und wenn es nicht gutgeht?
Der Wagen des Kollegen fährt los, die Reifen hinterlassen Schlieren auf dem nassen Asphalt.
Eine Spur im Regen.
Das Ende einer Unschuld.
2
Katja blickt durch die Scheibe in den Verhörraum. Joshua sitzt am Tisch, verängstigt und verloren. So wie die vielen anderen vor ihm. Um ihren Widerstand zu brechen, lässt man sie warten, eine halbe Stunde oder mehr. Ungewissheit und Stille. Nur die wenigsten halten das aus.
Er ist kurz davor durchzudrehen, das sieht sie ihm an. Immer wieder wandern seine Augen ruhelos durch den Raum, versuchen sich an irgendetwas festzuhalten, aber da ist nichts. Nur nackte Wände und das blickdichte Glas des Venezianischen Spiegels. Er starrt rüber zur Tür. Die einzige Richtung, aus der etwas zu erwarten ist. Rettung oder Vernichtung.
»Ich glaube, er ist so weit«, sagt Fink.
»Ja«, sagt Katja.
»Alles wie besprochen?«
»Genau so.«
Er legt ihr eine Hand auf die Schulter. Eine Geste des Trostes: Du kannst dich auf mich verlassen, ich mach das schon! Er weiß, wie es in ihr aussieht, und sie weiß, dass er es weiß. Seine Verbindlichkeit tut ihr gut. Diese unaufdringliche Art, Nähe zu schaffen, ohne ihr zu nahe zu treten.
»Holger!«
Er dreht sich zu ihr um. »Was?«
»Danke, dass du das für mich tust.«
»Was immer du willst, Katja!« Er lächelt mehrdeutig und verschwindet.
Sie wendet sich wieder dem Jungen hinter der Scheibe zu.
Joshua wippt nervös mit den Füßen. Als sich die Tür öffnet, zuckt er zusammen. Fink kommt herein, eine Akte in der Hand. Er legt sie auf den Tisch und setzt sich. Ruhig und besonnen. Joshua starrt nervös auf den blassrosa Pappdeckel. Fink wartet einen Moment, lässt die Akte wirken. Dann zieht er die bei dem Zugriff in Neuperlach sichergestellten Drogentütchen aus der Brusttasche seines Hemdes und wirft sie wortlos auf den Tisch.
Das Schweigen ist seine Waffe. Es gibt keine bessere. Und keinen, der sie besser einsetzt. Der Jäger und seine Beute, ein geduldiges Lauern ohne sichtbare Gefühle. Fink verzichtet auf drohende Gesten, erspart sich vorwurfsvolle Blicke. Wortlos lässt er die Zeit verstreichen, bis sein Gegenüber die Nerven verliert und anfängt zu reden, sich um Kopf und Kragen redet, bloß um diesem unerträglichen Schweigen endlich zu entkommen.
Dass das alles nicht spurlos an einem vorübergeht, kennt Katja von sich selbst. Das Zermürben eines Tatverdächtigen in der stickigen Luft eines Verhörraums zehrt jedesmal an ihr. Das Vorspielen endloser Geduld, dieses wohlkalkulierte Wechselspiel zwischen Freundlichkeit und Distanz, saugt sie aus. Zwar ist sie erleichtert, sobald sie den Widerstand auf der anderen Seite des Tisches endlich gebrochen hat, beim einen früher, beim anderen später. Aber sobald sie zu Hause ist, schlägt die Erschöpfung durch. Sie sitzt mit ihrer Tochter beim Abendessen, hört zu, wie Jenny von der Schule erzählt oder von ihren Freundinnen, und kämpft verzweifelt darum, Anteil zu zeigen, auch wenn ihr die Kraft dazu fehlt. Und wie war dein Tag, Mama? Gut. Nichts Besonderes. Ganz normal. Jeder Satz eine Qual, jede Antwort eine ungeheure Anstrengung. Was sie wirklich erlebt hat, muss sie vor Jenny verbergen, wie sie sich wirklich fühlt, darf sie nicht zeigen. Und immer wird sie dabei von dem beklemmenden Gefühl begleitet, ihrer Tochter nicht gerecht zu werden.
Katja fragt sich, wie Fink das macht. Wie er es schafft, den Job vom Privatleben zu trennen. Das alles von sich fernzuhalten in den wenigen Stunden zu Hause. Einfach nur da zu sein für seine beiden Söhne und seine Frau.
Kennst du einen Polizisten, dessen Ehe gut läuft?
Katja hat Melanie bei einer Grillparty kennengelernt. Fink hatte Geburtstag und ein paar Kollegen zu sich nach Hause eingeladen. Ein schmaler Reihenhausgarten in Fürstenried-West. Das satte Grün des Rasens, eine Schaukel für die Jungs. Melanie wirkte inmitten der Kollegen wie ein Fremdkörper, bemüht, aber hilflos. Sie liebte ihren Mann, das war ihr anzusehen, aber sie hasste es, die Frau eines Polizisten zu sein.
Katja wendet sich wieder dem Schweigen hinter der Scheibe zu. Joshua reagiert genau wie erwartet. Zieht sich in sich zurück wie ein bockiges Kind. Nimmt den ungleichen Kampf an, den Blick gesenkt, die Hände über den immer heftiger wippenden Knien ineinander verschränkt. Er versucht, sich an sich selbst festzuhalten, minutenlang, bis er begreift, dass er keinen Halt finden wird. Katja spürt Mitleid mit ihm. Niemand hat ihn genötigt, Drogen zu verkaufen, aber sie hat ihn in diesen Verhörraum gezwungen, in dieses aussichtslose Ringen mit sich selbst und gegen Fink, ohne auch nur zu ahnen, worum es wirklich geht.
Fink schaut zu ihr herüber. Ihre Blicke treffen sich hinter dem verspiegelten Glas, auch wenn er sie nicht sehen kann. Er weiß, wo sie steht, und nickt ihr unmerklich zu. Dann nimmt er die Akte vom Tisch, schlägt sie auf. Sie ist leer, aber das kann Joshua nicht sehen.
»Du bist neunzehn«, sagt Fink und beginnt sachlich abzuspulen, was Katja ihm über den Jungen erzählt hat. »Nach der Scheidung deiner Eltern hast du die Schule abgebrochen. Du hast eine Lehre als Schreiner gemacht, die du vor drei Monaten mit der Gesellenprüfung abgeschlossen hast. Du lebst in einer Wohngemeinschaft in Laim mit einem Maschinenbaustudenten aus Augsburg und einer koreanischen Musikstudentin, die du nicht leiden kannst, weil sie den ganzen Tag Geige übt. Was ich übrigens gut verstehen kann.« Er schlägt die leere Akte zu, legt sie zurück auf den Tisch.
Joshua glotzt ihn an. »Woher wissen Sie das alles?«
Von Jenny, denkt Katja und spürt, wie sich ihr Magen zusammenzieht.
»Ich bin die Polizei«, sagt Fink freundlich, »schon vergessen?« Er nimmt die Tütchen mit den Drogen vom Tisch, dreht sie zwischen seinen Fingern hin und her. »Seit wann dealst du?«, fragt er.
»Ich denke, Sie sind die Polizei«, erwidert Joshua. Der verzweifelte Versuch einer Gegenwehr. Ein letztes Aufbäumen, rührend in seiner Hilflosigkeit.
Katja erinnert sich daran, wie Jenny ihr Joshua vorgestellt hat. Die Verliebtheit der beiden flatterte durch den Raum wie ein bunter Schmetterling. Ihr erster Freund! Er stand neben ihr und gab Katja schüchtern die Hand, ein scheues Lächeln im Gesicht. Auch wenn sie ihn sofort mochte, war sie erschrocken. Neunzehn! Vier Jahre älter als Jenny. Und woher kam dieser unruhige Ausdruck in seinen Augen, dieser flackernde Blick?
Zuerst schrieb sie ihr Misstrauen ihrer Überempfindlichkeit als Polizistin zu. Bis zu dem Tag, als Jenny anfing, sie zu belügen. Sie wollte bei einer Freundin übernachten. Katja hatte nichts dagegen. Aber dann rief die Freundin bei Katja an. Ob Jenny da sei. Sie versuche schon die ganze Zeit, sie auf ihrem Handy zu erreichen, aber Jenny gehe nicht dran. Katja wusste, wo sie ihre Tochter finden würde. Sie setzte sich ins Auto und fuhr zu Joshua. Jenny lag nackt in seinem Bett. Auf dem Nachttisch ein brennender Joint. Und eine Schachtel mit Kondomen.
Ein Heimweg ohne Worte, ein sprachloser Abend. Jennys Schluchzen hinter ihrer abgeschlossenen Zimmertür, während Katja hinaus in die Dunkelheit starrte und sich fragte, wohin das alles noch führen würde.
Mitten in der schlaflosen Nacht kam Jenny zu ihr ins Bett, schmiegte sich schweigend an sie, ein verletztes Kind auf der Suche nach Schutz. Erst als sie am nächsten Morgen beim Frühstück saßen, brach sie ihr Schweigen.
»Warum tust du das, Mama?«
»Tue ich was?«
»Hinter mir herspionieren?«
»Warum lügst du mich an?«
»Ich bin alt genug.«
»Um im Bett deines Freundes nackt zu kiffen?«
»Und wenn schon!«
»Er ist vier Jahre älter als du.«
»Ich liebe ihn.«
»Das ist das, was du glaubst.«
»Das ist das, was ich fühle.«
»Du wärst nicht die Erste, deren Gefühle missbraucht werden.«
»Nur, weil du ihn nicht leiden kannst.«
Katja schaute ihre Tochter an. Irgendetwas in ihr hatte sich verändert. Jenny war nicht länger ihr kleines Mädchen.
»Hast du mit ihm geschlafen?«
»Was soll die Frage?«
»Da lagen Kondome neben seinem Bett.«
»Na und?«
»Habt ihr sie benutzt?«
»Ja«, sagte Jenny zögernd, »haben wir.«
Ein Schreck, aber keine Überraschung. Früher oder später wäre es sowieso dazu gekommen.
»Wenigstens etwas«, sagte Katja.
»Warum bist du so zynisch?«, fragte Jenny.
»Ich bin nicht zynisch, ich mache mir Sorgen um dich. Mütter tun das in der Regel. Schon mal gehört?«
»Alle machen sich Sorgen«, sagte Jenny und nahm ihre Hand. »Auch Töchter um ihre Mütter.« Und nach einer kurzen Pause: »Weißt du noch, wie alt du warst bei deinem ersten Mal?«
»So alt wie du«, sagte Katja leise. Sie fühlte sich wie ein kleines Mädchen. Ihre Hand in der ihrer Tochter. Jennys Finger strichen über ihre, liebevoll und warm. Die Rollen waren vertauscht.
»Er hat mich nicht dazu gedrängt«, sagte Jenny. »Ich hab ihn darum gebeten. Ich wollte es unbedingt. Und ich bin froh, dass es passiert ist.«
»War es wenigstens schön?«
»War es. Und sag jetzt nicht: ›Na, immerhin‹.«
Sie lächelte ihrer Mutter zu. Das Lächeln eines arglosen Mädchens im trügerischen Zauber eines falschen Glücks.
Finks Stimme reißt Katja aus ihren Gedanken zurück in den Verhörraum des Rauschgiftdezernats der Münchner Kriminalpolizei.
»Das mit den Drogen ist das eine«, sagt Fink zu dem eingeschüchterten Joshua. »Das andere ist die Sache mit dem Mädchen.«
»Wie bitte!?«
»Die Kleine ist erst fünfzehn.«
»Na und?«
»Stell dich nicht blöder, als du bist.«
»Ich hab sie zu nichts gezwungen.«
»Fragt sich, ob der zuständige Richter das auch so sieht.«
»Ich lass mir von Ihnen nichts anhängen.«
»Ich brauche dir nichts anzuhängen, so tief, wie du in der Scheiße sitzt.«
»Was wollen Sie von mir?«
»Alles. Die ganze Geschichte. Von Anfang an. Nicht mehr und nicht weniger.«
Katja fragt sich, welchen Anteil sie selbst hat an dem, was hier geschieht. Der Tag, an dem sie Fink angerufen und gefragt hat, ob irgendwas gegen den Jungen vorliege. Sein Versprechen, sich darum zu kümmern. Ein paar Stunden später sein Rückruf. Joshua stand auf einer Liste, aber bis auf einen vagen Verdacht hatten sie nichts gegen ihn in der Hand. Katja hätte das alles auf sich beruhen lassen können, einfach darauf vertrauen, dass Jenny rechtzeitig erkennen würde, dass sie sich auf den Falschen eingelassen hatte. Aber wann war das, rechtzeitig? Und wie weit vertrug sich Jennys Recht auf Vertrauen mit Katjas Pflicht zur Verantwortung?
Katja traf eine Entscheidung. Sie ließ es nicht auf sich beruhen. Stattdessen stellte sie eigene Nachforschungen an, durchleuchtete den Jungen heimlich, überprüfte seine privaten Kontakte. Es dauerte nicht lange, bis sie fündig wurde. Er hatte mit dem Dealen angefangen, um sein knappes Lehrgeld aufzubessern. Es gab immer einen Grund, sich selbst etwas vorzumachen. Fast jede kriminelle Karriere basierte auf einem Selbstbetrug. Und auch wenn er kein professioneller Dealer war, er war auf dem besten Weg dahin. Eine Einbahnstraße in den eigenen Untergang. Wer sich mit den falschen Leuten einließ, saß in der Falle. Den wenigsten gelang der Absprung.
Fink war wenig erstaunt gewesen, als sie ihn erneut angerufen hatte. »Dahinter steckt was Privates, richtig?«
»Er ist mit Jenny zusammen.«
»Hab ich mir schon gedacht.«
»Ich brauche deine Hilfe.«
»Keine Sorge, wir finden schon was.«
Sie betrachtet Joshua. Er scheint begriffen zu haben, dass er verloren hat. In sich zusammengesunken sitzt er da, keine Spur mehr von Widerstand, keine Farbe mehr im Gesicht, nur noch ein graues Häufchen Elend. Er tut ihr leid. Und wieder ist da dieses Ringen in ihr. Zum hundertsten Mal die Frage, ob sie zu weit gegangen ist, und zum hundertsten Mal die Antwort: Es gibt keine Alternative!
»Also gut«, sagt Fink zu Josh, »gehen wir deine Optionen durch. Erstens: Du machst das, was die Typen, mit denen du dich eingelassen hast, von dir erwarten. Hältst dicht und lässt dich verknacken. Ersttäter, Jugendstrafrecht, du könntest auf eine milde Strafe hoffen. Wenn da nicht die Sache mit dem Mädchen wäre.«
»Ich hab doch gesagt, dass ich sie zu nichts gezwungen hab.«
»Und ich hab gesagt, dass es auf den Richter ankommt. Außerdem weißt du nicht, ob sich die Eltern der Kleinen einen Anwalt nehmen.«
»Sie hat bloß eine Mutter«, sagt Joshua leise.
»Bitte?«, fragt Fink.
»Bei der Kripo.«
»Moment mal.« Fink spielt den Erstaunten. »Hast du gerade Kripo gesagt?«
»Hauptkommissarin bei der Mordkommission.«
»Dann hast du die Arschkarte!«
»Wieso? Sie weiß doch, dass Jenny und ich … Es war okay für sie.«
»Bis jetzt vielleicht. Aber wenn sie spitzkriegt, dass der Freund ihrer Tochter ein Dealer ist, sieht das ganz anders aus. Dann wird sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dir einen Einlauf zu verpassen. Oder dein Richter kommt auf die Idee, dass das mit dem Mädchen nur ein Vorwand war, um an die Mutter ranzukommen. Um rauszukriegen, gegen wen sie so alles ermittelt. Du kapierst, worauf ich hinauswill?«
»Ja«, sagt Joshua leise.
»Dann sind wir uns einig, dass diese Variante keine gute Nummer ist.«
»Und die zweite Option?«
»Reiner Tisch«, sagt Fink. »Alle Namen, die dir einfallen. Auf deiner Ebene und der darüber. Wer dich beliefert, an wen du deine Kohle abdrückst und wo das Zeug herkommt, das du vertickst. Das ganze Programm.«
Fink macht seine Sache hervorragend. Der perfekte Schauspieler in einem widerwärtigen Stück. Joshua besteht jetzt nur noch aus Verzweiflung. Kein Boden mehr unter den Füßen, in jeder Pore seines Körpers die nackte Angst.
»Die werden das rauskriegen«, wimmert er. »Wenn ich im Knast lande … Die haben ihre Leute da. Und dann, was passiert dann?«
»Weiß ich nicht«, erwidert Fink, »kann ich dir nicht sagen.« Er lehnt sich zurück, verschränkt die Arme hinter dem Kopf und wartet.
Joshua überlegt fieberhaft. Katja kann sehen, wie es in ihm arbeitet. Und dass er keine Lösung findet.
»Gibt’s nicht noch ’n dritten Weg?«, fragt er schließlich.
»Einen dritten Weg?«, wiederholt Fink, der nur auf diese Frage gewartet hat. Unmerklich lächelt er in Richtung Spiegel.
Joshua bekommt das in seiner Panik nicht mit. »Was weiß ich«, jammert er. »Irgendwas, um da heil rauszukommen.«
»Du willst, dass ich dich gehen lasse?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber gemeint.«
»Was würden Sie denn an meiner Stelle tun?«, schreit Joshua. Er verliert die Nerven, fängt an zu heulen, schlägt unvermittelt seine Stirn auf die Tischplatte.
Fink springt auf, reißt ihn an den Haaren zurück. »Beherrsch dich«, befiehlt er. »Zieh hier bloß keine Show ab!«
Der Einzige, der hier eine Show abzieht, bist du, denkt Katja.
»Bitte«, flüstert Joshua heiser. »Ich bitte Sie!«
»Hast du dich wieder im Griff?«, fragt Fink kalt.
»Ja.«
»Sicher?«
»Ja.«
Fink lässt die Haare des Jungen los und geht zurück zu seinem Platz. Er tut so, als würde er nachdenken, angestrengt, minutenlang, während Joshua ihn reglos anstarrt, bereit, auch noch den kleinsten Strohhalm zu ergreifen.
»Okay«, sagt Fink schließlich, »weil heute Sonntag ist. Ich helfe dir, wenn du mir hilfst. Du gibst mir den Namen deines Lieferanten, und ich sorge dafür, dass niemand erfährt, von wem wir den Tipp haben. So weit klar?«
»Ja.«
»Du bist doch Schreinergeselle. Ich kenne da eine Firma in Wiesbaden. Die suchen immer jemanden.«
»Ich soll nach Wiesbaden?«
»Willst du lieber in den Knast?«
»Nein.«
»Dann halt den Ball flach. Ich ruf für dich da an. Und du packst deine Sachen und verlässt noch heute deine Wohngemeinschaft. Und noch was: Finger weg von dem Mädchen. Kein Kontakt mehr. Weder persönlich noch am Telefon. Schick ihr einfach eine Nachricht, dass es vorbei ist und sie dich in Ruhe lassen soll.«
»Das kann ich ihr nicht antun.«
»Willst du mit mir über die Bedingungen diskutieren?«
»Nein.«
»Dann hätte ich jetzt gerne den Namen. Und vergiss nicht: Ich hab dich im Auge. Rund um die Uhr.«
So ist das, denkt Katja auf der anderen Seite der Scheibe. Sie merkt, dass sie friert. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Jetzt muss sie mit den Konsequenzen leben.
Drüben im Verhörraum notiert sich Fink den Namen, nimmt die Akte und die Drogentütchen vom Tisch und steht auf.
»Gehen wir«, sagt er.
Der Kaffee schmeckt fürchterlich. Säuerlich und bitter. Sie sitzen in Finks Büro und schauen hinaus in den Regen. Der Himmel ist nur noch eine graue Masse, ohne jede Kontur. Die Flure des Dezernates sind leer. Bis auf die Kollegen von der Bereitschaft ist niemand da.
Deswegen haben sie den Sonntag gewählt. So wenig Zeugen wie möglich. Die wenigen Eingeweihten werden schweigen und die Sache vergessen, das hat Fink ihr versprochen. Es wird keinen Bericht geben, der Einsatz wird nie stattgefunden haben.
Durch ein Fenster hat Katja den Jungen über die Straße davongehen sehen, mehr ein Schlurfen als ein Gehen, den Blick gesenkt, die Schultern gebeugt. Fink hat ihn zur Pforte begleitet, jetzt rührt er in seinem Kaffee.
»Zufrieden?«, fragt er.
»Du warst gut«, sagt Katja.
»Nicht besser als sonst.«
»Glaubst du, er hat die Lektion verstanden?«
»Willst du dein schlechtes Gewissen beruhigen?«
»Hat er?«
»Mit Sicherheit«, sagt Fink.
Katja schaut in die lauwarm gewordene Tasse in ihrer Hand. Die Kondensmilch macht die braune Brühe nicht besser. Auf der Oberfläche schwimmen weiße Flocken. »Ich mache mir Sorgen«, sagt sie.
»Deswegen sind wir doch hier«, versucht Fink zu scherzen.
»Jenny wird mir Vorwürfe machen.«
»Du hast doch gehört, was ich zu dem Jungen gesagt habe. Sie wird es nicht erfahren.«
»Sie wird es mir ansehen.«
Fink zieht die Augenbrauen hoch, schüttelt den Kopf. »Du machst es mir echt nicht leicht, weißt du das?«
»Ja, weiß ich. Trotzdem danke.« Er tut ihr leid. Sie weiß, wie das auf ihn wirken muss: Er setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um ihr einen Gefallen zu tun, und sie gibt ihm das Gefühl, dass das nicht genug ist.
Fink nimmt ihre Hand.
»Wie gesagt, Katja: was immer du willst.« Und wieder ist da dieses mehrdeutige Lächeln.
Sie zieht ihre Hand zurück. »Lass uns aufhören damit, Holger.«
»Wir haben doch noch gar nicht angefangen.«
»Du bist verheiratet.«
»Noch.«
»In Wahrheit willst du, dass es so bleibt.«
»Das liegt nicht bei mir.«
»Das liegt nur bei dir!«
Es ist absurd. Sie sitzt dem Mann gegenüber, dem sie sich am liebsten hingeben würde, und versucht, seine gescheiterte Ehe zu retten, nur damit sie sich ihm nicht hingeben muss. Sie versteht sich nicht. Und fragt sich zum hundertsten Mal, ob sie sich überhaupt jemals verstanden hat.
»Du musst mehr mit ihr reden, Holger. Wie es in dir aussieht, was der Job mit dir macht. Sie muss wissen, was du tust. Damit sie nicht vergisst, wer du bist.«
Das Lächeln verschwindet schlagartig aus seinem Gesicht, das Band zwischen ihnen zerreißt. »Ich soll ihr von meinen Einsätzen erzählen? Von den nächtlichen Razzien in den Clubs? Von den zugedröhnten Schickeriakindern, die in den Villen ihrer Eltern Kokspartys feiern, während ihre Alten sich beim Wochenendtrip auf Ibiza mit Champagner volllaufen lassen? Von den Junkies, die selbst ihre Zähne an die Sucht verloren haben und in den Papierkörben am Stachus oder am Sendlinger Tor nach Pfandflaschen suchen? Oder von den Kurieren aus Südamerika, die im Klinikum Großhadern um ihr Leben ringen, nachdem die Drogenkondome in ihrem Bauch geplatzt sind? Das alles soll ich ihr erzählen? Sie mit dieser Scheiße vollmüllen? Verarsch dich selbst!«
»Lass sie einfach nur an deinem Leben teilhaben. Sie hat ein Recht darauf.«
»Das geht nicht.«
»Wer sagt das?«
»Das kann ich nicht!«
»Hast du es jemals versucht?«
Er schaut sie an, voller Wut. »Ausgerechnet du sagst mir das? Die Frau, die den Freund ihrer Tochter mit einem getürkten Einsatz dazu bringt, sie zu verlassen? Das ist echt stark, Katja, ganz große Klasse!«
Sie spürt die Verzweiflung, die hinter seiner Wut liegt. Er will nicht mit ihr über seine Frau reden, er will gerettet werden, ohne sich stellen zu müssen. Genau wie Katja. Aber es würde niemals funktionieren zwischen ihnen. Sie muss es beenden. Ein für allemal.
»Melanie liebt dich«, sagt sie. »Und du liebst sie!«
»Halt die Klappe, Katja!«
»Gib ihr die Chance, dich nicht zu verlassen.«
Fink starrt sie an, dann dreht er sich um und verlässt wortlos das Büro. Sein breiter, kräftiger Rücken. Die Sehnsucht, die er in ihr auslöst, jedesmal, wenn sie ihn sieht. Dieser Wunsch, sich an ihn zu lehnen und innezuhalten, wenigstens einen Moment lang.
Was immer du willst, Katja!
Er hat das ernst gemeint. Aber diese Worte werden nur Worte bleiben. Sie weiß es, und er weiß es auch.
Sie tritt hinaus in die Nässe, spürt die Tropfen auf ihrer Haut, in ihren Haaren. Den Wunsch, all das loszuwerden. Abzuwaschen, womit sie sich beschmutzt hat. Keine Chance. Trotzdem genießt sie den Regen.
Sie zieht ihr Handy aus der Tasche, schaltet es wieder auf laut. Fünf Anrufe in Abwesenheit, alle von ihrer Tochter. Sie drückt die Kurzwahltaste mit Jennys Nummer.
»Mama!«
»Hey, Kleine.«
»Wo bist du, ich hab mir Sorgen gemacht!«
Ich auch, denkt Katja, und jetzt muss ich den Preis dafür zahlen. »Ich weiß, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Ich hab mich mit einer Kollegin in einem Café getroffen. Sie hat mich drum gebeten. Ich hab das Handy leise gestellt, damit wir nicht gestört werden. Geht ihr nicht gut. Sie hat Probleme zu Hause. Mit ihrem Mann.«
»Sei froh, dass du keinen hast«, scherzt Jenny.
»Brauche ich nicht«, sagt Katja, »hab ja dich.«
Sie denkt an ihren ungelebten Traum von einer Familie. Vater, Mutter, Kind. An das, was möglich gewesen wäre. Sie hat sich dagegen entschieden. Weil es nicht anders ging. Das Unmögliche war stärker.
»Alles klar, Mama?«
»Alles bestens.«
Wieder eine Lüge. Schon die zweite heute. Der Beginn einer unheilvollen Verstrickung. Ein Kartenhaus aus Lügen, Ausreden, Halbwahrheiten, das irgendwann einstürzen muss.
»Ich hab einen Kuchen für uns gebacken.«
»Womit hab ich das verdient?«
»Gar nicht. Macht aber nichts. Kriegst trotzdem ein Stück. Aber nur, wenn du uns Sahne mitbringst.«
Das Handy an Katjas Ohr summt. Sie schaut auf das Display. Dorfmüller!
»Sekunde, Liebes. Bin sofort wieder bei dir.«
Sie nimmt das Gespräch entgegen. »Passt jetzt nicht, Rudi.«
»Passt nie.«
»Es ist Sonntag.«
»Sonntag ist vorbei.«
»Heißt das …?«
»Genau das heißt es!«
Sie beißt sich auf die Lippen. Nicht jetzt. Bitte, nicht jetzt! »Und wenn ich nicht drangegangen wäre?«
»Hättest du dir früher überlegen müssen.«
»Wo bist du?«
»Auf dem Weg zu dir.«
»Ich bin nicht zu Hause.«
»Sag mir, wo wir uns treffen. Ich hol dich ab.«
Sie überlegt fieberhaft. Wenn er erfährt, wo sie gerade ist, wird er erfahren, was sie getan hat. Vielleicht wird er es verstehen, aber er wird es nicht gutheißen. Und was sie jetzt am allerwenigsten brauchen kann, sind Vorwürfe. Es reicht, wenn sie sich selbst welche macht.
»Feldherrnhalle«, sagt sie. »In zwanzig Minuten.« Sie drückt das Gespräch weg.
»Entschuldige«, sagt sie zu Jenny, »aber da musste ich drangehen.«
»Rudi, oder?«
»Wie kommst du darauf?«
»Höre ich dir an.«
»Tut mir leid.«
»Habt ihr wieder einen Toten?«
»Kann sein, ich weiß es noch nicht.«
»Also kein gemeinsamer Kuchen. Und keine Sahne.«
»Was soll ich machen, Schatz?«
»Sag einfach nicht mehr Schatz zu mir. Oder Liebes. Oder Kleine. Nenn Rudi so, der steht garantiert drauf.«
3
Sie verlässt die U-Bahn am Odeonsplatz. Ihr schlechtes Gewissen hüllt sie ein wie eine giftige Wolke. Ab jetzt wird zwischen Jenny und ihr nichts mehr sein, wie es war. Langsam geht sie die Treppen hinauf. Die Feldherrnhalle glänzt im Regen. Rudis alter Wagen steht schräg gegenüber vor dem Eingang zum Hofgarten, halb auf dem Gehsteig. Seine Parkkünste sind eine Katastrophe.
Er winkt ihr durch das offene Fahrerfenster zu. »Fünf Minuten drüber.«
»Geh mir nicht auf den Wecker.«
»Dafür werde ich bezahlt.«
»Du liebst deinen Job. Und du willst ihn behalten. Wenn du so weitermachst, überlege ich’s mir vielleicht noch mal und schmeiß dich raus.«
Er reicht ihr einen Kaffeebecher und eine Bäckereitüte durchs Fenster. »So wie immer: schwarz mit einem Schuss Milch. Und ein Schokocroissant. Und jetzt steig endlich ein. Sonst überleg ich mir das mit dem Job noch mal und schmeiß selber hin.«
»Klingt echt verlockend.« Katja nimmt einen Schluck aus dem Becher und schreit auf.
»Und verbrenn dich nicht«, sagt Rudi trocken. »Er ist ziemlich heiß.«
Fluchend steigt sie ein, knallt die Beifahrertür zu. Der Duftbaum am Rückspiegel schwingt hin und her. Sein süßlich-penetranter Geruch verschlägt ihr den Atem. »Der Gestank in deiner Karre ist wirklich eine Zumutung!«
»Das ist kein Gestank, sondern Myrrhe-Orange. Was ganz Besonderes. Hab ich mir extra aus dem Ausland zuschicken lassen.«
»Nenn mir den Hersteller, und ich spreng seine Fabrik in die Luft.«
»Hast ja wieder Toplaune heute.«
»Wenn du willst, dass sie sich bessert, wirfst du das verdammte Ding aus dem Fenster!«
»Tut mir leid, gehört zur Innenausstattung. Und die ist nicht verhandelbar.«
»Bitte«, sagt Katja, »dann eben anders!« Sie zieht das Schokocroissant aus der Tüte, schiebt sie von unten über den Duftbaum und drückt die Öffnung unter dem Rückspiegel zusammen. »Quarantäne«, sagt sie. »Soll er doch die Tüte verpesten.«
»Ignoratin«, sagt Rudi und startet den Motor. »Und wehe, du krümelst mir meine Velourssitze voll.«
Der goldfarbene 77er-Granada mit Vinyldach ist Rudi Dorfmüllers Ein und Alles. So gleichgültig ihm seine äußere Erscheinung ist, so pedantisch kümmert er sich um seinen Wagen. Den Lack poliert er regelmäßig von Hand auf. Die Kunststoffflächen im Inneren behandelt er mit speziellen Pflegemitteln, die Holzimitationen mit Möbelpolitur. Die Velourssitze werden einmal in der Woche erst abgebürstet und anschließend abgesaugt. Den Handstaubsauger bewahrt er im Kofferraum auf. Für alle Fälle.
Rudi Dorfmüller ist fast zwei Meter groß und dünn wie ein Aal. Hände und Füße sind riesig, seine Glieder zu lang für Pullover und Hosen. Weil die zu kurzen Ärmel seine Pulsadern nicht bedecken, friert er ständig. Behauptet er jedenfalls. Weshalb er zu jeder Jahreszeit einen grünen Bundeswehrparka mit einer kleinen Deutschlandfahne auf einem der Ärmel trägt. Obwohl erst Anfang dreißig, zeigen sich unter seinen braunen Haaren auf dem scharf geschnittenen Kopf schon jetzt die ersten lichten Stellen. In spätestens zehn Jahren wird sein Schädel komplett kahl sein. Was ihm völlig egal ist.
Rudi lebt in einer kleinen Wohnung in Trudering. Katja ist noch nie dagewesen, aber sie kann sich vorstellen, wie es dort aussieht. Jedenfalls nicht so sauber wie im Inneren seines Granadas. Sie dreht sich um, schaut nach hinten. Der grüne Parka liegt auf dem Rücksitz. Für alle Fälle.
Rudi hat sich vor zwei Jahren von Einbruch/Diebstahl zur Mordkommission versetzen lassen. Aus Langeweile, wie er Katja später erzählt hat. Und weil er zu schlau war, um bei den Eigentumsdelikten zu versauern. Als er ihr zum ersten Mal in ihrem Büro gegenübersaß, war sie mehr als skeptisch. Keine drei Monate später konnte sie sich die Arbeit ohne ihn nicht mehr vorstellen.
Rudis Schlagfertigkeit ist ebenso bezwingend wie sein Humor. Dazu diese ganze eigene Art zu denken. Die Fähigkeit, neue Wege zu finden, wenn die Ermittlungen in Sackgassen verlaufen. Das Beste an ihm ist, dass man ihn unterschätzt, wenn man ihn nicht kennt. Was schon so manchem Tatverdächtigen zum Verhängnis geworden ist.
Sie fahren in Richtung Isar und weiter über die Luitpoldbrücke, vorbei am Friedensengel. Kurz darauf passieren sie den Prinzregentenplatz, wo der größte Feldherr aller Zeiten das Bett mit seiner Nichte teilte, ehe sie das Verhältnis beendete, indem sie sich erschoss. Als sie auf die Autobahn fahren, läßt der Regen nach. Der Himmel beginnt sich aufzuhellen. Im Osten zeigen sich erste blaue Flecken zwischen den Wolken.
»Wo fahren wir hin?«, fragt Katja.
»Feldkirchen-West«, gibt Dorfmüller zurück. »Ein Baggersee.«
»Was ist passiert?«
»Möglicherweise nichts, vielleicht aber auch das Schlimmste.«
»Heißt dieses ›vielleicht‹, dass es keine Leiche gibt?«
»Nur, dass bislang keine gefunden wurde.«
»Was wollen wir dann da?«
»Den Tauchern bei der Arbeit zuschauen.«
Sie erreichen den mutmaßlichen Tatort um kurz nach drei. Inzwischen ist die Sonne durchgebrochen, ihre Strahlen tanzen auf dem grünlich trüben Wasser des Sees. Einsatzkräfte der Schutzpolizei sperren die aufgelassene Kiesgrube weiträumig ab. Rudi nickt einem der Beamten zu, lässt die Scheibe herunter, weist Katja und sich aus.
Die Autobahn ist zum Greifen nah. Vorbeischießende Autos, das Sirren der Reifen auf dem abtrocknenden Asphalt, ein permanentes Rauschen.
Sie steigen aus, Katja schaut sich um. Direkt am Ufer steht der Einsatzwagen der Polizeitaucher. Sie sind damit beschäftigt, ihre Pressluftflaschen zu überprüfen und die Suchscheinwerfer, mit denen sie den Seegrund absuchen werden. Zwei ihrer Kollegen lassen mithilfe einer Winde ein Motorboot von einem Anhänger in den See gleiten. Noch ein paar Minuten, dann kann es losgehen.
Katja bemerkt die luftleere Hülle eines Schlauchbootes, halb im Wasser, halb auf dem Sand, eine schlaffe blassgelbe Haut aus Gummi, angehoben und wieder gesenkt von den kleinen Wellen, die unter ihr ans Ufer laufen. Kein Ruder, weder im Boot noch daneben, nur eine einzelne Sandale.
»Sind wir deswegen hier?«, fragt Katja.
»Ganz genau«, sagt Rudi.
»Wo ist die Spusi?«
»Unterwegs.«
Katja deutet auf die Reifenabdrücke der Einsatzfahrzeuge und die zahlreichen Sohlenprofile der Einsatzkräfte im aufgeweichten Boden. Sollte sich das hier tatsächlich als Tatort herausstellen, ist er komplett verunreinigt. »Eine echte Sauerei. Die Kollegen werden sich freuen.«
Sie zieht Latexhandschuhe aus der Tasche, streift sie über. Tritt an das Boot, beginnt es zu untersuchen. Ruhig und routiniert. Keine Mutter mehr, die sich um ihr Kind sorgt, nur noch Polizistin. Es dauert nicht lange, dann hat sie den Schnitt gefunden. Zwanzig Zentimeter lang, sauber und glatt. »Ein Messer«, sagt sie. »Scharfe Klinge, keinerlei Ausfransungen. Der Schnitt wurde in einer einzigen Bewegung ausgeführt.«
Sie wendet sich der Sandale zu, nimmt sie hoch, betrachtet sie sorgfältig von allen Seiten. Rechter Fuß, das Korkbett von der Nässe aufgequollen, die Laufsohle außen an der Ferse stark abgelaufen. Auf der Unterseite ist eine zweistellige Zahl eingeprägt. »Ein Mann mit O-Beinen und Schuhgröße dreiundvierzig. Der Kork hat dafür gersorgt, dass sie nicht untergegangen ist.«
»Wo ist die zweite?«, fragt Rudi.
»Möglicherweise noch an seinem Fuß«, sagt Katja und schaut hinüber zu einem der Streifenwagen, neben dem eine uniformierte Beamtin die Personalien eines jungen Pärchens aufnimmt. Das Mädchen reicht der Beamtin ihren Ausweis. Katja schätzt sie auf höchstens sechzehn. Der Junge ist deutlich älter. Vielleicht Anfag zwanzig. Er sitzt in der geöffneten Fahrertür eines Autos, seine Finger klopfen auf das Lenkrad. Wahrscheinlich will er zeigen, wie wenig ihn das alles angeht.
»Wer ist das junge Glück da?«, fragt Katja.
»Die beiden haben das Zeug hier gefunden und dann die eins eins null gewählt.«
»Was machen die an einem verregneten Sonntagmittag an einem Baggersee?«
»Bin ich Jesus?«, fragt Rudi.
Die Befragung verläuft wie erwartet. Der unangenehme Einblick in das private Leben zweier Unbeteiligter. Sie haben sich erst gestern kennengelernt, ganz in der Nähe, auf der Party eines Freundes von ihm. Das Mädchen war mit einer Freundin dort. Man hat getanzt, der Alkohol ist in Strömen geflossen, auch Drogen waren im Spiel. Nichts Dramatisches, wie der Junge eilig versichert, nur ein paar Pillen und das übliche Gras. Man bemerkte einander, kam ins Gespräch, alberte rum. Nach einem gemeinsamen Joint fing man an rumzuknutschen. Wie das eben so läuft. Dann musste das Mädchen nach Hause. Also haben sie sich für heute verabredet. S-Bahnhof Riem. Er hat sie mit seinem Wagen abgeholt. Sie sind zum Baggersee gefahren. Bei dem Regen waren sie dort ungestört.
Katja schaut in seinen Wagen. Beide Sitzlehnen sind bis zum Anschlag heruntergedreht. »Wie alt bist du?«, fragt sie das Mädchen.
»Fünfzehn.«
»Und du? Oder soll ich Sie sagen?«
»Einundzwanzig.« Er schaut Katja besorgt an. Wahrscheinlich fragt er sich, ob er wegen des Altersunterschiedes Ärger bekommen wird.
»Sex?«, erkundigt sich Katja.
Der Junge nickt, das Mädchen fängt an zu weinen.
»Einvernehmlich?«
»Was wollen Sie denn damit sagen?«
»Du bist volljährig, sie nicht.«
»War ihre Idee«, sagt der Junge und wendet sich an das Mädchen: »Sag ihr, dass du’s unbedingt wolltest.«
Das Mädchen nickt schluchzend.
»Dein erstes Mal?«, fragt Katja.
Ihr Schluchzen wird lauter.