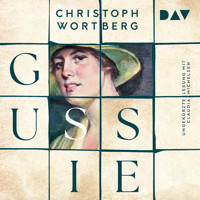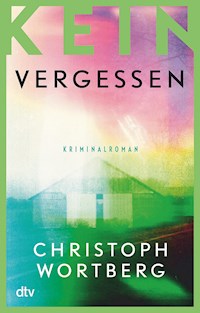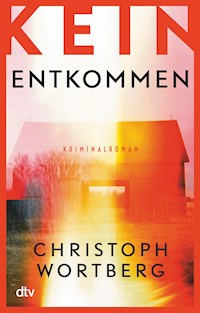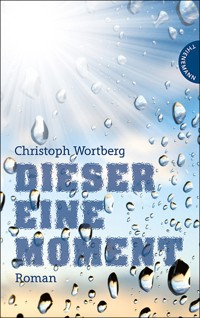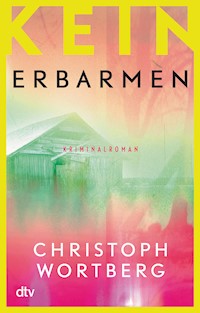
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Katja-Sand-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Das grandiose Finale der Trilogie um Katja Sand Bei einem Hafturlaub bringt der zu lebenslänglich verurteilte Martin Wolf eine Pistole an sich, erschießt zwei JVA-Beamte und ergreift die Flucht. Katja Sand ist wie gelähmt, ihre Vergangenheit holt sie ein. Vor 17 Jahren war sie es, die Wolf ins Gefängnis brachte. Zusammen mit einem Komplizen hatte er einen Geldtransporter überfallen, sechs Millionen Euro erbeutet, einen der Fahrer erschossen und eine Geisel genommen, für die Katja sich austauschen ließ. In einer Scheune im Wald hielt Wolf sie gefangen, die versprochene Hilfe kam nicht. Es gelang Katja, ihren Peiniger mit einem Schuss ins Bein zu überwältigen, doch heute bereut sie, dass sie ihn am Leben ließ. Sie weiß: Wolf will sich an ihr rächen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Christoph Wortberg
Kein Erbarmen
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Erster TeilDAVOR
Das Mädchen stützte die Hände auf dem feuchten Gras ab und beugte sich über das Ufer des Kanals. Schwarzes Wasser, in dem sich graue Wolkenfetzen spiegelten, vom Wind getrieben, dazwischen leuchtend blaue Farbtupfer wie eine flüchtige Erinnerung an längst vergangene, glückliche Tage.
Der Gedanke, auf das Wasser zu schauen und dabei in den Himmel zu blicken, machte das Mädchen schwindelig. So wenig es wusste, was jenseits der schimmernden, spiegelnden Oberfläche verborgen war, so wenig konnte es sagen, was hinter dem Wolkengrau lag, das unter ihm vorbeizog. Die Welt war ein Rätsel, alles war ein Rätsel.
Das Wasser zog das Mädchen magisch an. Es stellte sich vor, das bleierne Schwarz unter der Spiegelung des Himmels zu durchstoßen, es sah sich hinuntertauchen in eine bodenlose Tiefe, weiter und immer weiter hinab, die Augen weit aufgerissen, um sich herum nur Schatten und Schemen, ein letzter Blick zurück nach oben, Reste von Licht, ein stetig abnehmendes Funkeln, bis die Dunkelheit es vollkommen umschloss.
Kein Sehen mehr und kein Hören, nur noch Fühlen. Das an seiner Brust entlangstreichende Wasser kühl und weich, kein Oben, kein Unten, kein Gewicht mehr und kein Körper, ein raumloses Schweben jenseits von Ort und Zeit, der Wunsch, nie mehr auftauchen zu müssen aus diesem grenzenlosen Nichts.
Und plötzlich die Stimme des Vaters, liebevoll und warm.
Fühlt es sich gut an?
Ja, Papa, das tut es.
Was siehst du?
Gar nichts.
Aber das stimmte nicht. Das Mädchen sah sich selbst inmitten des wolkenzerfetzten Himmels, der Wind kräuselte die Wasseroberfläche, und neben ihm das Gesicht des Vaters, die Hand auf der Schulter des Mädchens, sein vertrautes Lächeln.
Das Mädchen wollte sich zu ihm umdrehen, aber es traute sich nicht, weil es Angst hatte, dass er dann nicht mehr da sein würde.
Sie schauten gemeinsam hinunter auf das Wasser und den Himmel darüber. Alles war eins, alles gehörte zusammen.
Das Mädchen fragte sich, was über den Wolken war, hinter dem Blau, das nachts schwarz war, jenseits des Mondes und der Sterne.
Die Unendlichkeit, sagte der Vater und wurde ernst hinter seinem Lächeln.
Das Mädchen verstand nicht, was er damit meinte, und konnte sich nicht vorstellen, was das bedeutete: Unendlichkeit. Hieß das, man ging immer weiter und weiter und kam nie irgendwo an?
Vielleicht ist man ja schon da, erwiderte der Vater. Alles, was da draußen ist, ist auch in dir, die ganze Welt, der ganze Himmel.
Aber das verwirrte das Mädchen erst recht. Wie sollte das alles in seinen kleinen Körper passen, wenn alle Schritte der Welt nicht ausreichten, um die Grenze dieser komischen Unendlichkeit jemals zu erreichen?
Deine Seele, sagte der Vater, ist winzig und riesengroß zugleich, du kannst sie nicht anfassen, du kannst sie nur fühlen. Und manchmal, wenn du traurig bist oder glücklich, dann spürst du darin ein wenig von dieser Unendlichkeit.
Die hellen Flecken im Grau des Himmels veränderten sich. Aus Blau wurde Orange, dann Violett, schließlich ein zartes Rosa. Jenseits der Wolken ging die Sonne unter, die Dämmerung saugte die Farben auf. Alles passierte kaum merklich und rasend schnell zugleich, die Zeit löste sich auf.
Noch immer schaute das Mädchen auf das Wasser unter sich. Die Dunkelheit hatte die Spiegelung verschluckt. Und mit der Spiegelung auch sein Gesicht und das seines Vaters.
Bist du noch da?, fragte das Mädchen.
Natürlich, sagte der Vater, immer, das weißt du doch.
Ja, sagte das Mädchen, das weiß ich. Aber plötzlich war es sich nicht mehr sicher. Angst kroch in ihm hoch, eine bedrohliche Kälte. Es zitterte und fragte sich, ob es sich nicht vielleicht doch zu ihm umdrehen sollte, bloß zur Sicherheit.
Papa?
Keine Antwort. Nur das leise Rauschen des Windes, das Flüstern der Bäume. Und hinter dem Mädchen nichts bis auf die Böschung des Kanals, die kopfsteingepflasterte Straße und eine lange Reihe von Häusern, erleuchtete Fenster hinter schmiedeeisernen Zäunen. Und das Mädchen selbst, kniend auf dem feuchten Gras am Ufer, ein erfrorenes Herz in einem mageren Kinderkörper, die Hände zu Fäusten geballt, den Mund zu einem stummen Schrei aufgerissen. Papa!
Das Mädchen wandte sich wieder dem Kanal zu, starrte auf die unergründliche Schwärze unter sich. Das Wasser rief nach ihm, oder war es der Vater, das Mädchen wusste es nicht. Aber es war ja auch egal, alles war egal. Hauptsache, diese grauenhafte Kälte ließ nach, dieses unerträgliche Gefühl, lebendig erfroren zu sein. Papa! Das Mädchen sehnte sich danach, von ihm umarmt zu werden, den Kopf an seinen Hals zu legen, geborgen und beschützt. Es wollte zu ihm, ganz egal, wo er war.
Das Mädchen ließ sich fallen und wurde im selben Moment zurückgerissen. Die Arme der Mutter, die es gewaltsam an sich zogen, ihr rasender Puls an seiner Wange, in seinen Ohren ein erschrockenes Kreischen: Um Himmels willen, Kind, was machst du da bloß?
Ihre Hand strich dem Mädchen über das Haar, der hilflose Versuch einer Beruhigung, behauptete Zärtlichkeit, Fingernägel, die schmerzhaft über seine Kopfhaut kratzten.
Schweigend saßen sie beim Essen, das Haus um sie herum eingehüllt in lähmende Stille. Das Mädchen sah zu, wie die Mutter mit Gabel und Messer ein Stück Fleisch zerteilte, es sich in den Mund schob und langsam zerkaute. Die Bewegungen ihrer Gesichtshaut, das Knacken ihrer Kiefer, die Geräusche beim Schlucken. Das Mädchen hatte sich noch nie in seinem Leben so einsam gefühlt.
Wir müssen zusammenhalten, sagte die Mutter, wir schaffen das, irgendwann wird es besser, du wirst sehen. Ihre Worte erreichten das Mädchen nicht. Sie tanzten durch den Raum wie Seifenblasen, hohl und ohne jede Bedeutung.
Der leere Platz des Vaters. Er saß reglos da, eine durchsichtige Hülle aus Luft. Sie weiß es nicht besser, sagten seine Augen, sei sanft zu ihr, verurteile sie nicht.
Ich versuche es doch, dachte das Mädchen, aber ich schaffe es einfach nicht.
Du musst etwas essen, sagte die Mutter, den Mund zu einem hilflosen Lächeln verzogen, ihr Gesicht eine furchteinflößende Grimasse.
Das Mädchen starrte sie an und sprang auf. Sein Stuhl fiel um, es war ihm egal. Es rannte die Treppe hinauf in sein Zimmer, warf sich auf das Bett. Die Bienen und Schmetterlinge auf dem Schirm der Nachttischlampe, die Wände, die sich auf seinen kleinen Körper zuschoben, das Fenster ein schwarzes Loch, dahinter die Unendlichkeit, über die der Vater gesprochen hatte.
Das Mädchen verstand das alles nicht, seine Seele war viel zu klein für diese Unendlichkeit, es gab sie nicht, es konnte sie einfach nicht geben.
Du hast mich angelogen, Papa!
Warum sollte ich dich anlügen?
Um mich zu trösten.
Eine Lüge kann nicht trösten, sagte er, sie macht alles nur noch schlimmer. Warum sollte ich alles nur noch schlimmer machen wollen?
Ich weiß es nicht, dachte das Mädchen. Es war zehn Jahre alt, und alles in ihm war durcheinander und kaputt. Und alles würde durcheinander und kaputt bleiben, sein ganzes Leben lang.
Das Mädchen drehte sich auf den Rücken und starrte die Decke an. Mit angehaltenem Atem wartete es darauf, dass Stücke daraus hervorbrechen und es unter sich begraben würden. Aber die Decke blieb ganz, kein Stück brach daraus hervor.
Stattdessen das unwiderstehliche Verlangen, den Mund aufzureißen und nach Luft zu schnappen. Das Mädchen hasste sich dafür, sein Herz schlug wie wild, seine Lungen pochten. Wimmernd kroch es vom Bett, schlich hinüber ins Schlafzimmer der Eltern und zog eine der Schranktüren auf, hinter der die Anzüge des Vaters hingen und über einer Stange seine Krawatten. Das Mädchen strich mit den Händen über die Sakkos, glitt mit den Fingern in die Ärmel, verbarg den Kopf zwischen den Innenfuttern, die nach Liebe rochen und nach Sicherheit.
Schließlich schlüpfte es in den Schrank und zog die Tür hinter sich zu, ließ sich in die Dunkelheit fallen, die Nase erfüllt vom Geruch des Vaters, auf der Haut seine Wärme, in den Ohren sein Lachen. Papa!
Langsam wurde das Mädchen ruhiger. Seinen Kinderrücken an die Schrankwand gelehnt, legte es sich eine Hand auf die Brust und wartete darauf, dass seine Seele sich füllte mit der Unendlichkeit, die der Vater beschrieben hatte, vorhin, als sie gemeinsam auf das Wasser des Kanals geschaut hatten, während der Wind graue Wolken über den Himmel trieb.
1
München liegt hinter ihnen, vor ein paar Minuten haben sie die Stadtgrenze passiert, sie fahren auf der A8 in Richtung Salzburg. Die Scheibenwischer von Dorfmüllers Granada bewegen sich gleichförmig hin und her, schauerartiger Regen, die Ausläufer einer abklingenden Schlechtwetterfront. Katja Sand blickt aus dem Beifahrerfenster auf die vorbeiziehende Landschaft. Hügeliges Ackerland, dazwischen kleine Waldstücke, die Berge im Süden wie eine ferne Verheißung unter einem blassgrauen Himmel. Ein ganz normaler Frühlingstag Mitte Mai, schon morgen soll es wieder sonnig und warm sein, aber seit einer Stunde ist nichts mehr normal an diesem Tag, der so normal begonnen hat.
Das Frühstück mit Jenny, ihre Erwähnung eines Jungen aus ihrer Jahrgangsstufe, dessen Name vorher noch nie gefallen war, ein errötendes »Mama!«, als Katja nachzufragen wagte. Jennys auffällige Eile, nicht zu spät in die Schule zu kommen, ihr scheinbar beiläufiger Blick in den Garderobenspiegel und das genervte Augenrollen, als Katja kommentierte: »Du siehst toll aus!« Schließlich: der Kuss auf Katjas Wange, bevor die Wohnungstür hinter ihr zufiel, ihre Schritte auf der Treppe, zwei Stufen auf einmal, während Katja lächelnd zurück in die Küche ging. Sie ist so stolz auf ihre Kleine, die längst nicht mehr klein ist, sie liebt sie über alles.
Anschließend hat sie geduscht, zufrieden mit sich und ihrem Körper, gegen acht hat sie die Wohnung verlassen und beim Sankt-Anna-Platz die U-Bahn genommen, eine Mordermittlerin auf dem Weg zur Arbeit, bereit für einen neuen Tag. Im November wird sie vierzig.
Sie mag dieses Versinken in der Anonymität eines U-Bahn-Zuges, das stille Beobachten der Fahrgäste. Blicke, die sie zufällig streifen, ein unbekannter Mann, eine fremde Frau. Sie lächelt, freundlich und unverbindlich. Niemand sieht ihr an, was sie beruflich macht.
Es ist eine Menge passiert im letzten Jahr, denkt sie. Dr. Alexander Hanning, ein Psychoanalytiker und Traumatherapeut, der zwei seiner Patienten getötet hat. Nachdem sie ihm die Morde nachgewiesen hatte, hat er versucht, sie auf einem Schrottplatz zu verbrennen. Monate später, nach seiner Verurteilung, hat sie ihn in der Haft besucht. Den Analytiker, nicht den Täter. Er hat ihr geholfen, die Mörderin einer ehemaligen OP-Schwester und eines Kinderchirurgen im Ruhestand zu überführen.
Sie muss oft an ihn denken, an die Gespräche, die sie mit ihm geführt hat im Besuchsraum der JVA Straubing, seine durchdringenden Augen hinter der goldumrandeten Brille. Er hat in sie hineingeschaut wie in ein offenes Buch, mitten hinein in ihre Abgründe, sie hat es zugelassen, das war der Preis für seine Hilfe. Er hat mehr gesehen, als ihr lieb ist.
Sie sieht hinüber zu Dorfmüller. Sein Gesicht ist angespannt, er blickt auf die Straße vor sich. Seit sie losgefahren sind, hat er kein Wort gesagt. Das Schweigen fällt ihm nicht leicht, sie kann es ihm ansehen, aber er weiß, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Fragen ist.
Der Anruf war um kurz nach zwei in ihrem Büro in der Münchner Mordermittlung eingegangen. Dorfmüller hatte ihn entgegengenommen. Ruhig wie immer hörte er zu, stellte kurze Zwischenfragen und machte sich Notizen, während sie ihm gegenüber vor ihrem Computer saß und aufgelaufene Akten abarbeitete, die Finger auf der Tastatur, ihre Gedanken im Irgendwo.
Kurz bevor er auflegte, war sie aufgestanden und zur Kaffeemaschine gegangen, um ihre Tasse zum dritten Mal an diesem Tag zu füllen. Die Kanne noch in der Hand, wartete sie darauf, dass er etwas sagen würde, aber er blieb stumm. Die Art, wie er sie ansah, ließ sie sofort begreifen, dass sie den Rest des Tages nicht mehr am Schreibtisch verbringen würde.
Ein Gewaltverbrechen, dachte sie, jemand hat einen Toten gefunden.
Sie versuchte, in seinem Gesicht zu lesen. Etwas war anders als sonst. Unbehagen, ein merkwürdiges Zögern. Dann sah sie das Mitleid in seinen Augen.
»Jetzt komm schon, Rudi«, sagte sie. »Was ist los?«
Er verzog seine Lippen, rieb sich die riesigen Hände, sein hagerer, fast zwei Meter großer Körper zusammengefaltet auf dem Schreibtischstuhl.
»Zwei Justizbeamte«, sagte er. »Erschossen aufgefunden in ihrem Transporter.«
»Wo?«
»Großhartpenning, südlich von Holzkirchen.«
»Was wollten die da?«
»Sie haben einen Gefangenen zu einer Beerdigung begleitet.«
»Von wo aus?«, fragte sie. »Welche JVA?«
Dorfmüller wand sich. Als wollte er den Namen nicht aussprechen. Dazu dieser Ausdruck in seinen Augen. Er will mich beschützen, dachte sie. Eine dunkle Ahnung kroch in ihr hoch.
»Rudi!«, sagte sie.
»Straubing«, erwiderte er leise.
Der Duftbaum am Rückspiegel des Granadas schaukelt still vor sich hin. Moschus-Tamarinde, herb und säuerlich, eine dieser unsäglichen Geruchskombinationen, die Dorfmüller regelmäßig aus Frankreich bezieht. Normalerweise beschwert sie sich schon beim Einsteigen über die Unerträglichkeit des Gestanks, er verteidigt ihn dann schwärmerisch als olfaktorisches Wunder, ein ewig gleiches Spiel zwischen ihnen, bei dem er stets die Oberhand behält.
Dass sie heute stumm geblieben ist, liegt an dem Namen des Gefangenen, der am Morgen in Begleitung zweier Justizbeamter in einem JVA-Transporter zur Beerdigung seiner Mutter in Großhartpenning aufgebrochen ist. Drei Silben, ein ewiger Albtraum: Martin Wolf, der vor über sechzehn Jahren wegen Mordes an einem Geldtransportfahrer zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Der sich in ihrem Leben eingenistet hat wie ein Krebsgeschwür. Den sie nie losgeworden ist, sosehr sie sich auch bemüht hat.
Dorfmüller nimmt den Fuß vom Gas und fährt an der Abfahrt Holzkirchen auf die Bundesstraße 318 in Richtung Tegernsee. Nach einem Kilometer biegt er rechts ab in die Miesbacher Straße und dann links auf die Bundesstraße 13. Der Regen hat nachgelassen, der Himmel klart auf.
Draußen wird es heller, denkt Katja, und in mir immer düsterer.
Sie kennt die Strecke von früher. Im Sommer kam sie oft her, um mit Freunden im nahen Kirchsee oder im Hackensee zu baden. Das Glitzern der Sonne auf dem weichen Moorwasser, der Wind, der durch das Uferschilf strich, nasse Fußabdrücke auf verwitterten Holzstegen. Badehandtücher im hohen Gras, das Leben eine Verheißung.
Je näher sie dem Tatort kommen, desto mehr zieht sich ihre Brust zusammen. Sie fürchtet sich nicht vor dem, was sie zu sehen bekommen wird – die beiden toten Justizbeamten, die Schusswunden in ihren Körpern, die Blutspritzer auf dem Blech des Transporters –, sie fürchtet sich vor den Gefühlen, die sie überfallen werden, vor der unsichtbaren Anwesenheit des Mannes, der die tödlichen Schüsse abgegeben hat.
Auf einem Parkplatz zwischen Holzkirchen und Großhartpenning steht ein Streifenwagen. An der Fahrertür lehnt ein uniformierter Beamter. Dorfmüller hält an und kurbelt die Scheibe herunter. Er zieht seinen Dienstausweis aus der Tasche des Bundeswehrparkas, den er trägt, seit Katja ihn kennt. Jeden Tag, im Sommer wie im Winter, egal, wie kalt oder warm es ist. Der Parka ist seine zweite Haut.
Er weist sich aus, der Beamte deutet auf einen Feldweg an der nördlichen Seite des Parkplatzes, der zu einem Waldstück führt. Dorfmüller bedankt sich und setzt zurück. Er schaut Katja fragend an, als wartete er darauf, dass sie ihre Zustimmung gibt. Sie weiß, dass er das aus Rücksicht tut, also nickt sie.
Das Knirschen kleiner Steine unter den Reifen, als sie über den Feldweg fahren. Sie schließt die Augen. Plötzlich ist alles wieder da. Ein heißer Sommertag vor mehr als sechzehn Jahren. Sie sitzt auf der Rückbank eines 7er-BMW, neben ihr einer der Geiselnehmer, das Gesicht unter einer Sturmhaube verborgen. Auch sein Komplize am Steuer trägt eine Sturmhaube. Er wirft ihr durch den Rückspiegel einen Blick zu. Kalte Augen, eingerahmt von dem Sehschlitz der Maske, gesteppte Nähte auf dunkler Wolle. Stunden später wird sie sein ganzes Gesicht sehen, ohne die Haube. Noch später wird sie seinen Namen erfahren. Er wird sich für immer in sie einbrennen, genau wie seine Augen: Martin Wolf.
Der Mann neben ihr zieht ein Taschenmesser aus seiner Jeans, lässt es aufschnappen und greift nach dem Saum ihres T-Shirts. Die Klinge fährt in die dünne Baumwolle. Das Geräusch zerreißenden Stoffs. Er rollt den herausgeschnittenen Fetzen zu einer Binde zusammen, legt ihn ihr über die Augen, knotet ihn hinter ihrem Kopf zusammen. Dabei lässt er seine Finger durch ihr Haar gleiten, sein übelriechender Atem streicht über ihren Hals, er stöhnt leise. Sie wehrt sich nicht, um ihn nicht zu provozieren. Sie hört, wie er seine Maske abnimmt, jetzt, da sie ihn und den anderen nicht mehr sehen kann. Papier knistert, als er eine Zigarette aus der Schachtel zieht. Das Aufschnappen und Aufflammen eines Feuerzeuges, sein erster Zug. Der Rauch mildert den Gestank seines Schweißes, auch wenn er ihn nicht überdecken kann.
Sie konzentriert sich auf ihren Atem, um die aufsteigende Panik zu unterdrücken. Das Brummen des Motors, das Sirren der Reifen auf dem Asphalt.
Der Mann am Steuer schaltet das Autoradio ein. Irgendein Country-Song. Gitarre, Bass, im Hintergrund ein Schlagzeug. Dazu eine Frauenstimme, die nach Dolly Parton klingt. Katja stellt sie sich auf einer Bühne vor, auf einem Barhocker sitzend, die Beine in einer engen Hose, die Füße in High Heels, tausendfach gebrochenes Scheinwerferlicht auf einem Oberteil aus glänzenden Pailletten. Die blond gefärbten Haare mit einer Brennschere zu Wellen geformt, glänzend rote Lippen über künstlich geweißten Zähnen.
Die Hand des Mannes neben ihr legt sich auf Katjas Schultern, seine Finger klopfen den Rhythmus der Musik auf ihren Oberarm, als würde er auf ihre Haut schreiben: Du gehörst jetzt mir!
Ihre Muskeln verkrampfen sich, sie wagt nicht, sich zu bewegen. Sie kommt sich ausgeliefert vor und lächerlich. Sie schämt sich für ihre Angst. Das Schlimmste daran: Sie sitzt freiwillig auf dieser Rückbank, niemand hat sie dazu gezwungen.
»Alles okay?«, fragt Dorfmüller.
Sie öffnet die Augen, schaut ihn an. Sie ringt sich ein Nicken ab. Dabei ist nichts okay, gar nichts. Alles ist wieder da.
2
Dorfmüller stoppt den Granada am Ende des Feldweges an der Einmündung in eine Nebenstraße. Ihnen gegenüber das Waldstück, eine Wand aus Bäumen, dunkle Schatten zwischen den hoch aufragenden Stämmen, zum Süden hin Felder, der Blick hinüber nach Großhartpenning, rote Dächer, der Turm der Pfarrkirche. Dahinter wieder Wald, sanfte Hügel, ein Voralpenidyll.
Es regnet nicht mehr, beim Aussteigen zieht Katja der Geruch nach feuchter Erde in die Nase, verdunstendes Wasser auf den Halmen der Felder. Ein paar Kilometer weiter ist die Sonne durch die Wolken gebrochen, vereinzelt strahlende Flecken auf dem Grün der Landschaft, die Vorahnung des Sommers.
Der JVA-Transporter steht am Rand des Waldstücks, die Beifahrerseite den Bäumen zugewandt. Uniformierte Beamte haben mit zwei Streifenwagen die Nebenstraße weiträumig abgesperrt, der eine hundert Meter vor dem Transporter, der andere hundert Meter dahinter. Dazwischen ein Wagen der Spurensicherung und ein dunkelgrüner Alfa Spider mit beigefarbenem Stoffverdeck. Leah Levy ist also schon da.
Die Gerichtsmedizinerin steht in der geöffneten Fahrertür des Transporters, beugt sich über den toten Justizbeamten am Steuer, wie immer passt ihre Kleidung nicht zum Anlass und schon gar nicht zum Ort. Und wie immer ist ihr das völlig egal. Sie hat sich Latexhandschuhe über die Hände und Plastiküberzieher über die hochhackigen Stiefel gezogen, auf dem Saum ihres Mantels Erdspritzer, sie muss ihn anschließend eigentlich reinigen lassen. Aber so, wie Katja sie kennt, wird sie sich damit begnügen, die eingetrocknete Erde herauszubürsten, oder die Flecken ganz einfach hinnehmen und ignorieren.
»Hallo, Leah.«
»Sekunde.« Levy winkt ab, ohne sich zu ihr oder Dorfmüller umzudrehen. »Bin sofort bei euch.«
Katja nutzt die entstehende Pause, um sich ein Bild zu verschaffen. Hinschauen, ohne zu bewerten, wahrnehmen, was ist. Das große Ganze, nicht die Einzelteile. Ein Gefühl für die Atmosphäre des Ortes gewinnen und die Stimmung, die das in ihr auslöst.
Sie blendet alles Überflüssige aus: die uniformierten Kollegen und die Streifenwagen, die Spurensicherer in ihren weißen Overalls, die den Tatort untersuchen, die über die Leiche gebeugte Leah Levy, selbst Dorfmüller, der neben ihr steht, sein schütteres Haar im Wind, die riesigen Hände in den ausgebeulten Taschen seines Parkas vergraben.
Sie denkt sich all diese Menschen weg und konzentriert sich auf den Transporter. Den Moment, in dem er zum Stehen kam, am Rand einer Nebenstraße, die an einem Wald nordwestlich von Großhartpenning entlangführt. Sie schaut in das Innere des Wagens. Das Gitter, das die vorderen Sitze vom hinteren Teil des Wagens trennt, der Rückraum ein Käfig, der das Entkommen für die transportierten Gefangenen unmöglich machen soll. Die Windschutzscheibe ist von innen mit Blut befleckt, genau wie das Armaturenbrett. Neben dem toten Fahrer sitzt der zweite Justizbeamte, die Haut seiner Hände wächsern, bläulich hervortretende Adern unter einer blassen Hülle. Er trägt ein Uniformhemd, die dazugehörige Jacke hängt rechts neben ihm am Haken eines Haltegriffs. Sein noch immer angeschnallter Körper ist in sich zusammengesackt, der Kopf auf die Brust gefallen. Dunkelblondes, kurz geschnittenes Haar, in seinem Hinterkopf eine blutige Schusswunde. Blut, das ihm über den Haaransatz am Hals in den Kragen gesickert ist. Sein Hemd, das sich vollgesaugt hat, ehe das Blut geronnen und eingetrocknet ist. Aufgerissene Augen, eine schmale Nase, der Mund halb geöffnet. Katja schätzt ihn auf Anfang vierzig. Wie immer, wenn sie einen Toten sieht, spürt sie Wut in sich und Hilflosigkeit, wie immer versucht sie, beides zu unterdrücken. Sie kann sich keine Gefühle leisten, nicht jetzt.
Die Schiebetür hinter der Beifahrertür des Transporters ist aufgezogen, das Schloss von innen aufgeschlossen, die vergitterte Tür des Käfigs steht offen, die Sitzbank ist leer. Sie wendet sich um und betrachtet den toten Fahrer, der von Levy untersucht wird. Die Wucht des Schusses hat seinen Oberkörper nach vorne gerissen, das Gesicht liegt zwischen den Speichen des Lenkrads, Arme und Hände hängen herunter. Die schwarzen Haare rund um das Einschussloch in seinem Hinterkopf sind grau meliert, er ist älter als sein Kollege, Katja schätzt ihn auf Ende vierzig.
»Also?«, fragt sie.
Leah Levy schaut sie an, ihre Betroffenheit versteckt hinter einer ausdruckslosen Miene, der jahrelang eingeübte professionelle Umgang mit dem Tod, die einzige Möglichkeit, das alles zu ertragen. »Aufgesetzter Schuss«, sagt sie nüchtern. »Eine Hinrichtung, kalt und präzise. Die Kugel ist oberhalb des ersten Wirbels in den Hirnstamm eingedrungen. Spontaner Exitus, da war sofort Feierabend.«
»Er hat also nichts mehr gespürt.«
»Gar nichts. Macht es aber nicht besser.«
»Nein«, sagt Katja. »Natürlich nicht.« Und dann: »Was ist mit dem anderen?«
»Vom Prinzip her dasselbe, Einschussloch hinter dem linken Ohr, vermutlich Kaliber .22. Die Waffe war nicht aufgesetzt, der Schusskanal verläuft von unten nach oben. Der Täter muss beim Schuss also auf der linken Fahrzeugseite hinter dem Fahrer gesessen und aus Höhe der Hüfte gezielt haben.«
»Dann war der Beifahrer das erste Opfer?«
»Ich schätze, ja.«
»Erschossen während der Fahrt?«
»Halte ich für wahrscheinlich.«
Katja versucht, sich ein Bild vom Tathergang zu machen. Die Morde müssen auf der Rückfahrt erfolgt sein. Martin Wolf, eingeschlossen in seinem Käfig, vor ihm die beiden Justizbeamten, der Blonde und der Graumelierte, arglos und darüber erleichtert, dass der schwierigste Teil ihrer Aufgabe hinter ihnen liegt. Am Morgen sind sie aus der JVA losgefahren, hundertachtzig Kilometer bis Großhartpenning, knapp zwei Stunden Autobahn und Landstraße. Zuvor haben sie den Gefangenen auf mögliche Waffen durchsucht, eine unter der Achsel versteckte Rasierklinge oder einen in seinen Schuhen verborgenen Schlagring. Sie haben nichts gefunden.
Die Trauerfeier und die anschließende Beerdigung sind komplikationslos verlaufen. Ein Gefangener, der sich von seiner toten Mutter verabschiedet, durch Handschellen an einen seiner Bewacher gefesselt, während der andere ihn absichert. Die Worte des Pfarrers am Grab, ausgehobenes Erdreich, eine Schaufel Sand, die auf dem Sarg landet, ein letzter Blick in die lehmige Grube. Vielleicht haben die beiden Beamten Wolf noch eine letzte Zigarette gegönnt, ein paar tiefe Züge mit Blick auf die Berge im Süden zwischen Schlieren aus Regen. Dann das Einsteigen in den bereitstehenden Transporter, das Einschließen in den Sicherheitskäfig, das Starten des Motors.
Die Fahrt zurück nach Straubing. Vorne der Blonde und der Graumelierte, Wolf in ihrem Rücken, durch Stahldraht von ihnen getrennt. Die beiden Beamten sind guter Laune, noch zwei Stunden, dann haben sie Feierabend, es hätte nicht besser laufen können, für sie ebenso wie für Wolf. Er hat sich während des gesamten Ausflugs vorbildlich verhalten, hat jede ihrer Anweisungen befolgt, widerspruchslos, ohne jeden Protest. Er hat sie mit seiner Gefügigkeit eingeschläfert und ihre Vorsicht mit seiner Unterwerfung aufgeweicht. An seinem Körper hat er die Tatwaffe versteckt, die er irgendwann im Verlauf der Beerdigung an sich gebracht hat, eine Kleinkaliberpistole, handlich und unauffällig, das kühle Metall auf seiner Haut. Sie hat an einem geheimen Platz auf ihn gewartet, in der Kirche oder davor, das Versteck war sorgfältig ausgesucht und sicher vor ungewollter Entdeckung.
Jemand hat die Waffe dort deponiert, denkt Katja. Was bedeutet, dass es Mittäter gegeben haben muss, mindestens einen.
Der Graumelierte steuert den Transporter in Richtung Holzkirchen. In Höhe des Parkplatzes – dort, wo Dorfmüller sich später bei einem uniformierten Kollegen nach dem Tatort erkundigt hat – zückt Wolf die handliche, kleinkalibrige Pistole. Er schaut zu dem blonden Beamten auf dem Beifahrersitz, er braucht jetzt Kaltblütigkeit und Glück. Vor ihm der Käfig, die Kugel muss durch das Gitter gehen und den Kopf des Beamten treffen.
Wolf hebt die Waffe, schiebt den Lauf durch den Käfig, stützt ihn auf dem stählernen Gitter ab. Er richtet die Pistole auf den Kopf des Blonden, er ist ganz ruhig dabei, dann drückt er ab. Kaltblütigkeit und Glück, die Kugel dringt hinter dem linken Ohr in den Hinterkopf des Beamten ein, er sackt leblos in sich zusammen. Der Graumelierte reißt erschrocken das Lenkrad herum, der Transporter gerät ins Schlingern, aber er kann ihn abfangen und schließlich zum Stehen bringen.
Im Leerlauf steht der Wagen da, mitten auf der Straße. Der Graumelierte starrt auf seinen leblosen Kollegen, die pulsierende Wunde in seinem auf die Brust gesackten Kopf, blonde Haare voller klebrigem Blut, das ihm den Hals hinunter in den Kragen läuft, rote Spritzer auf den Scheiben, dem Armaturenbrett, überall.
Rüber auf den Parkplatz, sagt Wolf kalt, und dann weiter den Feldweg entlang. Ist ja gut, erwidert der Graumelierte geschockt, oder vielleicht: Verlieren Sie bloß nicht die Nerven, oder einfach nur: Bitte! Dann steuert er den Wagen in die geforderte Richtung, das Geräusch der kleinen Steine unter den Reifen – genau wie eben, als Dorfmüller den Granada über denselben Feldweg gesteuert hat –, Grasbüschel, die über den Unterboden kratzen.
Anhalten, sagt Wolf an der Einmündung zu der kleinen Nebenstraße. Also hält der Graumelierte an, die linken Räder noch auf dem Asphalt, die rechten Räder im Gras. Motor aus, sagt Wolf und dann: Schlüssel!
Der Graumelierte zögert. Wenn ich Ihnen den gebe, bin ich tot, sagt er leise.
Und wenn nicht? Wolf lächelt böse: Vielleicht überlege ich’s mir ja noch mal.
Also reicht ihm der Beamte den Schlüssel durch das Gitter, was soll er auch sonst tun. Seine Hände zittern.
Geht doch, sagt Wolf und schließt den Käfig auf. Ein gezielter Schuss auf das Schloss der Schiebetür, und er zieht sie auf. Aber er steigt nicht aus, wendet sich stattdessen an den Justizbeamten auf dem Fahrersitz.
Bitte, sagt der Graumelierte.
Kopf nach vorne, sagt Wolf.
Der Justizbeamte starrt ihn an.
Nach vorne, wiederholt Wolf.
Der Beamte hebt die Arme, als würde das irgendetwas ändern, seine zitternden Finger vor dem Grün der Bäume hinter den Scheiben. Die Angst färbt sein Uniformhemd dunkel, unter den Achseln und am Rücken. Die Kälte des nahenden Todes, die Pistole in Wolfs Hand. Der metallene Lauf, der sich hebt, die Mündung, die sich gegen seinen grau melierten Hinterkopf drückt.
Ein Schuss, das Zusammenzucken eines Körpers, fallende Arme, der Aufprall eines toten Gesichtes auf dem Lenkrad. Danach: Stille.
Hätte ich Wolf damals erschossen, denkt Katja, dann würden diese beiden Männer noch leben.
»Okay«, sagt sie.
»Was meinst du damit?«, fragt Leah Levy.
»Weiß auch nicht«, sagt Katja. »Nur so.«
Sie wendet sich Dorfmüller zu, der ein paar Meter weiter auf der Straße steht. Er hat ihr den Rücken zugewandt, telefoniert.
»Danke, Leah«, sagt Katja.
»Ich beeil mich mit der Obduktion«, gibt Levy zurück.
Brauchst dich nicht zu beeilen, denkt Katja, ist ja längst alles klar.
Sie geht zu Dorfmüller, der sein Telefonat beendet hat und selbstvergessen auf das Display seines Handys starrt. »Mit wem hast du gesprochen?«, fragt sie.
Er blickt auf. »Die JVA in Straubing. Der Direktor sagt, dass er Rücksprache mit der Anstaltspsychologin genommen hat, bevor er Wolfs Ersuchen auf Freigang stattgegeben hat. Die Akte gab einen negativen Bescheid nicht her. Fünfzehn Jahre lang tadellose Führung. Dazu ein laufender Antrag auf vorzeitige Haftentlassung und ein Gutachten, das ihm eine positive Prognose bescheinigt hat. Und dann natürlich die besondere Härte der Situation. Die eigene Mutter stirbt nur einmal.«
»Jetzt ist nicht nur die Mutter tot«, erwidert Katja.
»Der Direktor wäscht seine Hände in Unschuld.«
»Sternzeichen Arschloch«, sagt Katja trocken. Und fügt düster hinzu: »Haben die toten Beamten Familien?«
»Haben sie«, erwidert Dorfmüller. »Beide verheiratet. Der Beamte auf dem Beifahrersitz heißt Robert Belling, neununddreißig, hat einen Sohn und eine Tochter, neun und zwölf. Der andere, Andreas Meissner, ist sechsundvierzig. Hat erst vor Kurzem zum zweiten Mal geheiratet. Eine Kollegin aus der Justizverwaltung.« Er schaut sie an. Mit diesem ganz speziellen Dorfmüller-Blick. Eine Mischung aus Sorge und Mitleid. Er weiß nur das, was alle wissen: dass Katja Martin Wolf damals festgenommen hat und dass er wegen ihr jahrelang in Straubing gesessen hat, ein skrupelloser Gewalttäter, der einen Geldtransportfahrer erschossen hat, verurteilt zu lebenslanger Haft unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
Schau mich nicht so an, Rudi, denkt sie. Woraufhin er sofort den Blick senkt. Als hätte er ihre Gedanken gelesen. Er spürt immer, wenn er ihre Grenzen überschreitet.
Danke, denkt sie. Und zuckt erschrocken zusammen, weil sie für eine Sekunde das Gefühl hat, dass Martin Wolf hinter Dorfmüller steht und sie mit seinen schadhaften Zähnen voller Spott und Verachtung angrinst.
»Alles klar?«, fragt Dorfmüller.
Sie ignoriert die Frage. »In welcher Kirche in Großhartpenning fand die Beerdigung seiner Mutter statt?«
»Mariä Heimsuchung.«
»Passt ja super«, sagt Katja. »Hast du den Namen des Pfarrers?«
Dorfmüller nickt. »Er heißt Angermaier.«
3
Pfarrer Angermaier erwartet sie vor dem Kirchenportal von Mariä Heimsuchung. Ein Mann um die fünfzig, schwarzer Anzug mit dem obligatorischen weißen Kollar, auf den Schultern vereinzelte Hautschuppen. Klobige schwarze Schnürschuhe mit Gummisohlen, die auf den Steinplatten des Kirchenschiffs leise quietschen. Dünne graue Haare über Geheimratsecken, zu einem Scheitel gekämmt. Auf der auffallend langen Nase eine Brille, eines dieser billigen Gestelle jenseits aller Mode. Dahinter lebendige graublaue Augen, die ständig in Bewegung sind. Beim Sprechen hüpft sein gewaltiger Adamsapfel auf und ab. Alles an ihm erinnert Katja an einen Vogel, wäre da nicht die dunkle Stimme mit dem ausgeprägten bayerischen Einschlag, die so gar nicht zu seiner äußeren Erscheinung passen will. Er redet ohne Unterlass und macht dabei den Eindruck, als würde er ausschließlich sich selbst zuhören.
»Hier hat er gestanden«, sagt er, als sie den Altar erreichen.
»Wer?«, fragt Dorfmüller.
»Der Sarg der Verblichenen«, sagt der Pfarrer.
»Aha«, sagt Dorfmüller.
Angermaiers graublaue Vogelaugen huschen durch die Bankreihen, sein Adamsapfel hüpft auf und ab, sein bayerischer Bass hallt durch das Kirchenschiff.
Die Dora Wolf sei ein Urgestein gewesen, sagt er, zum Zeitpunkt ihres Ablebens achtundsechzig Jahre alt, aufgewachsen in Großhartpenning, verheiratet mit einem örtlichen Bäcker, zwei Söhne, der Martin und der Jürgen, ein Nachzügler, neun Jahre jünger als Martin. Die Dora habe die beiden allein großgezogen und sich zugleich um die Bäckerei kümmern müssen, nachdem ihr Gatte bereits mit Ende dreißig vom Herrn heimgeholt worden sei, ein bösartiger Tumor, Metastasen überall, man kenne das ja. Und jetzt also die Dora, ein Herzinfarkt, der eine Sohn im Gefängnis, der andere in München, sie habe es nicht einmal mehr ins Krankenhaus geschafft. Hinter dem Tresen sei sie zusammengesackt, einfach so, ein Herzog-Josef-Brot in der Hand, das sie gerade für eine Kundin aus dem Regal gezogen habe, um es in die Schneidemaschine zu stecken. Die Kundin habe sofort einen Arzt verständigt, der allerdings nur noch den Tod habe feststellen können.
»Mitten aus dem Leben gerissen«, sagt Pfarrer Angermaier. »Die Pfade des Herrn und so weiter.«
Die Bänke seien voll gewesen bei der Beerdigung, die Dora würde es beglückt zur Kenntnis genommen haben. Schön habe sie ausgesehen und friedlich, wie sie so in ihrem offenen Sarg dalag, während ein Raunen durch die Bankreihen ging, als der Martin die Kirche betrat. In Handschellen sei er hereingeführt worden, begleitet von zwei Beamten der Justizvollzugsanstalt Straubing. Plötzlich sei es ganz ruhig geworden in der Kirche, kein Husten und kein Räuspern mehr, stattdessen habe sich eine ganz eigenartige Stille breitgemacht, er habe an das letzte Abendmahl denken müssen, Jesus im Kreis seiner Jünger, einer von euch wird mich verraten.
Der Jürgen, der vorne saß, sei aufgestanden und habe stumm zugeschaut, wie der Martin nach vorne geführt wurde, im schwarzen Anzug mit dunkler Krawatte, den er sich für den Anlass wohl geliehen hatte, die rechte Hand gefesselt an die linke eines der beiden Beamten. Vorne am Sarg seien die drei stehen geblieben. Der Martin habe auf seine tote Mutter geschaut und leise darum gebeten, sich von ihr verabschieden zu dürfen. Der Beamte habe ihm daraufhin die Handschellen aufgeschlossen und sich umgedreht, genau wie sein Kollege, aus Pietät natürlich. Der Martin habe sich langsam über den Sarg gebeugt, er habe den Kopf seiner toten Mutter mit den Händen umfasst und sie auf die Stirn geküsst. Selbst er, Angermaier, habe sich in diesem Moment abgewandt, er habe da nicht stören wollen. Diese letzten Sekunden des Abschiednehmens, die habe man dem Martin doch zubilligen müssen trotz all der schrecklichen Dinge, die er vor Jahren getan hatte. Auch die Trauergäste hätten sämtlich die Köpfe gesenkt.
»Keiner hat hingeschaut?«, fragt Katja.
»Nein«, erwidert der Pfarrer. »So etwas ist ja immerhin ein sehr intimer Moment. Auch wenn der Martin grauenhafte Dinge getan hat, die meisten kennen ihn noch von früher, er stammt ja aus dem Ort. Jedenfalls hat er sich dann wieder aufgerichtet, der Beamte hat ihn mit den Handschellen erneut an sich gefesselt und sich mit ihm und seinem Kollegen neben den Jürgen in die erste Reihe gesetzt. Ich hab dem Bestattungsunternehmer Brandner aus Holzkirchen zugenickt, dass er den Sarg schließt, und dann habe ich mit der Trauerrede begonnen.«
Nach der Eucharistie hätten die Sargträger den Sarg aus der Kirche getragen, rüber zum angrenzenden Friedhof. Der Jürgen direkt dahinter, dann der Martin und der Rest der Trauergemeinde.
»Und die Beamten waren die ganze Zeit bei ihm?«
»Freilich«, sagt der Pfarrer. »Vorher, währenddessen und nachher.«
Der Martin habe sich anschließend bei ihm für die schöne Trauerrede bedankt (»Wirklich würdevolle Worte, Herr Pfarrer!«), habe seinen Bruder Jürgen mit der freien Hand umarmt (»Bis dann, kleiner Bruder!«) und sei danach von den Beamten wieder in den Transporter gesetzt worden, da sei so ein eingebauter Käfig drin gewesen, da hätten sie ihn eingeschlossen, und dann seien sie mit ihm losgefahren.
»Wann war das?«, fragt Katja.
»So gegen zwölf«, sagt Angermaier.
»Dann war die Verabschiedung von seiner Mutter am offenen Sarg der einzige Moment, in dem er keine Handschellen trug?«
»Ja.«
»Und alle haben sich in dem Augenblick umgedreht oder die Köpfe gesenkt, die beiden Justizbeamten und Sie eingeschlossen.«
»Wegen der Pietät«, erwidert der Pfarrer. »Wie gesagt.«
Katja blickt Dorfmüller an. Er nickt, und sie weiß, dass er dasselbe denkt wie sie: Die Pistole muss im Sarg versteckt gewesen sein, im Futter oder unter der Leiche, in einem unbeobachteten Moment dort platziert, wahrscheinlich von Wolfs Bruder Jürgen.
»Ich würde gerne das Grab sehen«, sagt Katja. »Das von der Dora.«
»Natürlich«, sagt der Pfarrer.
Seine quietschenden Schuhe auf den Steinplatten, sie folgen ihm hinaus, inzwischen hat die Sonne den Kampf mit den Wolken gewonnen, der Himmel hat aufgerissen, die nach Süden abgedrängte graue Front staut sich an den Bergen.
Der Friedhof umgibt die Kirche wie ein Kranz, die alten Gräber nahe beim Chor, die jüngeren zu den Rändern hin. Ganz außen ein frisch aufgeworfener Hügel, saftige Erde, die sich in den nächsten Tagen langsam setzen wird. Ein schlichtes Holzkreuz, der Name der Verstorbenen, das Datum ihrer Geburt, der Tag ihres Todes.
Katja sieht Martin Wolf vor der Grube stehen, eingerahmt von den beiden Justizbeamten, hinter ihm die Trauergemeinde, seine freie Hand greift nach der kleinen Schaufel, die in einem Eimer mit Sand steckt. Er beugt sich vor, Sandkörner, die auf den Sarg unter ihm fallen, um seinen Mund ein heimliches Grinsen, an seinem Körper die Pistole, mit denen er keine halbe Stunde später Belling und Meissner erschießen wird. Zwei zurückgelassene kleine Kinder, zwei weinende Ehefrauen. Narben, die bleiben werden für den Rest ihres Lebens.
»Wir werden den Sarg wieder ausgraben müssen«, sagt Katja.
»Das meinen Sie nicht ernst«, entgegnet der Pfarrer.
»Wir müssen mögliche Spuren sichern. Wegen der Pistole. Die war darin versteckt.«
Der Pfarrer starrt sie sprachlos an, Dorfmüller zieht die Augenbrauen hoch.
Katja wendet sich ab. Und wieder ein Sprung zurück in der Zeit, so wie vorhin auf dem Weg zum Tatort. Mehr als sechzehn Jahre, die sich anfühlen wie ein paar Minuten. Eine dunkle Scheune in der Nacht, Mondlicht, das zwischen den Lücken der Holzsparren hindurchfällt, nur sie und er, Katja Sand und Martin Wolf, in ihrer Hand seine Pistole, in seinem Gesicht ein schiefes Lächeln. Die Mündung der Waffe zeigt auf sein Herz. Na los, mach schon, sagt er voller Verachtung, in seinen Augen die Sehnsucht, einer Verhaftung durch den Tod zu entkommen. Ihr Zeigefinger am Abzug, sie zieht ihn langsam durch, der Druck auf der Sehne, ihr Atem ein einziges Rasen. Hättest du wohl gerne, denkt sie und lässt die Mündung der Pistole im letzten Moment nach unten wandern. Die Kugel schlägt in seinem Oberschenkel ein. In seinem Blick erst Erstaunen, dann grenzenlose Enttäuschung. Sie spürt, wie sich ihre Mundwinkel nach oben ziehen. Jetzt ist sie es, die lächelt.
Eine schweigende Ewigkeit später waren Sirenen zu hören, das Blaulicht von Streifenwagen fiel durch die Zwischenräume der Holzsparren, und dann, endlich, legten sich Peters Arme um sie. Er drückte sie an sich, alles gut, Liebes, sein Atem an ihrem Ohr, der warme Luftzug eines verloren geglaubten Glücks. Und für einen Moment lang hatte sie die Hoffnung, der Albtraum sei endlich vorbei.
Dabei hatte er gerade erst begonnen.
4
Die Exhumierung des Sarges dauert eine Stunde. Schwitzende Arbeiter, die das frische Grab mit Spaten öffnen, Stiche in frische Erde, die Lippen mürrisch zusammengepresst. Was für ein Irrsinn, sagen ihre Augen, da gräbt man mit einem kleinen Bagger ein Loch, senkt einen Sarg hinein, schaufelt es zu, nur um es noch am selben Tag wieder aufschaufeln und anschließend ein zweites Mal zuschaufeln zu müssen.
Hinein und hinaus, der verstorbenen Dora Wolf ist es egal. Ihr friedliches Gesicht, wachsweiß im schimmernden Satinfutter des erdbefleckten Sarges, die von der Nachmittagssonne beschienenen bunten Fenster des Chores, wiederkäuende Kühe auf einer nahen Wiese, die verwitterten Pfähle der Weidezäune.
Katja hat sich Latexhandschuhe über die Finger gezogen, nimmt sich das Innere des Sarges vor. Sie sucht nach einem Hohlraum im Futter, einer aufgerissenen Naht. Sie findet sie links neben Doras totem Kopf, nickt einem herbeigerufenen Spurensicherer zu, der die Stelle untersucht und mehrere Fingerabdrücke auf der Sargwand sicherstellt.
Wolfs Hand ist an der offenen Naht ins Futter geglitten, seine Finger haben nach der heimlich deponierten Pistole getastet, sie ergriffen und unter die Manschette seines Hemdes geschoben, während er, ganz trauernder Sohn, die Stirn seiner Mutter küsste. Danach hat er sich aufgerichtet und sich die Handschellen wieder anlegen lassen. Weder die Trauergäste noch die beiden Beamten haben irgendetwas bemerkt. Er ist ihnen in die Kirchenbank gefolgt, hat seinem Bruder beim Hinsetzen einen Blick zugeworfen, ein kaum merkliches Lächeln, und geduldig der Trauerrede des Pfarrers gelauscht. Nach außen hin der toten Mutter nachweinend, in Gedanken die geplante Flucht durchgehend, hat er am offenen Grab Sand auf den in die Grube gesenkten Sarg geworfen und sich beim Pfarrer für seine tröstlichen Worte bedankt. Schließlich hat er seinen Bruder umarmt und sich widerspruchslos in den Käfig im JVA-Transporter einschließen lassen, amüsiert über die ahnungslosen beiden Beamten, die in seinem Kopf längst tot waren.
Auf der Rückfahrt schweigen sie sich an, Dorfmüller den Blick starr auf die Straße gerichtet, Katja mit ihren Gedanken im Irgendwo. Der hilflose Versuch zu begreifen, was passiert ist, und sich gleichzeitig auszumalen, was daraus folgen wird. Die Landschaft fliegt an ihr vorbei, ein unscharfes Bild, ein verschwommenes Gemälde aus grünen und grauen Farbtupfern, nirgendwo ein Fixpunkt, an dem sie sich festklammern könnte, kein Anker, kein Halt. Stattdessen das Chaos widerstreitender Gefühle, kalte Wut und nagende Angst. Das Bemühen, sich Stärke einzureden und Entschlossenheit – du wirst dieses Schwein finden, Katja! –, und daneben das Gift des Zweifels – was, wenn nicht?
Kurz hinter der Münchner Stadtgrenze klingelt ihr Handy. Eine junge Kollegin aus der Polizeiinspektion Holzkirchen. Katja aktiviert den Lautsprecher, damit Dorfmüller mithören kann.
»Wegen der Überprüfung, um die Sie uns gebeten haben«, sagt die Kollegin. »Wir haben uns die Überwachungskameras sämtlicher Geldautomaten in Holzkirchen angeschaut.«
»Und?«, fragt Katja. »Sind Sie fündig geworden?«
»Sind wir«, sagt die Kollegin. »Martin Wolf hat an einem Automaten der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee am Bahnhofsplatz Geld abgehoben. Neunhundert Euro. Mit der EC-Karte des JVA-Beamten Andreas Meissner. Er muss sie ihm vor dem tödlichen Kopfschuss abgenommen und seine PIN erpresst haben.«
Vier Zahlen, denkt Katja, hingestammelt von einem zum Tode Verurteilten, in einem JVA-Transporter, an einem Waldrand in der Gemarkung Großhartpenning. »Danke Ihnen«, sagt sie zu der Kollegin und drückt das Gespräch weg.
Dorfmüller fragt nicht nach. Er weiß, wann es besser ist, sie in Ruhe zu lassen. Und er kennt sie gut genug, um zu ahnen, wie es in ihr aussieht, auch wenn diese Ahnung nicht ausreicht, um ihren wahren Zustand auch nur ansatzweise nachzuvollziehen. Kurz darauf stoppt er den Granada vor dem Haus in der Sternstraße.
»Wir sehen uns morgen«, sagt Katja und öffnet die Beifahrertür.
Er legt seine riesige Hand auf ihren Arm, versucht, ihr Mut zuzusprechen. »Wir kriegen ihn, Katja!«
»Auf jeden Fall«, erwidert sie und steigt aus. Sie folgt dem davonfahrenden Granada mit dem Blick und erwischt sich dabei, wie sie die Umgebung aus den Augenwinkeln abtastet. Das beklemmende Gefühl, heimlich beobachtet zu werden. Die Vorstellung, Martin Wolf könnte jederzeit hinter einem der parkenden Autos hervorspringen oder aus dem Schatten einer Haustür hervortreten, seine knochige Hand auf ihrer Schulter, sein fauliger Atem an ihrem Ohr: Hallo, Katja!
Das Klingeln ihres Handys lässt sie zusammenzucken. Ihre Hand fährt in die Tasche ihres Mantels, es klingelt erneut, das Vibrieren des Telefons an ihren Fingern. Das ist er, denkt sie, das muss er sein! Angst überfällt sie, ihr Herz beginnt zu rasen. Wieder klingelt es, sie zögert noch immer. Und wenn er es wirklich ist? Hallo, Katja, seine Stimme wie rostiges Eisen, so hört man sich wieder, wie geht’s denn so? Und dann die Frage, die in Wahrheit eine Feststellung ist: ob sie sehr enttäuscht ist oder eher wütend, dass er sich die Freiheit zurückgeholt hat, die sie ihm genommen hat, und ob sie Angst hat, jetzt, da er überall sein kann, ganz nah oder ganz weit weg. Es klingelt zum vierten Mal, sie zwingt sich dazu, das Telefon aus der Tasche zu ziehen, ihre Finger zittern, als sie auf das Display schaut. Es ist nicht Martin Wolf.
»Hallo, Peter«, sagt sie so gleichmütig und beiläufig wie möglich.
»Ich hab gehört, was passiert ist.«
»Was meinst du?«
»Wolf.«
»Und?«
»Muss ich mir Sorgen machen?«
»Worüber? Dass wir ihn nicht erwischen?«
»Dass er dich vorher erwischt!«
»Warum sollte er?«
»Jetzt komm schon Katja, wir wissen beide, was damals passiert ist.«
»Ich hab ihm ins Bein geschossen, das ist passiert.«
»Du hast dafür gesorgt, dass er seit Jahren im Knast sitzt.«
»Und genau da wird er bald wieder sitzen.«
Peter antwortet nicht. Sie kann ihn atmen hören. »Bist du noch dran?«, fragt sie.
»Du musst aufpassen, Katja!«
»Danke, aber das brauchst du mir nicht sagen. Nicht du!« Sie merkt, dass sie wütend wird. Vielleicht, weil sie ihm seine Fürsorge nicht abnimmt. Vielleicht, weil diese Fürsorge Jahre zu spät kommt. Peter Schäfer. Der einzige Mann, mit dem sie sich je eine gemeinsame Zukunft vorstellen konnte.
»Es geht hier nicht nur um dich, Katja!«
»Worum denn noch?«
»Jenny ist auch meine Tochter.«
Die Luft bleibt ihr weg, Panik steigt in ihr auf. Der Impuls, ihn anzuschreien. Aber sie schreit nicht, weil ihn das nur bestätigen würde in seiner Ablehnung ihr gegenüber und weil sie weiß, dass er recht hat. Also schweigt sie.
»Findest du das so abwegig?«, fragt er nach einer Weile.
»Nein«, sagt sie leise.
Sie würde ihn am liebsten ohrfeigen. Nicht, weil er sich Sorgen um Jenny macht, es wäre komisch, wenn er das nicht täte, sondern weil er mit dem, was er sagt, mitten ins Schwarze trifft. Dabei würde sie sich am liebsten selbst ohrfeigen, weil er diesen Gedanken ausgesprochen hat, bevor sie ihn selbst gehabt hat. Sie fragt sich, ob sie Martin Wolf das zutraut: sich an ihr zu rächen, indem er sich an Jenny vergreift.
»Ich werde aufpassen«, sagt sie. »Du kannst dich darauf verlassen.«
»Ich möchte, dass du mich auf dem Laufenden hältst.«
»Ja«, sagt sie. »Natürlich.«
Sie beendet das Gespräch mit einem Tastendruck. Ihr Körper ist eine einzige Verkrampfung. Das unbändige Verlangen, sich ihre Wut und den Hass aus der Seele zu schreien und das alles endlich zu beenden. Ihre Dienstwaffe zu ziehen, sie Martin Wolf an den Kopf zu halten und abzudrücken. Kalt, erbarmungslos, ohne jedes Gefühl.
Damals hatte sie die Gelegenheit dazu. Sie hat sie ungenutzt verstreichen lassen. Ein zweites Mal wird ihr das nicht passieren.
5
Müde geht Katja die Treppe hinauf. Und hält überrascht inne, als sie ein Lachen vernimmt. Jennys Stimme und die eines Unbekannten, flirtend, lockend, dann plötzliche Stille. Sie späht durch die Streben des Treppengeländers nach oben. Zwei aneinandergepresste junge Körper in der offenen Wohnungstür, ein leidenschaftlicher Kuss, eine innige Umarmung.
Vorsichtig zieht sie den Kopf zurück, presst sich an die Wand des Treppenhauses und wartet darauf, dass sie Schritte hört. Tut so, als würde sie gerade nach oben gehen, als ein Junge an ihr vorbeifliegt, so alt wie Jenny, groß und schlaksig, er nimmt drei Stufen auf einmal, in seinen Augen nichts als Glück. Er nickt ihr zu, sie nickt zurück, dann ist er an ihr vorbei. Sie hört, wie er zu singen beginnt, ausgelassen und froh, bevor die Haustür hinter ihm zufällt.