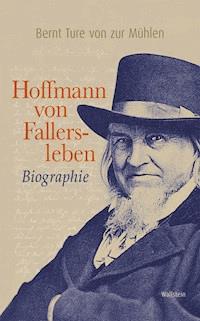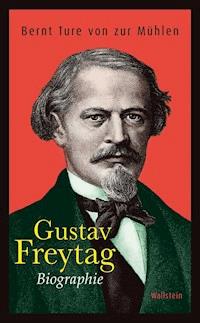
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Zum 200. Geburtstag von Gustav Freytag am 13. Juli 2016. Gustav Freytag (1816 -1895) war zu seinen Lebzeiten der meistgelesene Schriftsteller im Deutschen Kaiserreich. Sein Roman »Soll und Haben" und seine mehrbändigen Kulturgeschichten erreichten mit immer neuen Auflagen Millionen von Lesern. Unter seiner Herausgeberschaft entwickelte sich die Zeitschrift »Die Grenzboten" zwischen 1848 und 1870 zum führenden Sprachrohr der deutschen Nationalliberalen. Bernt Ture von zur Mühlen unterzieht das gängige Freytag-Bild einer kritischen Überprüfung: Geriet der populäre Schriftsteller und Publizist, der sich auch als lautstarker Polenverächter äußerte, mit der negativen Darstellung von Juden in »Soll und Haben" in den Ruf des Antisemiten, so hat er doch andererseits differenzierte Personen geschaffen und in Aufsätzen und Flugschriften zum Kampf gegen jede Art von Antisemitismus aufgerufen. Diese erste umfassende Biographie zeichnet den Lebensweg des gebürtigen Schlesiers und preußischen Patrioten nach: Privatdozentur in Breslau, frühe Erfolge als Dramatiker, Kauf des »Grenzboten", sensationeller Aufstieg zum führenden deutschen Romancier, gescheiterte Karriere als Reichstagsabgeordneter, Berater des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Der 200. Geburtstag Gustav Freytags ist Anlass, sich mit Leben und Werk des umstrittenen Mannes zu beschäftigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernt Ture von zur Mühlen
Gustav Freytag
Biographie
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2016www.wallstein-verlag.deVom Verlag gesetzt aus der Stempel GaramondUmschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf© SG-Image unter Verwendung eines Porträts von Gustav FreytagDruck: Hubert & Co, GöttingenISBN (Print) 978-3-8353-1890-8ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2985-0ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2986-7
Inhalt
Vorwort
1. Kindheit, Jugend und Studienjahre. Als Privatdozent in Breslau. Frühe Anfänge als Dramatiker
Kindheit und Jugend in Kreuzburg und Oels
Studienjahre in Berlin und Breslau
Habilitation und Lehrtätigkeit als Privatdozent. Lyrische Anfänge
Im Breslauer Vereinsleben. Erster Erfolg als Dramatiker
Gescheiterte Bewerbung und Ende der Lehrtätigkeit
Im Einsatz für die schlesischen Weber. ›Die Valentine‹. Abschied von Breslau
2. Erfolge als Dramatiker in Leipzig und Dresden
Als Dramatiker am Leipziger Theater
Umzug nach Dresden. Heirat
Die Revolution von 1848 und der Kauf der ›Grenzboten‹
3. Als Herausgeber der ›Grenzboten‹. Der Erfolg von ›Soll und Haben‹. Gescheiterte Karriere als Politiker
Journalistische Arbeit mit den ›Grenzboten‹
Kauf des Hauses in Siebleben. Bekanntschaft mit Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha
›Die Journalisten‹. Die Gründung des Literarisch-Politischen Vereins
Haftbefehl und Informantenschutz. Neue Staatsbürgerschaft
Der Erfolg von ›Soll und Haben‹
Streit und Versöhnung mit dem Herzog
Tod des Bruders Reinhold. ›Die Fabier‹
Der Nationalverein. ›Bilder aus der deutschen Vergangenheit‹
›Neue Bilder‹. ›Die Technik des Dramas‹. ›Die verlorene Handschrift‹
Als Abgeordneter im Norddeutschen Reichstag. ›Karl Mathy, Biographie‹
Als Kriegsberichterstatter im Feldzug 1870. Der Verkauf der ›Grenzboten‹
4. Nach dem Verkauf der ›Grenzboten‹. Rückzug ins Privatleben
Das Ende der journalistischen Arbeit. Tod der Ehefrau
Geburt der zwei Söhne und zweite Ehe. Umzug nach Wiesbaden
Tod des Sohnes und Trennung von der Ehefrau. Anna Strakosch. ›Gesammelte Werke‹ und ›Erinnerungen aus meinem Leben‹
Scheidung. Eheschließung mit Anna Strakosch. Glückliches Privatleben. Tod am 30. April 1895
Anhang
Anmerkungen
Zeittafel
Chronologisches Werkverzeichnis
Briefausgaben
Literatur
Register
Bildnachweis
Vorwort
Als Gustav Freytag am 30. April 1895 im Alter von 78 Jahren in Wiesbaden starb, brachten die deutschen Zeitungen und Zeitschriften ausführliche Nachrufe auf den meistgelesenen Schriftsteller des Deutschen Kaiserreiches. Auch in den europäischen Nachbarländern gedachte man Gustav Freytags, der mit seinen Romanen, Theaterstücken und Kulturgeschichten wie kein anderer Schriftsteller seiner Zeit das literarische und politische Denken seiner deutschen Zeitgenossen beeinflusst hat. Sein Roman Soll und Haben aus dem Jahr 1855 erschien in seinem Todesjahr in der 43. Auflage, sein Lustspiel Die Journalisten war zu seinen Lebzeiten die meistgespielte Komödie auf den deutschen Bühnen, und die mehrbändige Kulturgeschichte Bilder aus der deutschen Vergangenheit war längst zum Hausbuch des deutschen Bildungsbürgertums geworden. Die Zeitschrift Die Grenzboten hatte in der Zeit von Gustav Freytags Herausgeberschaft zwischen 1848 und 1870 maßgeblichen Einfluss auf die politische Klasse in den deutschen Ländern ausgeübt. Mit großer Leidenschaft war ihr Herausgeber für ein vereinigtes Deutschland unter preußischer Führung und die Gründung eines deutschen Nationalstaates eingetreten. Zusammen mit Julian Schmidt, dem führenden Literaturkritiker jener Zeit, hatte sich Gustav Freytag in den Grenzboten für das Programm des Bürgerlichen Realismus eingesetzt und erfolgreich für einen Epochenwechsel in der Literatur gekämpft.
Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers am 13. Juli 1966 erinnerten nur noch einige Regionalblätter an den einst gefeierten Erfolgsautor. Und an seinem 100. Todestag am 30. April 1995 war er so gut wie vergessen. Heute gehören seine Werke nicht mehr zum Kanon der großen deutschen Literatur. Die Germanistik scheint das Interesse an ihm weitgehend verloren zu haben. Freytags Werke gelten gerade noch als Zeitdokumente. Nur zu seinem Roman Soll und Haben sind in den vergangenen Jahren mehrere bemerkenswerte Studien erschienen.[1]
Die Gründe für dieses nachhaltige Vergessen sind vielschichtig. Für Gustav Freytag war ein Leben in Vaterlandsliebe und Pflichterfüllung, Arbeit und Unterordnung, Selbstdisziplin und Sparsamkeit das höchste moralische Gebot eines jeden Bürgers. Dieser in seinen Werken propagierte Wertekanon hat in der deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg seine Wertschätzung verloren. Die Zeit ist darüber hinweggegangen. Die Hauptursache für das Vergessen aber war der Vorwurf des Antisemitismus, der ihn im literaturwissenschaftlichen Betrieb zur Unperson hat werden lassen. Mit der Darstellung des Verbrechers Veitel Itzig, der jüdischen Romanfigur aus Soll und Haben, hat Gustav Freytag einen nachhaltigen und verhängnisvollen Einfluss auf die Ausprägung antisemitischer Vorurteile in Deutschland ausgeübt. Von der mit allen antisemitischen Stereotypen ausgestatteten Figur des Veitel Itzig führt ein direkter Weg zu den jüdischen Zerrbildern in Julius Streichers Zeitschrift Der Stürmer und Veit Harlans Film Jud Süß. Als im Jahr 1977 der Filmemacher Rainer Werner Fassbinder für den Westdeutschen Rundfunk eine mehrteilige Fernsehverfilmung von Soll und Haben plante, gab es in den Medien eine heftige Diskussion. Führende Literaturwissenschaftler und Publizisten, die noch Judenverfolgung, Exil und Holocaust persönlich erlebt hatten, haben damals mit Erfolg gegen die geplante Verfilmung protestiert. Die filmische Darstellung der antisemitischen Stereotypen könne antisemitische Vorurteile hervorrufen und verstärken. Der Literaturwissenschaftler Hans Mayer warnte vor einer unkritischen Lektüre von Soll und Haben. Man solle diesen Roman nicht mit »Einfühlung« lesen, denn sonst könne sich der Leser »im Gestrüpp der Vorurteile von einst« verfangen.[2] Es ist nur zu verständlich, dass die Vertreter dieser Generation, die noch persönlich betroffen waren von Judenverfolgung, Exil und Holocaust, zu dieser Einschätzung gekommen sind.
Aber Gustav Freytag war kein Antisemit. Er hat mit der Darstellung des Veitel Itzig nur die antisemitischen Klischees seiner Zeit bedient. Als eine der wenigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hat er Stellung gegen jede Art von Antisemitismus bezogen. Seine Antwort auf Richard Wagners üble Schmähschrift Die Juden in der deutschen Musik war im Frühjahr 1869 ein mehrseitiger Aufsatz in den Grenzboten, ein lautstarker Appell gegen den Antisemitismus und für ein gleichberechtigtes Zusammenleben mit den Juden in Deutschland.[3] Der in dritter Ehe mit einer Jüdin verheiratete Schriftsteller war 1890 dem kurz zuvor gegründeten Verein zur Abwehr des Antisemitismus beigetreten. Und 1893 veröffentlichte er die Flugschrift Ueber den Antisemitismus. Eine Pfingstbetrachtung, in der er jede Form von Antisemitismus verurteilte. Aber das alles wurde in der Diskussion im Jahr 1977 gar nicht oder nur am Rande zur Kenntnis genommen.
Es gehört zu den Merkwürdigkeiten in der Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sich hingegen so gut wie niemand für die antipolnischen Ressentiments Gustav Freytags interessiert hat. Mit zahlreichen Artikeln in seiner Zeitschrift Die Grenzboten, mit seinem Roman Soll und Haben und mit seinen kulturgeschichtlichen Werken hat der Schriftsteller ganz wesentlich zur Verbreitung eines negativen Bildes von den Polen als einem kulturlosen, zu wirtschaftlichen Leistungen unfähigen und zur Staatsführung ungeeigneten Volkes beigetragen. Diese gehässigen Vorurteile haben nachfolgenden Generationen zur Rechtfertigung für die Teilungen und Besetzungen Polens und die Kolonialisierung und Germanisierung des Landes gedient. In den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben polnische Germanisten begonnen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Inzwischen liegen mehrere umfangreiche Veröffentlichungen zu Gustav Freytags problematischem Polenbild und der Wirkungsgeschichte seiner Werke in Deutschland und Polen vor.[4]
Bis auf den heutigen Tag gibt es keine wissenschaftlich fundierte Biographie Gustav Freytags. Die frühen Lebensbilder, die noch zu seinen Lebzeiten oder nur wenige Jahre nach seinem Tod erschienen sind, stammen aus der Feder von Freunden oder Weggefährten.[5] Es handelt sich um kritiklose Einzeldarstellungen. Aber sie liefern wichtige Dokumente zur Lebensgeschichte des Schriftstellers. Gustav Freytags Autobiographie Erinnerungen aus meinem Leben, die er im Alter von fast 70 Jahren nach eigenem Bekunden lieblos hingeschludert hat, ist ein Gemisch aus Wahrheiten, Halbwahrheiten und Unwahrheiten. Auffallend ist das Verschweigen von Ereignissen und Fakten, die eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt haben. Die Autobiographie war ein Akt inszenierter Selbstdarstellung, dient aber in Verbindung mit den über 10.000 erhaltenen Briefen von der Hand Freytags als wichtige Quellensammlung. Es war die Aufgabe des Biographen, diese Dokumente auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, sie durch Aussagen von Zeitzeugen zu ergänzen und Richtigstellungen vorzunehmen. Das hier entworfene Lebensbild hat auf alle Ausschmückungen, spekulativen Übertreibungen und falsche Rücksichtnahme verzichtet.
Im Lebenslauf Gustav Freytags hat es keine dramatischen Ereignisse gegeben, wohl aber überraschende Wendungen, die untypisch für den Sohn eines angesehenen Arztes und Bürgermeisters aus der schlesischen Provinz waren. Seine wissenschaftliche Laufbahn hat der 1816 in Kreuzburg geborene Schlesier nach Promotion in Berlin und Habilitation in Breslau bald aufgegeben. Nach frühen Erfolgen seiner Theaterstücke plante er eine Laufbahn als Schriftsteller. Aber als preußischer Patriot sah er sich nach der Revolution von 1848 in der Verantwortung, sich als Herausgeber einer Zeitschrift für seine nationalliberalen Ideen einzusetzen. Die Grenzboten haben zwischen 1848 und 1870 zu den Themenfeldern Staat, Politik, Gesellschaft und Kultur Stellung bezogen. Im Blickpunkt der Kulturberichterstattung standen vor allem die Literaturkritik und der Kampf für den von Julian Schmidt propagierten Bürgerlichen Realismus.[6]
Der Journalist und Schriftsteller Gustav Freytag hat für die Erfüllung seines Traumes gekämpft, als Volkserzieher und Fürstenlenker Einfluss auf die politischen Geschicke seines Landes zu nehmen. Sein Lebensziel war der deutsche Nationalstaat, ein vereinigtes Deutschland unter preußischer Führung. Mit seinen literarischen Werken gelang ihm die Erfüllung eines Teils seines Traumes. Der unglaubliche Erfolg seiner Romane und seiner Kulturgeschichten brachte ihm hohes Ansehen in weiten Kreisen des deutschen Bürgertums und machte ihn zu einem vermögenden Mann. Die vernichtenden Urteile fast aller bedeutenden Schriftsteller seiner Zeit, die ihm fehlende Poesie und Unvermögen vorwarfen, haben ihn nicht sonderlich gestört. Aus seiner Sicht gab ihm der Erfolg bei seinen Lesern Recht.
In der Politik hat Freytag als enger Freund des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha und als Berater des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm nur eine unmaßgebliche Rolle gespielt. Sein Versuch, im Jahr 1867 als Abgeordneter des Norddeutschen Reichstags eine politische Karriere zu starten, war schon nach wenigen Monaten zum Scheitern verurteilt. Als er auf Einladung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm im August 1870 als Berater und Kriegsberichterstatter am Feldzug gegen Frankreich teilnahm, erhoffte er sich noch einmal die Gelegenheit, als Fürstenlenker eine Rolle spielen zu können. Aber schon nach wenigen Wochen kehrte er von der Front wieder an seinen Schreibtisch zurück. Von seinem Rat, auf eine Kaiserkrönung zu verzichten, wollte niemand etwas wissen. Die Einigung Deutschlands unter Preußens Führung im Januar 1871 hat er als Erfüllung seines politischen Traumes erlebt, aber die Ausrufung eines Deutschen Kaiserreiches widersprach seiner liberalen und antifeudalen Grundeinstellung. Von der politischen Bühne trat er ab. Mit seinem Romanzyklus Die Ahnen, den er 1872 begann und dessen sechsten und letzten Teil er 1880 mit letzter Kraft abschloss, begeisterte er noch einmal seine Leser. Danach zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück, besorgte seine Gesammelten Werke in 22 Bänden und präsentierte sich in seinen Erinnerungen aus meinem Leben als preußischer Patriot und als bescheiden seinem Volk dienender Schriftsteller.
Die fast lückenlose chronologische Darstellung von Gustav Freytags Leben verdankt sich in erster Linie der Auswertung seiner zahlreichen Briefwechsel. Schon fünf Jahre nach seinem Tod gab Alfred Dove, ein Mitarbeiter an den Grenzboten und später ein langjähriger Freund, die zwischen Freytag und dem Historiker Heinrich von Treitschke gewechselten Briefe heraus.[7] Wichtig für die Bewertung der politischen Positionen Freytags ist sein Briefwechsel mit Herzog Ernst von Sachsen-Coburg und Gotha, der im Jahr 1904 von Eduard Tempeltey, dem Kabinettschef des Herzogs, mit aufklärenden Anmerkungen veröffentlicht worden ist.[8] In den Briefen an seinen Freund Theodor Molinari hat sich Freytag in ungewohnt offener Art und Weise über sehr Persönliches geäußert. Diese Briefe liegen seit einigen Jahren in einer gut kommentierten Ausgabe vor.[9] Aus den letzten Lebensjahren Freytags stammt sein Briefwechsel mit Anna Strakosch, seiner dritten Ehefrau, in dem der Schriftsteller auch Intimes aus seinem Privatleben nicht ausgeklammert hat.[10] Von größter Bedeutung ist die dreibändige Ausgabe von Gustav Freytags Briefen an die Verlegerfamilie Hirzel, die Margret Galler und Jürgen Matoni zwischen 1994 und 2003 herausgegeben haben.[11] Ohne diese profund kommentierte Edition wäre die vorliegende Arbeit über Leben und Werk Gustav Freytags nicht möglich gewesen.
Im Spannungsfeld von Werkanalysen und der Darstellung des Lebenslaufes wird sich ein Biograph naturgemäß für das Lebensbild entscheiden und auf die bereits vorliegenden Interpretationen hinweisen. Die vorliegende Biographie begnügt sich mit knappen Inhaltsangaben der Werke Gustav Freytags. Nur im Fall der noch heute gespielten Journalisten und des Romans Soll und Haben wurden einige kommentierende Ausführungen zur Wirkungsgeschichte hinzugefügt.
In weiten Kreisen der Bevölkerung ist der einstige Lieblingsschriftsteller des deutschen Volkes nicht mehr bekannt. Ein Gustav-Freytag-Verein gibt in unregelmäßigen Abständen Mitteilungsblätter mit neuen Details aus seinem Leben heraus. In Wangen im Allgäu präsentiert ein Gustav-Freytag-Museum seinen Nachlass. In Gotha kümmert sich der Heimatgeschichtsverein Siebleben um das Ansehen Gustav Freytags. Der 200. Geburtstag am 13. Juli 2016 könnte der Anlass sein, sich mit dem Leben und Schaffen des meistgelesenen deutschen Schriftstellers des 19. Jahrhunderts zu beschäftigen.
1. Kindheit, Jugend und Studienjahre. Als Privatdozent in Breslau. Frühe Anfänge als Dramatiker
Kindheit und Jugend in Kreuzburg und Oels
Gustav Freytag hat seine Erinnerungen aus meinem Leben mit der etymologischen Erklärung seines Familiennamens begonnen. »Der Name Freytag ist ein altdeutscher Männername. Die erste Silbe ist der Name der germanischen Göttin Frija, die zweite unser Wort Tag, welchem in alter Zeit die Nebenbedeutung Licht, Glanz anhing.« Für den im Jahr nach dem Ende der napoleonischen Freiheitskriege im schlesisch-polnischen Grenzland geborenen Gustav Freytag ist das ein in mehrfacher Hinsicht charakteristisches Vorgehen. Zum einen demonstriert hier ein Vertreter der inzwischen etablierten Germanistik stolz sein Fachwissen. Zum anderen konnte Freytag mit dem Hinweis auf die altgermanische Herkunft seines Namens seine deutsche Herkunft unter Beweis stellen: »Meine Vorfahren, an deren Sippe sich das Wort als Familienname befestigte, waren deutsche Landsleute unweit der polnischen Grenze.« Und nicht zuletzt war der etymologische Einstieg eine Demonstration von Bürgerstolz. Mögen alte Adelsgeschlechter ihren Stammbaum bis in graue Vorzeiten nachweisen können, dem stolzen Bürger genügt der Nachweis seiner Herkunft anhand seines Namens.
Die Vorfahren Gustav Freytags waren Freibauern, wie man die Besitzer von großen Höfen damals nannte. Sie siedelten seit Jahrhunderten im schlesischen Grenzgebiet zu Polen in jenem Landschaftsdreieck, das durch die Städte Kreuzburg, Konstadt und Pitschen gebildet wurde. Im Verlauf des ersten Schlesischen Krieges war dieses Gebiet im Jahr 1741 zu Preußen gekommen. Wie ihre Landesherren, die Herzöge von Brieg, waren die Freytags schon bald nach der Reformation zum protestantischen Glauben übergetreten. Es sei für sein ganzes Leben prägend gewesen, schreibt Freytag im Rückblick von siebzig Jahren, »daß ich als Preuße, als Protestant und als Schlesier unweit der polnischen Grenze geboren bin«.
Nach geltendem Landesrecht waren die Bauernhöfe in diesem Teil Schlesiens Minorate. Der jüngste Sohn erbte den Hof. Die älteren Brüder mussten anderweitig ihr Glück versuchen, entweder als Knechte oder durch Einheirat in andere Höfe, falls sie nicht nach dem Besuch von Gymnasium und Universität in akademischen Berufen oder im Staatsdienst eine Stelle fanden. Wenn auch schon frühe Quellen aus dem 16. Jahrhundert flüchtige Hinweise auf einige Vorfahren geben, so lässt Freytag die ausführliche Darstellung seiner Familiengeschichte erst mit seinem Großvater beginnen. Der im Jahr 1737 geborene Georg Freytag war als ältester Sohn schon im Alter von acht Jahren von seinem Vater zu Verwandten in die Stadt gegeben worden, um sich auf dem Gymnasium auf den Besuch der Universität vorbereiten zu können. Er studierte Theologie, wurde im Alter von 23 Jahren als Diakon nach Konstadt berufen und wenig später zum Pfarrer ernannt. Neben der kirchlichen Arbeit bewirtschaftete er für den jüngeren, noch unmündigen Bruder den großen Hof. Nach dessen Volljährigkeit hat dieser den älteren Bruder ausgezahlt. Mit dieser Auszahlung wurde der Grundstein für das Familienvermögen der Freytags gelegt. Der Großvater hat den bescheidenen Reichtum zu schätzen gewusst. »Daß er nach damaligen Verhältnissen wohlhabend war, erleichterte ihm den gastfreien Verkehr und half dazu, daß er auch unter den Anspruchsvollen im Landadel und Militär sich fest und in gutem Einvernehmen behauptete.« Diese Feststellung hat für Freytags Vater und später auch für ihn selbst Gültigkeit gehabt. Er hat sich Zeit seines Lebens auf sehr selbstbewusste Art dem wohlhabenden Großbürgertum zugehörig gefühlt.
Der Großvater, in seiner Gemeinde ein geschätzter Pfarrer, ist klug und haushälterisch mit seinem bescheidenen Vermögen umgegangen. Als er 1799 im Alter von 62 Jahren starb, hinterließ er ein wohlbestelltes Haus. Die fünf Töchter, mit guter Mitgift ausgestattet, hatten in preußische Beamtenfamilien geheiratet. Die beiden Söhne waren auf die Universität gegangen, der ältere hatte Medizin studiert, der jüngere Jura. Der ältere Sohn war der Vater von Gustav Freytag.
Eine Familiengeschichte erlaubt Einblicke in die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Mitglieder, auch wenn es über den Einzelnen nur wenige Informationen gibt. Der 1774 geborene Gottlob Ferdinand Freytag war, wie seinerseits sein Vater, in jungen Jahren zu Verwandten in die Stadt gegeben worden. Er sollte auf dem Gymnasium in Oels das Abitur machen. Im Jahr 1793 ging er, mit einem komfortablen Wechsel vom Vater ausgestattet, nach Halle, wohin es damals fast alle jungen Schlesier zum Studium zog. Nach vier Jahren kam er als approbierter Mediziner zurück. Ein Jahr später ließ er sich in Kreuzburg nieder. Als junger Arzt wurde er nicht nur von den Honoratioren und wohlhabenden Bürgern der Stadt konsultiert, er hat auch in den benachbarten Dörfern Krankenbesuche gemacht. Sein guter Ruf sprach sich schnell herum. Bald wurde er auch zu den Kranken jenseits der Landesgrenze gerufen. In dem 1807 von Napoleon gegründeten Herzogtum Warschau fehlten zu jener Zeit wegen der Kriegswirren die Ärzte. Von dort kamen an manchen Tagen eilige Boten ganze Tagesreisen weit geritten, um ärztliche Hilfe zu holen. »Da gab es für den Arzt oft lange Fahrten auf elendem Wege, durch Kiefernwald und fußhohen Schnee im federlosen Wagen oder offenen Schlitten. Der Reisende saß in einem dicken grauen Mantel oder in die Wildschur gehüllt, den Arzneikasten unter dem Sitz, Säbel und Pistolen zur Seite. Denn die Grenzwälder waren durch streifendes Gesindel unsicher und im Winter durch hungrige Wölfe.« Der pflichtbewusste Arzt, der fließend Polnisch sprach, behandelte gleichermaßen arme und reiche, deutsche und polnische Patienten. »Unholde polnische Gäste« waren nur die gefürchteten Wölfe, für deren Abschuss Prämien bezahlt wurden, »für den Wolf zehn, für die Wölfin elf Taler«. Wie ein roter Faden werden sich diese Erinnerungen durch das Leben Gustav Freytags ziehen. Für ihn ist noch im hohen Alter von fast 80 Jahren Polen ein »fremdes«, »unheimliches« Land, das man bewaffnet mit Säbel und Pistolen bereist, stets bedroht von Wölfen oder gefährlichem Gesindel.[1]
Gustav Freytags Geburtshaus in Kreuzburg (Schlesien)und Porträt. Postkarte um 1910
Als auch in Kreuzburg, einer Stadt mit etwas über 2.000 Einwohnern, die neue Städteordnung eingeführt wurde, bot die Bürgerschaft am 8. Oktober 1809 dem geschätzten Arzt für ein Jahresgehalt von 350 Talern das Amt des Bürgermeisters an. Gottlob Ferdinand Freytag hat sich in diesem Amt bewährt. Besonnen führte er seine Stadt durch die schwierigen Zeiten. Mal zogen französische Truppen durch das Stadttor, mal waren es russische Soldaten, dann wieder lagerten Kosaken vor dem Rathaus oder es waren Baschkiren, die mitten in der Stadt ihr Lagerfeuer anzündeten. Plünderungen und Diebstähle waren an der Tagesordnung. Das Leben der Menschen in Kreuzburg erreichte 1813 seinen Tiefpunkt. Erst der Sieg über Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig brachte langsam die Wende. Mit dem Frieden zog neues Leben ein.
Auch der Kreuzburger Bürgermeister richtete sein Leben neu ein. Im Jahr 1815, kurz nach der Schlacht bei Waterloo, heiratete er Henriette Albertine Zebe, die Tochter eines protestantischen Pfarrers aus Wüstebriese bei Ohlau. Ein Jahr später, am 13. Juli 1816, kam Gustav Freytag zur Welt. Ein seine Mutter charakterisierendes Lebensbild hat der Sohn nicht geliefert. Sie bleibt die Frau im Hintergrund, unscharf und ohne hervorstechende Züge. Das entsprach seiner patriarchalischen Auffassung von der Rolle der Frau. Mit der gleichen Zurückhaltung wird er später von seinen Ehefrauen sprechen. Wenn er die Ehefrauen von Freunden erwähnt, dann stattet er sie mit idealtypischen Eigenschaften aus, sie sind klug, tüchtig, liebenswert, »die Vertraute der Gedanken ihres Gatten«. Mehr erfährt man nicht.
Die Persönlichkeit der Vaters nimmt dagegen in den Erinnerungen einen breiten Raum ein. Er ist die dominierende Gestalt in der Familie. Man kann den Einfluss des Vaters auf das Weltbild Freytags nicht hoch genug einschätzen. Preußische Gesinnung und protestantisches Arbeitsethos waren für den Arzt und Bürgermeister die Grundpfeiler bürgerlicher Werte. Er hat seinen beiden Söhnen ein Leben in Pflichterfüllung, Arbeit, Disziplin, Verantwortungsgefühl und Sparsamkeit vorgelebt. Die bescheidene Lebensführung trotz Vermögen im Hintergrund und Zugehörigkeit zur großbürgerlichen Klasse sowie die Bereitschaft zur Übernahme von politischer Verantwortung haben prägend gewirkt. Die Verbindung von Arztberuf und Politiker hat bis in den Sprachgebrauch des publizistisch tätigen Sohnes Spuren hinterlassen. Die revolutionäre Bewegung des Volkes war für ihn ein »Zustand der Krankheit«, eine »Art ansteckender Wahnsinn«. Die Aufgabe der Politik sollte es sein, »die Krankheiten des Völkergeistes pathologisch zu behandeln«. Das Junkertum und der Adel waren für Gustav Freytag ebenso eine Krankheit wie der Sozialismus. Politische Irrtümer sollten als »Krankheitsherd im Körper des Volkes geheilt werden«.
Wegen des niedrigen Gehalts von nur 350 Talern gab der Bürgermeister, der von nun an eine Familie zu versorgen hatte, im März 1816 sein Amt ab und ließ sich im benachbarten Pitschen als Arzt nieder. Es wurde nur ein kurzes Zwischenspiel. Die Kreuzburger wussten, was sie an ihrem Bürgermeister gehabt hatten. Sie machten ihm das Angebot, dieses Amt zu einem erhöhten Gehalt von 500 Talern jährlich, dazu 12 Klafter Holz, auf Lebenszeit zu übernehmen. Schon 1819 zog die Familie wieder nach Kreuzburg. Bis zum Jahr 1847 versah Gottlob Ferdinand Freytag seinen Dienst als Bürgermeister in seiner Heimatstadt.
Gustav Freytag hat seine Kindheitserinnerungen lebendig und anschaulich geschildert, aber sie unterscheiden sich nicht von den Kindheitserinnerungen anderer Erzähler aus jener Zeit. Es ist eine Kindheit ohne besondere Auffälligkeiten. Eine tüchtige und zupackende Mutter, die den Haushalt besorgt, Kinderspiele in Haus und Garten, die Wertschätzung von geschenkten Spielsachen und Kleidungsstücken, eindrucksvolle Weihnachtsfeiern und Kinderbesuche, alles im Grunde nicht sonderlich erzählenswert und nur für den Erzähler im Rückblick von Bedeutung. Aufschlussreich sind die wenigen Zeilen, die sich auf die wirtschaftliche Lage der eigenen Familie und auf das Wirtschaftsleben der Einwohner Kreuzburgs beziehen: »Die Eltern lebten nach den Verhältnissen jener Zeit in mäßigem Wohlstand.« Mehr erfährt man nicht über die Vermögensverhältnisse der Familie. Umso ausführlicher gerät der Bericht über die allgemeine Wirtschaftslage in Kreuzburg: »Das Handwerk in der Stadt hatte gegen die Ungunst der Zeit zu kämpfen. Einst waren die Tuchmacher und Strumpfwirker wohlhabende Innungen gewesen«, erinnert sich Freytag, der wie kein anderer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts den Einfluss von Handel und Wirtschaft auf das Leben der Menschen in das Zentrum seiner Arbeit gestellt hat. »Der erschwerte Verkehr mit der Fremde und noch mehr der Beginn der Maschinenarbeit machte ihnen mit jedem Jahr das Verdienst geringer. Noch fehlte das Geld und die Kraft zum größeren Betriebe; die alte Zeit geht zu Ende, der Segen der neuen wird noch nicht sichtbar, es ist eine Periode des Rückgangs und der ersten Versuche auf neuen Bahnen, in welche meine Kindheit fällt.«
Ausführlichen Raum nehmen im Rückblick die Grenzstreitigkeiten zwischen Deutschen und Polen ein. Die Stadt Pitschen besaß vor ihren Toren ein großes Wiesengelände, das bis zum Grenzflüsschen Prosna reichte. Ein ungenauer Grenzverlauf ließ die jenseits der Prosna wohnenden Polen Jahr für Jahr Ansprüche auf das von den Bauern aus Pitschen gemähte Heu erheben. In jedem Sommer kam es zu heftigen Streitereien und Heudiebstählen. Die Anweisungen der preußischen Regierung, den jährlichen Heuertrag von 300 bis 500 Talern zu teilen, wurden nicht befolgt. In schöner Regelmäßigkeit waren Schlägereien und Misshandlungen von Wachtposten die Folge. Es war ein typischer Grenzkonflikt, wie er an allen Landesgrenzen der Welt an der Tagesordnung war. Aber für Freytag waren solche Auseinandersetzungen mehr als nur ein Grenzkonflikt. Für ihn waren das Bedrohungen aus dem »fernen« und »unheimlichen« Land Polen.
Eine reguläre Schule hat der Sohn des Kreuzburger Arztes und Bürgermeisters bis zu seinem zwölften Lebensjahr nicht besucht. Die Eltern schickten ihn als Privatschüler zum Pfarrer der kleinen Stadt, einem Schwager seiner Mutter. Dieser skurrile Kauz verstand zwar nichts von Mathematik und Naturwissenschaften, und von Hausarbeiten hielt er zur Freude seines Zöglings gar nichts, aber der sprachgewandte Mann, der an den Sonntagen seine Predigten sowohl in deutscher als auch in polnischer Sprache hielt, muss ein guter Lateinlehrer gewesen sein. Zeitgleich mit dem Lesen und Schreiben lernte sein kleiner Schüler die lateinischen Vokabeln und die Grammatik. Als der Junge zu Ostern 1829 kurz vor Erreichen des dreizehnten Lebensjahres auf das Gymnasium kam, hatte er schon längst die Klassiker der lateinischen Literatur im Originaltext gelesen. Auch in der römischen Geschichte kannte er sich bestens aus. Noch im hohen Alter sollte Gustav Freytag davon profitieren. Er konnte problemlos schwierige wissenschaftliche Abhandlungen in lateinischer Sprache lesen. Aber für die Persönlichkeitsbildung des Jungen hatte diese Art von elitärem Einzelunterricht beträchtliche Folgen. Der fehlende Umgang mit Gleichaltrigen aus anderen sozialen Verhältnissen ließ kein Verständnis für Menschen aus den unteren sozialen Schichten aufkommen. Gleichzeitig festigte sich in ihm die elitäre Überzeugung von der Zugehörigkeit zu den sogenannten besseren Kreisen, dem Großbürgertum.
Jede Künstlerbiographie fragt nach den prägenden Eindrücken, die in einem jungen Menschen den Grundstein zu einer künstlerischen Laufbahn gelegt haben. Manchmal ist es das Vorbild eines Elternteils oder die Förderung einer frühzeitig erkannten Begabung, die am Anfang einer Künstlerlaufbahn steht. Für Freytag kommen die prägenden Einflüsse aus dem protestantischen Pfarrhaus, das sich einmal mehr in der deutschen Literaturgeschichte als Kaderschmiede für angehende Schriftsteller bewährt hat. Sowohl der Vater als auch die Mutter waren in protestantischen Pfarrhäusern aufgewachsen und hatten sich bemüht, das erworbene Bildungsgut ihren Kindern weiterzugeben. Der Vater war ein begeisterter Theaterbesucher, der seine beiden Söhne häufig in die Aufführungen der in Kreuzburg gastierenden Wanderbühnen mitnahm. Hier wurde der Grundstein für Freytags lebenslange Liebe zum Theater gelegt. »Für die Jugendbildung ist das kleine Stadttheater ebenso bedeutsam, wie die Einwirkung der Lauchstädter auf die Studierenden des früheren Geschlechts.« Im kleinen Lauchstädt, nicht weit von Weimar gelegen, waren zu jener Zeit die Aufführungen von Goethes und Schillers Dramen über die Bühne gegangen, von denen die deutsche Theaterwelt schwärmte. Während seiner Studienjahre in Halle war Freytags Vater ein begeisterter Besucher des Lauchstädter Theaters gewesen. An seine ausführlichen Berichte hat sich der Sohn noch Jahrzehnte danach erinnern können.
Die Eltern nahmen den Jungen häufig in die Aufführungen der Wandertheater mit. Die Schauspiele und Komödien haben den Zwölfjährigen verständlicherweise oft überfordert. Aber für die Zauberpossen und Singspiele konnte er sich begeistern, obwohl sich sein musikalisches Talent in sehr engen Grenzen hielt. Auch ein jahrelanger Geigenunterricht hatte keine besondere Freude an der Musik wecken können. »Mein Gehör blieb unsicher, und ich habe für mein späteres Leben wenig anderes von dieser Beschäftigung bewahrt, als die Erinnerung an meinen gutherzigen Lehrer.« Dafür wurde durch intensive häusliche Lektüre der Grundstein für literarische Interessen gelegt. Heute sind die Romane von Heinrich Clauren, A. von Tromlitz und Karl van der Velde längst vergessen. Die wenigen Literaturgeschichten, die ihre Namen noch erwähnen, tun deren Romane als triviale Schmarren ab. Aber für den zwölfjährigen Gustav Freitag war die Freude am Lesen wichtiger als der Inhalt des Gelesenen.
Das Jahr 1829 brachte einen tiefen Einschnitt in das Leben des Jungen. Die Eltern gaben ihn nach dem Osterfest zum Bruder des Vaters nach Oels, damit er dort das Gymnasium besuchen konnte. Der noch nicht einmal 13 Jahre alte Junge klammert sich beim Abschied verzweifelt an Vater und Mutter, als diese die Rückreise antreten und ihn allein in der Fremde zurücklassen. Über den seelischen Schmerz, den eine so abrupte Trennung nach sich zieht, hat man sich in früheren Zeiten wenig Gedanken gemacht. Schon der Großvater war fortgegeben worden, später hatte dieser seinen Sohn ebenfalls zu Verwandten gegeben, jetzt wiederholte sich dieser schmerzliche Vorgang.
Bis zum Abitur wird der Junge in Oels bleiben, die ersten Jahre im Haus des jüngeren Bruders seines Vaters, eines Junggesellen, der als Gerichtsdirektor zu den Honoratioren der Stadt gehörte. Dieser Onkel, seit Kindertagen nach einem schweren Sturz verkrüppelt und durch einen Buckel stark behindert, führte ein vollkommen zurückgezogenes Leben. Nach den täglichen Amtsgeschäften auf dem Gericht beschäftigte sich der mit einem beeindruckenden Sprachtalent begabte Mann mit den Werken der Weltliteratur, die er ausschließlich in den Originalsprachen las. Latein und Griechisch beherrschte er ebenso wie Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch, er sprach fließend Polnisch und auch das Russische war ihm geläufig. Bis in die Nacht hinein arbeitete er in seiner Bibliothek. Von der bedeutenden Büchersammlung konnte der junge Neffe also vorerst nicht profitieren, da die Bibliothek keine Übersetzungen bereithielt. Die einzige Nebenbeschäftigung des völlig vereinsamten Mannes war die Blumenzucht. »Durch seine Mißgestalt ausgeschieden vom Familienglück, fand er in der Geistesarbeit vergangener Zeiten und in dem, was die Blumenwelt von schönen Formen ihm entgegentrug, seine beste Befriedigung. In diesem Leben war er ernst und schweigsam geworden.« Schweigsam leben die beiden nebeneinander her, schweigsam machen sie die Spaziergänge durch die Stadt, und mit Schweigen reagiert der Onkel auf gelegentliches Fehlverhalten seines Neffen. Einmal in der Woche geht der Gerichtsdirektor abends in das Weinhaus, um sich nach einer Stunde wieder zu verabschieden, eine stumme Respektbekundung für die Honoratioren der Stadt.
Die Aufnahmeprüfung auf das Gymnasium hat Gustav Freytag nur dank seiner exzellenten Lateinkenntnisse bestanden. Der Direktor des Gymnasiums wollte ihm lange nicht glauben, dass ihm die vorgelegten Textstellen unbekannt waren, so flüssig und gekonnt waren seine Übersetzungen. Dafür hatte der Prüfling keine Ahnung von den Berechnungen der Seiten und der Winkel eines Dreiecks. Von dergleichen hatte er noch nie gehört. Er musste in der Quarta beginnen. Das Lernen fiel ihm zwar leicht, aber an ein regelmäßiges und vor allem selbständiges Arbeiten konnte er sich anfangs nur schwer gewöhnen. Jetzt rächte es sich, dass er niemals zum Anfertigen von Hausarbeiten angehalten worden war.
In seinen freien Stunden überkam den Jungen die Lesewut. Er durfte sich nach Belieben in der kleinen Leihbibliothek der Stadt bedienen. Zuerst waren es die Ritter- und Räubergeschichten, die er verschlang. Dann entdeckte er die großen Romane von Walter Scott, die er mit wachsender Freude las. Und schließlich begeisterte er sich für die Indianer- und Seefahrerromane von James Fenimore Cooper. Für einen angehenden Schriftsteller war das keine schlechte Vorbereitung. Von der großen Gestaltungskraft der beiden Romanciers hat er nach eigenem Bekunden viel gelernt.
Als der Junge vierzehn geworden war, zog sein drei Jahre jüngerer Bruder Reinhold zu ihm. Zwischen den beiden hat Zeit ihres Lebens ein enges Verhältnis bestanden. Während die beiden Brüder die Sommerferien des Jahres 1831 im Elternhaus in Kreuzburg verbrachten, starb völlig überraschend der Onkel. Er sei nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, heißt es. Vermutlich war er ein Opfer der Choleraepidemie geworden, die in jenem Jahr vor allem in den östlichen Provinzen Preußens mit verheerenden Folgen gewütet hatte. Der Haushalt des Onkels wurde aufgelöst, die wertvolle Bibliothek versteigert. Über die Aufteilung der Erbschaft ist nichts bekannt. Die Hinterlassenschaft des Verstorbenen muss beträchtlich gewesen sein. »Alles war in dem stillen Haushalt weit reicher als daheim. Die Einrichtung der Zimmer, der Mittagstisch und das Gerät, an den Wänden Bilder und gute Kupferstiche, große Glasschränke mit schön gebundenen Büchern.« Von seinem Einkommen als Gerichtsdirektor hatte der zurückgezogen lebende Mann Ersparnisse sammeln können, die jetzt in Form der Erbschaft das Familienvermögen der Freytags vermehrten.
In Kreuzburg beschloss der Vater, seine beiden Söhne bis zum Abitur auf dem Gymnasium in Oels zu lassen. Die beiden Jungen, nun fünfzehn und zwölf Jahre alt, kamen in ein Bürgerheim, in dem sie ein Leben ohne besondere Aufsicht führen konnten. Die Klassenkameraden wurden zum Familienersatz. Die beiden haben die neue Freiheit genossen. Den Leistungen in der Schule hat das freizügige Leben nicht geschadet. Am 30. März 1835 verließ der neunzehnjährige Gustav Freytag das Gymnasium in Oels mit dem Reifezeugnis, das seit 1834 in Preußen als Voraussetzung eines Universitätsbesuchs normiert war. Die Prüfungskommission bestätigte ihm ein »anständiges, bescheidenes und wohlgefälliges Betragen«.[2] Seine Leistungen seien in einigen Fächern durch häufige Krankheiten beeinträchtigt worden. »In der deutschen Sprache ist sein Vortrag sehr gebildet und gewandt.« In den Fächern Latein und Griechisch wurden ihm hervorragende Kenntnisse bestätigt, auf Latein konnte er sich flüssig unterhalten.
Den Übergang vom Gymnasium auf die Universität hat Freytag direkt vollzogen. Auf den Gedanken, wie viele seiner Altersgenossen vor dem Beginn des Studiums eine Bildungsreise zu unternehmen, ist er nicht gekommen. Der Grund dafür war ein gravierender Augenfehler. Er war extrem kurzsichtig. Das Aussehen seiner Mitmenschen hat er nur schemenhaft wahrgenommen, die Häuser auf der anderen Straßenseite konnte er kaum erkennen. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen hat er sein Leben lang auf den Gebrauch einer Brille verzichtet. Nur in Ausnahmefällen, im Theater beispielsweise oder im Museum, hat er Augengläser benutzt. Wer so wenig von der Außenwelt wahrnimmt, der findet auch nichts zum Bestaunen und Bewundern. Das Reisen hat ihm sein Leben lang nichts bedeutet.
Es gibt nur wenige Informationen über das äußere Erscheinungsbild des jungen Mannes, der sich nach seinem erfolgreichen Abitur für ein Studium in Breslau entschieden hatte. Hoher Wuchs, starker Körperbau und straffe Haltung, weißblondes Haar, hohe Stirn und hellblaue Augen, so hat ein Weggefährte ihn beschrieben.[3] Über seinen Charakter erfährt man fast nur die gängigen Klischees von einem zurückhaltenden und bescheidenen Wesen. Das Selbstporträt, das der fast Siebzigjährige von sich geliefert hat, ist von seinem Wunschdenken geprägt. Seine stillen und zurückhaltenden Züge hätten sich im Zusammenleben mit dem schweigsamen Onkel gebildet: »Ich vermute, daß dies abgeschiedene Dasein auch auf mein späteres Leben nachgewirkt hat. Der Knabe wurde gewöhnt, allein für sich zu leben.« So wollte der erfolgreichste Schriftsteller seiner Zeit von seinen Lesern wahrgenommen werden. Nichts davon ist wahr. Allein das Verzeichnis mit den Namen der Freunde und Weggefährten des kommunikativen Mannes beweist das Gegenteil. Fast täglich hatte er Umgang mit Kollegen, Freunden und Mitarbeitern, fast täglich erhielt er Besuche oder er machte Besuche. Von einem Leben in Einsamkeit kann auch nach drei Ehen nicht gesprochen werden.
Die hervorstechenden Charaktermerkmale Freytags waren ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, ein zielstrebiger Ehrgeiz und eine bewundernswerte Arbeitskraft. Seine großbürgerliche Herkunft, auf die er Zeit seines Lebens stolz war, verlieh ihm das starke Selbstbewusstsein, mit dem er sich schon in sehr jungen Jahren in den führenden Kreisen aus Politik, Wirtschaft und Kultur bewegt hat. In diesen Kreisen stellte man seinen Ehrgeiz nicht zur Schau. Aber ohne Ehrgeiz wird man nicht zum meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit, ohne Ehrgeiz entwickelt man nicht als Herausgeber seine Zeitschrift zu einem einflussreichen Presseorgan, und ohne Ehrgeiz steigt man nicht in die höchsten Kreise der Gesellschaft auf und wird zum Berater des Kronprinzen von Preußen. Die 22 Bände seiner Gesammelten Werke und die 23 Jahrgänge seiner Zeitschrift Die Grenzboten mit über 800 Artikeln aus seiner Feder sind ein Beweis für seine unglaubliche Arbeitskraft, die auch durch eine chronische Lungenkrankheit und häufige Fieberanfälle kaum beeinträchtigt wurde.
Für Freytags ausgeprägtes Selbstbewusstsein gab es noch einen weiteren Grund, den er selbst und auch seine frühen Biographen diskret verschwiegen haben. Er war Zeit seines Lebens finanziell unabhängig. Das Familienvermögen, dessen Anteil er entweder zum Beginn seines Studiums oder am Tag seiner Volljährigkeit vom Vater ausgezahlt bekommen hat, war dank protestantischem Arbeitsethos und preußischer Haushaltsdisziplin und dank Zins- und Zinseszinsen beträchtlich gewachsen. Der Großvater hatte das vom jüngeren Bruder für die Übernahme des väterlichen Hofes ausbezahlte Geld gut angelegt und seinen Kindern weitergegeben. Der Vater hatte als Arzt und Bürgermeister bescheiden gelebt. Der Nachlass von dessen verstorbenen Bruder hatte das Familienvermögen vergrößert. Ohne dieses Vermögen hätte Gustav Freytag weder sein Studium finanzieren noch Jahre später als unbezahlter Privatdozent in Breslau einen aufwendigen Lebenswandel in den gehobenen Kreisen der Gesellschaft führen können. Die ersten Tantiemen für seine frühen Theaterstücke erhielt der junge Schriftsteller erst in der Mitte der vierziger Jahre. Aber da verwaltete schon ein kaufmännisch erfolgreicher Freund sein Vermögen in Höhe von 14.000 Talern, für die er jährlich fünf Prozent Zinsen zahlte.[4] Mit diesem Vermögen im Hintergrund konnte Freytag optimistisch in die Zukunft blicken, als er in Breslau sein Studium begann.
Studienjahre in Berlin und Breslau
Am 11. Mai 1835 schrieb sich Gustav Freytag an der Breslauer Universität ein. Für das nächste Jahrzehnt sollte die schlesische Hauptstadt zu seiner Heimat werden, nur unterbrochen von einem zweijährigen Studienaufenthalt in Berlin. Sein erster Wohnsitz war Schmiedebrücke 37. Nach einem halben Jahr zog er um. Das Verzeichnis der Universitas Litterarum Viadrina Wratislawiensis nennt für den Studenten Nr. 157 die Heilig-Geist-Straße 15 als neue Adresse.[5]
Breslau hatte in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts einen rasanten Wandel zur Industrie- und Wirtschaftsmetropole und zur führenden Kulturstadt im Osten Preußens durchgemacht. Im Jahr 1816, Gustav Freytags Geburtsjahr, zählte die Stadt 73.000 Einwohner. Ein Vierteljahrhundert später lebten in ihr schon 100.000 Menschen. Die Beschreibungen der Stadt an der Oder aus der Feder zeitgenössischer Autoren wie Friedrich Rückert, Heinrich Laube, Karl von Holtei, Fanny Lewald und Hoffmann von Fallersleben liefern ein höchst widersprüchliches Bild. Mit den realen Gegebenheiten haben die Stadtbeschreibungen von Schriftstellern nur wenig zu tun, sind sie doch häufig von deren schwankenden Stimmungen abhängig. Freytag hat für die schönen Breslauer Kirchen geschwärmt, er hat den Breslauer Ring in den höchsten Tönen gelobt und das Blücherdenkmal auf dem Salzring bewundert. Aber für städtebauliche Eigenheiten und die Reize einer schönen Landschaft hat er Zeit seines Lebens nicht viel übrig gehabt.
Es gibt von Freytag aus dieser Zeit keine Äußerungen über das Zusammenleben der deutschen Einwohner mit der zahlenmäßig nicht zu übersehenden polnischen Minderheit und den im Stadtleben präsenten jüdischen Einwohnern. Erst nach dem Kauf der Zeitschrift Die Grenzboten im Jahr 1848 hat er als deren Herausgeber die Gelegenheit wahrgenommen, sich über die Juden in Breslau und das Leben der Polen in Schlesien und im Herzogtum Posen zu äußern. Als Student hat er sich in den ersten Semestern nicht viel um das Kulturleben in der schlesischen Hauptstadt gekümmert. Dabei hatte Breslau auf kulturellem Gebiet viel zu bieten. Als Freytag im Herbst 1836 nach seinem dritten Semester Exmatrikulation nahm, feierte die Universität ihr 25-jähriges Jubiläum. Die auf Reformen bedachte preußische Regierung hatte am 3. August 1811 die altehrwürdige Viadrina in Frankfurt an der Oder geschlossen und sie mit der Breslauer Leopoldina zu einer Volluniversität mit den vier Fakultäten Theologie, Philosophie, Medizin und Jura zusammengelegt. Die Königliche Universitätsbibliothek gehörte mit ihren über 200.000 Bänden zu den größten Bibliotheken Preußens. Zahlreiche Buchhandlungen und eine erstaunlich vielfältige Verlagsszene legten vom kulturellen Leben der Stadt Zeugnis ab. Die Oper und das Theater gehörten zwar nicht zu den ersten Häusern in der preußischen Theaterlandschaft, aber sie galten als Sprungbrett für junge Talente, die es an die großen Bühnen in Berlin, Dresden, Leipzig und Hamburg zog.
Von besonderer Bedeutung für das kulturelle Leben der Stadt waren die zahlreichen Vereine, die überwiegend in den zwanziger Jahren gegründet worden waren. In ihnen trafen sich die Vertreter aus Oberschicht, Bildungsbürgertum und aufstrebendem Mittelstand. Künstler und Musiker, Dichter und Wissenschaftler kamen mit wohlhabenden Kaufleuten und höheren Beamten zu literarischen Teeabenden und Lesekränzchen, Chorsingen und Diskussionen über aktuelle politische und kulturelle Fragen zusammen. Was in Berlin den gehobenen Kreisen die Salonkultur war, das war den Breslauer Bürgern das Vereinsleben. Freytag hat sich während seiner Zeit als Student nicht um das Vereinsleben gekümmert. Zum einen hatten Studenten nicht den gesellschaftlichen Status, um in den verschiedenen Zirkeln des arrivierten Bürgertums mit respektvoller Anerkennung empfangen zu werden. Zum anderen verkehrten die Studenten fast ausschließlich in ihren Verbindungen. Erst nach seiner Rückkehr aus Berlin wurde für Gustav Freytag das Vereinsleben Breslaus interessant.
Für die Wahl seiner Studienfächer ist Freytag den Lesern seiner Erinnerungen eine Begründung schuldig geblieben. Seine Lehrer auf dem Gymnasium waren »wie ich selbst der Meinung, daß ich auf den gebahnten Wegen der Klassischen Philologie fortgehen würde. Doch es kam anders«. Er schrieb sich für das Fach Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft ein. Von seinem Vater war er zu keinem Studienfach gedrängt worden. Als junger Student konnte er sich eine gewisse Orientierungslosigkeit leisten, zumal er im Gegensatz zu vielen seiner Kommilitonen finanziell unabhängig war.
Sechs bis acht Vorlesungen und Seminare hat Freytag in jedem der drei Semester belegt und vorschriftsmäßig testieren lassen. In den meisten Fällen haben die Professoren ihm die Mindestnote »fleißig« bewilligt. Ein »ausgezeichnet fleißig« hat er nur von dem Altertumswissenschaftler und Archäologen Julius Athanasius Ambrosch und dem Germanisten Heinrich Hoffmann von Fallersleben erhalten.[6] In seinen Erinnerungen hat Freytag diese beiden Persönlichkeiten ausdrücklich hervorgehoben, weil er sich ihnen zu großem Dank verpflichtet gefühlt hat. Beide Wissenschaftler haben, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise, auf ihren Fachgebieten Hervorragendes geleistet.
»Ambrosch begann gerade als junger Professor seine Vorlesungen über Privataltertümer und antike Kunst, ich hörte ihn gern und ihm verdanke ich nicht wenig.« Der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Ambrosch hatte dank mehrerer Stipendien des liberalen preußischen Kulturministers Karl Freiherr Stein von Altenstein studieren, promovieren und habilitieren können. Auf mehrjährigen Studienreisen nach Italien hatte er sich fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Archäologie und der Altertumskunde erworben. Minister Altenstein ernannte ihn im Jahr 1834 zum außerordentlichen Professor für Archäologie, fünf Jahre später machte er ihn gegen den Widerstand der Fakultät zum Ordinarius. Es war das Verdienst des jungen Professors, dass die Klassische Archäologie schon bald an der Breslauer Universität als vollwertiges Fach anerkannt wurde. Als Direktor des Akademischen Museums für Altertum und Kunst hat er wichtige Arbeit geleistet.[7] »Er war ein lebhafter feinfühlender Mann, der es verstand, die Zuhörer zu fesseln.« In seinem ersten Semester hat Freytag bei Ambrosch die Vorlesung ›Römische Altertümer‹ belegt. Ambrosch wurde im Jahr 1848 Mitglied der Nationalversammlung in Frankfurt am Main.
Noch ausführlicher fällt in den Erinnerungen die Würdigung der Persönlichkeit und der Leistungen Hoffmanns von Fallersleben aus. »Wichtiger noch wurde dem jungen Studenten eine andere Vorlesung, welche Hoffmann von Fallersleben als Privatissimum las, die Handschriftenkunde. Ich war der einzige Zuhörer und erhielt die Stunde in seiner Wohnung. Durch ihn wurde ich in das weite Gebiet der germanischen Altertümer eingeführt. Er hatte im Lesen alter Handschriften ehrenwerte Fertigkeit gewonnen, hatte an großen Bibliotheken zu Wien und in Belgien selbst fleißig abgeschrieben, und war bekannt als findig und als behender Herausgeber.« Neben der Handschriftenkunde, die damals ein wichtiges Fach für die Grundlagenforschung der noch jungen Germanistik war, hörte Freytag im Wintersemester 1835/36 Hoffmanns Vorlesungen über ›Enzyklopädie der deutschen Philologie‹ und im folgenden Semester über ›Deutsche Grammatik des 13. Jahrhunderts‹.[8]
Hoffmann war nach seinem Studium in Göttingen und Bonn im Jahr 1823 als Kustos an die Breslauer Universität gekommen. Minister Altenstein hatte ihn 1830 gegen den Widerstand der Fakultät zum außerordentlichen Professor für Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft und fünf Jahre später zum Ordinarius ernannt. Am 20. Dezember 1842 verfügte der neue preußische Kulturminister seine Entlassung aus dem Staatsdienst, da Hoffmann in seinen Unpolitischen Liedern