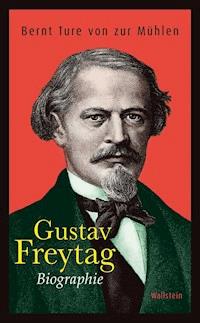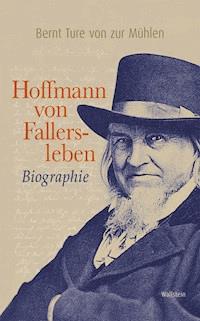
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hoffmann von Fallersleben ist als Verfasser der deutschen Nationalhymne sowie vieler Kinderlieder ("Alle Vögel sind schon da", "Ein Männlein steht im Walde") bekannt. Doch darüber hinaus gibt es noch viele Facetten zu entdecken. Hoffmann war Dichter und Gelehrter, Entdecker von Sprachdenkmälern und Volksliedsammler, Kirchenliedforscher und politisch engagierter Liedermacher. Als Herausgeber und Bearbeiter altniederländischer Literatur wurde er zum Mitbegründer der Niederlandistik. Wegen seiner kritischen Gedichte wurde Hoffmann 1843 als Professor an der Breslauer Universität entlassen. Man entzog ihm die preußische Staatsbürgerschaft und verwies ihn des Landes. Hoffmann irrte daraufhin quer durch Deutschland und konnte immer wieder bei Freunden Unterschlupf finden. In diesen Jahren war er mit seinen in hohen Auflagen verbreiteten Gedichten einer der Wegbereiter der Revolution von 1848. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er als Bibliothekar des Herzogs von Ratibor in Corvey. Der schwierige Charakter dieses Mannes und sein umtriebiges Leben machen es nicht leicht, zu einer gerechten Bewertung zu kommen. Diese Biographie unternimmt den Versuch, Hoffmann Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und seinen historischen Standort zu bestimmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernt Ture von zur Mühlen
Hoffmann von Fallersleben
Biographie
Hoffmann im Jahr 1841.
Lithographie nach einem Gemälde von Ernst Resch
Bernt Ture von zur Mühlen
Hoffmann
von Fallersleben
Biographie
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung
der Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft
und der Hoffmann-von-Fallersleben-Stiftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2. Aufl. 2010
© Wallstein Verlag, Göttingen 2010
www.wallstein-verlag.de
Vom Verlag gesetzt aus der Stempel Garamond
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf,
unter Verwendung eines Gemäldes von Otto Rasch
ISBN (Print) 978-3-8353-0790-2 ISBN (eBook, pdf) 978-3-8353-2137-3 ISBN (eBook, epub) 978-3-8353-2138-0
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
Inhalt
Vorwort
1. Kindheit und Jugend, Studienjahre und frühe Anfänge
Kindheit und Jugend in Fallersleben
Studienjahre in Göttingen
Studienjahre in Bonn
Frühe Anfänge in Berlin
2. Die Breslauer Jahre als Kustos und Professor
Als Kustos an der Bibliothek
Ernennung zum außerordentlichen Professor
Das Jahr der großen Reisen
Ernennung zum Ordinarius
Beendigung der Bibliotheksarbeit und lange Reisen
Der Erfolg der ›Unpolitischen Lieder‹
Amtsenthebung und Entlassung
3. Wanderjahre als politischer Literat
Unstetes Leben nach der Entlassung
Bürgerrecht in Mecklenburg
Die Revolutionsjahre 1848 und 1849
4. Das Leben als freier Schriftsteller und Bibliothekar
Spätes Eheglück
Die Jahre in Weimar
Als Bibliothekar in Corvey
Anhang
Anmerkungen
Zeittafel
Chronologisches Werkverzeichnis
Literaturverzeichnis
Dank
Register
Vorwort
Als der Dichter, Literaturwissenschaftler und Bibliothekar Heinrich Hoffmann, der sich nach seinem in der Nähe von Wolfsburg gelegenen Geburtsort Hoffmann von Fallersleben nannte, am 19. Januar 1874 in Corvey starb, verbreitete sich die Nachricht von seinem Tod in großer Eile im ganzen Land. Mehrere tausend Bürger, die zur Beerdigung teilweise von weit her angereist kamen, erwiesen dem Toten auf dem Friedhof im Corveyer Schlossgarten die letzte Ehre.
Für die ältere Generation, die noch die Zeit des Vormärz und die Ereignisse der Revolution von 1848 in Erinnerung hatte, war Hoffmann von Fallersleben der politische Dichter, der mit seinen brisanten Liedern und Gedichten die Herrschenden verhöhnt und verspottet und das Volk zum Kampf für Einigkeit und Recht und Freiheit aufgerufen hatte. Wegen dieser Lieder und Gedichte war er 1843 vom preußischen Staat als Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Breslauer Universität entlassen worden. Damals hatte man dem von Ausweisung und Strafverfolgung bedrohten Dichter, der ruhelos von Stadt zu Stadt und von Land zu Land hetzte, begeistert Fackelzüge dargebracht und ihn als Freiheitsdichter gefeiert.
Als Verfasser von Naturlyrik und Liebesgedichten besaß Hoffmann noch im hohen Alter in der Leserschaft einen beträchtlichen Bekanntheitsgrad. Vor allem dem an Musik interessierten Bürgertum war er als einer der meistvertonten Dichter seiner Zeit im Bewusstsein. So bedeutende Komponisten wie Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms und Franz Liszt, die der Dichter alle persönlich kannte, hatten seine Lieder und Gedichte vertont. Auf Chorkonzerten und Liederabenden waren zu Lebzeiten Hoffmanns mehr als 1.500 Vertonungen seiner Texte zu hören.
Dagegen werden sich nur wenige Trauergäste an Hoffmann als Literaturwissenschaftler erinnert haben. Die Zeit war über ihn hinweggegangen. Dabei hatte er sich als junger Professor für deutsche Sprache und Literatur in den Gelehrtenkreisen seiner Zeit einen respektablen Namen gemacht. Mit seinen zwölfbändigen ›Horae belgicae‹ gehörte er zu den Mitbegründern der alten Niederlandistik.
Wer sich am 24. Januar 1874 vor dem im Klosterhof des Corveyer Schlosses aufgebahrten Sarg verneigte und von dem Toten Abschied nahm, der kannte Hoffmann von Fallersleben in erster Linie als Dichter des Deutschlandlieds und als Verfasser fast aller bekannten deutschen Kinderlieder. Das am 26. August 1841 auf der Insel Helgoland verfasste ›Lied der Deutschen‹ war längst fester Bestandteil im Repertoire von Männerchören und Gesangsvereinen, Arbeitergenossenschaften und politischen Parteien geworden. Vertreter der konservativen Parteien sangen das Lied zu Josef Haydns Melodie auf ihren Veranstaltungen ebenso wie die Nationalliberalen und die Anhänger revolutionärer Gruppen. Die parteiübergreifende Bekanntheit des ›Deutschlandlieds‹ veranlasste ein halbes Jahrhundert später den ersten Präsidenten der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, dieses Lied im Jahr 1922 zur deutschen Nationalhymne zu machen.
Es waren in erster Linie Hoffmanns Kinderlieder, die für die meisten Trauergäste den emotionalen Bezug zum toten Dichter herstellten. Seine in immer neuen Auflagen verbreiteten Kinderlieder hatten längst Einzug in die deutschen Kinderzimmer gehalten. Lieder wie »Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald«, »Alle Vögel sind schon da«, »Ein Männlein steht im Walde«, »Auf unsrer Wiese gehet was«, »Alle meine Entchen«, »Winter, ade!« und »Morgen, Kinder, wird’s was geben« gehörten schon zu Lebzeiten ihres Verfassers zum Bildungsgut vieler Familien. Auf dem Friedhof von Corvey war der Abschied von Hoffmann auch ein Dank an den Dichter für seine Kinderlieder.
Die Germanistik hat frühzeitig das Interesse an diesem Mann verloren, der sich zeit seines Lebens als Schüler in der Gefolgschaft Jacob Grimms gesehen hatte. Als Entdecker und Herausgeber alter Sprachdenkmäler teilte er das Schicksal der meisten Literaturwissenschaftler seiner Zeit, deren Entdeckungen zum Kanon der germanistischen Forschung avancierten, während die Namen der Entdecker in Vergessenheit gerieten. Seine in hohen Auflagen verbreiteten politischen Gedichte, mit denen er in den Jahren des Vormärz einen wichtigen Beitrag zur politischen Bewusstseinsbildung in Deutschland geleistet hatte, verloren nach der Revolution von 1848 ihre Aktualität und gerieten in Vergessenheit. Von seiner Naturlyrik und seinen Liebesliedern haben nur wenige Gedichte den Lauf der Zeit überlebt. In den neueren germanistischen Studien über das Junge Deutschland, den Vormärz und die Biedermeierzeit taucht sein Name nur am Rande oder gar nicht mehr auf.
Unter diesen Vorzeichen ist es nicht verwunderlich, dass es bis auf den heutigen Tag keine wissenschaftlich fundierte Biographie Hoffmanns gibt. Seit dem Erscheinen der umfassenden Gesamtausgabe der Werke Hoffmanns, die der verdienstvolle Hoffmann-Forscher Heinrich Gerstenberg1 zwischen 1890 und 1893 herausgegeben hat, sind nur wenige schmale Einzeldarstellungen und Lebensbilder2 veröffentlicht worden. Erst mit der Kulturgeschichte ›Im schlesischen Mikrokosmos. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben‹ von 2005 aus der Feder des polnischen Germanisten Marek Halub3 und der Studie ›Hoffmann von Fallersleben in Weimar 1854-1860‹ von Irina Kaminiarz4 aus dem Jahr 1988 sind Arbeiten erschienen, die das Leben des Dichtergelehrten in seinen Breslauer beziehungsweise in seinen Weimarer Jahren nachzeichnen und seine literarischen und wissenschaftlichen Leistungen würdigen.
Es war das Verdienst der 1937 gegründeten Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft und des Seminars für deutsche Sprache und Literatur der Technischen Universität Braunschweig, anlässlich von Hoffmanns 200. Geburtstag im April 1998 ein Symposion veranstaltet zu haben, auf dem sich zahlreiche Literaturwissenschaftler mit dem politischen Dichter, Sprachforscher und Volksliedsammler Hoffmann beschäftigten. Die in der Festschrift publizierten Ergebnisse gaben wichtige Anstöße zu einer Auseinandersetzung mit Hoffmanns Werken und deren Wirkungsgeschichte sowie seiner Arbeit als Literaturwissenschaftler in der Frühzeit der deutschen Philologie.5
In den Jahren darauf kam es zu einem regen Gedankenaustausch zwischen den deutschen Hoffmann-Forschern und den polnischen Germanisten und Niederlandisten der Breslauer Universität. Mit feinem Gespür für die Historie nahmen die polnischen Literaturwissenschaftler den Jahrestag von Hoffmanns Ernennung zum Professor an ihrer Universität zum Anlass, im Jahr 2003 in Breslau ein Internationales Symposion zu veranstalten. Ein Schwerpunkt der Forschungsergebnisse lag auf der Untersuchung der zwölfbändigen ›Horae belgicae‹, mit denen der Dichtergelehrte schon früh einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der alten niederländischen Literatur geleistet hatte. Hoffmanns hymnologische Arbeiten zum mittelalterlichen Kirchenlied wurden ebenso gewürdigt wie seine bahnbrechenden Untersuchungen zum Volkslied. Die Auswertung jüngster Archivfunde gab Anstöße zu einer veränderten Einschätzung der Rolle Hoffmanns als politischer Dichter nach dem Vormärz. Weitere Forschungsschwerpunkte lagen auf den zahlreichen Vertonungen seiner Lieder und Gedichte.6
Die deutsch-polnische Zusammenarbeit fand einen vorläufigen Höhepunkt, als sich im Mai 2008 die führenden Vertreter der Breslauer Germanistik und Niederlandistik mit den deutschen Hoffmann-Forschern in der niedersächsischen Heimat Hoffmanns zum dritten Internationalen Symposion trafen.7 Hier kam es zur Veröffentlichung bisher unbekannter Dokumente, die zu einer völlig neuen Bewertung von großen Teilen der Biographie Hoffmanns führen. Was Kurt G. P. Schuster, der Präsident der Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft, an neuen Dokumenten entdeckt hatte, lässt große Teile der bisherigen Lebensbilder zu Makulatur werden. Hatte sich Hoffmann in seiner 1868 erschienenen Autobiographie ›Mein Leben. Aufzeichnungen und Erinnerungen‹8und seinen zahlreichen Briefen als armen Poeten dargestellt, als zeit seines Lebens völlig mittellosen Literaten, der nur mit größter Mühe seinen kargen Lebensunterhalt hatte bestreiten können, so entpuppte er sich jetzt als cleverer Geschäftsmann und erfolgreicher Händler seiner Flugschriften und politischen Lieder, der von seinen Einnahmen in Form von Gehaltszahlungen, Bücherverkäufen, Verlagshonoraren und beträchtlichen Kapitalanlagen ein Leben in Wohlstand hätte führen können.
Das wirft natürlich die Frage nach der Glaubwürdigkeit von Hoffmanns autobiographischen Aufzeichnungen und seinen Briefen auf. Die Autobiographie ist ein Gemisch von Erinnerungen, Datensammlungen, Tagebucheintragungen, Briefzitaten, Zeitanalysen und Presseausschnitten. Aber die naive Ehrlichkeit, mit der Hoffmann über seine Erfolge wie auch seine Misserfolge und seine Niederlagen berichtet hat, macht dieses Dokument in Verbindung mit seinen Briefen zu einer hervorragenden Quellensammlung. Sie dient der vorliegenden Biographie als Zitaten-Steinbruch.
Es war die Aufgabe des Biographen, die vorhandenen Dokumente auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, sie mit den Aussagen von Zeitzeugen zu vergleichen, Richtigstellungen und Präzisierungen vorzunehmen und ein Lebensbild Hoffmanns zu entwerfen, das auf alle Ausschmückungen, spekulative Übertreibungen und falsche Rücksichtnahmen verzichtet. Die Auswertung der neuesten Forschungsergebnisse macht es möglich, auch in solche Lebensabschnitte Licht zu bringen, über die Hoffmann geschwiegen, unrichtige Angaben gemacht oder einseitig geschönte Darstellungen geliefert hat.
Das Leben Hoffmanns verlief vor dem Hintergrund der großen historischen Ereignisse des 19. Jahrhunderts. Die Freiheitskriege, die Jahre der Restauration, der Vormärz, die Revolution von 1848 und die Jahre vor und nach der Reichsgründung von 1871 – seine politischen und dichterischen Stellungnahmen zu diesen Ereignissen haben nicht selten zu Fehlinterpretationen und zu einer unzulässigen Vereinnahmung und Instrumentalisierung seiner Person und seiner Werke geführt. Der schwierige Charakter dieses Mannes und sein umtriebiges Leben machen es dem Biographen nicht leicht, zu einer gerechten Bewertung zu kommen. Hoffmann war Dichter und Gelehrter, erfolgreicher Entdecker von Sprachdenkmälern und Volksliedsammler, Kirchenliedforscher und politisch engagierter Liedermacher, bedeutender Herausgeber von altniederländischer Literatur und gefeierter Verfasser von Kinderliedern. Er war aber auch der ewige Verächter der französischen Kultur, ein bornierter deutschtümelnder Versemacher und ein spießiger Provinzler, der in fremden Ländern für alles Fremde nur Spott übrig hatte. Und er war der zündelnde Intellektuelle, der das politische Feuer von 1848 vorbereiten half, aber beim Brand nicht dabei sein wollte. Diese Biographie unternimmt den Versuch, Hoffmann Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und seinen historischen Standort zu bestimmen.
1. Kindheit und Jugend, Studienjahre und frühe Anfänge
Kindheit und Jugend in Fallersleben
August Heinrich Hoffmann wurde am 2. April 1798 in Fallersleben geboren, einem kleinen Ort im Kurfürstentum und späteren Königreich Hannover. Der Vater Heinrich Wilhelm Hoffmann war Kaufmann und Gastwirt, später auch Bürgermeister der Gemeinde, in der um die Jahrhundertwende etwa 1.000 Einwohner lebten. Die Mutter Dorothea Eleonore Maria Hoffmann war eine geborene Balthasar und stammte aus dem benachbarten Wittingen. Unter den Vorfahren väterlicher- und mütterlicherseits finden sich häufig die Berufsbezeichnungen Kaufmann und Gastwirt. Die bodenständige Familie der Hoffmanns hat mehrfach den Bürgermeister von Fallersleben gestellt.1
Zehn Kinder hat Dorothea Hoffmann zwischen 1788 und 1803 zur Welt gebracht, sechs davon wurden entweder tot geboren oder starben noch vor oder kurz nach Erreichen des ersten Lebensjahres. Heinrich war das dritte der das Kindesalter überlebenden Kinder. Der ältere Bruder Daniel kam 1790 auf die Welt, die ältere Schwester Auguste wurde 1794 geboren, für die jüngere Schwester Dorothea Friederike wird 1800 als Geburtsjahr angegeben. Das Geburtshaus aller Kinder war ein stattliches Fachwerkhaus, es befand sich seit 1688 im Besitz der Familie und war eines der größten Häuser am Platz.
Die dominierende Gestalt in der Familie war der Vater. Er erfreute sich »eines hohen Ansehens, weil er sich vor niemandem fürchtete, und im Bewusstsein, nur das Rechte zu wollen, sich auch vor niemandem zu fürchten brauchte. Schon seine stattliche Gestalt, seine Körperstärke und Gewandtheit, mehr aber noch seine ganze Art und Weise, wie er auftrat, waren achtunggebietend.« Die imponierende Erscheinung des Vaters hat der Sohn in seinen Erinnerungen mehr als einmal ausführlich beschrieben. Der junge Heinrich hatte nicht nur die hochgewachsene Statur des Vaters geerbt und dessen dominantes Auftreten übernommen, sondern auch dessen Unbeugsamkeit und Starrsinn.
Die aufopferungsvoll für die Familie sorgende Mutter hat dagegen in seinem Leben keine große Rolle gespielt. Dorothea Hoffmann hat ihren Mann um mehr als zwanzig Jahre überlebt. Obwohl der Sohn anlässlich seiner ausführlich beschriebenen Besuche mehr als einmal die Gelegenheit gehabt hätte, ein seine Mutter charakterisierendes Lebensbild zu entwerfen, hat er es nicht getan. Sie bleibt immer die Frau im Hintergrund, unscharf und ohne hervorstechende Züge. Es war auch nicht die Mutter, sondern die Großmutter, die sich um das kranke und schwächelnde Kind gekümmert hat, das nicht nur alle Kinderkrankheiten durchmachte, sondern nach einer bösartigen Hauterkrankung sogar vorübergehend erblindet war. Der durch übergroße Fürsorge verzogene Junge leistete sich Eigenwilligkeiten bei Eßgewohnheiten und Kleiderwahl, ansonsten verlief die Kindheit ohne besondere Auffälligkeiten.
Im dörflich geprägten Fallersleben passten die Kinder ihre Spiele dem zyklischen Verlauf der Jahreszeiten an. Im Frühling hatte man seine Freude am Säen und Pflanzen im Garten und sammelte Schmetterlinge, im Sommer ging man in die umliegenden Wälder zum Beerenpflücken, im Herbst halfen die Kinder bei der Ernte, und die schneereichen Wintermonate boten Gelegenheit zu Schlittenfahrten und Spielen auf dem Eis. Schilderungen von Taubenzucht und Kaninchenhaltung, Volksfesten und öffentlichen Spielveranstaltungen vervollständigen die Erinnerungen an fast idyllische Kinderjahre, die auch nach dem Einmarsch fremder Soldaten und der Einquartierung wechselnder Besatzungsmächte ungetrübt verlaufen sind.
Die großen Ereignisse der Geschichte wälzten sich in diesen Jahren wie eine gewaltige Flutwelle über die deutschen Länder. Das Kurfürstentum Hannover wurde ab 1803 zum Spielball der Großmächte. Im kleinen Fallersleben erlebte man den Lauf der Geschichte mit dem Kommen und Gehen der Besatzungsmächte. Im Mai des Jahres 1803 marschierten die Franzosen in den kleinen Ort ein und blieben bis zum Herbst des folgenden Jahres. Eine Schwadron berittener Artillerie hatte in Fallersleben Standquartier genommen, die kleinen Jungen freuten sich über die bunten Uniformen und die roten Federbüsche auf den Helmen und spielten Soldat. Als die Franzosen abzogen und im Oktober 1804 die Preußen kamen, liefen die Kinder auf der Straße den preußischen Soldaten nach. Und sie liefen auch den Soldaten aus Schweden und Russland hinterher, als diese durch Fallerslebens Straßen marschierten. Im Jahr 1806 prangte im kleinen Ort auf den Landeshoheitspfählen der preußische Adler. Am Straßenrand winkten die Einwohner den in den Krieg ziehenden Truppen Preußens zu, wenig später begafften sie die versprengten Haufen und den langen Zug der Flüchtlinge. Jetzt erzählte man von verlorenen Schlachten der Preußen. Schon im November desselben Jahres verschwanden die preußischen Adler und machten den französischen Hoheitszeichen auf den Pfählen Platz. Auf dem Weihnachtsmarkt bestaunten die Bürger die zum Verkauf ausgestellten Bilderbogen. Auf einem war der Tod des Prinzen Louis von Preußen zu sehen, auf einem anderen feierte Kaiser Napoleon mit seinen Generälen den Sieg in der Schlacht von Jena und Auerstedt.
Hoffmanns Geburtshaus in Fallersleben um 1870
In Fallersleben ging alles seinen gewohnten Gang. Der kleine Heinrich Hoffmann hatte inzwischen die Bürgerschule besucht, ein großer Raum, in dem eine Vielzahl von Kindern verschiedener Altersstufen von einem einzigen Lehrer beaufsichtigt wurde, der ihnen Lesen und Schreiben beibringen sollte. Die wenigen bessergestellten Eltern, abgeschreckt von der Unfähigkeit des überforderten Lehrers, besorgten ihren Kindern einen Privatlehrer, der auch Naturkunde, Geographie und Französisch unterrichten musste. In seinen Erinnerungen kann sich Hoffmann für den Unterricht im Rechnen und für die Musik begeistern. Der dilettantische Nachbau von Musikinstrumenten aller Art beschäftigte ihn für längere Zeit, aber er wird niemals das Spielen auf einem Musikinstrument erlernen. Und erstaunlicherweise wird er auch später als erfolgreicher Dichter und Komponist von Kinderliedern nicht die Notenschrift beherrschen.
Vater Hoffmann blieb trotz wechselnden Besatzungsmächten im Amt des Bürgermeisters. Er konnte es sich leisten, die schulische Ausbildung seines Sohnes durch Privatunterricht zu ergänzen. Der Junge tat sich besonders hervor durch flüssiges Vortragen von Texten. An zwei Abenden in der Woche musste er den Stammgästen in der Wirtschaft die Zeitung vorlesen. Man hatte in Fallersleben den ›Hamburger Unparteiischen Correspondenten‹ abonniert, der sowohl über die große Politik als auch über die kleinen Tagesgeschehnisse informierte. An die patriotischen Kommentare des Bürgermeisters Hoffmann wird sich der Sohn noch nach Jahrzehnten erinnern. Die Niederlagen der Preußen gegen die Franzosen wurden als Niederlagen für alle Deutschen empfunden.
Während die Gäste in der Wirtschaft ihr Bier tranken und Zigarren rauchten, las der Elfjährige die Berichte aus dem ›Hamburger Unparteiischen Correspondenten‹ vor, Berichte über Napoleons Feldzüge nach Spanien im Jahr 1809 und die Kämpfe der Truppen des Rheinbundes an der Seite des französischen Kaisers. Bald darauf beherrschten die Kriege in Süddeutschland und der Aufstand in Hessen die Schlagzeilen. Jubel kam in der Gastwirtschaft auf bei den Meldungen über den Sieg in der Schlacht von Aspern, Verzweiflung und Wut nach Napoleons erneuten Siegen, dann Triumphgefühle, als der vom französischen Kaiser seines Landes beraubte Herzog Friedrich Wilhelm wieder in Braunschweig einzog.
Im Jahr 1810 wurde Hannover mit dem Königreich Westfalen vereinigt, an dessen Spitze Napoleons Bruder Jérôme als König herrschte. Jetzt gab es auch im beschaulichen Fallersleben große Veränderungen. Frankreich war Besatzungsmacht, der kleine Ort wurde zum selbständigen Canton im neu gebildeten Oker-Departement erhoben, Bürgermeister Hoffmann wurde Canton-Maire, sein ältester Sohn Daniel avancierte zum Mairie-Secrétaire. Das Gehalt war zwar spärlich, aber das Amt gewährte dem patriotisch denkenden Bürgermeister einen gewissen Handlungsspielraum gegenüber der französischen Herrschaft. Heinrich Hoffmanns antifranzösische Haltung, die von ihm zeit seines Lebens lautstark vorgebrachten Ressentiments gegen die französische Kultur und seine bis zum Hass gesteigerte Abneigung gegen alles »Welsche« haben ihre Wurzeln in diesen jugendlichen Erfahrungen.
Das Leben unter einer Besatzungsmacht brachte gerade in einem kleinen und überschaubaren Gemeinwesen ein verändertes politisches Klima mit sich. »Plötzlich war nun alles anders geworden. Das öffentliche Politisieren hörte auf«, liest man in Hoffmanns Aufzeichnungen. Es ist nur zu verständlich, dass sich der über Jahrzehnte hinweg von der Polizei verfolgte Schriftsteller vor allem an die Allgegenwart der von den Franzosen eingesetzten Geheimpolizei erinnert. Diese ständige Bedrohung zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben: »Die geheime Polizei nämlich, diese saubere Napoleonische Einrichtung, war auch in Westfalen eingerichtet und zählte mehr Eingeborene als Fremde unter ihren Helfern und Helfershelfern – ewige Schmach für den deutschen Namen!«
Die Zensur, die seine schriftstellerische Arbeit bis ins hohe Alter beeinträchtigt hat, lernte Hoffmann schon als Zwölfjähriger kennen. Mit dem Vorlesen der Meldungen und Berichte aus dem ›Hamburger Unparteiischen Correspondent‹ hatte es jetzt ein Ende. Die französischen Besatzer sorgten für eine kontrollierte Berichterstattung: »Der Westfälische ›Moniteur‹, die einzige westfälische Zeitung, halb französisch, halb deutsch, ging von der Regierung aus; alle Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Flugblätter und Anzeigen standen unter der strengsten Zensur. Fremde Zeitungen waren zu teuer und durften sich ebenfalls nicht frei äußern. Der ›Hamburger Unparteiische Correspondent‹ hatte für uns aufgehört.« Man spürt die ganze Verbitterung des über Jahrzehnte hinweg von der Geheimpolizei verfolgten, von der Zensur eingeschränkten und schließlich wegen seiner kritischen Gedichte aus Amt und Würden gejagten Hoffmann, wenn er sich noch nach mehr als fünfzig Jahren an die Verfolgung von Polizei und Zensur erinnert: »Geheime Polizei und Zensur hatte bis jetzt keiner bei uns eigentlich gekannt, jetzt lernten wir sie in ihrer ganzen Bedeutung kennen: beide waren die besten Mittel zur gänzlichen Unterdrückung der Wahrheit und jeder vaterländischen und freisinnigen Regung.«
Seiner patriotischen Einstellung und seiner Franzosenfeindlichkeit zum Trotz hat Hoffmann aber eine durchaus differenzierte Haltung gegenüber den Neuerungen der Besatzer eingenommen. Die französischen Eroberer waren nicht nur die unerwünschte Besatzungsmacht, sie waren gleichzeitig auch die erwünschten Reformer: »Das junge Königreich Westfalen hatte Gleichheit vor dem Gesetz, mündliches und öffentliches Gerichtsverfahren, Schwurgerichte, allgemeine Conscriptions-und Steuerpflichtigkeit, freie Ausübung des Gottesdienstes der verschiedenen Religionsgesellschaften, gleiche Berechtigung zu öffentlichen Ämtern, Trennung der Justiz und Verwaltung und hatte – keine Hörigkeit, keine Frohnden und Zehnten, keine Privilegien und keinen Adel.« In diesem problematischen Spannungsfeld von Unterdrückung und Fortschritt war es nach Darstellung des Sohnes der Vater, der sich vorbildlich verhalten hat. Als Canton-Maire kam er seinen Pflichten nach, aber er schöpfte den Rahmen seiner Möglichkeiten voll aus, verweigerte Denunziationen, und im Zweifelsfall fällte er seine Entscheidungen zugunsten seiner Landsleute, nicht zugunsten der Besatzer.
Am 7. April 1812, wenige Tage nach der Konfirmation des gerade vierzehn Jahre gewordenen Heinrich, begleitete Daniel Hoffmann seinen Bruder in das nur eine Tagesreise entfernte Helmstedt. Das dortige Pädagogium stand zwar als gymnasiale Ausbildungsstätte nicht im besten Ruf, aber es bot doch genügend Möglichkeiten für eine ordentliche Ausbildung. Die Entdeckung seiner außerordentlichen Sprachbegabung sollte für den jungen Hoffmann die entscheidende Erfahrung dieser zwei Jahre auf dem Helmstedter Gymnasium werden.
Jede Künstlerbiographie fragt nach den prägenden Einflüssen, die in einem jungen Menschen den Grundstein zu einer künstlerischen Laufbahn gelegt haben. Manchmal ist es das Vorbild eines in der Kunst, Musik oder Literatur erfolgreichen Elternteils, dann wieder die Förderung einer frühzeitig erkannten Begabung, die am Anfang einer Künstlerlaufbahn stehen. Im Elternhaus Hoffmanns wird man vergebens nach solchen prägenden Einflüssen suchen. Besondere Anregungen auf dem Gebiet der Musik oder der Literatur hat der später so erfolgreiche Liederdichter und Sprachwissenschaftler in seiner Jugend nicht erhalten. Im Alter von vierzehn Jahren habe er angefangen, einfache Verse zu schreiben, berichtet Hoffmann in seinen ›Erinnerungen‹. Der um eine Beurteilung gebetene Lehrer drückte ihm daraufhin die Sprachlehren von Johann Heinrich Voß und Karl Philipp Moritz in die Hand, mit denen der Junge aber nichts anfangen konnte. Erst die Gedichte des Johann Gaudenz von Salis-Seewis, die der hilfsbereite Lehrer dem Wissbegierigen als vorbildliche Lektüre für angehende Dichter empfahl, wurden zu einer Art Schlüsselerlebnis. Der heute weitgehend vergessene Salis-Seewis, 1762 in Graubünden in der Schweiz geboren, genoss zu jener Zeit wegen seiner formgewandten Gedichte und nicht zuletzt wegen seiner persönlichen Bekanntschaft mit Goethe, Schiller und Herder einen guten Ruf als Dichter. Für den jungen Hoffmann wurde die Beschäftigung mit diesen Gedichten zur wichtigen Begegnung mit der Lyrik: »Ich las mit wahrer Andacht und las langsam, wohl ein Vierteljahr hindurch nichts als Salis; ehe ich ein neues anfing, kehrte ich gern zu den alten liebgewordenen zurück. Salis war zu sehr mein eigenes Selbst geworden, als dass ich an ein Darstellen meiner Leiden und Freuden gedacht hätte. So wie ich aber mit dem Technischen minder zu kämpfen hatte, stellte sich der Trieb zu dichten stärker ein als je zuvor.« Weder von den Eltern noch von den Lehrern, auch nicht von Freunden hat der junge Hoffmann irgendwelche Hilfe beim Schreiben von Gedichten bekommen. Er war auf sich allein gestellt. Aber die unermüdlichen Versuche, den richtigen Rhythmus der Sprache und die passenden Reime für seine noch hilflosen Verse zu finden, haben sein Sprachgefühl entwickelt.
Die frühen dichterischen Versuche des Vierzehnjährigen fanden vor dem Hintergrund der großen politischen Ereignisse des Jahres 1812 statt. Im Sommer marschierten französische Regimenter durch Helmstedt in Richtung Osten. Im Gymnasium bemühte man sich, die Schüler über die Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Man hatte die ›Augsburger Allgemeine Zeitung‹ abonniert, aus der sich die Jungen über Napoleons Kriegserklärung gegen Russland und die Gegenerklärung des Zaren informieren konnten. Im Herbst schwoll der durch die Straßen Helmstedts marschierende Strom von Soldaten an. Im Winter berichtete der ›Westfälische Moniteur‹ von der Niederlage der Franzosen vor Moskau und von der Flucht Napoleons. Bürgermeister Hoffman las diese Nachrichten seiner Familie vor, die in geschlossener Runde das Weihnachtsfest feierte. Auch Heinrich war dabei, Bruder Daniel hatte ihn trotz Schnee und Eis und klirrender Kälte im Pferdewagen abgeholt und nach Fallersleben mitgenommen. Als der Frühling Einzug hielt, marschierten wieder französische Regimenter durch Helmstedts Straßen, diesmal in Richtung Westen. Auch westfälische Soldaten waren dabei, die den Rückzug aus Russland in erbarmungswürdigem Zustand überlebt hatten und den neugierigen Schülern Einzelheiten von den Kriegsschauplätzen im fernen Russland berichten konnten. Als Heinrich in den Osterferien wieder in Fallersleben war, konnte er zum letzten Mal die plündernde Soldateska der Franzosen erleben. Wieder war es der Vater, der als Bürgermeister die Ordnung aufrechtzuerhalten versuchte und schlichtend eingriff, um Unheil zu verhüten.
Bald darauf erreichte der Geist der deutschen Freiheitskriege das Gymnasium in Helmstedt. Jetzt sprengten preußische Husaren durch die Straßen. »Am 24. Juli gingen vier meiner Mitschüler heimlich unter die preußischen Freiwilligen«, hat Heinrich in sein seit Jahresanfang geführtes Tagebuch notiert. Weitere Kameraden schlossen sich den Freiwilligen an, als die Kunde von der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 die Runde machte.
Das Ende des Königreichs Westfalen hat der Bürgermeister von Fallersleben auf souveräne Art und Weise überstanden. Er forderte seine Mitbürger, die von nun an nicht mehr Westfalen, sondern wieder Hannoveraner waren, in öffentlicher Rede auf, ihn wegen vorsätzlicher Ungerechtigkeiten oder sonstigen schuldhaften Verhaltens anzuklagen. Nachdem sich niemand mit Schuldvorwürfen gemeldet hatte, erklärte Heinrich Wilhelm Hoffmann seinen Rücktritt vom Amt des Bürgermeisters, verzichtete auf das Jahresgehalt von 50 Talern und zog sich im November 1813 ins Privatleben zurück.
Die politischen Ereignisse haben den Sohn durchaus beschäftigt, aber noch mehr kümmerte er sich um seine Ausbildung. Der junge Heinrich verfügte über eine enorme Arbeitskraft, die ihm sein ganzes Leben lang zustatten kommen sollte. Mit Erfolg erweiterte er seine Kenntnisse in den Fächern Latein, Griechisch und Französisch. Daneben schrieb er weiter Gedichte. »Für Poesie blieb ich nach wie vor beseelt und thätig trotz allen Aufregungen, welche sich durch das Kriegsgetümmel wiederholten.« Er las Kleist, Matthisson und Hölty, Schillers Balladen lernte er auswendig. Im Tagebuch notierte er: »Die Lectüre deutscher Dichter wird mir immer angenehmer.« Als das Gymnasium in Helmstedt am 24. Januar 1814 die Rückkehr von Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig mit einem Festakt beging, durften sechs ausgewählte Schüler Gedichte vortragen. Heinrich war einer von ihnen, er deklamierte ›Das Vaterlandslied für die Deutschen‹ von Ernst Moritz Arndt, der als Dichter der Freiheitskriege bei den Jungen hohes Ansehen genoß. Seine eigenen Gedichte kreisten in dieser Zeit um Motive aus dem Wechsel der Jahreszeiten und um den Tod der jüngsten Schwester. In seinen Mitschülern fand er ein aufmerksames Publikum.
Das Frühjahr 1814 brachte Veränderungen im Leben des Jungen mit sich. Auf Wunsch seines Vaters sollte er Helmstedt verlassen und auf das renommierte Katharineum in Braunschweig wechseln. Am 19. April nahm er von Lehrern und Mitschülern Abschied, schon am 25. April bestand er die Aufnahmeprüfung in seiner neuen Schule. Bei einem alten Küster und dessen Frau fand er Unterkunft, der Vater hatte das Kostgeld für drei Mahlzeiten am Tag bewilligt. Der Schulanfang fiel in die Zeit straff organisierter militärischer Aufrüstung, denn der Herzog von Braunschweig gab sich größte Mühe, das Heer seines kleinen Landes zu vergrößern und die Ausrüstung seiner Soldaten zu verbessern. »Kein Wunder, dass auch unter solchen Rüstungen meine Poesie ihre bisherige harmlose Richtung einbüßte«, erinnerte sich später der Dichter an seine jugendlichen Versuche. Begeistert von den Ideen der deutschen Freiheitskriege, las er jetzt die Lieder aus Theodor Körners ›Leyer und Schwert‹. Unter dem Eindruck der glücklich erfolgten Vertreibung der Franzosen und beeinflusst vom patriotischen Pathos von Körners Liedern verfasste er auf dem Braunschweiger Katharineum in kürzester Zeit einige Lieder und Xenien, die er seinem Vater vorlegte. Der alte Hoffmann zeigte sich beeindruckt.
Seinen ersten Erfolg feierte der junge Dichter am Tag nach dem 24. Juli 1814, dem Tag des Friedensfestes, das im ganzen hannoverschen Land gefeiert wurde. Beim Schützenfest der Schützengilde sang die versammelte Jugend von Fallersleben das Lied »Herein, herein in unsers Kreises Runde«, der Text stammte aus der Feder des jungen Heinrich Hoffmann. Wenige Wochen später überreichte ein Braunschweiger Buchdrucker dem stolzen Verfasser einige Abdrucke seines Liedes. Eine prägende Erfahrung! Die Art und Weise der Entstehung der ersten Veröffentlichung Hoffmanns ist symptomatisch für das Erscheinen vieler seiner Werke. Jeweils aus gegebenem Anlass wurde rasch ein Text verfasst und ebenso rasch ein Drucker gefunden. Schon nach wenigen Tagen kam die Gelegenheitsarbeit als Faltblatt oder einfacher Druckbogen heraus. An einem kontinuierlichen Aufbau eines Gesamtwerkes war Hoffmann zeit seines Lebens nicht interessiert.
Der frühe Erfolg war für den erst sechzehnjährigen Gymnasiasten eine große Motivation. Im Sommer und Herbst des Jahres 1814 beschäftigte er sich besonders intensiv mit den alten Sprachen, daneben setzte er seine literarischen Versuche fort. Er schrieb jetzt nicht nur Gedichte, sondern versuchte sich auch als Satiriker. Kurz vor den Weihnachtsferien legte er seinem Vater erwartungsvoll die Versuche vor. Der aber reagierte mit Hohn und Spott auf das ebenso arrogante wie dilettantische Gefasel. »Angehender Hogarth«, lästerte der alte Hoffmann, »gewöhne Dir die Faseleien ab, denn in der That, ich möchte Dich künftig nicht gern in der Schaar der Satyriker sehen.« Die barsche Kritik verfehlte ihre Wirkung nicht. Bis zu den Osterferien kümmerte sich der gescheiterte Satiriker fast ausschließlich um die schulischen Belange.
Die Osterferien 1815 wollte er im Elternhaus verbringen. Auf dem Fußmarsch von Braunschweig nach Fallersleben wurde er von den Nachrichten aus der großen Politik überrascht. Kaiser Napoleon war aus seiner Verbannung nach Frankreich zurückgekehrt. Im ganzen Land herrschte große Aufregung. Werber zogen durch Städte und Dörfer, um die jungen Männer zu den Waffen zu rufen. Jetzt musste die gerade errungene Freiheit gegen das napoleonische Frankreich verteidigt werden. Auch im Hause Hoffmann fand ein Anwerbeversuch statt. Als ein aufgeregter Amtmann die von Napoleon ausgehende Gefahr beschwor und den inzwischen siebzehnjährigen Heinrich aufforderte, sich den vielen jungen Männern anzuschließen und sich zur Verteidigung des Vaterlandes zur Verfügung zu stellen, da lehnte dieser das Ansinnen ab. »Für die schöne Regierung werde ich meine Haut nicht zu Markte tragen«, will er damals gesagt haben. Und ohne jeden weiteren Kommentar hat er in seinen Erinnerungen die Aussage mit dem Satz ergänzt: »Ich meinte das in vollem Ernste, weil ich lieber gegen die inneren als die äußeren Feinde kämpfen wollte.«
Schon in den Jahren zuvor hatte der Gymnasiast erlebt, wie Schulkameraden heimlich die Schule verließen und sich als Freiwillige bei den preußischen Truppen meldeten, um aktiv an den deutschen Freiheitskriegen teilzunehmen. Und wie damals hat er es auch diesmal vorgezogen, lieber vom ungefährdeten Schreibtisch aus zu kämpfen. Die Kritik an der Landesregierung als Vorwand setzt einen peinlichen Akzent. Denn in den nächsten Monaten schreibt der junge Hoffmann Freiheitslieder und politische Sonette im Stil des Theodor Körner. Von Kritik an den »inneren Feinden« ist gar nicht die Rede. Jetzt wird der deutsche Freiheitskampf glorifiziert, an dem er selbst gar nicht teilnimmt. Die Gedichte wurden lautstark vor den Klassenkameraden vorgetragen, verbales Säbelrasseln ersetzte den Kampf mit der Waffe. Beim ortsansässigen Buchdrucker ließ er vier seiner Gedichte ohne Nennung eines Verfassernamens unter dem Titel ›Deutsche Lieder‹ drucken. »Die Begeisterung, in der sie verfasst sind, verdient noch heute Anerkennung; sonst ist nichts Gutes dran«, heißt es im Rückblick. Ein ähnlich abschätziges Urteil galt auch seiner ›Elegie auf den Tod des Herzogs von Braunschweig‹. Herzog Friedrich Wilhelm war am 16. Juni 1815 in der Nähe von Waterloo kurz vor der erfolgreichen Schlacht gegen Napoleon gefallen. Sechzehn vierzeilige Strophen brachte Hoffmann in starker Eile zu Papier, dann ließ er die patriotische Klage als Flugblatt ohne Ortsangabe und Erscheinungsdatum, aber unter seinem Namen drucken. »Das einzig Gute daran ist der Höltysche Ton«, distanzierte sich der Verfasser später von seinem pathosgetränkten Machwerk. Immerhin stehen die ›Deutschen Lieder‹ und die ›Elegie‹ im Werkverzeichnis Hoffmanns auf den ersten beiden Plätzen.
Neben dem Verfassen von politisch engagierten Sonetten, wozu ihn die Siegesmeldungen aus Frankreich motivierten, schrieb er jetzt auch im Zustand jungenhafter Verliebtheit lange Erzählungen, Romanzen, Balladen und Naturbeschreibungen. Ein Schulkamerad hatte es ihm angetan. In seinem verliebten Zustand ließ er sich zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen. Mit Ludwig Henneberg sollte ihn eine jahrzehntelange Freundschaft verbinden, die auch manche Brüche überdauert hat.
Sein literarisches Vorbild war jetzt nicht mehr der Dichter Salis-Seewis, nun bewunderte er Gotthard Ludwig Theobald Kosegarten, dessen schwülstige Gedichte und empfindsame Romane sich zu dieser Zeit beim Publikum großer Beliebtheit erfreuten. Später wird er dieses frühe Vorbild als »unglückliche Wahl« bezeichnen. Mit der gleichen Vehemenz, mit der sich der Heranwachsende in die Welt gefühlsseliger Schwelgereien gestürzt hatte, riss er sich auch wieder heraus. »Diese Schwäche junger Poeten hatte ich nun erkannt und suchte durch ein frisches männliches Streben nach Klarheit meiner bewusst zu werden und mich von aller Gemüthsschwäche zu bewahren.« Er wechselte den Freundeskreis und verbrachte mit den neuen Kameraden die Abende in den Wirtshäusern. Mit Hohn und Spott zog man über die vermeintlichen Spießbürger her, die man im Kreis der Lehrerschaft oder sonst wo entdeckt zu haben glaubte. Der junge Poet distanzierte sich sogar von seiner dichterischen Vergangenheit: »Selbst mein Hang zur Poesie erschien mir abgeschmackt und nur höchstens noch dazu passend, ihn als Gegenstand des Witzes zu verbrauchen.« Nicht einmal das Tagebuch wurde fortgesetzt.
Das letzte Halbjahr auf dem Braunschweiger Katharineum diente den Vorbereitungen auf einen guten Schulabschluss. Um den musste er sich keine Sorgen machen, er lernte leicht und schnell, seine große Sprachbegabung ließ ihn in den wichtigsten Fächern jener Zeit, Latein und Griechisch, ohne Schwierigkeiten gute Leistungen bringen. Mit den Freunden wurde auf den Wirtshausabenden bei Bier und Wein nicht nur großmäulig gespottet und gelästert. Für die Primaner stellte sich inzwischen immer drängender die Frage nach der Berufswahl. Bis zum Beginn des Sommersemesters 1816 musste sich Hoffmann entscheiden. Natürlich kam nur ein Studium in Frage. Die Eltern drängten ihn zwar nicht, aber sie legten ihm ein Brotstudium nahe. »Sie wünschten die Theologie, ließen mir aber freie Wahl.« An allen deutschen Universitäten wurden damals massenhaft junge Theologen ausgebildet. Da nicht annähernd so viele Pfarrstellen zu vergeben waren, wie Theologen die Universität verließen, blieb den meisten Absolventen später nichts anderes übrig, als Lehrer zu werden. Vor Beginn seines Studiums hatte sich der junge Hoffmann nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht, welche beruflichen Möglichkeiten sich ihm boten, er willigte ohne Widerspruch ein und kam den Wünschen des Vaters nach. Am 2. April 1816 feierte er seinen achtzehnten Geburtstag, verbrachte nach dem Abschied von Lehrern und Mitschülern am Katharineum noch einige Tage im Elternhaus, dann machte er sich Ende April auf die Wanderung nach Göttingen, um das Studium zu beginnen.
Studienjahre in Göttingen
Am 28. April 1816 traf Hoffmann in Göttingen ein, wenige Tage später immatrikulierte er sich an der renommierten Georgia Augusta, einer der bedeutendsten deutschen Universitäten. Drei Vorlesungen hat er belegt, Kirchengeschichte, Hebräisch und die Paulinischen Briefe. Sein Urteil über die Vorlesungen fiel vernichtend aus. Zum einen langweilten ihn die Themen, zum anderen hielt er die Professoren für unfähig. Die abschätzige Meinung des jungen Studenten muss keineswegs den wahren Sachverhalt wiedergeben. Zeit seines Lebens hat Hoffmann große Schwierigkeiten gehabt, Vorträge und Vorlesungen in ganzer Länge anzuhören. Themen außerhalb seines Interessengebietes langweilten ihn. Seine Hyperaktivität und seine Ungeduld haben ihn noch im fortgeschrittenen Alter Unhöflichkeiten begehen lassen, er hat so manchen Vortragsredner einfach unterbrochen oder ist abrupt aus Veranstaltungen fortgegangen. Jetzt aber kam hinzu, dass sich die Wahl des Theologiestudiums als Fehlgriff herausstellte. Immer wieder malte er sich die kommenden Jahre als Abstieg auf der »Jacobsleiter meiner Wünsche und Hoffnungen« aus. Zuerst die Studienjahre in einem Fach, das ihn nicht interessierte, dann die Tätigkeit als Hauslehrer, schließlich die Jahre als Kandidat und Prediger auf der Suche nach einer Pfarrstelle, und am Ende drohte das Dasein als Pfarrer mit Weib und Kindern im trauten Heim. »Die Wünsche der Deinigen, wenn auch nicht deine« wären dann in Erfüllung gegangen, lautete die nüchterne Bilanz. Ein Blick auf die Vermögensverhältnisse seiner Familie machte ihm klar, dass schwierige Zeiten auf ihn zukommen würden. Mit einer nennenswerten Unterstützung konnte er nicht rechnen. Der Vater hielt ihn knapp. Es muss offenbleiben, ob er aus erzieherischen Gründen dem Sohn eine großzügigere Unterstützung verweigert hat oder ob er dies aus einer gewissen Weltfremdheit tat, wie der Sohn mutmaßte. Der junge Student lebte am Existenzminimum, manchmal machte er Schulden, und wenn der Vater nach verzweifelten Bettelbriefen ein paar Taler schickte, mussten davon die Schulden beglichen werden.
Nach dem Sommersemester 1816 entschloss sich Hoffmann zu einem Wechsel des Studienfaches. Unterstützung für dieses Vorhaben erhielt er von einem Bruder seines Vaters, der als Pfarrer in Mühlhausen im Waldeck’schen lebte. Von Ende September bis Mitte Oktober hielt er sich bei seinem Onkel auf und ließ sich beraten. Ganz nebenbei fand er Interesse an der Sprachforschung und begann mit der Arbeit an einem Waldeck’schen Idiotikon. Dialektstudien wird er in seinem Leben an vielen Wohnorten betreiben. Kaum war er wieder in Göttingen, belegte er für das Wintersemester die Vorlesungen in Ästhetik, Philologie und Altertumskunde. Erst im Laufe des Semesters fand er den Mut, seinem Vater den Wechsel des Studienfaches mitzuteilen. »Mönchlein! Mönchlein! Du gehst einen schweren Gang!«, schrieb der Vater, aber er stimmte zu. Umgehend erhielt er auch die für die neuen Fächer erforderliche Fachliteratur, Winckelmanns ›Briefe‹ und Lessings ›Laokoon‹.
Hoffmann betrieb sein Studium mit großer Intensität, aber die Geldsorgen wurden immer drückender. Nur mit Mühe konnte er am Ende des Wintersemesters seine Schulden bezahlen, dann wanderte er heim nach Fallersleben, um die Ferien und auch das Sommersemester zu Hause zu verbringen. Der Geldmangel zwang ihn zu diesem Freisemester. Aber er wusste seine Zeit zu nutzen: »Ich studierte nun allgemeine Sprachlehre, Lateinisch, Griechisch, las den Homeros und die Nibelungen, lernte Holländisch und brachte es im Dänischen so weit, dass ich mich bald unterhalten konnte.«
Das Wintersemester 1817/18 verbrachte er wieder in Göttingen. In zunehmendem Maß begeisterte er sich für die Klassische Philologie. Vor allem die Vorlesungen von Friedrich Gottlieb Welcker über die Tragödien des Sophokles hatten es ihm angetan. Zu dem als fortschrittlich geltenden Professor entwickelte sich im Laufe der nächsten Semester ein Vertrauensverhältnis, denn als Welcker im Jahr 1819 vom preußischen Kultusminister einen Ruf an die neue Bonner Universität erhielt, wechselte auch Hoffmann die Universität und folgte seinem Professor nach Bonn. Um ihm den Umzug zu erleichtern, hatte Welcker angeboten, seine Büchersammlung kostenlos nach Bonn transportieren zu lassen.
Neben dem Studium fand Hoffmann genügend Zeit für den Umgang mit Freunden und für die Aktivitäten in den studentischen Gruppen. So ausführlich er sich über seine Freunde ausgelassen hat, so knapp und unscharf sind seine Berichte über seine Teilnahme an den Göttinger Studentenunruhen vom Sommer 1818. Zwei Freunde spielten für längere Zeit eine wichtige Rolle. Ludwig Henneberg hatte er schon auf dem Katharineum in Braunschweig in schwärmerischer Liebe verehrt, ihm Oden geschrieben und Gedichte gewidmet. In Göttingen traf man sich wieder. Aber nach einiger Zeit erkaltete die Freundschaft, denn Henneberg war »unter die Prosaischen Landsleute gerathen«, was immer das bedeuten mochte. Umso fester schloss er sich seinem neuen Freund Simon Krawinkel an. Man traf sich fast täglich, schrieb sich Briefe und tauschte Gedichte aus, bis ein nichtiger Streit zum Zerwürfnis führte. Der harmoniebedürftige Hoffmann war nicht konfliktfähig, unterschiedliche Meinungen zogen oft einen sofortigen Bruch der Beziehung nach sich.
Andere Freundschaften scheint er in dieser Zeit nicht geschlossen zu haben. Aber er muss gute Kontakte zu einigen Vertretern der Landsmannschaften gehabt haben, denn auf seinen Reisen und später in seinem neuen Studienort genoss er mehrmals deren Gastfreundschaft. Für die Anhänger der Burschenschaften war Göttingen kein gutes Pflaster. Die Studentenschaft galt als konservativ, leistungsorientiert und politisch wenig interessiert. Auf der Wartburgfeier am 18. Oktober 1817 waren keine Studenten aus Göttingen vertreten. Aber die Aufbruchstimmung, die in den Jahren nach den Freiheitskriegen und vor den Karlsbader Beschlüssen an den deutschen Universitäten aufkam, machte schließlich auch vor der Göttinger Studentenschaft nicht halt. Im Sommersemester 1818 kam es nach einem harmlosen, geradezu lächerlichen Vorkommnis zu Studentenunruhen, die in Straßenschlachten ausarteten und zu einem starken Solidarisierungseffekt innerhalb der Studentenschaft führten. Ein Metzger hatte einen Studenten geohrfeigt, die Landsmannschaft verlangte Satisfaktion, der Prorektor verwies an die Polizeibehörde, die Polizei unternahm nichts, die Studentenversammlung beschloss die Erstürmung der Metzgerei, am Abend lag das Haus in Trümmern. Die Regierung musste einschreiten, am 17. Juli rückten Husaren ein, jetzt solidarisierten sich viele Studenten mit den Landsmannschaften, mit Hoffmann an der Spitze zog man vor das Königliche Kommissariat und forderte »Burschenfreiheit«. Am nächsten Abend widersetzten sich die Studenten dem Versammlungsverbot, es kam zu Straßenschlachten, Hoffmann flüchtete in eine Gastwirtschaft. »Dies große Ereigniß blieb nicht ohne großen Einfluß auf die ganze Göttinger Studentenwelt«, konstatierte er später. Für ihn blieb seine Beteiligung an den Straßenschlachten ohne Folgen. War er wirklich nur durch Zufall an die Spitze der demonstrierenden Studenten gedrängt worden, ein baumlanger Kerl von fast zwei Metern Gardemaß, womit er alle um einen Kopf überragte? Oder war das nur eine Schutzbehauptung? Noch im hohen Alter hat Hoffmann seine jugendliche Begeisterung für die Burschenschaften bagatellisiert. Dabei deutet vieles darauf hin, dass er zu dieser Zeit stark mit den Burschenschaften sympathisiert hat. Wenige Wochen nach den Göttinger Studentenunruhen wird er nach Jena pilgern, wo der Gründungskongress der deutschen Burschenschaften stattfand. Bald darauf bekundete er durch Haartracht, Bart und Kleidung seine Solidarität mit den Burschenschaften.
Auch wenn ihn die Belange der Studentenschaft in zunehmendem Maß interessierten, von seinem Studium ließ er sich durch nichts abhalten. Nur die Vorlesungen waren für ihn meistens nicht der richtige Ort. Dafür besuchte er täglich die Bibliothek, und nächtelang saß er über den ausgeliehenen Büchern. Im Wintersemester 1817/18 war es die Klassische Philologie gewesen, die ihn fasziniert hatte, im folgenden Sommersemester beschäftigte er sich intensiv mit der Altertumswissenschaft. Vor allem aber hatten es ihm die Werke Johann Joachim Winckelmanns angetan, der schon zu dieser Zeit als Theoretiker des europäischen Klassizismus großen Ruhm genoss. »Ich studierte Winckelmann’s Werke und las mit großer Begeisterung seine Briefe.« In seiner Umgebung stieß Hoffmann damit auf wenig Verständnis. »Aber wozu das alles? Fragten mich meine Freunde. Das wußte nur ich eben am besten: ich wollte ein zweiter Winckelmann werden.« Dieser Plan nahm konkrete Formen an. Er wollte so bald wie möglich das Studium der Kunstgeschichte in Italien beginnen, dann sollte es nach Griechenland gehen. Reisebeschreibungen gehörten schon jetzt zur täglichen Lektüre, er lernte Französisch und wollte bald mit dem Italienischen und Neugriechischen anfangen.
Hoffmann als Student um 1820.
Gemälde von Carl Schumacher
Die Briefe Winckelmanns, für die der junge Student sich so begeisterte, hat er ihrer Bedeutung entsprechend gelesen. In seinen Briefen feierte Winckelmann Rom als idealen Ort der ästhetischen Bildung. Mit dieser Aufwertung Roms und der Idealisierung der griechischen Kultur empfahl der große Gelehrte den Deutschen die Chancen eines bedeutenden Kultureinflusses auf die Bildung einer deutschen Nationalkultur. Die Aufwertung Roms und Griechenlands diente ihm gleichzeitig zur Abwertung der französischen Kultur und ihres Einflusses auf das politisch zerstrittene Deutschland, das sich erst noch seine eigenständige Nationalkultur erschaffen musste.
Diese Gedanken fielen bei dem jungen Hoffmann auf fruchtbaren Boden. Der Patriotismus des Vaters hatte schon in frühen Jahren prägend auf ihn gewirkt. Als Schüler hatte er sich für die Ideale der deutschen Freiheitskriege begeistert. Der Rückfall der deutschen Fürsten in einen längst überholten Feudalismus und in die Kleinstaaterei nach dem Sturz Napoleons hatte den jungen Studenten tief enttäuscht, die Folgen dieser restaurativen Politik erlebte er auf seinen Reisen. Nicht mit der Waffe in der Hand wollte er gegen den französischen Feind kämpfen, sondern mit seinen literarischen Werken gegen alle Reaktionäre in seinem deutschen Vaterland. Jetzt fand Hoffmann in dem Gelehrten Johann Joachim Winckelmann das große Vorbild, das mit seinem wissenschaftlichen Werk einen Beitrag leisten wollte im Prozess der Herausbildung einer deutschen Nationalkultur. Zum ersten Mal entdeckte der junge Student eine Identifikationsfigur. Kein kriegerischer Held, kein großer Politiker, ein bedeutender Gelehrter wurde zum Vorbild. Erfüllt von seinem »großartigen Lebensplan« träumte er von zukünftiger Größe.
Die politisch erhitzte Atmosphäre an der Göttinger Universität einerseits und die eigene höchst ehrgeizige Lebensplanung andererseits bildeten den Hintergrund, vor dem die Wandlung Hoffmanns vom glühenden Anhänger Winckelmanns zum begeisterten Studenten der deutschen Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte verständlich wird. Die Universitätsleitung hatte den Semesterschluss wegen der studentischen Unruhen vorgezogen. Schon Mitte August begannen die Semesterferien. Hoffmann hatte eine lange Reise geplant. Er wollte zuerst nach Kassel, dann über die Wartburg nach Jena, schließlich über Fallersleben zurück nach Göttingen. Über diese mehrwöchige Wanderung hat er einen ausführlichen Reisebericht geschrieben. Aber es gibt eine ganze Anzahl von Gründen, seiner Darstellung nicht immer Glauben zu schenken.
Am 4. September 1818 traf Hoffmann in Kassel ein. Im Lesesaal der Bibliothek hat er angeblich zufällig Jacob Grimm entdeckt, der in diesen Jahren als Bibliothekar im Fridericianum tätig war. Durch die Herausgabe der ›Kinder- und Hausmärchen‹ und der ›Deutschen Sagen‹ hatten sich die Brüder Grimm in deutschen Gelehrtenkreisen schon einen hervorragenden Namen gemacht. Nach kurzer Begrüßung überbrachte der Student aus Göttingen Grüße von seinem Mentor Welcker. Mit diesem Kunstgriff hat er sich auch später so manche Tür geöffnet. Jacob Grimm muss von dem jungen Mann sehr angetan gewesen sein, denn er lud ihn zu sich nach Hause ein, nachdem er ihm noch rasch einen Brief Winckelmanns zum Abschreiben herausgesucht hatte. Hoffmann war fasziniert von der Persönlichkeit des Gelehrten. »Ich fand ihn eben beschäftigt mit seiner Grammatik. Mehrere Bogen lagen bereits gedruckt vor. Ich sah und erstaunte, eine neue Welt ging mir auf, ich wurde nachdenklich und schwankend in meinen Plänen. Da ich den vorigen Sommer dänisch gelernt hatte und in der letzten Zeit zu Göttingen auch holländisch, mich auch um deutsche Literaturgeschichte gekümmert, so gab es in unserer Unterhaltung Berührungspunkte genug. Hatte schon in der Bibliothek seine Persönlichkeit auf mich gewirkt, so war das in seinem Zimmer unter seinen Arbeiten, Büchern und Handschriften jetzt noch mehr der Fall. Die Ordnung, die hier überall bis ins kleinste waltete, der Fleiß, der aus Allem sich kund gab, die lebendige Theilnahme bei allen Dingen, auf welche die Rede kam, Alles das gewann ihm meine innige Liebe und Verehrung.«
Am nächsten Tag traf man sich wieder in der Bibliothek, diesmal war auch Wilhelm Grimm dabei. In das ehrfurchtsvoll gereichte Stammbuch schrieb Jacob Grimm den mittelhochdeutschen Zweizeiler » Ein ieglich mensche enphat darnach als ime sin herze stat.« Dann begleitete er den Besucher die Treppe hinab zum Ausgang. Hoffmann erwähnte jetzt seine Pläne, nach Italien und Griechenland zu reisen, um dort die alten Kunstwerke zu studieren. Jacob Grimm hörte geduldig zu, dann fragte er in herzlichem Ton: »Liegt Ihnen Ihr Vaterland nicht näher?«
Diese Frage wurde zum Schlüsselerlebnis für den jungen Mann, der ein zweiter Winckelmann werden wollte, der mit den Idealen der antiken Kultur seinem zersplitterten Vaterland einen Weg zur Bildung einer deutschen Nationalkultur zu zeigen verlangte. Die Radikalität der Frage erforderte eine radikale Antwort. Ein halbes Jahrhundert später erinnerte sich Hoffmann an diese ergreifende Szene: »Ich höre die Worte noch heute, die Worte vom 5. September 1818. Noch auf der Reise entschied ich mich für die vaterländischen Studien: deutsche Sprache, Litteratur- und Culturgeschichte, und bin ihnen bis auf diesen Augenblick treu geblieben.«
Die spontane Entscheidung Hoffmanns für Jacob Grimms Vorschlag, sich ganz den vaterländischen Studien zu widmen, fiel in die Zeit, in der sich die Germanistik als Wissenschaft zu konstituieren begann, und zwar als Wissenschaft mit offen ausgesprochener politischer Zielrichtung. Für Jacob Grimm war die Aufhebung der bestehenden Grenzen das Vermächtnis einer allen Deutschen gemeinsamen Sprache: »Ein Volk ist der Inbegriff von Menschen, welche dieselbe Sprache reden. Das ist für uns Deutsche die unschuldigste und zugleich stolzeste Erklärung, weil sie mit einmal über das Gitter hinwegspringen und jetzt schon den Blick auf eine näher oder ferner liegende, aber ich darf wohl sagen einmal unausbleiblich heranrückende Zukunft lenken darf, wo alle Schranken fallen und das natürliche Gesetz anerkannt werden wird, dass nicht Flüsse, nicht Berge Völkerscheiden bilden, sondern dass einem Volk, das über Berge und Ströme gedrungen ist, seine eigene Sprache allein die Grenze setzen kann.«2 Jacob Grimms Hoffnung auf einen deutschen Nationalstaat mit einer eigenen deutschen Nationalkultur gehörte vor 1848 zu den fortschrittlichen Bemühungen des aufgeklärten Bürgertums, das damit die Abschaffung des feudalistischen Systems der absolutistisch regierten Kleinstaaten anstrebte. Mit diesen politischen Zielen hat sich Hoffmann zeit seines Lebens identifiziert.
Der so schnell gefasste Entschluss des jungen Studenten, nicht mehr ein zweiter Winckelmann werden zu wollen und das Studium der Antike zu betreiben, sondern stattdessen die deutsche Literatur- und Kulturgeschichte zu studieren und Jacob Grimms Rat zu folgen, scheint nur auf den ersten Blick ein radikaler Wechsel zu sein. Hoffmann verstand sofort, dass Winckelmann und Jacob Grimm mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit das gleiche Ziel ansteuerten. Der eine hoffte, dass die Beschäftigung mit dem antiken Bildungsideal den Deutschen einen Weg zur Bildung einer einheitlichen Kulturnation zeigen würde, der andere hoffte, dass die Erkenntnis von den gemeinsamen kulturellen Wurzeln und der gleichen Sprache allen Deutschen den Weg zum Nationalstaat und zu einer eigenen Nationalkultur ebnen würde. Der Student Heinrich Hoffmann, sensibilisiert für die fortschrittlichen politischen Ideen dieser Jahre und empfänglich für die Methoden und Ziele der neuen deutschen Philologie, fand in dieser wichtigen Entwicklungsphase seines Lebens in Jacob Grimm seinen Mentor und Wegweiser.
Nach diesem fast religiös anmutenden Erweckungserlebnis verließ er Kassel und wanderte über Eisenach, Gotha, Erfurt und Weimar nach Jena. Man muss seinen Reisebericht kritisch lesen und um das ergänzen, was er verschweigt. Ziel seiner Wanderung war natürlich Jena, weil sich dort am 18. Oktober 1818, am Jahrestag der Wartburgfeier, die Allgemeine deutsche Burschenschaft konstituieren wollte. Wer als Student in diesen Tagen nach Jena reiste, der sympathisierte mit den Ideen der Burschenschaften. Diesen Grund seiner Reise hat Hoffmann verschwiegen. Er tat so, als habe er erst in Jena etwas vom Gründungskongress erfahren. Noch in hohem Alter hat Hoffmann nicht zugeben wollen, wie stark er mit der deutschen Burschenschaftsbewegung sympathisiert hat. Er hatte seine Gründe dafür. Als Kämpfer mit der Feder und dem offenen Wort hat er sich selbst immer wieder beschrieben, so sollte ihn die Nachwelt in Erinnerung behalten. Auch wollte er nicht den Eindruck aufkommen lassen, er habe sich jemals in Organisationen oder Parteien politisch engagiert. Ein solches Engagement hat er zeit seines Lebens abgelehnt. Wenn er nach einem halben Jahrhundert, beim Schreiben seiner Autobiographie, seine Begeisterung für die Bewegung der deutschen Burschenschaften heruntergespielt hat, dann lag das allerdings auch an der in diesen Jahren geringen Wertschätzung, die den Verbindungen entgegengebracht wurde.
Sein Reisebericht erschöpft sich in Belanglosigkeiten. Am 25. September hat er »die einzige Merkwürdigkeit Eisenachs, die Wartburg, in Augenschein genommen«. Er verliert kein Wort darüber, dass dort ein Jahr zuvor fast 500 Studenten die 300-jährige Wiederkehr der lutherischen Reformation und den Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig gefeiert hatten. Der Jenaer Professor Lorenz Oken war der Festredner gewesen. Seither war die Wartburg für alle fortschrittlichen Studenten eine Kultstätte, die man andächtig besuchte und nicht wie zufällig »in Augenschein nahm«. In Weimar übernachtete Hoffmann im Hotel Elephant, konnte seine Rechnung nicht bezahlen und ließ die Ausgabe seines ›Homer‹ als Pfand zurück. Im Theater leistete er sich einen Stehplatz und besuchte eine Aufführung von Shakespeares ›Romeo und Julia‹. Mit den letzten Münzen in der Tasche kam er nach Jena, lief einmal über das Schlachtfeld, auf dem die napoleonischen Truppen zwölf Jahre zuvor einen triumphalen Erfolg hatten feiern können, dann stellte er sich hungrig und durstig auf den Marktplatz der Universitätsstadt und wartete auf Hilfe. Die ließ nicht lange auf sich warten. Mehrere Studenten erkannten ihn, nahmen ihn mit und gewährten Unterkunft. Wer konnte ihn in Jena gekannt haben? Natürlich waren es Studenten aus Göttingen, die aus den gleichen Beweggründen nach Jena gekommen waren wie er selbst. In seinem Reisebericht verliert Hoffmann kein Wort darüber.
Als sei er ganz zufällig zu den Veranstaltungen der Burschenschaften gekommen, so berichtet er von den Ereignissen: »Zu dem eben hier tagenden allgemeinen Burschentage hatten sämtliche Burschenschaften ihre Abgeordneten geschickt. Ich ging zuweilen in die Sitzungen, die immer öffentlich waren. Für die Idee der Burschenschaft war auch ich beseelt, vielleicht mehr als mancher Burschenschafter, obwohl ich weder dieser noch sonst einer Verbindung angehörte.« Dem zwanglosen Miteinander, dem legeren Umgangston, dem allgemeinen Duzen konnte er viel abgewinnen, aber er reagierte verärgert auf den Gruppenzwang, der den jungen Männern einen langen Bart, langes Haar und das Tragen altertümlicher Trachten vorschrieb. Vor allem die Vertreter des radikalen Flügels der Burschenschaften, die sogenannten Altdeutschen, bestanden auf einer deutlichen Abgrenzung zu den anderen Verbindungen durch Haartracht und Kleidung. Bei Hoffmann dauerte der Prozess der politischen Bewusstseinsbildung etwas länger. Ein halbes Jahr später wird er seine Sympathien für die Altdeutschen mit schulterlangem Haar, langem Bart und entsprechender Kleidung bekunden. Die Turnübungen der Studenten an Reck und Barren fand er lächerlich, vor allem das Pathos und die strenge Ernsthaftigkeit, mit der die begeisterten Turner ihre Rituale vollzogen und darin das Heil der Welt erblickten, stießen ihn ab. Es ist allerdings charakteristisch für ihn, dass sich in seinem Bericht über den Jenaer Gründungstag nur Bemerkungen über diese Äußerlichkeiten finden. Das Programmatische der Veranstaltung wird nicht erwähnt. Immerhin war die Bewegung der Burschenschaften mit ihren Forderungen nach einer politischen und wirtschaftlichen Einheit der deutschen Nation, Gleichheit vor dem Gesetz, Schaffung eines deutschen Gesetzbuches, Schutz von Freiheit und Eigentum und Garantie der Meinungs- und Pressefreiheit ein wichtiger Teil der deutschen Opposition gegen das reaktionäre System unter Fürst Metternich.
Unzulänglich dokumentiert hat er auch seine Begegnung mit Lorenz Oken, der mit seiner berühmt gewordenen Rede auf dem Wartburgfest im Jahr zuvor eine der führenden Persönlichkeiten der studentischen Opposition geworden war. »Das Interessanteste an Jena war mir Oken. Gleich in den ersten Tagen machte ich seine Bekanntschaft. Ich war oft bei ihm.« Wann und wo er Lorenz Oken getroffen und wie er ihn näher kennengelernt hat, das hat er verschwiegen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass er die Galionsfigur der burschenschaftlichen Bewegung rein zufällig kennengelernt hat. Das Resümee seiner höchst lückenhaften Berichterstattung lässt vielmehr den Schluss zu, dass er ganz gezielt die Bekanntschaft Okens gesucht hat, so wie er auch ganz gezielt nach Jena gewandert war, um an der Gründungsversammlung der deutschen Burschenschaften teilzunehmen.
Die Begegnung mit Lorenz Oken sollte für Hoffmanns literarische Entwicklung nicht ohne Folgen bleiben. Oken war zu dieser Zeit nicht nur Professor an der Jenaer Universität, er war auch der Herausgeber der Zeitschrift ›Isis‹. Was den jungen Studenten auf die Idee gebracht hat, dem renommierten Oken zahlreiche Epigramme für seine Zeitschrift anzubieten, lässt sich nur vermuten. Wahrscheinlich hatte er die fertigen Distichen schon im Gepäck gehabt. Jedenfalls erschienen zwischen dem Herbst 1818 und dem Frühjahr 1820 in der ›Isis‹ über einhundert Distichen und Tetrastichen aus der Feder Hoffmanns, allerdings ohne Nennung des Verfassers.3
Der Rückgriff auf die aus der antiken Literatur stammende Form des Epigramms war noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bei den deutschen Schriftstellern ein geschätztes Mittel, um auf geistreiche Art Missstände aller Art in satirischer Form anzuprangern. Hoffmann lieferte eine große Anzahl Zwei- und Vierzeiler. »Alle diese Epigramme bezogen sich auf die damaligen deutschen Zustände, besonders in Hannover. Stoff gab es genug, auch in der Studenten-und Professorenwelt, die Philisterei und das Zopfthum grünten und blühten schon wieder in unserm Staats- und geselligen Leben, viele Köpfe und Hände waren beschäftigt, die alte gute Zeit wieder auf die Beine zu bringen und jedes Missfallen darüber, jeden Widerstand dagegen als staatsgefährlich auszuposaunen.« Die Qualität dieser Epigramme ist allerdings mäßig. Zwar lässt sich meist der satirische Inhalt erschließen, aber die überraschende Sinndeutung der Schlusspointen kann nur selten überzeugen. Zu den wenigen gelungenen Distichen gehört jenes auf das als Kulturhochburg so gelobte Sachsen-Weimar, hier weist sich der Verfasser als Kenner der antiken Literatur und sprachgewandter Kritiker der Zeitgeschichte aus:
»Sachsen Weimar. Deutschlands freiestes Land, du classischer Boden!
O hätte Sparta nicht Sklaven gehabt, und Sykophanten Athen.«
Nur in wenigen Fällen erreichen seine über einhundert Epigramme dieses Niveau. Das Distichon spielt auf die Beschlagnahme der ›Isis‹ und die Verurteilung Okens am 24. Januar 1818 an. Oken war in der Nummer 195 der ›Isis‹ mit Hohn und Spott über die reaktionären Verfasser der von den Studenten auf dem Wartburgfest verbrannten Bücher hergezogen. Es folgten Denunziation, Konfiskation und Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe trotz Pressefreiheit in Weimar. Im Berufungsverfahren wurde das Urteil allerdings aufgehoben. Hoffmann war bestens über diese Vorgänge informiert.4
Lorenz Oken muss Gefallen gefunden haben an dem jungen Mann, mit dem er sich in diesen politisch aufgewühlten Tagen mehrmals getroffen hat. Er kannte auch dessen katastrophale finanzielle Lage. Ganz spontan bezahlte er sofort nach Erhalt der wenigen Manuskriptseiten ein Autorenhonorar von erstaunlichen zwei Louisdor, umgerechnet etwa zehn Taler. »Die Sachen sind viel mehr werth«, soll er gesagt haben, »aber ich gebe gar kein Honorar, und darum müssen Sie so vorlieb nehmen.« In das Stammbuch, das ihm Hoffmann in Jena am 12. Oktober 1818 vorlegte, schrieb er auf die Rückseite des eingeklebten Porträts von Johann Joachim Winckelmann: »Sey Dir ein Vorbild.« Wenige Wochen früher, noch vor der entscheidenden Begegnung mit Jacob Grimm, hätte dieser Imperativ den jungen Studenten wohl begeistert. Jetzt hatte er andere Pläne. »Wenn auch das, was er von mir erhoffte, nicht in Erfüllung ging, so freut es mich doch heute noch, daß er etwas von mir hoffte.« Erst zwei Jahrzehnte später werden sich die beiden in der Schweiz wiedersehen. Aber da ist Lorenz Oken nicht mehr Professor an der Jenaer Universität und mutiger Herausgeber einer liberalen Zeitschrift, sondern ein wegen seiner liberalen Haltung aus der Heimat vertriebener Exilant.
In den letzten Tagen des Oktobers trat Hoffmann die Rückreise an. In Weimar konnte er dank der zwei Louisdor von Oken im Hotel Elephant seine Homer-Ausgabe zurückfordern, dann ging die Wanderung in Begleitung eines Studienfreundes durch die dichten Nebelfelder der thüringischen Landschaft zurück nach Göttingen, wo gerade das Wintersemester begonnen hatte. Von der mehrwöchigen Reise hatte er prägende Erfahrungen mitgebracht, die seinem Leben eine neue Richtung geben sollten. Zunächst war es die wegweisende Begegnung mit Jacob Grimm, die seinen Entschluss festigte, sich ganz dem Studium der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft zu verschreiben. Dann waren es die Erlebnisse in Jena, das Zusammentreffen mit den Burschenschaftlern auf dem Gründungstag der deutschen Burschenschaften, die ihn für deren Ideen begeisterten. An der konservativen Universität in Göttingen, so glaubte er, hatte er nichts mehr zu suchen. Er wollte zu neuen Ufern aufbrechen, es zog ihn nach Bonn zur neuen Friedrich-Wilhelms-Universität, die gerade erst wenige Wochen zuvor gegründet worden war. Nur noch das Wintersemester musste er in Göttingen absitzen. Zu Hause angekommen, schrieb er als Erstes einen langen Brief an Jacob Grimm. Überschwänglicher Dank, dann machte er einige programmatische Ankündigungen. Er wolle schon im nächsten Jahr in die Niederlande, um dort alte Volkslieder zu sammeln, in diesem Land habe sich bedauerlicherweise niemand darum gekümmert.5
In Göttingen erwartete ihn eine Nachricht, die ihm zuerst wie eine Farce vorkam, deren Folgen aber bald bedrohliche Formen annehmen sollten. Das Königreich Hannover brauchte Soldaten. Der Student Heinrich Hoffmann aus Fallersleben sollte seiner Wehrpflicht Genüge tun und sich beim Regiment in Celle einfinden. Dem Verweigerer wurde schließlich mit der Arretierung durch die Landreiter gedroht. Auch eine Eingabe beim zuständigen Ministerium in Hannover bewirkte nichts. Erst mit der Zahlung der sogenannten Stellvertretungssumme von 20 Talern, die der Vater aufbrachte, konnte sich der Student von der Wehrpflicht freikaufen, um das Wintersemester in Göttingen zu verbringen. Viel Freude am Studium hatte er allerdings nicht mehr. Die Vorlesungen langweilten ihn. Er begann wieder mit dem Schreiben von Gedichten, aber als er seine Verse einer strengen Qualitätskontrolle unterzog, fand nichts vor seinen kritischen Augen Gnade, alles landete im Ofen. In Gedanken war er schon in Bonn, dem Ziel seiner Wünsche und Hoffnungen: »Von der neuen Universität am schönen Rhein erwartete ich ein neues Leben für meine Studien und für mein Herz.«
Da er sich noch von der Familie verabschieden wollte, wanderte er sofort nach der Exmatrikulation nach Fallersleben, wo er am 17. März ankam. Der Empfang in der Familie war herzlich. Aber vor allem sein Vater machte sich Sorgen über den beruflichen Werdegang des Sohnes, der keine klaren Angaben über ein Berufsziel machen konnte. Unmissverständlich war die väterliche Ankündigung, in Zukunft keine finanzielle Unterstützung zu gewähren. Aber damit konnte sich der Sohn, der in den letzten Jahren stets am Existenzminimum gelebt hatte, durchaus abfinden. Der Abschied vom Vater war herzlich, noch ahnte keiner, dass es ein Abschied für immer sein würde. Für einige Wochen wollte er noch zu seinem Bruder Daniel, der in Magdeburg eine gute Stelle im preußischen Staatsdienst gefunden hatte. Das heitere Zusammensein währte bis zum 18. April, dann wurde es überschattet von der Nachricht der schweren Erkrankung des Vaters. Während sich Daniel Hoffmann als ältester Sohn sofort der Verantwortung stellte und unverzüglich zur Familie nach Fallersleben reiste, reagierte sein Bruder Heinrich völlig anders: »Ich fühlte, daß meine ganze Zukunft in Frage gestellt wäre, wenn ich nach Hause zurückkehrte, denn war der Vater wirklich todt, so hätte ich die Meinigen nicht wieder verlassen können. So schwer die Wahl war, so mußte ich mich doch für die Weiterreise nach Bonn entscheiden.«
Er trat sofort seine Reise nach Bonn an. Zunächst führte der Weg noch einmal nach Göttingen, wo er seinen Haushalt auflöste, dann wanderte er über Kassel nach Frankfurt am Main. Hier erreichte ihn am 3. Mai 1819 die Nachricht vom Tod des Vaters. Seine Erschütterung hielt sich in Grenzen. »Das Leid hat sein Recht, aber die Freude will auch ihr Recht haben«, notierte er in den ›Erinnerungen‹ und berichtete dann von dem heiteren Leben und Treiben auf dem Postschiff, das ihn rheinabwärts von Mainz nach Bonn brachte. Die Aufrichtigkeit, mit der hier ein junger Mann über seine Gefühle unmittelbar nach dem Erhalt der Nachricht von seines Vaters Tod berichtet, ist erstaunlich. Aber diese Schilderung wäre unvollständig ohne die Erwähnung seiner Reaktion auf den ausführlichen Bericht seines Bruders über das lange und qualvolle Ende des Vaters. Es war ein Sterben im Beisein der Familie,