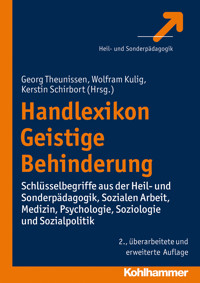
Handlexikon Geistige Behinderung E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Work with people who have mental disabilities has been undergoing greater change in recent years than practically any other field in remedial and special needs teaching. As the ability of people with mental disability to learn and develop was recognized, a competence and strengths approach was adopted in the theories and concepts underlying support work for them, and this was supplemented by taking into account the views of those affected and a commitment to strengthen their legal rights. This pocket dictionary provides solid scientific guidance in the face of the rapid developments and upheavals in assistance for the mentally disabled that have taken place in recent years. It includes all of the major key concepts that are important from both the practical and theoretical viewpoints. At the same time, the pocket dictionary tries to indicate the interdisciplinary nature of this specialist field of work by including terms that come not only from the field of remedial and special needs teaching, but also from psychiatry/medicine, psychology, sociology, social policy and social work.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 822
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie kaum ein anderer Bereich der Heil- und Sonderpädagogik ist die Arbeit mit geistig behinderten Menschen in den letzten Jahren in Bewegung geraten. Mit der Anerkennung der Lern- und Entwicklungsfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung haben sich auch die Theorien und Konzepte der Geistigbehindertenhilfe einer Kompetenz- und Stärkenperspektive verschrieben und um die Betroffenensicht und das Engagement zur Stärkung ihrer Rechte in der Gesetzgebung ergänzt. Das Handlexikon liefert angesichts der rasanten Entwicklungen und Umbrüche der Geistigbehindertenhilfe in den letzten Jahren eine solide wissenschaftliche Orientierungshilfe. Dafür wurden alle wesentlichen Schlüsselbegriffe aufgenommen, die sowohl in praktischer als auch theoretischer Hinsicht bedeutsam sind. Dabei will das Handlexikon gleichzeitig den interdisziplinären Charakter dieses Fach- und Arbeitsbereiches zum Ausdruck bringen, indem die aufgenommenen Begriffe nicht nur aus dem Bereich der Heil- und Sonderpädagogik, sondern auch aus Psychiatrie/Medizin, Psychologie, Soziologie, Sozialpolitik und Sozialer Arbeit stammen.
Professor Dr. Georg Theunissen hat den Lehrstuhl für Geistigbehindertenpädagogik und Pädagogik bei Autismus an der Universität Halle-Wittenberg. Dr. Wolfram Kulig ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter. Dipl.-Päd. Kerstin Schirbort ist Pädagogische Leiterin eines Wohnbereichs für Menschen mit Lernschwierigkeiten und komplexer Behinderung.
Georg Theunissen Wolfram Kulig Kerstin Schirbort (Hrsg.)
Handlexikon Geistige Behinderung
Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2013 Alle Rechte vorbehalten © 2007 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-022531-2
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-027620-8
mobi:
978-3-17-027621-5
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
A
Ablösung, Trennung vom Elternhaus
Active Support, aktive Unterstützung
Aggression, aggressives Verhalten
Alphabetisierung, Erwerb schriftsprachlicher Kompetenz, Lesen, Schreiben
Altenarbeit und Altenbildung
Alter und Altern
Anenzephalie
Anstalten
Anthropologie
Anthroposophie
Arbeit
Armut
Assistenz
Ästhetische Erziehung, ästhetische Bildung
Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
Aufsichtspflicht und Haftung
Autismus, autistische Störungen, autistische Züge
Autismus-Spektrum
B
Basale Kommunikation
Basale Pädagogik, basale Aktivierung
Basale Stimulation
Bedürfnisse, Bedürfnisorientierung
Begegnung
Begleitung
Behindertenrechtskonvention (BRK)
Benachteiligung
Beratung
Berufliche Bildung
Berufliche Integration, berufliche Rehabilitation
Betreuung
Betreuungsrecht
Bildung
Bildungsfähigkeit
Bindung, Bindungsforschung
Biographiearbeit
Bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit, Volunteering
Bürgerzentrierung
C
Community Care
Computergestützte Analysesysteme
Consulenten, Konsulenten, Konsulentendienst
Coping, Copingstrategien
Corporate Citizenship, Corporate Social Responsibility
D
Deeskalation
Defektologie
Defizite, Defizitorientierung
Deinstitutionalisierung
Delinquenz, Kriminalität
Demenz
Depression
Developmental Disabilities
Dezentralisierung
Diagnostik
Didaktik, didaktische Modelle
Disability, Behinderung, Disability Studies
Diskriminierung
Dissozialität
Dissoziation, dissoziative Störungen
Doppeldiagnose, dual diagnosis
Down-Syndrom, Trisomie 21
E
Eingliederungshilfe
Eltern- und Familienarbeit
Elterninitiativen
Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung
Emanzipation
Emotionen, emotionale Entwicklung
Empowerment, Selbstermächtigung, Selbstbefähigung
Enthospitalisierung
Entwicklung
Entwicklungstests, Entwicklungsgitter, Entwicklungsskalen
Epidemiologie
Epilepsie, epileptisches Anfallsleiden
Ergotherapie
Erlebnispädagogik
Erwachsenenbildung
Erwachsenwerden
Erziehung
Ethik, Menschenwürde
Euthanasie
F
Familie
Familienentlastender/familienunterstützender Dienst
Förderdiagnostik
Förderplanung
Förderung
Förderzentrum
Forschungsmethoden
Freizeit, Freizeitgestaltung
Freizeitassistenz
Fremdbestimmung
Frühbehandlung, Kindförderung, Kooperation mit Eltern
Frühdiagnostik
Früherkennung
Functional Skills
G
Gebärden
Gedächtnis, Gedächtnisprozesse
Geist, geistig, mental
Geistigbehindertenpädagogik
Geistige Behinderung
Geistige Entwicklung
Gemeinsame Erziehung
Gemeinsamer Unterricht
Gender, Geschlecht, Genderforschung
Generalisierung, Transfer
Gerontologie
Geschichte der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung
Gestützte Kommunikation, Facilitated Communication
Gesundheit
Gesundheitserziehung
Gewalt
H
Handlungsbezogenes Lernen
Hauswirtschaft, Privathaushalt
Heilpädagogik
Heilpädagogische Rhythmik
Hilfebedarf
I
ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
Identität, Selbstbild, Selbstkonzept
Individuelle Hilfeplanung
Inklusion, Inclusion
Inklusive Pädagogik, inclusive education
Integration
Integrationsfachdienste
Integrative Körpertherapie, Gestalttherapie
Intellectual Disabilities, intellektuelle Behinderung
Intelligenz
Intelligenztests
Interdisziplinäre Frühförderung
Interdisziplinarität
Intervention
Isolation, Vereinsamung
K
Kinder- und Jugendmedizin
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Kinder- und Jugendwohnen
Klinische Bilder
Kompensation
Kompetenz, Kompetenzorientierung
Komplexe Behinderung / komplexe Behinderung
Kooperation
Kooperationsklassen, kooperativer Unterricht
Kreativität
Kretinismus
Krisen
Krisenintervention
Kunst
Kunsttherapie
L
Lebenspraktische Bildung
Lebensqualität
Lebensstilplanung
Lebensweltorientierung, Kontextorientierung
Leibpädagogik
Leichte Sprache (aus der Sicht von People First)
Lernbehinderung
Lernen, Lernfähigkeit, Lerntheorien
Lernschwierigkeiten, Menschen mit Lernschwierigkeiten
M
Massage
Mathematik, Rechnen
Mediation
Mehrfache Behinderung
Menschenbilder
Menschenrechte
Mental Retardation, Mental Handicap
Mitbestimmung, Mitwirkung
Mobilitätsförderung, Verkehrserziehung
Montessori-Pädagogik
Motivation
Motorik, motorische Beeinträchtigungen
Musik
Musikerziehung
Musiktherapie
N
Nationalsozialismus
Netzwerkarbeit
Neue Medien, Computer(programme)
Neuronale Plastizität
Neuropädiatrie
Neurowissenschaften
Normalisierung, Normalisierungsprinzip
O
Offene Hilfen
Öffentlichkeitsarbeit
Ökonomisierung
Oligophrenie
P
Partizipation
Partnerschaft
Paternalismus
Peer Counseling
People First Deutschland
Persönliche Assistenz
Persönliches Budget
Persönliche Zukunftsplanung
Persönlichkeitsstörungen, Psychopathie
Person
Person-centered Planning; Personzentrierte Planung
Pflege, Pflegebedürftigkeit
Pflegekonzepte
Physiotherapie
Positive Verhaltensunterstützung, Positive Behavioral Support
Prävention
Praxisberatung
Problemlösetraining, problem solving
Problemverhalten
Profession, Professionalisierung
Projektorientierter Unterricht
Psychiatrie, psychiatrische Versorgung
Psychiatrisches Modell, medizinisches Modell
Psychische Störungen, psychische Krankheit
Psychomotorik
Psychopharmaka
Psychotherapie
Pubertät
Q
Qualität, Qualitätsentwicklung
Qualitätssicherung, Evaluation, Nutzerkontrolle
R
Regionalisierung
Rehabilitation
Rehistorisierung
Religionsunterricht, evangelisch/katholisch
Resilienz
Ressource, Ressourcenaktivierung
S
Sachkunde, Sachunterricht
Savants, Inselbegabung
Schizophrenie, wahnhafte/psychotische Störungen
Schmerzen
Schule für Geistigbehinderte, Schule für praktisch Bildbare, Schule für individuelle Lebensbewältigung, Förderschule, Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Selbstbestimmung, Autonomie
Selbstverletzendes Verhalten, Autoaggression
Selbstvertretung, Self-Advocacy, Selbstvertretungsgruppen, People First
Selbstwahrnehmung
Sensomotorische Lebensweisen
Sexualassistenz, Sexualbegleitung
Sexualität
Sexualpädagogik
SIVUS-Methode
Snoezelen
Sozial adaptives Verhalten
Soziale Arbeit, social work, Sozialarbeit, Sozialpädagogik
Soziale Konflikte
Soziale Netzwerke
Soziale Probleme
Soziales Lernen, Soziales Kompetenztraining
Sozialpädiatrie
Sozialpädiatrische Zentren
Sozialraum, Sozialraumorientierung
Special Olympics
Spiel, Spielförderung
Sport, sportliche Aktivität
Sprache
Sprachtherapie, Logopädie
Stärken, Stärken-Perspektive
Sterbebegleitung
Stereotypien
Stigma, Stigmatisierung
Subjektzentrierung
Sucht, Abhängigkeitssyndrom
Supported Living, unterstütztes Wohnen
T
Tagesstätten, Tagesförderstätten, day centers
TEACCH, Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children
Teilhabe
Teilhabeplanung, Örtliche Teilhabeplanung
Therapie
Tics
Transdisziplinarität
Trauer, Trauerarbeit
Trauma, posttraumatische Belastungsstörung
U
Unterrichtsmethoden
Unterstützerkreis, Circle of Supports, Circle of Friends
(siehe auch Persönliche Zukunftsplanung)
Unterstützte Beschäftigung, Supported Employment
Unterstützte Kommunikation
Unterstützter Ruhestand
Unterstützung
Unterstützungsmanagement, Case Management
Ursachen geistiger Behinderung (medizinische Aspekte)
Ursachen geistiger Behinderung (soziale Aspekte)
V
Validation
Verbände, Organisationen
Verfahren zur Erfassung psychischer Störungen
Verfahren zur Erfassung sozial adaptiver Verhaltensweisen
Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen
Verhaltensphänotypen, behavioral phenotypes
Vulnerabilität
W
Wahrnehmung
Wahrnehmungsförderung
Werkstatt für behinderte Menschen
Wohlbefinden
Wohnen, Wohnformen
Z
Zwang, Zwangsstörungen
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Stichwortverweise
Vorwort
In keinem anderen Bereich der Heil- oder Sonderpädagogik ist in den letzten Jahren so viel Neues entstanden und in Bewegung geraten wie in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen.
Menschen mit geistiger Behinderung wurden Jahrzehnte lang als versorgungs-, behandlungs- und belieferungsbedürftige Defizitwesen betrachtet und mit ihren Bedürfnissen und Wünschen nicht ernst genommen. Erst seit kurzem hat sich diese Situation deutlich verändert. Moderne Theorien und Ansätze gehen von einer prinzipiellen Lern- und Entwicklungsfähigkeit geistig behinderter Menschen aus und haben sich einer Kompetenz- oder Stärken-Perspektive verschrieben. Sie zeichnen ein Bild von Menschen mit geistiger Behinderung, das der traditionellen defizitorientierten Sicht kontrapunktisch gegenübersteht und nachhaltig in Richtung auf Wertschätzung und Selbstbestimmung hinausläuft. Hierzu haben Menschen mit geistiger Behinderung in den letzten Jahren selbst einen wichtigen Beitrag geleistet, indem sie Selbstbewusstsein präsentieren und Selbstbestimmung fordern.
Mit dieser weltweiten Entwicklung, die vor allem den ethischen Bereich betrifft, also auf veränderte Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung zielt, gehen weitreichende Änderungen in Sozialpolitik, praktischer Arbeit, aber auch in der empirischen Forschung und theoretischen Reflexion einher.
So sehen sich nicht nur professionell Tätige in der Praxis und Angehörige wie vor allem Eltern geistig behinderter Kinder, sondern ebenso nichtbehinderte Mitbürger vor zahlreiche neue Herausforderungen gestellt.
Hierzu müssen Einstellungen zu Menschen mit geistiger Behinderung überdacht und Beziehungen neu bestimmt werden. Menschen mit geistiger Behinderung müssen als Bürger mit Rechten und Wünschen respektiert und als Experten angenommen werden. Notwendige Veränderungen in allen Bereichen der Praxis und des gesellschaftlichen Lebens sind die Folge.
Auch die Behindertenpolitik reagiert, indem sie zum Beispiel diesem gewandelten Selbstverständnis durch die Stärkung der Rolle Betroffener in der Gesetzgebung (Persönliches Budget) Rechnung zu tragen versucht. Doch nicht nur neue Gesetze für die Hilfe für behinderte Menschen sind als sozialpolitische Folge dieses veränderten Verständnisses aufzufassen; hinzu kommen Gruppen von behinderten Menschen, die selbst Politik machen und ihre Belange aktiv vertreten. Unter selbstorganisierten Zusammenschlüssen, Selbstvertretungsgruppen und insbesondere unter dem Namen »People First« nehmen Menschen mit geistiger Behinderung zunehmend am politischen Geschehen teil.
Die Theoriebildung macht deutlich, dass bisher anerkannte Grundpositionen aus der Heil- oder Sonderpädagogik um die Betroffenen-Sicht und Rechte-Perspektive erweitert werden müssen und auch methodische und methodologische Fragen immer neu zu stellen sind.
Eine solche Situation, die sich durch rasante Entwicklungen, ständige Veränderungen, Neuerungen oder Umbrüche auszeichnet, ist durch eine Vielzahl von neuen Terminologien oder Bedeutungsverschiebungen bestehender Begriffe gekennzeichnet. Hier ist ein Nachschlagewerk hilfreich, das durch eine Bündelung und Reduktion auf das Wesentliche eine Orientierungshilfe verspricht, ohne dabei spezifische Differenzierungen oder unterschiedliche Positionen zu sehr einzuebnen oder Bewährtes auszublenden.
Genau an dieser Stelle hat das vorliegende Handlexikon seinen Platz, der zwischen einem lexikalischen Wörterbuch und einem umfassenderen Lehr- oder Handbuch anzusiedeln ist.
Es soll vor allem ein Nachschlagewerk für praktisch Tätige, Lehrende und Studierende in allen Bereichen der Geistigbehindertenarbeit sein.
Im Unterschied zu bereits vorhandenen Wörterbüchern der Heil- oder Sonderpädagogik sowie zum Handlexikon der Behindertenpädagogik soll ein stringenter, interdisziplinärer Bezug zum Personenkreis der Geistigbehinderten vorgenommen werden. Es geht um Schlüsselbegriffe, die in der Geistigbehindertenarbeit aus heil- oder sonderpädagogischer, medizinisch-psychiatrischer, psychologischer, therapeutischer, soziologischer, sozialpädagogischer und sozialpolitischer Sicht eine prominente Rolle spielen. Viele der ausgewählten Begriffe waren oder sind prägend für die Entwicklungsgeschichte des Arbeitsfeldes und stammen nicht nur aus der Heil- oder Sonderpädagogik, sondern ebenso aus der Psychiatrie/Medizin, Psychologie, Soziologie, Sozialpolitik und Sozialen Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Die Begriffe sollen in ihrer Gesamtheit einen fachwissenschaftlichen und fachlichen Überblick sowie bedeutsame Zusammenhänge vermitteln, ohne dabei aktuelle Themen, Fragen, Probleme und Herausforderungen zu vernachlässigen.
Im Unterschied zu den Herausgebern des Wörterbuchs der Heilpädagogik halten wir es für wichtig, auch moderne Begriffe aus der Fachdiskussion zu berücksichtigen (z. B. Empowerment, Inklusion, Community Care), weil nicht wenige dieser »Modewörter« inzwischen zu Kursgewinnern auf dem Ideenmarkt Sozialer Arbeit zählen und zu Konzepten avanciert sind, die traditionelle heilpädagogische Modelle abgelöst haben und auf dem besten Wege sind, sich als Paradigmen zeitgemäßer Geistigbehindertenarbeit zu etablieren.
Manche Schlüsselbegriffe lassen sich wie lexikalische Stichwörter abhandeln, manche benötigen dagegen mehr Raum und eine Aufbereitung als Fachartikel.
Durch eine große Anzahl an Verweisen bei den einzelnen Stichwörtern sollen enge Bezüge aufgezeigt, Vernetzungen und Beziehungen hergestellt werden.
Zur zweiten, erweiterten Auflage haben 86 Autorinnen und Autoren 280 Stichwörter beigesteuert. Es handelt sich dabei um ausgewiesene Expertinnen und Experten, die zu den jeweils ausgewählten und zugeordneten Begriffen gearbeitet haben bzw. mit bestimmten Begriffen aufgrund ihrer Forschungen und Publikationen unmittelbar in Verbindung gebracht werden.
Neben diesen etablierten Fachleuten (wie z. B. langjährigen Lehrstuhlinhabern) werden gleichfalls Beiträge von renommierten Nachwuchswissenschaftler/innen berücksichtigt.
Die Herausgeber hoffen mit dieser Kombination von verschiedenen Autorinnen und Autoren der Meinungsvielfalt innerhalb des Arbeitsfeldes und dem breiten Spektrum von fachwissenschaftlichen und fachlichen Positionen Rechnung zu tragen.
Der Einfachheit halber und aus Platzgründen wurde zumeist die männliche Schreibweise benutzt, Personen weiblichen Geschlechts sind jedoch stets mitgedacht.
Bedanken möchten wir uns bei allen Autorinnen und Autoren für die bereitwillige Unterstützung durch exzellente Beiträge. Ebenso gilt unser Dank Herrn Dr. Burkarth vom Kohlhammer-Verlag für die gute Zusammenarbeit.
Wolfram Kulig, Kerstin Schirbort und Georg Theunissen
A
Ablösung, Trennung vom Elternhaus
Ablösung beschreibt einen biografischen Prozess, eine Entwicklungsaufgabe mit wesentlicher Bedeutung für die Ausbildung der → Identität. Bereits die Geburt und danach das Abstillen, Laufen lernen, die Entwicklung eines eigenen Willens (Trotzalter) etc. stellen Schritte in die zunehmende Unabhängigkeit von den Eltern dar. Alle Entwicklungen im Eltern-Kind-Verhältnis zu mehr Unabhängigkeit und Eigenständigkeit (Klauß 1997, 39) tragen zur Ausbildung eines Konzeptes vom eigenen Leben und der eigenen Person bei. Bei der schrittweise und über einen längeren Zeitraum erfolgenden Ablösung greifen äußere und innere Prozesse ineinander: Während das Kind sich äußerlich von den Eltern entfernt, alleine spielt, mit Freunden weggeht, eigene Interessen verfolgt und schließlich auszieht, löst es sich auch aus einer zu Beginn des Lebens symbiotischen Beziehung und entwickelt eigene Vorstellungen, Orientierungen, Bewertungsmuster und Handlungsweisen. Dies geht häufig und vor allem in der → Pubertät mit Auseinandersetzungen zwischen den Generationen einher.
Viele gesellschaftliche Institutionen unterstützen diese Ablösungsprozesse, sodass Eigenständigkeit und Unabhängigkeit stetig zunehmen. Für Menschen mit geistiger Behinderung stellt die Ablösung eine besondere Herausforderung dar, sie können vor allem dann, wenn sie Sonderinstitutionen außerhalb ihres Wohnumfelds besuchen, die Ablösung nicht in vergleichbarer Form einüben und damit schrittweise bewältigen:
Bereits im Kindergarten lernen Kinder üblicherweise, Wege alleine zu gehen, erste Freunde zu finden und mit ihnen etwas zu unternehmen. Kinder mit geistiger Behinderung werden meist gebracht und abgeholt, ihr Zuwachs an Eigenständigkeit ist hierbei geringer.
Zur Schule gehen Kinder ohne Behinderungen in der Regel ohne Elternbegleitung, sie weiten ihren Freundeskreis sehr aus und haben erstes (Taschen-)Geld. Behinderte Kinder werden meist weiterhin transportiert, und auch die Freizeitkontakte sind stärker organisiert.
Im Jugendalter sind
Peergroups
wichtig. Kontakte ohne Elternkontrolle helfen bei der Ausbildung eigener Sichtweisen. Jugendliche mit geistiger Behinderung brauchen hierfür Unterstützung und sind deshalb auch hier stärker fremdbestimmt. Ähnliches gilt für Urlaub und Freizeit; auch dort können sie nur begrenzt Unabhängigkeit und eigene Interessen erproben.
Die freie Wahl eines Arbeitsplatzes ermöglicht im Idealfall ein selbstbestimmtes Leben, eine eigene Wohnung und das Eingehen einer → Partnerschaft. Menschen mit geistiger Behinderung finden Arbeitsmöglichkeiten vor allem in Werkstätten, und ihr Einkommen ermöglicht kein wirklich eigenständiges Leben. Der Auszug aus der Herkunftsfamilie erfolgt oft fremdbestimmt (durch Eltern, Fachleute, unter Behördenmitwirkung) und häufig sehr spät (Klauß 1995, 448).
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























