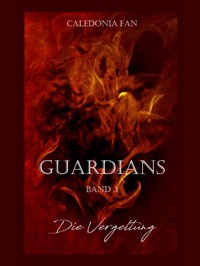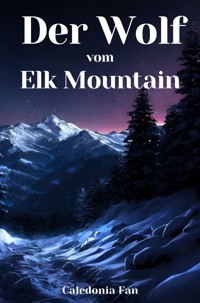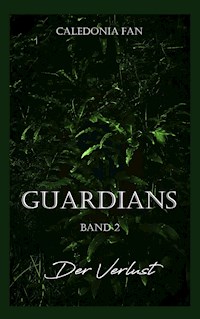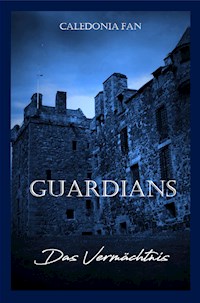6,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookmundo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hannah Benedikt findet sich nach einem Schlaganfall in einem Pflegeheim wieder. Sie hat Schwierigkeiten, mit der neuen Situation klarzukommen, und rettet sich oft in ihren trockenen, manchmal auch beißenden Humor. Ein Kampf beginnt, der sie nicht zurück in ihr altes Leben führt, sondern in eines, das jeden Tag neue Herausforderungen bereithält. Doch Hannche, wie sie von ihrer besten Kindheitsfreundin immer genannt wurde, zieht Kraft aus den Erinnerungen, die sie ab und zu überkommen, und sie ist nicht bereit, sich unterkriegen zu lassen. Nach und nach kann sie den Blick von ihrem eigenen Schicksal lösen und auf andere richten. Und sie entdeckt, dass das Leben auch mit eingeschränkter Beweglichkeit noch viel für sie bereit hält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Hannche
Hannche
Caledonia Fan
Impressum
Copyright: Caledonia Fan
Jahr: 2024
ISBN: 9789403755847
Lektorat/ Korrektorat: Caledonia Fan
Covergestaltung: Caledonia Fan
Weitere Mitwirkende: Stefan Wiegand (Coverfoto)
Verlagsportal: Bookmundo
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig
Widmung
Gewidmet denen, die sich täglich
um unsere Senioren und Pflegebedürftigen kümmern.
Ich verabscheue die Hannche, die vorhin im Speisesaal geflennt hat. Das bin nicht ich gewesen. Das war ein von neuen Eindrücken überrumpeltes Weiblein, das zwischen dem Wundern über Blicke fremder Männer und der Scham über verkleckertes Essen den Blick für die Realität verloren hat.
Aber nur kurz, korrigiere ich mich selbst, das war nur ein Moment der Schwäche. Ich bin stark und ich werde mich – wie von Marianne prophezeit – an alles hier gewöhnen. An wirklich alles.
Hannche
Hat mich jemand gerufen?
Blinzelnd öffne ich die Augen. Draußen dämmert gerade erst der Morgen. Im grauen Viereck des Fensters am Fußende von Frau Herzels Bett sehe ich ein fahles Stück Himmel, mehr leider nicht, so sehr ich mich auch anstrenge, denn zum Aufsetzen fehlt mir allein die Kraft.
Es muss noch sehr früh sein. Auf dem Gang draußen ist es still. Im Zimmer hingegen nicht. Missmutig äuge ich zu Frau Herzel hinüber. Die Bettnachbarin liegt mit offenem Mund auf dem Rücken und schnarcht.
Niemand hat mich gerufen. Natürlich nicht, wer sollte das auch um diese Zeit? Meine Familie ist nicht hier. Nur Frau Herzel und die Schwestern. Und die nennen mich nicht Hannche. Das hat nur Gertrud gemacht ...
Als ich letzte Woche hier einzog, meinte ich im ersten Moment, in dem Sessel am Fenster sitzt sie. Dasselbe silbrige Haar, derselbe komplizierte Knoten, die dicke, gelbliche Kunststoffbrille. Aber als die Frau den Kopf wandte, erkannte ich, dass es nicht Gertrud war. Sie konnte es ja auch gar nicht sein. Meine Freundin ist vor drei Jahren gestorben. Das wurde mir in dem Moment, als ich meinen Irrtum erkannte, so deutlich bewusst, dass ich unvermittelt zu weinen begann.
Beate schob sich hastig hinter mir ins Zimmer und legte meine Handtasche auf das Bett.
„Mama, das wird schon“, murmelte sie.
Meine Tochter klang verlegen und ich biss mir auf die Lippen, als sie unbeholfen meine Wange tätschelte. Gefühle und Zärtlichkeiten waren noch nie ihre Stärke gewesen.
„Der erste Tag ist immer der schwerste, Frau Benedikt“, meinte die dunkelhaarige Schwester, die meine Sachen hereintrug. Beruhigend strich sie mir über die Schulter. Die Frau, die Beate um einen halben Kopf überragte, hieß Monika und war die Stationsleiterin, wie mir ihr Namensschild verriet.
„Gefällt Ihnen das Zimmer nicht?“, fragte sie weiter. „Sie werden sich schon eingewöhnen. Geben Sie sich Zeit, das wird nicht von heute auf morgen, aber an jedem Tag ein bisschen.“
Sie wuchtete meinen Koffer auf den Stuhl neben dem Bett, während sie das sagte, und lächelte mir noch einmal aufmunternd zu, bevor sie ging.
Das Zimmer? Das hatte ich noch gar nicht angesehen.
Ich wischte mir die feuchten Spuren von den Wangen und blinzelte durch die nassen Brillengläser.
Doch, das Zimmer war hübsch. Zwei Betten, zwei Schränke, zwei Nachtschränke, zwei Stühle, zwei, zwei, zwei ...
Die leise Hoffnung, trotz der Absage der Heimleitung doch in einem eigenen Zimmer leben zu können, zerplatzte wie eine Seifenblase. Ich hatte meine hübsche Wohnung in Ellerbach nur sehr schweren Herzens aufgegeben. Das Häuschen war mein eigenes kleines Reich gewesen und hier musste ich ein noch viel kleineres Reich plötzlich mit einer anderen Frau teilen. Einer völlig fremden noch dazu.
Schon wieder kamen die dummen Tränen. Selbst wenn die andere die Freundlichkeit oder Rücksichtnahme in Person war – ich wollte sie nicht haben, nicht hier, nicht in meinem Zimmer.
Es will einfach nicht heller werden draußen. Inzwischen muss doch schon ein bisschen Zeit vergangen sein, während ich meinen Erinnerungen nachgehangen habe. Das rechte Bein tut weh, das gelähmte. Die neuen Schmerztabletten, die die Ärztin aufgeschrieben hat, sind auch nicht besser als die vorherigen.
Am Montag nach meiner Ankunft bekam ich das erste Mal eine der neuen Tabletten und merkte: Da war auf einmal eine viel zu große in meinem Mund. Ich kannte meine Pillen vom Krankenhaus, alle, die glatten, die runden, die bitteren und die, die ein bisschen auf der Zunge prickelten. Aber die große, die kannte ich nicht und so spuckte ich sie in meine Hand.
Die junge Schwester mit dem blonden Pferdeschwanz, die mir das Schälchen gegeben hatte, zog mehr verärgert als erstaunt die Augenbrauen zusammen.
„Na, na, was soll denn das? Tabletten werden runtergeschluckt, nicht ausgespuckt, Frau Benedikt.“
Doch ich schüttelte den Kopf, hielt ihr meine Handfläche mit der ausgespuckten Pille darauf unter die Nase und kniff die Lippen demonstrativ zu. Diese Tablette konnte nur falsch sein.
Die Schwester sah mich mit schlecht verborgenem Unmut an. „Ach so, die neue Tablette. Ja, die ist etwas groß. Kriegen Sie sie nicht runter?“
Neu? Ach so.
Das hätte mir ja auch mal jemand sagen können, hören konnte ich schließlich noch sehr gut und mein Gedächtnis hatte - auch wenn das manche vielleicht annahmen - keineswegs gelitten, wobei ich mir allerdings noch nicht sicher war, ob ich das gut oder eher bedauerlich finden sollte.
Natürlich hatte ich die Tablette dann geschluckt. Meine neue Hausärztin, die mich am Tag nach meiner Ankunft hier besuchte, hatte also etwas aufgeschrieben. Also war unsere Art der Zwiesprache erfolgreich gewesen – sie fragte, ich antwortete mit Kopfschütteln oder Nicken.
Kopfschütteln, Nicken, meine neue Art der Unterhaltung ...
Seit dem Schlaganfall habe ich große Schwierigkeiten mit dem Sprechen. Es geht inzwischen etwas besser als gleich danach, aber immer, wenn ich versuche zu reden, erschrecke ich vor meiner eigenen Stimme. Öffne ich den Mund, läuft mir sofort der Speichel aus dem Mundwinkel und das ist mir entsetzlich peinlich. Außerdem klingt meine Stimme, als ob jemand in ein Ofenrohr brüllt. Ich kann die Lautstärke schlecht kontrollieren und die Zunge gehorcht auch nicht in dem Tempo, wie sie soll. Es ist ein bisschen wie nach einer Spritze beim Zahnarzt oder wie betrunken sein, da kommt die Sprache dem Denken auch nicht hinterher. Genauso wenig wie das Denken dem Geschehen, sinniere ich belustigt.
Meine Bettnachbarin Frau Herzel hört schwer und nach ein paar erfolglosen Versuchen, ihr meine Wünsche mitzuteilen, habe ich es aufgegeben.
„Schwester, die schreit immer so!“, hat sie einmal gemeint, als Schwester Monika hereingekommen ist. Seitdem schweige ich lieber. Nur wenn die Sprachlehrerin kommt, bemühe ich mich, aber vor ihr schäme ich mich auch nicht. Sie zieht nicht mal Handschuhe an, wenn sie mein Gesabber wegwischt. Meine verkorksten Laute spricht sie genauso verkehrt nach und erklärt mir danach, wie ich es anders machen muss. Dann wiederholt sie die Laute so, wie sie irgendwann bei mir einmal klingen sollen, unermüdlich, immer wieder. Und mit viel Geduld werden sie das auch. Irgendwann halt.
Geduld ...
Das ist das, was mir fehlt. Zu warten, bis es draußen heller wird, bis ich umgedreht werde, bis es Essen gibt, bis die Tür aufgeht und vielleicht einmal Besuch für mich kommt - das kann ich so schlecht.
Das Bein tut noch mehr weh. Wie spät wird es sein? Vielleicht fünf? Die Amseln singen schon ...
Ich habe nahe der Kirche gewohnt. Der stündliche Glockenschlag hat mich nie gestört, auch das morgendliche Läuten am Sonntag nicht, oder das ganz früh am Ostermorgen. Im Gegenteil, so wusste ich immer, wie spät es gerade war. Die Kirchenglocke hat mein ganzes Leben begleitet, denn ich habe bis zuletzt in meinem Elternhaus gelebt. Sie sagte mir, wie spät es ist, auch wenn ich nachts mal wach lag. Ihr Klang war tröstlich und mahnend zugleich. Schlug es fünf, war es Zeit, aufzustehen. Die Hühner mussten gefüttert werden, bevor wir in die Schule gingen.
Der Bettbezug hat tatsächlich ein Loch. Ein kleines, gleich hier oben am Zipfel. Wäre ich zu Hause, würde ich jetzt aufstehen, Nadel und Faden holen und es ausbessern, immer die leise, mahnende Stimme der Mutter im Ohr: Ein Mädchen hat seine Wäsche stets in Ordnung zu halten. Überhaupt - diese Bettwäsche! Mutter hätte mich zurückgeschickt zur Mangel im Keller vom Lindengasthof, wäre ich mit solchen Falten nach Hause gekommen!
Vor dieser Mangel habe ich mich als Kind immer gefürchtet. Deshalb ist Gertrud auch immer mitgegangen. Mutter wusste das nicht. Sie mochte keine Feigheit.
Die Mangel stand im letzten Keller des großen Gasthofgebäudes, wo der Schein der alten Karbidlampe in Gertruds Hand die Trennwände aus Lattenrosten als bizarre Schatten an der Wand tanzen ließ. Es kam vor, dass einem Ratten über die Füße huschten. Gertrud half immer, den schweren Korb zu tragen, und ging voran. Sie hatte keine Angst. Sie hatte vor gar nichts Angst. Einmal hatte sie Maxe, dem dicken Sohn vom Fleischer, mit einem Katapult ein Taubenei auf den gewaltigen Hintern platziert. Wir saßen dabei auf der Bank vor dem Lindengasthof. Als Maxe kreischend herumfuhr, war das Katapult längst wieder in ihrer Schürzentasche und wir beide spielten ganz brav abklatschen und sangen dazu 'Bei Müllers hat's gebrannt'. Hinterher, als Maxe verschwunden war, haben wir uns ausgeschüttet vor Lachen.
Es ist wirklich albern, wohin die Gedanken spazieren, wenn man einen zerknitterten Bettbezug sieht. Ich war schon wieder bei Gertrud, der besten Freundin meiner Kindheit, Jugend – eigentlich immer.
Frau Herzel schnarcht weiter. Ihr Wecker tickt unglaublich laut. Selbst wenn ich noch müde wäre - dabei einzuschlafen ist nicht leicht.
Im Nebenzimmer rauscht die Toilettenspülung. Wer dort wohl wohnt? Wahrscheinlich jemand, der noch laufen kann.
Ich müsste eigentlich auch mal. Ob ich noch so lange warten kann, bis die Schwester von selbst kommt? Manchmal taucht sie auch gar nicht noch einmal auf, bevor sie die Schicht beendet.
Ich höre eine Tür klappen. Es ist also doch die Nachtschwester gewesen. Wenn ich jetzt gleich klingle, hat sie einen kurzen Weg ...
Wo ist die Klingel? Sie liegt doch immer hier, neben meiner linken Hand! Weit kann sie nicht sein, ich habe sie vorhin noch gespürt – da, da ist sie ...
Ich habe die Klingel heruntergeschmissen. Mit dem Klappern wird mir klar, dass ich die Schwester nun nicht mehr rufen kann. Entweder ich halte es an, bis die Frühschicht zum Waschen kommt, oder ich mache mich nass.
Wie ich das hasse! Das ist so entwürdigend. Im Krankenhaus hat mir niemand einen Schieber gebracht. 'Sie haben eine Windel dran', wurde mir mitgeteilt. Eine Windel. Wie ein Baby, nur dass deren Windeln kleiner sind. Am schlimmsten ist das große Geschäft, obwohl ich dafür hier im Heim endlich den Schieber bekomme. Ich bin kein Leichtgewicht, das weiß ich und manchmal weine ich leise ins Kissen, wenn die Schwester mich danach mühsam auf die Seite dreht. Danach höre ich das Geräusch, welches verrät, dass sie sich Gummihandschuhe anzieht. Als Nächstes kommt das Zischen des Sprays mit dem Pflegeschaum, dann der Zellstoff. Ich beiße die Zähne zusammen und lasse die Tränen laufen, denn ich weiß: Es geht vorbei und bald bin ich wieder sauber. Und irgendwann einmal werde ich mich wahrscheinlich daran gewöhnt haben. Oder keine Windel mehr brauchen, weil ich wieder eine Toilette benutzen kann.
Es ist wie verhext. Seit ich weiß, dass die Klingel unerreichbar ist, wird das Bedürfnis immer stärker. Auch die Schmerzen im Bein scheinen nun erst recht zuzunehmen. Ich könnte Frau Herzel bitten zu klingeln, aber die hört mich nicht mal, wenn sie wach ist, und jetzt schläft sie.
Zu allem Überfluss ist jetzt noch eine Fliege im Zimmer unterwegs, so eine dicke, goldgrüne. Sie ist zwar recht langsam, aber für mich trotzdem viel zu schnell. Ich muss die Schwester mal fragen, ob sie hier Leimbänder haben. Obwohl – Leimbänder? Da gibt’s jetzt etwas viel Besseres, Wirkungsvolleres. Ein Spray oder so ein komisches, kleines Ding, das man in die Steckdose steckt ...
Als ich ein Kind war, gab es bei uns zu Hause immer Leimbänder. An der großen, schmiedeeisernen Tischlampe über dem eichenen Wohnzimmertisch und in der Küche natürlich, manchmal drei Stück. Wir Kinder lachten immer, wenn Mutter beim Tischdecken mit dem Haarnetz daran hängen blieb. Doch ebenso staunten wir auch, wenn wir sahen, wie sie mit einem schnellen Griff die gelösten Haarsträhnen erneut feststeckte und so die ruinierte Frisur wieder in Ordnung brachte. Manchmal klebte das Haarnetz so fest, dass es sich nicht ablösen ließ. Das war dann natürlich noch mehr Grund zum Lachen.
Überhaupt wurde viel gelacht in meiner Familie. Wir waren sechs Kinder, aber Kinderzimmer gab es nicht. Die Großeltern wohnten ja mit bei uns. Alles Leben spielte sich in dem großen Wohnzimmer mit den blank gescheuerten und gebohnerten Holzdielen ab. Man war fast nie allein, Privatsphäre gab es so gut wie gar nicht ...
Privatsphäre ist auch so etwas, was man erst schätzt, wenn man es nicht mehr hat. Jede Minute des Tages mit einem wildfremden Menschen zu verbringen, damit muss man erst mal klarkommen.
Vorsicht, Hannah, du kannst dir kein Selbstmitleid erlauben, das macht das Gemüt schwer.
Mühsam verändere ich meine Lage ein wenig. Unter meinem Po kribbelt es, als säße ich in einem Ameisenhaufen. Ich kann mich nicht mal kratzen, denn die Hand unter meinen fast Neunzig-Kilo-Körper zu schieben – dazu reicht meine Kraft nicht.
Frau Herzel hat sich verschluckt beim Schnarchen und hustet zwei, drei Mal. Ob sie wach wird?
Ich hebe den Kopf ein wenig, doch ich kann nichts sehen. Die hohe Lehne des Sessels verbirgt die Schläferin vor meinen Blicken.
Frau Herzel hat ein riesiges Ballonfederbett und sie liegt dahinter verborgen wie hinter einem Berg.
So ein herrliches, plusterweiches Bett hatte ich auch einmal. Ist gar nicht so lang her, vielleicht drei, vier Jahre. Ich musste mir damals einen Ruck geben für den Kauf, denn es war recht teuer gewesen. Aber ich hatte es nie bereut, im Gegenteil: Abends habe ich mich immer richtig darauf gefreut, hineinkriechen zu können, wenn es im Schlafzimmer wegen des offenen Fensters so kalt war, dass mein Atem kleine weiße Wölkchen bildete.
Meine Tochter Beate hatte den imaginären Berg erkannt, den mein linker Arm über der flachen Bettdecke angedeutet hatte. Damals gingen wir im Krankenhaus gemeinsam die Dinge durch, die ich mit ins Heim nehmen würde. „Aber Mama“, wehrte sie ab. „Das dicke Bett brauchst du doch nicht im Heim. Da ist es warm, die Zimmer sind geheizt.“ Sie schien es sich gerade noch verkneifen zu können, mich auszulachen, und ich begriff, dass sie mich nicht verstand. Das Bett bedeutete für mich mehr als nur eine warme Decke.
Einen Tag vorher hatte der Oberarzt mir behutsam mitgeteilt, dass meine Zukunft nun das Pflegeheim war. Natürlich nur, bis es mir besser ginge, die Lähmungen konnten ja zurückgehen.
Ich lachte, ich lachte ihn einfach aus! Ich kannte etliche Leute mit Schlaganfall, aber keinen, der einen erlitten hatte und später aus dem Pflegeheim wieder rausgekommen war.
Doch das Lachen hatte auch sein Gutes gehabt: Danach war der erste Schock überwunden und ich überlegte nun ziemlich gefasst, welche Dinge ich gern mitnehmen würde in mein neues Zuhause. Mein Federbett, das stand fest. Schließlich würden die Winternächte auch dann noch kalt sein, wenn ich nicht mehr in meinem kleinen Haus wohnte. Und das Fenster, das sollte auf jeden Fall auch weiterhin offen sein.
Ich habe meine Rechnung ohne Frau Herzel gemacht. Sie scheint frische Luft zu hassen. In den zwei Wochen, die ich jetzt hier bin, ist das Fenster nur zwei Mal kurz geöffnet worden, nämlich als die Reinemachfrau saubergemacht hat und Frau Herzel gerade beim Frühstück gewesen ist. Ansonsten bleibt hier alles verrammelt.
Aber die Reinemachfrau weiß, wie viel mir ein offenes Fenster bedeutet, und will es so einrichten, dass sie immer dann putzen kommt, wenn Frau Herzel bei Tisch ist. Eine liebe Seele ist sie, die Frau Kehrer. Als sie sich bei mir vorgestellt hat, hat sie gesagt, dass man mit so einem Namen wohl gar keinen anderen Beruf machen kann, und wir haben gemeinsam gelacht. Gestern hat sie mir einen Blumenstrauß gebracht. „Aus meinem Garten“, sind ihre Worte gewesen und sie hat ein wenig verlegen gelacht. „Weil Ihnen das Einleben hier so schwerfällt.“
Die Gute, woher weiß sie das? Ich habe zu niemandem ein Wort gesagt. Sie muss es mir einfach abgespürt haben. Ich bin so gerührt gewesen, dass mir die Worte für das Dankeschön im Hals stecken geblieben sind. Als ich endlich wieder habe sprechen können, ist sie längst verschwunden gewesen.
Ja, mein Federbett ... Natürlich hat meine Tochter Recht gehabt. Es ist manchmal zum Ersticken warm hier drin, auch ohne Federbett. Möchte wissen, wie Frau Herzel das aushält.
Ob mein Bett jetzt beim Müll ist? Oder hat es Beate für sich genommen? Nein, das wohl eher nicht. Ihr Schlafzimmer hat sie im fernöstlichen Stil gestaltet, sie richtet sich nach Energieflüssen und anderen unverständlichen Sachen. Leider habe ich sie nie in Hamburg besucht, deshalb hat sie mir einmal in einem Möbelversandhauskatalog ein paar Sachen gezeigt, die sie sich gekauft hat. Und ein Ballonfederbett passt da etwa genauso rein wie Holzpantoffeln zu Tschaikowskys Schwanensee.
Wo wohl alle meine Schallplatten hingekommen sind? Ich hatte so viele, war richtig stolz auf meine Sammlung.
Meine erste kaufte ich mir mit achtzehn von einem meiner ersten Löhne. Da hatte ich noch nicht einmal einen Schallplattenspieler. Aber Gertruds Eltern hatten einen und bei ihnen durfte ich meine Schallplatte anhören. Ihnen gehörte der Milchladen in unserem Dorf, das heißt, die Mutter hatte den Laden, der Vater die Milch, denn er versorgte die Herde von immerhin fünfundzwanzig Kühen! Ein ungeheurer Reichtum war das für die damalige Zeit.
Ich weiß noch, wie ich Gertruds Mutter immer mit offenem Mund anstarrte, wenn ich als Kind an der Hand meiner großen Schwester und später dann allein mit der Milchkanne zu ihr in den Laden kam. Sie trug stets eine blendend weiße, gestärkte Schürze mit gestickter Schrift auf dem Latz. „Knauers Molkerei“ stand da in blauen Buchstaben und darunter war eine Kuh eingestickt, die sich an einem Grasbüschel gütlich tat. Ihre Haare hielt die immer freundliche Frau mit einem schneeweißen Kopftuch zurück und ständig umschwebte sie der Duft frisch gemolkener Milch.
Gertrud war im Gegensatz zu ihrer Mutter nie sauber. Aber sie betrat ja auch nie den Laden, das durfte sie nicht. Wollte sie etwas von ihrer Mutter, musste sie sich hinten an die Tür stellen und so lange warten, bis der letzte Kunde bedient war und die Mutter zu ihr kam. Aber sie wollte selten etwas. Meist war sie froh, nicht in Reichweite der Eltern zu sein.
Gertrud war überhaupt ganz anders als ich. Sie hatte – wie schon gesagt – vor nichts Angst, machte Dinge, die ein Mädchen nie tat, wie zum Beispiel mit dem Katapult schießen, sie konnte schnitzen und trug auch immer ein kleines Taschenmesser in ihrer Schürzentasche. Auch Garn, Knöpfe, Schrauben, eine Hasenpfote und ein dicker Bleistiftstummel zählten zu ihren Schätzen.
Auf dem Gang wird es unruhig. Stimmen sind zu hören, Gelächter, Türen werden geöffnet und geschlossen, Wasser rauscht nebenan. Die Frühschicht beginnt ihren Dienst. Zum Glück, denn ich kann es kaum noch aushalten mit meinem Bein und ich muss ganz dringend mal.
Draußen fahren Autos vorbei, es sind viele und es scheint eine recht große Straße zu sein, denn auch Lastwagen sind zu hören.
Ich kann mich nicht erinnern, wie das Heim von außen aussieht. Habe ich das überhaupt wahrgenommen, als ich aus dem Krankenwagen gehoben wurde? Ich weiß es nicht mehr. Naja, es ist auch nicht unbedingt viel zu sehen, wenn man auf dem Rücken liegt und nur den Himmel und dann das Vordach vom Eingang über sich sieht. Man hört, wie eine automatische Tür sich öffnet, wird hindurch geschoben, erhascht einen Blick auf eine Infotafel und ist da. Nein, bewusst wahrgenommen habe ich da wohl nichts, außer dass ich mich gefragt habe, warum ausgerechnet in dem Auto, das mich herbrachte, der Stuhl kaputt gehen und ich deshalb auf die Trage gelegt werden musste. Aber ich weiß noch, dass ich Angst hatte, als die Trage aus dem Auto gezogen wurde und das Fahrgestell scheppernd auf dem Boden aufschlug. Leider haben die beiden jungen Krankenfahrer das nicht bemerkt und deshalb nicht gesehen, wie ich krampfhaft mit der gesunden Hand den Rand der Trage umklammerte und versuchte, mit der gelähmten meine Handtasche festzuhalten, die man auf meinen Bauch gelegt hatte und die bedenklich ins Rutschen kam.
Gedämpftes Kindergeschrei dringt von der Straße herein. Die müssen aber früh raus, die Kleinen.
Beate muss mir einen Wecker mitbringen. Besser wäre noch eine Wanduhr, eine richtig große, denn ohne Brille sehe ich nichts und meine Brille liegt auf dem Nachttisch, unerreichbar für mich.
Zu Hause hatten wir einen Regulator. Ein dunkelbraunes, reich mit Schnitzereien verziertes Holzgehäuse, das von Mutter liebevoll mit einer intensiv duftenden Politur aus Bienenwachs auf Hochglanz poliert wurde. Er beherbergte ein Uhrwerk mit einem wunderbar melodischen Schlagwerk. Ich weiß noch, wie wir Kinder immer mit angehaltenem Atem standen, wenn mein Vater am Samstagabend mit wichtiger Miene das kleine Glastürchen unter dem Zifferblatt öffnete und das goldfarbene Pendel anhielt. Als ich noch ganz klein war, fünf Jahre alt vielleicht, hatte mir Erna weisgemacht, es sei echtes Gold. Einige Jahre später erst wagte ich es zaghaft, Mutter nach dem Goldpendel zu fragen. Sie seufzte und meinte: 'Hannah, wenn das wirklich Gold wäre, müsste dein Vater nicht so schwer arbeiten und wir hätten ein großes Haus in der Stadt.‘ Da begriff ich, dass meine älteste Schwester mich belogen hatte.
Ja, der Regulator. Wenn Vater das Pendel angehalten hatte, setzte er umständlich seine goldumrandete Brille auf und zog seine Taschenuhr aus der Westentasche. Mit allerhöchster Konzentration verglich er die darauf angezeigte Zeit mit der des Regulators. Manchmal schob er vorsichtig den großen Zeiger ein wenig vor und zog dann mit dem Schlüssel das Uhrwerk auf. Und schließlich kam das, worauf wir Kinder immer voller Spannung und mit angehaltenem Atem warteten – er strich mit dem Zeigefinger einmal ganz sacht über die vier Metallstangen, denen sonst ein kleiner Hammer den Gong entlockte. Aber Vaters Berührung war anders, jeder Ton klang einzeln an und sie harmonierten einfach wunderbar. So stellte ich mir die Musik der Engel im Himmel vor, von denen der Kantor uns erzählt hatte. Erst wenn der letzte zarte Klang verklungen war, mein Vater das Pendel wieder anschob und die kleine Glastür schloss, war der Zauber vorbei. Wir Kinder atmeten aus und sprangen davon, um am nächsten Samstagabend dasselbe Schauspiel erneut herbeizusehnen.
Als meine Eltern dann schon lange tot waren und ich die Uhr in meinem Wohnzimmer hängen hatte, erinnerte ich mich noch oft an diese samstägliche Tradition. Immer, wenn ich den kleinen Schlüssel in das Loch schob und die fünf Umdrehungen machte, dachte ich an Vaters ehrfürchtige Bewegungen dabei. Mir sah niemand zu, wenn ich das Ritual vollzog, keine Enkel. Beate hatte bei ihren ständig wechselnden Männerbekanntschaften noch nicht den gefunden, mit dem sie Kinder haben wollte, und Joachim wohnte mit seiner Familie nicht gerade um die Ecke. So war ich eben allein.
Natürlich ist der Regulator bei mir zu Hause längst stehen geblieben. Alles ist irgendwie stehen geblieben zu Hause, vor allem die Zeit. Mir fallen mit Schrecken meine Pflanzen ein. Die Monstera und das Dickblatt sind schon fünfzehn Jahre alt! So viel Mühe habe ich in ihre Pflege gesteckt.
Ob sich wohl jemand darum kümmert? Sicher nicht. Beate ist zurück nach Hamburg gefahren, sie hat andere Dinge im Kopf als meine Zimmerpflanzen. Aber vielleicht hat sie der Nachbarin den Schlüssel gegeben? Erika Schneider würde sich bestimmt darum kümmern. Sie ist ja auch so eine mit grünem Daumen. Bei ihr wuchern nicht nur die Topfpflanzen auf der Fensterbank, nein, der ganze Garten ist ein grünes Paradies. Wenn ich im Frühsommer in meinem Liegestuhl gesessen habe, ist mein Blick oft neidisch über ihren üppigen Blauregen gewandert. Mein trauriges Exemplar hat sich mickrig dagegen ausgenommen und ich habe mich schon gefragt, ob es wirklich nur der Kaffeesatz und die Eierschalen im Kompost sind, die diese Oase der Erholung zustande bringen. Bei einem Plausch über den Gartenzaun hat mir Frau Schneider jedenfalls versichert, dass diese beiden Dinge in der Komposterde reine Wunder wirken.
Ich seufze leise.
Wenn ich das Bett am Fenster hätte, dann könnte ich sicher ein paar Topfpflanzen auf das Fensterbrett stellen. Und sicher würde Frau Kehrer ihnen auch ab und zu etwas Wasser geben. Am liebsten hätte ich ja Alpenveilchen, an deren Blütenpracht kann ich mich nicht sattsehen. Besonders die cyclamfarbenen haben es mir angetan, aber auch die dunkelroten gefallen mir. Doch in diesem überheizten Zimmer würden sie wohl nicht lange halten. Frau Herzel möchte es eben gern warm haben und außerdem geht das Ganze sowieso nicht, denn das Bett am Fenster gehört nun mal nicht mir, sondern meiner Mitbewohnerin. Sie sitzt ja auch den ganzen Tag dort in ihrem Stuhl und schaut hinaus.
Wenn sie nett wäre, könnte sie mir ein bisschen erzählen, was sie so sieht, das würde die Langeweile ein wenig vertreiben. Erst neulich, da hat es draußen ein lautes Hupen und quietschende Reifen gegeben, danach ist ein lautes Scheppern zu hören gewesen. Ich hätte gern gewusst, was passiert ist, doch das hätte bedeutet, dass ich Frau Herzel frage, und – wie gesagt – sie hört mich nur, wenn sie ihre Hörgeräte trägt, was selten der Fall ist. Und ich spreche so undeutlich und laut. Also habe ich es sein gelassen und gehofft, dass eine der Schwestern mal so nebenbei etwas erzählt. War aber nicht so. Schade.
Ich versuche erneut, einen Blick auf das Fenster zu werfen, und es knackt wieder in meinem Hals. Aber ich kann erkennen, dass es heller geworden ist. Jetzt müsste doch bald mal eine Schwester kommen. Es kribbelt immer noch unter meinem Po und ich versuche nun doch, meine Hand dorthin zu schieben. Mit viel Mühe schaffe ich es endlich – ich kann mich kratzen! Meine Güte, welche Wohltat. Wie wundervoll es ist, sich kratzen zu können, wenn es juckt. Das ist mir noch nie aufgefallen.
Natürlich juckt es jetzt ein paar Zentimeter daneben. Undenkbar, dass ich da herankomme. Und mit dem anderen Arm brauche ich es gar nicht zu versuchen, den kann ich gerade mal anheben, aber richtig gezielte Bewegungen? Keine Chance. Und auch keine Kraft dafür.
Im Krankenhaus hat man mir gesagt, dass sich diese Lähmung nicht wieder rückgängig machen ließe und dass man nur versuchen könne, die Beweglichkeit der Gelenke zu erhalten und die Verkrümmung der Finger und des Fußgelenks zu verhindern. So viel zu deiner Vorhersage, du Koryphäe von Oberarzt! Nur vorübergehend ins Heim – dass ich nicht lache!
Das ist noch so eine Sache, über die ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe – dass Gelenke und Finger beweglich sind. Man hält das für so selbstverständlich, dass man es nicht bewusst wahrnimmt.
Ich hebe meine linke Hand vor das Gesicht und betrachte sie eingehend. Langsam bewege ich die Finger, mache eine Faust, öffne sie wieder. Unbegreiflich, ich bewege nicht jeden Finger bewusst. Mein Gehirn erteilt den Befehl ‚Faust‘ und schon wissen alle fünf, dass sie sich krümmen sollen.
Ich hätte diesem faszinierenden Vorgang schon viel eher Beachtung schenken müssen ...
Als ich neun war, sollte ich Klavierspielen lernen. Der Kantor meinte, er halte mich für talentiert und wolle mir Unterricht erteilen. Mein Vater sah es als eine Auszeichnung an. Mich wundert noch heute, warum er nie gefragt hat, wo der Kantor mich wohl hat spielen hören, um zu diesem Urteil zu kommen.
Was er nicht wusste: Der Kantor hat mich tatsächlich gehört. Ich war nämlich von ihm erwischt worden und dass das passiert war, daran trug Gertrud die Schuld.
Zwischen der letzten Schulstunde und der Christenlehrestunde blieb uns immer etwas Zeit und Gertrud und ich vertrieben uns diese bei Regen im Gemeindesaal des Pfarrhauses. Dort stand auch das Harmonium und eines Tages öffnete ich vorsichtig den Deckel. Das war ein Sakrileg. Niemand von uns Kindern durfte das. Aber das Instrument faszinierte mich. Ich wusste, wie man es spielte, schließlich hing mein Blick beim Gottesdienst jedes Mal gebannt am Kantor, wenn er das tat.
Gertruds Miene forderte mich förmlich auf, dem Harmonium einen Ton zu entlocken. Erwähnte ich schon, dass sie vor nichts Angst hatte? Meine Füße reichten damals kaum bis zu den Schöpfpedalen und ich musste sie mit den Zehenspitzen betätigen. Nachdem ich das Schutztuch abgenommen hatte, glitt mein Blick über die vergilbten Tasten und die runden Register mit der verschnörkelten Schrift darauf, während meine Füße die quietschenden Pedale betätigten und Luft in den Balg beförderten. Zaghaft klimperte ich eine kurze Melodie.
Gertrud, die eigentlich Schmiere stehen sollte, lehnte am Türrahmen und lauschte mit offenem Mund. Es kam, wie es kommen musste. Nachdem meine letzten Töne leise wimmernd verklungen waren – ich hatte extra gewartet, bis alle Luft aus dem Balg entwichen war – sagte jemand: „Erstaunlich, Hannah, woher kannst du das?“
Der Kantor! Unbemerkt hatte er sich angeschlichen.
Mir blieb fast das Herz stehen. Auch Gertrud fuhr zusammen und stieß dabei mit dem Kopf an den Türrahmen. Sich verstohlen die schmerzende Stelle reibend, sah sie mich schuldbewusst an. Beide warteten wir mit klopfendem Herzen auf das unvermeidliche Donnerwetter. Aber der Kantor hatte sich umgedreht, ohne auf eine Antwort von mir zu warten, und rief die Kinder vom Kirchhof herein, um mit der Christenlehre zu beginnen.
Mit schamrotem Kopf schloss ich den Deckel, so behutsam, als könnte ein Laut davon dem Kantor das Geschehene wieder in Erinnerung bringen und die Strafe doch noch über mich hereinbrechen lassen. Aber es sah ganz so aus, als würde er die Sache nicht weiterverfolgen. Gertrud schaute mich verstohlen an und atmete mit einem triumphierenden Grinsen aus. Ich selbst traute dem Frieden aber nicht und blieb den Rest des Tages unruhig. Kurz überlegte ich sogar, dem Vater nach dem Abendessen meine Missetat zu beichten, für den Fall, dass der Kantor bei uns zu Hause auftauchte, um mich zu verpetzen. Bei dem Gedanken daran schlug mir das Herz bis zum Hals. Aber obwohl ich ein Geständnis für den besten Weg hielt, entschied ich mich dagegen.
Dass das ein Fehler war, zeigte sich am Abend, als es klopfte und Vater die Tür öffnete. Ich saß als personifiziertes schlechtes Gewissen auf der Küchenbank über meinen Hausaufgaben. Im verzweifelten Bestreben, nicht aufzufallen, machte ich mich noch kleiner und schrieb fleißig mit tief gesenktem Kopf, um meine roten Wangen niemanden sehen zu lassen. Nebenan im Wohnzimmer hörte ich Vater mit einem Mann reden und wieder wurde mir ganz schlecht vor Angst. War das der Kantor? Vielleicht hatte ich am Harmonium etwas kaputt gemacht und er hatte es jetzt erst entdeckt? Vielleicht musste mein Vater nun für den Schaden aufkommen? Was kostete ein neues Harmonium? Meine Knie waren so weich, dass ich froh war, sitzen zu können. Ich weiß noch, dass meine Feder Tintenkleckse auf dem Papier hinterließ, weil meine Hand zitterte.
Und dann kam das Unvermeidliche. Die Tür zum Wohnzimmer öffnete sich.
„Hannah, komm einmal herüber“, sagte mein Vater leise.
Ich glaubte nicht, dass meine bebenden Knie mich tragen würden, doch ich stand gehorsam auf. Mutter stand mit dem Geschirrtuch in den Händen am Spültisch und sah mich unsicher an. Irgendwie war das Leben in unserer Küche abrupt zum Stillstand gekommen, wie eingefroren. Meine älteren Geschwister, die mit ihren Hausaufgaben oder einem Buch ebenfalls am Tisch saßen, hielten inne und starrten mich an. Es war totenstill geworden und meine Schritte polterten überlaut auf den blank gescheuerten Holzdielen. Es schien fast, als klebten meine Füße auf dem Boden fest, so mühsam war das Laufen.
Naja, es ist dann doch nicht so schlimm geworden. Der Kantor hat meinem Vater angeboten, mich zu unterrichten, und mein Vater war einverstanden, weil es nichts kosten sollte. So kam es, dass ich einmal in der Woche nach der Schule ins Kantorhaus, das gleich neben dem Pfarrhaus stand, hinüberging und Klavierspielen lernte. Da ich zu Hause nicht üben konnte, wurden aus der einen Übungsstunde bald zwei und schließlich drei. Ich war mit Begeisterung dabei. Die Kantorsleute waren schon alt, viel älter als meine Eltern. Ab und zu half ich deshalb der weißhaarigen Kantorsfrau im Haushalt oder im Sommer auch im Garten, besonders beim Marmelade kochen und beim Ernten.
Dem Klavierunterricht folgten Übungsstunden am Harmonium. Meine Beine reichten inzwischen besser an die Pedale und ein halbes Jahr später zog ich zum Üben in die Kirche um, damit ich mich an die Orgel gewöhnte. Nach insgesamt drei Jahren war ich so weit: Die Prüfung stand an. Wenn ich sie bestand, durfte ich danach den Kantor sonntags an der Orgel vertreten. Ich war furchtbar aufgeregt. Der Kirchenschlüssel allein erschien mir schon gewaltig und Ehrfurcht vor diesem erhabenen Instrument mit seinem überwältigenden Klang erfüllte mich. Es erschien mir unglaublich, dass meine kleinen Finger diesen unzähligen Pfeifen, von denen die meisten tief im Inneren des Holzgehäuses verborgen waren, solche gewaltigen Töne entlocken konnten.
Die Prüfung fand am Ostersonntag statt und der Gottesdienst war wie immer sehr gut besucht. Aber diesmal hatten sich alle meine Klassenkameraden auf der Empore eingefunden, um mir zuschauen zu können. Fleischers Maxe war unter ihnen. Sie flüsterten miteinander, zeigten mit dem Finger auf mich und kicherten. Das war keineswegs geeignet, um meine Aufregung zu mindern.
Doch der Kantor hatte Mitleid mit mir und schickte sie mit der Bemerkung ‚Hier ist keine Zirkusveranstaltung‘ wieder nach unten zu ihren Eltern. Ich weiß noch, dass ich ihm dafür sehr dankbar war.
Der Gottesdienst selbst ging trotz meiner Ängste sehr gut über die Bühne. Ich machte keine großen Fehler, nur winzige, die der Kantor mit einem ebenso winzigen Schmunzeln quittierte. Als der letzte Ton des Nachspiels verklungen war, atmete ich auf. Dass nun noch der theoretische Teil folgte, bei dem ich unter anderem die Sonntage des Kirchenjahres in der richtigen Reihenfolge benennen und ein, zwei Fragen zur Konstruktion einer Orgel beantworten musste, das machte mir keine Angst. Ich wusste die Antworten im Schlaf und ich war mit dem Kantor im Inneren der Orgel herumgekrochen, hatte staunend seinen Erklärungen gelauscht, in fingerdünne Pfeifchen hineingeblasen und mit ihm über den piepsigen Ton gelacht und war schließlich mit Spinnweben und Staub bedeckt mit ihm wieder nach draußen geklettert.
Erst als der Pfarrer wohlwollend genickt und mir unter dem stolzen Blick des Kantors mit einer steif formulierten Gratulation die Hand schüttelte, begriff ich, dass die Prüfung bestanden war.
Nachdem sich die Tür hinter dem Pfarrer geschlossen hatte und der Kantor gerade nach ein, zwei passenden Worten suchte, fiel ich ihm um den Hals und gab ihm einen Kuss auf die nach Rasierwasser duftende, faltige Wange. Kurz spürte ich seine Umarmung und hörte sein geflüstertes „Gut gemacht, Hannah!“, da hatte ich ihn auch schon wieder losgelassen. Schamröte war mir ins Gesicht gestiegen. Ich war zwölf und so was tat man doch nicht!
Doch der Kantor strich mir noch einmal über den Scheitel und öffnete die Tür. „So, und jetzt raus mit dir“, befahl er. „Und genieße deine Ferien!“
Ich bin den ganzen Weg nach Hause gerannt, mit Galoppsprüngen von nie geahnter Höhe und Weite dazwischen. Mir war gewesen, als könnte ich fliegen.
Erschrocken fahre ich zusammen, als nach kurzem Klopfen die Tür geöffnet wird. Wer wohl heute zum morgendlichen Waschen kommt? Zuerst schiebt sich der obligatorische Wäschewagen ins Zimmer und wie üblich donnert er an den Türrahmen. Ob die es irgendwann mal lernen, das Ding hereinzubringen, ohne anzustoßen?
Der laute Rumms hat Frau Herzel geweckt, das Schnarchen bricht abrupt ab.
„Guten Morgen, meine Damen!“
Ah, das kann nur Karl sein. Karl hat Frühdienst, das wird ein schöner Tag. Ich lasse mich sogar hinreißen, ihm ein „Morgen“ zu antworten, und es gelingt wider Erwarten ganz gut.
Ich weiß noch, wie entsetzt ich gewesen bin, als er das erste Mal mit seinem Wagen ins Zimmer gekommen ist und verkündet hat, dass er mich waschen will. Er muss mir das angesehen haben, denn er hatte tröstend gemeint: „Nicht fürchten, ich will Sie nur waschen, nicht fressen.“
„Schieber!“, verlange ich flüsternd, als Karl eingetreten ist, denn ich kann es wirklich nicht mehr länger aushalten.
Er nickt, verschwindet aus dem Zimmer und kommt Sekunden später mit dem verlangten Utensil zurück. Mit geübten Handgriffen schiebt er es mir unter den kribbelnden Po. Der kalte Edelstahl auf der Haut lässt mich zusammenzucken.
Während er ein frisches Nachthemd aus meinem Schrank holt, pfeift Karl leise vor sich hin. „Na, wie geht’s meinem Herzel heute Morgen?“, ruft er zwischendurch zur Bettnachbarin hinüber.
Ich gluckse. Was für eine nette Anrede, ein schönes Wortspiel. Schade, dass Frau Herzel nicht antwortet, ich hätte gern gewusst, wie sie darauf reagiert. Sie scheint eine sehr mürrische Person zu sein. Oder sie hat es nicht gehört.
Karl holt den Schieber unter mir hervor und rollt mich zurück. Der Deckel klappert, dann bringt der Pfleger das Teil samt Inhalt nach draußen. Als er zurückkommt, verschwindet er im Bad. Wasser rauscht die Schüssel. Ich höre das typische Quetschgeräusch, wie immer, wenn er das Duschbad ins Wasser gibt. Inzwischen pfeift er ‚Wenn der weiße Flieder wieder blüht‘. Wundert mich nicht, mein Duschbad hat Fliederduft. Es ist von Beate, die mich letztes Wochenende besucht hat. Sie hat viele schöne Sachen mitgebracht, von denen sie weiß, dass ich sie mag. Bitterschokolade liegt in meinem Nachtschrank, fünf Tafeln. Leider kann ich sie allein nicht öffnen. Auch meine Nachttischlampe von zu Hause ist hier, aber ich kann den Schalter nicht erreichen. Bilder sind ebenfalls da, auf der Konsole über meinem Bett, Joachim mit seiner Familie und Beate bei ihrem Urlaub auf Korfu, in knappem Bikini. Meine Güte, das Mädel ist über fünfzig! Das war das Erste, was ich beim Anblick des Fotos dachte. Aber eine gute Figur hat sie, das muss man ihr lassen.
Wo war ich? Ach ja, die Mitbringsel von Beate. Mein geliebtes Fliederduschbad, zusammen mit der passenden Bodylotion und einem Fliederparfum.
Zu Hause hatte ich immer einige Stücke Fliederseife zwischen der Unterwäsche. Selbst gemachte. Das habe ich von meiner Großmutter gelernt, genauso wie Fliederöl machen, ein unverzichtbarer Inhaltsstoff ihrer Seife. Wenn sie ihren Seifentag hatte, roch das ganze Haus nach Flieder.
Seife zwischen die Wäsche zu legen, hat mich jedoch meine Mutter gelehrt. In ihrem Wäscheschrank lag immer Rosenseife und sie selbst, unsere Tischwäsche und Bettwäsche – alles roch penetrant nach Rosen. Ich hatte mir damals, als Mama gestorben war und ich mir die Wohnung so einrichtete, wie ich es wollte, ganz fest vorgenommen, dass ich niemals Rosenduft an meine Wäsche kommen lasse. Auch in meinem Garten hatten Rosen keinen Platz. Ich mochte die unauffälligen Blumen, zarte, die sich nicht so stolz der Sonne entgegenreckten, ich mochte Vergissmeinnicht und Cosmea, Ranunkeln und Löwenmäulchen. Kapuzinerkresse und Stiefmütterchen, die liebte ich. Stunden hatte ich in meinem grünen Paradies zugebracht. Immer gab es etwas zu zupfen, festzubinden, aufzusammeln. Erst wenn alles so war, wie ich es haben wollte, dann ließ ich mich in meinem bequemen Liegestuhl nieder und betrachtete zufrieden mein Werk. Und vermied den Blick auf Frau Schneiders Blauregen ...
Mit den Handtüchern über dem Arm und der vollen Waschschüssel in den Händen kommt Karl aus dem Bad zurück. Ich habe schon überlegt, wie alt er wohl ist. Schätze mal so Mitte vierzig, höchstens fünfzig. Aber er hat sich ein jugendliches Gemüt bewahrt, zeigt manchmal einen regelrechten Lausbubencharme, der Kerl. Mit ihm kann ich mich am besten unterhalten, denn er versteht es, seine Fragen so zu formulieren, dass mir eine Antwort mit Nicken oder Kopfschütteln möglich ist. Doch seit ein paar Tagen genügt ihm das nicht mehr. Seit er weiß, dass ich sprechen kann und mich nur schäme, weil es so undeutlich und laut ist, will er richtige Antworten. Und er ist derart hartnäckig, dass er mir schon Respekt abverlangt.
„Na, wie ist es, wollen Sie heute mal in den Rollstuhl?“, meint er gut gelaunt.
In den Rollstuhl? Ich habe doch gar keinen! Und außerdem – wie soll ich aus dem Bett kommen? Ich kann doch nicht laufen.
Karl lacht. „Sie sehen ja regelrecht verschreckt aus. Aber ganz im Ernst – möchten Sie es nicht mal probieren? Ihr Rollstuhl ist gestern am Nachmittag geliefert worden. Ein echter Mercedes!“ Er hebt anerkennend den Daumen und eine Augenbraue.
Staunend reiße ich die Augen auf. Ein Mercedes? Ich wusste gar nicht, dass die auch Rollstühle bauen ...
Karl hat inzwischen scheppernd mein Bettgitter heruntergelassen und drapiert das Handtuch um meinen Hals. Ich recke erwartungsvoll das Kinn.
„Nein, die Schonzeit ist vorbei. Ihre linke Hand bitte, Gnädigste.“ Streng, aber mit einer winzigen Portion Schalk in den Augen mustert er mich und hält mir demonstrativ den Lappen hin.
Das meint er tatsächlich ernst? Ich habe zwei lange Wochen hier und vorher im Krankenhaus und der Reha stoisch ertragen, dass mich jemand von oben bis unten abwäscht. Keiner hat mich gefragt, ob ich das will. Keiner hat sich dafür interessiert, ob ich nicht zumindest ein bisschen helfen kann. Ich habe mich schon damit abgefunden. Und jetzt hält mir dieser Schatz von einem Pfleger den Waschlappen hin und erlaubt mir, mich selbst zu waschen!
Gerade als er fragend die Augenbrauen hochzieht, schnappe ich ihm den Lappen weg und rubble mir das Gesicht ab. Tut das gut! Hinter den Ohren, wunderbar! Und der Hals!
„Nochmal!“, dröhne ich Karl entgegen und halte ihm beglückt den Waschlappen hin. Erst als ich schon wieder über mein Gesicht fahre, fällt mir auf, dass ich eben das erste Mal unaufgefordert gesprochen habe. Ich muss mich zurückhalten, um nicht vor Wonne zu grunzen.
Karl lacht, als er mir den Lappen wieder abnimmt. „Das hätten wir schon viel eher machen müssen“, raunt er dem kleinen schwarzen Teddybären zu, der vom Fußende meines Bettes aus das Geschehen verfolgt.
Der Übermut packt mich, ich strecke Karl die Zunge heraus. Ein bisschen schief, aber immerhin.
Als Dankeschön drückt Karl mir erneut den Lappen in die Hand und deutet auf meinen Bauch. Begeistert mache ich weiter und es geht wunderbar, bis er mir den Lappen wie einen Handschuh über die rechte Hand zieht und auffordernd nickt.
Natürlich klappt es mit der Rechten nicht so gut. Karl muss die Hand führen und der Lappen rutscht von ihr herunter, weil ich ihn nicht festhalten kann. Aber der Anfang ist gemacht und Karl übernimmt einfach den Rest. Morgen wird es schon besser gehen, ganz bestimmt.