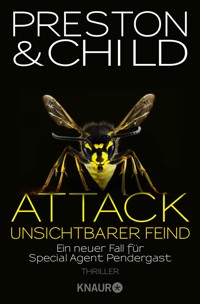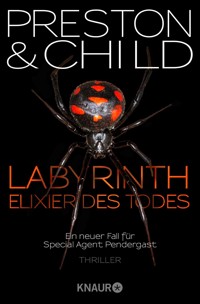9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
Ein Killer, der Köpfe sammelt: der 17. Fall für Special Agent Aloysius Pendergast - ein mitreißender Abenteuer-Thriller Nur nicht den Kopf verlieren, heißt es für Special Agent Aloysius Pendergast und Lieutenant Vincent D'Agosta: In New York treibt ein Serienkiller sein Unwesen, der die Köpfe seiner Opfer als Trophäen behält. Doch er hinterlässt kaum verwertbare Spuren, und die Ermordeten scheinen nichts gemeinsam zu haben – außer Geld, Macht und keinerlei Skrupel: Erst stirbt ein selbstverliebtes It-Girl, dann ein Mafia-Anwalt, ein Waffenhändler, ein Investmentbanker-Pärchen … Geht in New York ein Rächer um? Eine Welle der Hysterie stürzt die ganze Stadt ins Chaos. Mittendrin Agent Pendergast und Vincent D'Agosta, die kaum einen Schritt weiterkommen und nicht ahnen, dass die Motive des Killers finsterer sind als die neun Kreise der Hölle. Ebenso cool wie brillant, »eine Mischung aus Holmes und Bond« (Frankfurter Neue Presse) – das ist Special Agent Aloisius Pendergast, der Kult-Ermittler der amerikanischen Bestseller-Autoren Preston & Child. Im Thriller »Headhunt – Feldzug der Rache« löst Agent Pendergast seinen 17. Fall. Die komplette Thriller-Reihe im Überblick: - Relic – Museum der Angst - Attic – Gefahr aus der Tiefe - Formula – Tunnel des Grauens - Ritual – Höhle des Schreckens - Burn Case – Geruch des Teufels - Darc Secret – Mörderische Jagd - Maniac – Fluch der Vergangenheit - Darkness – Wettlauf mit der Zeit - Cult – Spiel der Toten - Fever – Schatten der Vergangenheit - Revenge – Eiskalte Täuschung - Fear – Grab des Schreckens - Attac – Unsichtbarer Feind - Labyrinth – Elixier des Todes - Demon – Sumpf der Toten - Obsidian – Kammer des Bösen - Headhunt – Feldzug der Rache - Grave – Verse der Toten - Ocean – Insel des Grauens
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Headhunt – Feldzug der Rache
Ein neuer Fall für Special Agent Pendergast
Aus dem Amerikanischen von Michael Benthack
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nur nicht den Kopf verlieren, heißt es für Special Agent Aloysius Pendergast und Lieutenant Vincent D'Agosta: In New York treibt ein Serienkiller sein Unwesen, der die Köpfe seiner Opfer als Trophäen behält. Doch er hinterlässt kaum verwertbare Spuren, und die Ermordeten scheinen nichts gemeinsam zu haben – außer Geld, Macht und keinerlei Skrupel. Geht im Big Apple ein Rächer um? Eine Welle der Hysterie stürzt die ganze Stadt ins Chaos. Mittendrin Pendergast und D'Agosta, die kaum einen Schritt weiterkommen und nicht ahnen, dass die Motive des Killers finsterer sind als die neun Kreise der Hölle.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
Epilog
Über die Autoren
Lincoln Child widmet dieses Buch seiner Frau Luchie.
Douglas Preston widmet dieses Buch Michael Gamble und Chérie Kusman.
1
Jacob ging schnell vor seinem kleinen Bruder, die Hände tief in die Hosentaschen geschoben, sein Atem hauchte in der frostigen Dezemberluft. Sein Bruder Ryan trug den Karton mit Eiern, den sie soeben in einem kleinen Lebensmittelgeschäft in der Nähe gekauft hatten – mit dem Geld, das sie ihrer Mutter aus dem Portemonnaie entwendet hatten.
»Erstens, weil der alte Knacker ein totaler Arsch ist«, sagte Jacob. »Zweitens, weil er ein rassistischer Arsch ist. Er hat die Nguyens angeschrien und ›Schlitzaugen‹ genannt, weißt du noch?«
»Ja, aber –«
»Drittens, weil er sich in der Kassenschlange im C-Town vorgedrängelt und mich wüst beschimpft hat, als ich ihm gesagt habe, das ist nicht fair. Du erinnerst dich doch noch daran, oder?«
»Ja, klar. Aber –«
»Viertens, er stellt in seinem Garten diese dämlichen Schilder mit Politsprüchen auf. Und weißt du noch, als er Foster mit einem Schlauch bespritzt hat, nur weil der durch seinen Garten gelatscht ist?«
»Jaa, aber …«
»Aber was?« Jacob drehte sich mitten auf der Straße um und starrte seinen jüngeren Bruder wütend an.
»… wenn er nun eine Waffe besitzt?«
»Er wird schon nicht zwei Jungs abknallen! Egal, wir sind längst wieder weg, bevor der verrückte alte Sack überhaupt spitzgekriegt hat, was passiert ist.«
»Vielleicht gehört er der Mafia an.«
»Wie bitte? Bei einem Namen wie Bascombe? Jaa, garantiert! Würde er Garguglio oder Tartglia heißen, würden wir das hier nicht machen. Er ist nur irgend so ’n alter Sesselpupser, dem man mal einen Denkzettel verpassen muss.« Plötzlich schaute er Ryan misstrauisch an. »Du willst dich doch wohl nicht drücken, oder?«
»Nein, nein.«
»Also gut. Auf geht’s.«
Jacob drehte sich um, ging die 84. Avenue entlang und bog dann in die 122. Straße. Dort ging er langsamer und betrat den Bürgersteig. Dabei bewegte er sich ganz locker, ein bisschen so, als mache er einen Abendspaziergang. Die Straße säumten überwiegend Einfamilienhäuser und Doppelhäuser, die typisch für das Wohnviertel hier in Queens waren. Weihnachtsbeleuchtung schmückte alle Häuser.
Er ging noch langsamer. »Schau dir das Haus des Alten an«, sagte er zu seinem Bruder. »Stockdunkel. Das einzige, in dem kein Licht brennt. Was für ein Grinch.«
Das Haus lag am Ende der Straße. Das Licht der Straßenlaternen, das durch die kahlen Bäume schien, warf ein Spinnennetz aus Schatten auf den gefrorenen Boden.
»Okay, wir schlendern hier lang, als wäre nichts passiert. Du machst den Karton auf, wir werfen ein paar Eier auf seinen Wagen, dann rennen wir um die Ecke und gehen einfach weiter.«
»Er wird wissen, dass wir’s gewesen sind.«
»Machst du Witze? Nachts? Außerdem hassen ihn alle Kids im Viertel. Die meisten Erwachsenen auch. Jeder hasst ihn.«
»Was, wenn er uns verfolgt?«
»Der alte Knacker? Der würde in null Komma nix einen Herzinfarkt kriegen.« Jacob kicherte. »Wenn wir die Eier hier auf seinen Wagen werfen, gefrieren die, und zwar auf der Stelle. Ich wette, er muss die Karre zehnmal waschen, nur um die Eier wieder abzubekommen.«
Jacob ging weiter auf dem Bürgersteig und näherte sich dem Haus. Mittlerweile bewegte er sich vorsichtiger. Aus einem der großen Fenster des Ranchhauses mit zwei Ebenen drang ein bläulicher Lichtschein: Bascombe sah fern.
»Da kommt ’n Wagen!«, sagte Jacob im Flüsterton. Sie versteckten sich in einem Gebüsch, als ein Fahrzeug um die Ecke bog und die Straße heruntergefahren kam. Die Scheinwerfer erhellten die gesamte Umgebung. Nachdem es vorbeigefahren war, spürte Jacob sein Herz schlagen.
Ryan sagte: »Vielleicht sollten wir doch nicht …«
»Halt die Klappe.« Er trat aus dem Gebüsch. Die Straße war heller erleuchtet, als ihm lieb war, was nicht nur an den Straßenlaternen lag, sondern auch an den Weihnachtsdekorationen – überall in den Vorgärten erleuchtete Weihnachtsmänner, Rentiere und Krippendarstellungen. Immerhin, Bascombes Haus war etwas dunkler.
Jetzt schlichen sie sich ganz langsam an, wobei sie sich im Schatten der am Straßenrand geparkten Pkws hielten. Bascombes Wagen, ein grüner Plymouth Fury, Baujahr 71, den er jeden Sonntag wusch und wachste, stand vor der Garage, so nahe am Haus wie möglich. Im Gehen sah Jacob die schemenhafte Gestalt des alten Mannes, der im Lehnstuhl saß und auf einen riesigen Flachbildschirm starrte.
»Halt. Er sitzt da vorne. Zieh die Mütze runter. Und die Kapuze tiefer. Und den Schal vors Gesicht.«
Sie richteten ihre Kleidung so lange, bis ihre Gesichter kaum noch zu erkennen waren, und warteten im Dunkeln zwischen dem Wagen und einem großen Busch. Die Sekunden tickten.
»Mir ist kalt«, beschwerte sich Ryan.
»Halt die Klappe.«
Sie warteten. Jacob wollte die Sache nicht durchziehen, solange der alte Mann im Sessel saß; dann hätte der nämlich bloß aufstehen und sich umdrehen müssen – und hätte sie entdeckt. Sie mussten abwarten, bis er hochkam.
»Er könnte die ganze Nacht da in seinem Sessel hocken.«
»Halt endlich die Klappe.«
Und dann stand der alte Mann auf. Das bläuliche Licht erhellte sein bärtiges Gesicht und die hagere Gestalt, als er am Fernseher vorbei in die Küche ging.
»Los!«
Jacob rannte zum Wagen, dicht gefolgt von Ryan.
»Mach ihn auf!«
Ryan klappte den Eierkarton auf, Jacob nahm ein Ei heraus. Ryan nahm auch eins, zögerte aber. Jacob warf sein Ei, was ein befriedigendes Platsch! auf der Windschutzscheibe verursachte, dann noch eins, und noch eins. Schließlich warf Ryan seine. Sechs, sieben, acht – sie schmissen die Eier auf die Windschutzscheibe, die Motorhaube, das Dach, die Seite. Wobei sie in ihrer Eile mehrere fallen ließen –
»Was zum Teufel!«, hörten sie jemanden brüllen. Bascombe kam aus dem Seiteneingang des Hauses gelaufen. Einen Baseballschläger schwingend, rannte er auf sie zu.
Jacob rutschte das Herz in die Hose, er schrie: »Lauf!«
Ryan ließ den Eierkarton fallen, drehte sich um – und rutschte sofort auf einer spiegelglatten, vereisten Fläche aus.
»Scheiße!« Jacob drehte sich um, packte Ryan am Mantel und riss seinen Bruder hoch. Doch mittlerweile stand Bascombe quasi über ihnen, mit dem Baseballschläger in Schlagstellung.
Sie rannten von der Einfahrt runter auf die Straße, Bascombe hinterher. Zu Jacobs Überraschung kriegte er allerdings keinen Herzinfarkt, und er fiel auch nicht tot um, sondern lief unerwartet schnell, holte sie womöglich sogar ein. Ryan fing an zu wimmern.
Hinter ihnen schrie Bascombe: »Ihr verfluchten Bengel, ich schlag euch die Köpfe ein!«
Jacob flitzte, dicht gefolgt von Ryan, um die Ecke auf die Hillside, vorbei an einigen Geschäften mit heruntergelassenen Rollläden und einem Baseballfeld. Aber der alte Knacker verfolgte sie immer noch, er schrie und hielt dabei den Baseballschläger hoch über den Kopf. Offenbar ging ihm aber langsam die Puste aus, denn er fiel ein wenig zurück. Vor ihnen erblickte Jacob das Gelände des von Maschendrahtzaun umgebenen Gebrauchtwagenhandels. Dort sollten im nächsten Frühjahr Wohnungen gebaut werden. Vor einiger Zeit hatten ein paar Kids ein Loch in den Zaun geschnitten. Er lief auf die Öffnung zu und kroch hindurch, Ryan immer noch dichtauf. Endlich fiel Bascombe zurück, immer noch lauthals Drohungen ausstoßend.
Hinter dem Gebrauchtwagenhandel befand sich ein Gewerbegebiet mit mehreren baufälligen Gebäuden. Jacob erspähte eine Werkstatt in der Nähe, mit einer Tür, an der die Farbe abblätterte, und einem zerborstenen Fenster an der Seite. Inzwischen war Bascombe nicht mehr zu sehen. Vielleicht hatte er das Loch im Zaun übersehen, aber Jacob hatte das Gefühl, dass er immer noch hinter ihnen her war. Sie mussten ein besseres Versteck finden.
Er versuchte, die Tür zu der Autowerkstatt zu öffnen – verriegelt. Vorsichtig schob er den Arm durch das kaputte Fenster, tastete nach dem Türknauf, drehte ihn von innen. Knarrend öffnete sich die Tür.
Er betrat die Werkstatt, Ryan hinter ihm. Behutsam schloss er die Tür und drehte das Riegelschloss.
Schwer atmend standen sie im Dunkeln. Jacob glaubte, ihm würde gleich die Lunge platzen, und versuchte, leise zu sein.
»Ihr Rotzlümmel!«, ertönte in der Ferne Bascombes schrille Stimme. »Euch werd ich’s zeigen!«
Es war dunkel in der Werkstatt, bis auf ein paar Scherben auf dem Boden war sie offenbar leer. Jacob fasste Ryan an der Hand und kroch auf allen vieren los. Sie benötigten ein Versteck, für den Fall, dass der alte Bascombe auf den Gedanken kam, hier nach ihnen zu suchen. Es war irre, aber es schien, als wollte der alte Knabe tatsächlich mit seinem Baseballschläger auf sie eindreschen. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erblickte Jacob im hinteren Teil der Werkstatt einen Laubhaufen – und zwar einen großen.
Er zog Ryan mit sich in die Richtung, wühlte sich in das Laub, legte sich auf die weiche Oberfläche und wischte mit den Händen herum, wodurch er die Blätter über sich und seinen Bruder verteilte.
Eine Minute verstrich. Noch eine. Inzwischen rief Bascombe nicht mehr nach ihnen – alles war still. Allmählich atmete Jacob wieder ruhiger, sein Selbstbewusstsein kehrte zurück. Nach ein paar weiteren Minuten begann er zu kichern. »Der alte Tattergreis, den haben wir abgehängt.«
Ryan schwieg.
»Hast du ihn gesehen? Er hat uns verfolgt, im Pyjama. Vielleicht ist ihm ja der Pimmel abgefroren.«
»Glaubst du, er hat unsere Gesichter erkannt?«, fragte Ryan mit zittriger Stimme.
»Bei den Mützen, Schals, Kapuzen?« Wieder kicherte er. »Die Eier sind bestimmt schon steinhart gefroren.«
Schließlich gestattete sich Ryan ein leises Lachen. »Ihr Rotzlümmel, euch werd ich’s zeigen!«, imitierte er die hohe, pfeifende Stimme des alten Mannes und den starken Queens-Akzent.
Sie lachten, erhoben sich langsam aus dem Laubhaufen, wischten sich die Blätter von den Klamotten. Plötzlich schnüffelte Jacob laut. »Du hast gefurzt!«
»Hab ich nicht!«
»Hast du doch!«
»Hab ich nicht! Wer’s gerochen hat, hat’s verbrochen!«
Jacob stutzte, schnüffelte aber immer noch. »Was riecht denn hier so?«
»Das ist kein Furz. Das ist … das ist krass.«
»Du hast recht. Das sind … ich weiß nicht, vergammelte Abfälle oder so was.«
Angeekelt trat Jacob einen Schritt zurück in das Laub und stolperte dabei über irgendetwas. Er streckte die Hand aus und stützte sich darauf ab, damit er nicht hinfiel, aber da hörte er, dass das Laub, unter dem er sich versteckt hatte, eine Art leises Seufzen von sich gab, und plötzlich war auch der Geruch, der über sie hinwegwehte, hundertmal übler als vorher. Jacob wich bereits taumelnd zurück, als er Ryan sagen hörte: »Guck mal, da ist eine Hand …«
2
Lieutenant Vincent D’Agosta, Commander der Detective Squad, stand im Flutlicht vor der Autowerkstatt in Kew Gardens, Queens, und sah den Kriminaltechnikern bei der Arbeit zu. Er war ziemlich sauer, weil er an seinem freien Tag noch so spät am Abend herausgeklingelt worden war. Der Leichenfund war um 23.38 Uhr gemeldet worden – nur zweiundzwanzig Minuten später wäre Lieutenant Pankhurst zum Tatort gerufen worden.
D’Agosta seufzte. Die Ermittlungen würden knifflig werden: eine junge Frau, enthauptet. In Gedanken entwarf er schon mögliche Schlagzeilen in der Boulevardpresse, in der Art von Leiche ohne Kopf in Oben-ohne-Bar gefunden, die berühmteste Überschrift in der Geschichte der Post.
John Caruso, der Leiter der Kriminaltechnik, tauchte aus dem grellen Licht auf und steckte sein iPad ein.
»Und? Was habt ihr gefunden?«, fragte D’Agosta.
»Dieses verdammte Laub. Ich meine, versuchen Sie mal, in diesem Durcheinander nach Haaren, Fasern, Fingerabdrücken, was auch immer zu suchen. Ist wie die Stecknadel im Heuhaufen.«
»Sie glauben, dass der Täter das gewusst hat?«
»Nee. Es sei denn, er hat früher mal bei der Spurensicherung gearbeitet. Ist bloß Zufall.«
»Kein Kopf?«
»Nein. Die Enthauptung hat aber nicht hier stattgefunden – kein Blut.«
»Todesursache?«
»Einzelner Schuss ins Herz. Großkalibriges Hochgeschwindigkeitsprojektil, ist mitten durchgegangen, von hinten nach vorn. Vielleicht finden wir ein paar Fragmente in der Wunde, aber wir haben keine Kugel gefunden. Und das Ganze ist auch nicht hier passiert. In Anbetracht der Kälte und so weiter würde ich schätzen, die Leiche wurde hier vor drei, vielleicht vier Tagen abgeladen.«
»Sexuelle Gewalt?«
»Bislang keine offensichtlichen Anzeichen. Wir müssen abwarten, bis der Rechtsmediziner die … Sie wissen schon … verschiedenen … untersucht hat.«
»Ja, klar«, sagte D’Agosta schnell. »Keine Papiere, nichts?«
»Null. Keine Dokumente, leere Taschen. Weiß, weiblich, vielleicht eins fünfundsechzig, schwer zu sagen, Anfang zwanzig, straffe Figur, offenkundig trainiert. Hat eine Dolce-und-Gabbana-Jeans angehabt. Und sehen Sie hier diese irren Sneakers, die sie trägt? Ich hab die eben im Netz recherchiert. Louboutin. Fast tausend Dollar.«
D’Agosta stieß einen leisen Pfiff aus. »Tausend-Dollar-Sneakers? Mamma mia.«
»Ja. Reiches weißes Mädchen. Ohne Kopf. Sie wissen doch, was das heißt, nicht wahr, Lieutenant?«
D’Agosta nickte. Die Medienleute würden in Kürze anrücken – und da waren sie auch schon, als hätte er sie per Gedankenübertragung herbeigerufen: Ein Kastenwagen von Fox 5 fuhr vor, dann noch einer, und dann ein Uber-Taxi mit niemand anderem darin als dem guten alten Bryce Harriman, dem Post-Reporter, der aus dem Auto stieg, als wäre er Mr. Pulitzer höchstpersönlich.
»Mist«, brummelte D’Agosta ins Funkgerät. Das galt dem Pressesprecher, Chang, aber der war ja bereits voll im Einsatz. Er stand an der Absperrung und redete wie üblich freundlich auf den Neuankömmling ein.
Caruso ignorierte den anschwellenden Chor hinter der Absperrung. »Wir arbeiten an einer Identifizierung und durchsuchen die Datenbanken mit den Vermissten.«
»Ich bezweifle, dass sie das Mädchen dort finden.«
»Man weiß ja nie bei so einem Mädchen. Kokain, Meth. Die könnte sogar eine Edelhure sein – alles ist möglich.«
D’Agosta nickte wieder. Seine schlechte Laune hatte sich ein wenig gelegt. Es handelte sich hier um einen Fall von großem öffentlichem Interesse. Das konnte man natürlich positiv oder negativ sehen, aber er hatte sich noch nie vor Herausforderungen gedrückt. Außerdem war er sich ziemlich sicher, dass der Fall ein Knaller werden würde. Wenn man denn bei etwas so Furchtbarem von Knaller sprechen konnte … Enthauptung, das hieß, dass es sich um einen geistesgestörten, perversen Täter handelte, den man leicht fassen konnte. Und wenn die junge Frau die Tochter reicher Eltern war, würde das bezüglich der Laborarbeiten zu einer Vorzugsbehandlung führen, sodass er sich vor diese ganzen Kleinscheißfälle drängeln konnte, die sich in den notorisch langsamen Forensiklabors des NYPD stapelten.
Die Leute von der Spurensicherung, alle bekleidet wie Chirurgen, setzten ihre Arbeit fort. Sie hockten da und dort mit krummen Rücken, schlurften herum wie übergroße weiße Äffchen, untersuchten die Blätter eines nach dem anderen, inspizierten den Betonboden der Werkstatt mit Lupen, bearbeiteten die Türgriffe und Fenster, nahmen Fingerabdrücke von den Glasscherben auf dem Boden. Sie beherrschten ihr Handwerk, und Caruso war sowieso der Beste. Auch sie ahnten, dass dies ein bedeutender Fall werden würde. Und weil es in jüngster Zeit so viele Skandale bezüglich der Laborarbeiten gegeben hatte, arbeiteten sie besonders sorgfältig. Und die beiden Jungs, die die Leiche gefunden hatten, waren noch gleich am Tatort vernommen worden, bevor man sie zu den Eltern entließ. In diesem Fall würden keine Abkürzungen vorgenommen werden.
»Weiter so«, sagte D’Agosta, versetzte Caruso einen leichten Schlag auf die Schulter und trat einen Schritt zurück.
Ihm war kalt geworden, deshalb beschloss er, am Maschendrahtzaun entlangzugehen, der das Gelände des ehemaligen Autohandels umgab, nur um sich zu vergewissern, dass man keine Stellen übersehen hatte, an denen der Täter sich Zugang verschafft hatte. Während er aus dem hell erleuchteten Gelände hinaustrat, war im Umgebungslicht zwar immer noch genügend zu erkennen, aber er schaltete trotzdem seine Taschenlampe ein. Im Gehen leuchtete er damit umher. Als er um die Ecke eines Gebäudes im hinteren Bereich bog und an einem Stapel plattgemachter Autos vorbeikam, erblickte er innerhalb – innerhalb! – der Umzäunung eine hockende Gestalt. Das war kein Cop, auch keiner aus seinem Team. Die Gestalt trug eine lächerlich dicke Daunenjacke mit einer Kapuze, viel zu groß für den Kopf, sodass sie aufragte wie ein Stück Ofenrohr.
»He! Sie da!« Die eine Hand am Holster seiner Dienstwaffe, mit der anderen die Taschenlampe haltend, lief D’Agosta auf die Gestalt zu. »Polizei! Stehen Sie auf, die Hände in Sicht!«
Mit erhobenen Händen stand die Gestalt auf. Wegen der pelzgesäumten Kapuze war das Gesicht völlig unkenntlich. Dann drehte sie sich zu D’Agosta um. Bis auf die zwei funkelnden Augen in der schwarzen Kapuze konnte er nichts erkennen.
Zu Tode erschrocken, zog er seine Waffe. »Was machen Sie hier? Haben Sie denn nicht das Absperrband gesehen? Weisen Sie sich aus!«
»Mein lieber Vincent, Sie können Ihre Waffe wieder einstecken.«
D’Agosta erkannte die Stimme sofort. Er senkte die Waffe und steckte sie zurück ins Holster. »Mein Gott, Pendergast, was machen Sie denn hier? Sie wissen doch, dass man sich erst ausweisen muss, bevor man an einem Tatort herumstochern darf.«
»Wenn ich schon mal hier bin, warum sollte ich da auf einen dramatischen Auftritt verzichten? Und was für ein Glück, dass gerade Sie mich gefunden haben.«
»Ja, genau. Sie haben echt Schwein. Ich hätte Ihnen auch eine Kugel in den Hintern jagen können.«
»Wie schrecklich, eine Kugel im Hintern. Sie erstaunen mich immer wieder mit Ihren fantasievollen Formulierungen.«
Einen Augenblick standen sie da und sahen einander an, dann zog D’Agosta einen seiner Handschuhe aus und streckte die Hand aus. Pendergast streifte seine schwarzen Lederhandschuhe ab, und sie gaben sich die Hand. Dabei packte D’Agosta Pendergasts Arm. Pendergasts Hand war kühl wie Marmor, er zog die Kapuze nach hinten und zeigte sein blasses Gesicht – die hellblonden Haare nach hinten gekämmt, die silbrigen Augen unnatürlich hell in dem schwachen Licht.
»Sie sagten, Sie müssen hier sein?«, fragte D’Agosta. »Ermitteln Sie?«
»Bei meinen Sünden, ja. Ich fürchte, meine Aktien sind, was das Bureau betrifft, ziemlich stark gefallen. Ich stecke gerade – wie drücken Sie das doch immer so kraftvoll aus? – vorübergehend voll in der Scheiße.«
»Stecken Sie tief in der Scheiße? Oder meinen Sie, Sie sind krassem Scheiß auf der Spur?«
»Genau. Krassem Scheiß.«
D’Agosta schüttelte den Kopf. »Wieso befasst sich das FBI mit dem Fall?«
»Einer meiner Vorgesetzten, der Stellvertretende Direktor Longstreet, hat die Hypothese aufgestellt, dass die Leiche möglicherweise aus New Jersey hierhergebracht wurde. Über die Bundesstaatsgrenze. Seiner Meinung nach könnte das organisierte Verbrechen etwas mit der Sache zu tun haben.«
»Das organisierte Verbrechen? Wir haben noch nicht mal Beweismaterial gesammelt. New Jersey? Was für ein Quatsch.«
»Ja, Vincent, auch ich fürchte, das sind alles Hirngespinste. Die nur ein Ziel verfolgen: Mir soll eine Lektion erteilt werden. Aber jetzt fühle ich mich eher wie Meister Lampe, der ins Dornendickicht geworfen wird, denn ich habe Sie hier gefunden, hier, wo Sie das Sagen haben. Genauso wie bei unserem ersten Zusammentreffen damals im Naturhistorischen Museum.«
D’Agosta brummelte irgendetwas Unverständliches. Er freute sich zwar, Pendergast zu treffen, doch er war gar nicht froh darüber, dass das FBI ebenfalls in dem Fall ermittelte. Außerdem sah Pendergast trotz des für ihn untypischen Plaudertons – der sich gezwungen anhörte – nicht gut aus, gar nicht gut: ultraschlank, fast abgemagert, das Gesicht eingefallen, dunkle Ringe unter den Augen.
»Ich bin mir durchaus bewusst, dass das hier keine begrüßenswerte Entwicklung ist«, sagte Pendergast. »Aber ich will alles tun, um Ihnen nicht im Weg zu stehen.«
»Kein Problem, Sie kennen ja das gespannte Verhältnis zwischen der New Yorker Polizei und dem FBI. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Tatort und stelle Sie allen vor. Oder möchten Sie sich lieber alles ungestört anschauen?«
»Wenn die Spurensicherung mit ihrer Arbeit fertig ist, würde ich mich freuen, mich einmal etwas umsehen zu dürfen.«
Doch Pendergast klang alles andere als freudig. Und er würde sich noch weniger freuen, wenn er erst einmal die drei Tage alte Leiche mit abgeschnittenem Kopf gesehen hatte.
»Wie ist der Täter auf das Gelände gekommen – und wieder heraus?«, fragte Pendergast, während sie gingen.
»Scheint mir ziemlich klar zu sein. Der Typ hatte einen Schlüssel zum hinteren Tor. Er ist auf das Gelände gefahren, hat die Leiche abgeladen und ist wieder weggefahren.«
Sie kamen vor der Werkstatt an und traten auf das grell erleuchtete Areal. Die Leute von der Spurensicherung waren fast fertig, packten gerade ihre Sachen zusammen.
»Woher stammt eigentlich das viele Laub hier?«, fragte Pendergast ziemlich desinteressiert.
»Wir glauben, die Leiche wurde auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks unter einem Haufen Laub versteckt und unter einer Plane festgezurrt. Die Plane wurde in einer Ecke zurückgelassen, das Laub und die Leiche vor der rückwärtigen Wand abgeladen. Wir befragen gerade die Nachbarn, um herauszufinden, ob einer von ihnen einen Pick-up oder einen anderen Kleinlaster auf dem Gelände gesehen hat. Bislang hatten wir noch kein Glück. In dieser Gegend herrscht viel Verkehr, Tag und Nacht.«
D’Agosta stellte Special Agent Pendergast seinen Detectives und Caruso vor. Keiner von ihnen gab sich besonders große Mühe, sein Missfallen über das Eintreffen des FBI zu verbergen. Pendergasts äußere Erscheinung war da auch nicht gerade hilfreich. Er sah aus, als wäre er gerade eben von einer Expedition in die Antarktis zurückgekehrt.
»Okay, Sie können«, sagte Caruso zu Pendergast, ohne ihn anzusehen.
D’Agosta betrat hinter Pendergast die Autowerkstatt, der sofort hinüber zur Leiche schlenderte. Das Laub war weggefegt worden, die Leiche lag auf dem Rücken. Zwischen den Schlüsselbeinen war eine sehr hervorstechende Austrittswunde zu erkennen, die zweifellos von einem Dum-dum-Hochgeschwindigkeitsgeschoss verursacht worden war. Das Herz war zerfetzt, der Tod musste auf der Stelle eingetreten sein. Selbst nach den vielen Jahren, in denen er in Mordfällen ermittelt hatte, war D’Agosta nicht so dickhäutig, dass er das tröstlich fand – im Tod eines so jungen Menschen konnte er keinen irgendwie gearteten Trost finden.
Er trat einen Schritt zurück, damit Pendergast sein Ding machen konnte, sah jedoch zu seinem Erstaunen, dass der Agent gar nicht seine übliche Nummer abzog, mit den Teströhrchen und der Pinzette und der Lupe, die quasi aus dem Nichts auftauchten, und dem endlosen Herumfummeln. Stattdessen ging er lediglich, fast ein wenig lustlos, um die Leiche herum und betrachtete sie aus verschiedenen Blickwinkeln, wobei er seinen langen, blassen Kopf ein wenig schräg hielt. Zweimal um die Leiche, dann dreimal. Bei der vierten Runde machte er sich nicht mal mehr die Mühe, zu verbergen, wie gelangweilt er war.
Er ging zurück zu D’Agosta.
»Na, irgendwas Auffälliges gefunden?«, fragte D’Agosta.
»Vincent, das hier ist wirklich eine Strafe. Bis auf die Enthauptung selbst sehe ich nichts, was diesen Mord auch nur im Geringsten interessant machen würde.«
Sie standen nebeneinander und betrachteten den Leichnam. Und dann hörte D’Agosta plötzlich, wie Pendergast leise Luft holte. Abrupt ging er in die Hocke, holte seine Lupe hervor und inspizierte damit den Betonboden in ungefähr einem halben Meter Entfernung von der Leiche.
»Was ist denn?«
Pendergast gab ihm keine Antwort, sondern nahm den schmutzigen Betonboden derart gründlich in Augenschein, als handelte es sich um das Lächeln der Mona Lisa. Jetzt ging er zur Leiche und holte eine Pinzette hervor. Er beugte sich über den durchtrennten Hals, bis sein Gesicht keine drei Zentimeter von der Wunde entfernt war, hielt die Pinzette unter die Lupe, bohrte sie in den Hals – D’Agosta musste sich leicht abwenden – und zupfte etwas daraus hervor, das wie ein Gummiband aussah, bei dem es sich aber offenbar um ein großes Blutgefäß handelte. Pendergast schnitt ein kurzes Stück davon ab und ließ es in ein Teströhrchen fallen, bohrte abermals ein wenig in dem Hals herum, zog ein weiteres Blutgefäß heraus und verstaute auch dieses. Und dann untersuchte er wieder minutenlang die riesige Wunde, wobei die Pinzette und die Teströhrchen fast ununterbrochen zum Einsatz kamen.
Schließlich richtete er sich auf. Seine gelangweilte Miene hatte sich ein wenig aufgehellt.
»Was ist denn?«
»Vincent, wie es scheint, haben wir es hier mit einem echten Problem zu tun.«
»Und wieso?«
»Der Kopf wurde genau hier vom Körper abgetrennt.« Er deutete nach unten. »Sehen Sie die winzige Kerbe dort im Boden?«
»Der Boden ist mit Kerben übersät.«
»Ja, aber in dieser habe ich ein kleines Stückchen Körpergewebe gefunden. Unser Mörder hat sich große Mühe gegeben, den Kopf abzutrennen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, aber das ist schwierig, und an irgendeinem Punkt ist er abgerutscht und hat diese winzige Kerbe verursacht.«
»Und wo ist dann das Blut? Ich meine, wenn der Kopf hier abgetrennt worden ist, müsste man doch wenigstens ein bisschen Blut finden.«
»Ah! Wir haben hier kein Blut gefunden, weil der Kopf erst viele, viele Stunden, vielleicht auch Tage, nachdem das Opfer erschossen worden war, abgeschnitten wurde. Die Frau war bereits an einem anderen Ort ausgeblutet. Sehen Sie sich mal die Wunde an!«
»Danach? Wie lange danach?«
»Nach der Retraktion dieser Blutgefäße im Hals zu urteilen, würde ich sagen, mindestens vierundzwanzig Stunden.«
»Sie meinen, der Mörder ist zurückgekommen und hat den Kopf vierundzwanzig Stunden danach abgeschnitten?«
»Möglicherweise. Oder wir haben es hier mit zwei Personen zu tun, die möglicherweise miteinander in Verbindung stehen oder auch nicht.«
»Zwei Täter? Was meinen Sie damit?«
»Die erste Person, die die Frau getötet und hier abgeladen hat, und die zweite … die die Frau gefunden und ihren Kopf mitgenommen hat.«
3
Lieutenant D’Agosta blieb nahe der Eingangstür der Villa am Riverside Drive 891 stehen. Anders als die Häuser ringsum, die mit bunter Weihnachtsbeleuchtung geschmückt waren, wirkte Pendergasts Domizil, auch wenn es sich angesichts des Alters in gutem baulichem Zustand befand, dunkel und scheinbar unbewohnt. Die fahle Wintersonne schien durch die dünne Wolkendecke und tauchte den Hudson, der hinter dem Schutzschirm der Bäume am West Side Highway lag, in fahles Morgenlicht. Es war ein kalter, deprimierender Wintertag.
D’Agosta holte tief Luft, trat unter das Schutzdach des Hauseingangs, ging die Stufen hinauf und klopfte an. Die Tür wurde erstaunlich schnell geöffnet, und zwar von Proctor, Pendergasts geheimnisumwittertem Chauffeur und Faktotum. D’Agosta erschrak ein bisschen, denn Proctor war seit ihrer letzten Begegnung stark abgemagert; normalerweise besaß er eine starke, ja sogar einschüchternde Ausstrahlung. Seine Miene war allerdings so ausdruckslos wie immer, und die Kleidung – Lacoste-Hemd und dunkle Slipper – auf untypische Weise lässig für einen Mann, der vermeintlich im Dienst war.
»Hallo, äh, Mr. Proctor –« D’Agosta wusste nie, wie er den Mann anreden sollte. »Ist Mr. Pendergast zu sprechen?«
»Er ist in der Bibliothek, folgen Sie mir.«
Doch er war nicht in der Bibliothek. Denn plötzlich erschien er im Refektorium, im üblichen makellosen schwarzen Anzug. »Vincent, herzlich willkommen.« Er streckte die Hand aus, D’Agosta schüttelte sie. »Legen Sie Ihren Mantel doch dort über den Stuhl.« Proctor ging zwar an die Haustür, um Gästen zu öffnen, bot einem aber niemals an, den Mantel abzunehmen. D’Agosta hatte schon immer das Gefühl, dass Proctor sehr viel mehr war als lediglich der Hausdiener und Chauffeur, doch worin genau seine Aufgaben bestanden und in welcher Beziehung er eigentlich zu Pendergast stand, dahinter war er noch nicht gekommen.
Er zog seinen Mantel aus und wollte ihn sich gerade über den Arm legen, als Proctor ihm diesen zu seiner nicht geringen Verwunderung abnahm. Während sie durch den Speisesaal in die Empfangshalle gingen, fiel D’Agostas Blick unwillkürlich auf das leere Marmorpodest, auf dem früher einmal eine Vase gestanden hatte.
»Ja, ich schulde Ihnen eine Erklärung.« Pendergast deutete auf das Podest. »Es tut mir sehr leid, dass Constance Ihnen mit der Ming-Vase einen Schlag auf den Kopf versetzt hat.«
»Mir auch.«
»Ich entschuldige mich, Ihnen nicht schon früher den Grund dafür genannt zu haben. Sie hat es getan, um Ihnen das Leben zu retten.«
»Okay. In Ordnung.« Aber die Geschichte ergab trotzdem keinen Sinn. Wie so vieles, das mit diesen verrückten Ereignissen in Zusammenhang stand. Er sah sich um. »Wo ist sie eigentlich?«
Pendergast machte ein ernstes Gesicht. »Fort.« Durch seinen eisigen Tonfall verbat er sich alle weiteren Fragen.
Eine peinliche Stille entstand, dann aber schien er milder gestimmt, und er streckte den Arm aus. »Kommen Sie mit in die Bibliothek und erzählen Sie mir, was Sie herausgefunden haben.«
D’Agosta folgte ihm durch die Empfangshalle in ein warmes, wunderschön möbliertes Zimmer. Dort flackerte ein Kaminfeuer. Dunkelgrüne Wände, Eichentäfelung und schier endlose Bücherborde mit alten Bänden. Pendergast zeigte auf einen Ohrensessel auf der einen Seite des Kamins, er selbst nahm auf der anderen Seite Platz. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ich nehme einen grünen Tee.«
»Hm, ein Kaffee wäre prima – wenn Sie welchen dahaben. Schwarz, zwei Stück Zucker.«
Proctor, der im Eingang zur Bibliothek stand, ging los. Pendergast lehnte sich im Sessel zurück. »Wie ich höre, haben Sie den Leichnam identifiziert.«
D’Agosta beugte sich im Sessel etwas nach vorn. »Das stimmt.«
»Und?«
»Na ja, zu meiner Überraschung haben wir einen passenden Fingerabdruck gefunden. Er ist fast sofort aufgetaucht – ich nehme an, weil die Frau digital erfasst wurde, als sie sich für das Global Entry System bewarb – Sie wissen schon, das Trusted-Traveler-Programm der Organisation der naturwissenschaftlichen und technischen Studentenschaft. Sie heißt Grace Ozmian, ist zweiundzwanzig Jahre alt, die Tochter von Anton Ozmian, dem Tech-Milliardär.«
»Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor.«
»Ozmian hat große Teile der Technologie erfunden, die Verwendung findet, um Musik- und Videomaterial zu streamen. Er ist der Gründer eines Unternehmens namens DigiFlood. Kindheit in ärmlichen Verhältnissen, aber er ist schnell aufgestiegen. Heute ist er steinreich. Jedes Mal, wenn eine Streaming-Software auf ein Gerät geladen wird, verdient seine Firma daran.«
»Und Sie sagen, es handelt sich um seine Tochter?«
»Genau. Ozmian ist Libanese in zweiter Generation und mit einem Stipendium aufs MIT gegangen. Grace wurde in Boston geboren, die Mutter starb bei einem Flugzeugabsturz, als sie fünf war. Sie ist in der Upper East Side aufgewachsen, hat Privatschulen besucht, schlechte Noten, hat nie gejobbt, hat das Studium abgebrochen und mit dem Geld des Vaters ein Jetset-Leben geführt. Hat vor ein paar Jahren auf Ibiza gelebt, dann Mallorca, ist aber vor rund einem Jahr nach New York zurückgekehrt und wohnt seitdem zusammen mit ihrem Vater im Time Warner Center. Ihm gehört da eine Neunzimmerwohnung – richtiger gesagt, drei Wohnungen, die zusammengelegt wurden. Ihr Vater hat die Tochter vor vier Tagen als vermisst gemeldet. Er hat der New Yorker Polizei die Hölle heißgemacht und vermutlich auch dem FBI, hat einen Haufen Beziehungen spielen lassen bei dem Versuch, seine Tochter zu finden.«
»Zweifellos.« Pendergast hob seine Teetasse an den Mund und trank einen Schluck. »Hatte die Tochter mit Drogen zu tun?«
»Möglicherweise. Es nehmen ja so viele junge Frauen – reiche wie arme – Drogen. Keine Akte, ein paarmal hat die Polizei sie in Gewahrsam genommen wegen Drogenkonsums und Erregung öffentlichen Ärgernisses, zuletzt vor einem halben Jahr. Bei einem Bluttest wurde Kokain in ihrem Körper nachgewiesen. Wurde aber kein einziges Mal angeklagt. Wir stellen gerade eine Liste von allen Leuten zusammen, mit denen sie bekannt war. Sie hatte einen ziemlich großen Bekanntenkreis, überwiegend Kinder reicher Eltern aus der Upper East Side und Eurotrash. Sobald der Vater benachrichtigt ist, werden wir ihren ›Freunden‹ gehörig auf den Zahn fühlen. Natürlich werden Sie über alles informiert.«
Proctor brachte die Tasse Kaffee.
»Sie meinen, der Vater weiß noch nicht Bescheid?«, fragte Pendergast.
»Äh, nein … wir kennen die Identität des Mädchens erst seit einer Stunde. Und das ist teilweise auch der Grund, warum ich hier bin.«
Pendergast hob die Brauen, ein Ausdruck des Missfallens trat in seine Gesichtszüge. »Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich einen Beileidsbesuch tätige?«
»Es geht nicht um einen Beileidsbesuch. Sie machen so etwas doch nicht zum ersten Mal. Es wäre Teil der Ermittlungen.«
»Ich soll diesem Milliardär die Nachricht überbringen, dass seine Tochter ermordet und enthauptet wurde? Nein, danke.«
»Schauen Sie, das ist nicht freiwillig. Sie müssen da hingehen. Sie sind beim FBI. Wir müssen dem Mann zeigen, dass wir intensiv in dem Fall ermitteln, und das Bureau auch. Wenn Sie nicht dabei sind, glauben Sie mir, wird Ihr Vorgesetzter davon erfahren – und das wollen Sie doch sicherlich nicht.«
»Mit Howard Longstreets Missfallen komme ich schon zurecht. Nur verspüre ich momentan keinerlei Verlangen danach, meine Bibliothek zu verlassen, um mich auf eine Trauerfall-Mission zu begeben.«
»Sie müssen die Reaktion des Vaters mit eigenen Augen sehen.«
»Halten Sie ihn für tatverdächtig?«
»Nein, aber der Mord könnte etwas mit seinen Geschäften zu tun haben. Ich meine, der Typ gilt als Weltklasse-Arschloch. Vielleicht hat er ja die falschen Leute verärgert, und die haben seine Tochter umgebracht, um es ihm heimzuzahlen.«
»Mein lieber Vincent, derlei ist nicht meine Stärke.«
D’Agosta war genervt. Sein Gesicht fühlte sich heiß an. Normalerweise ließ er Pendergast ja seinen Willen, aber diesmal lag er total falsch. Pendergast war doch meistens mühelos imstande, eine Situation richtig einzuschätzen – was war bloß los mit ihm? »Hören Sie, Pendergast, wenn Sie es nicht für die Ermittlungen tun wollen, dann tun Sie’s für mich. Ich bitte Sie als Freund. Ich kann da nicht allein hingehen, ich schaffe das einfach nicht.«
Einen langen Augenblick spürte er Pendergasts Blick auf sich ruhen. Dann aber griff der Agent nach seiner Teetasse, trank aus und stellte sie seufzend auf die Untertasse zurück. »Eine solche Bitte kann man wohl kaum abschlagen.«
»Prima.« D’Agosta stand auf, ohne seinen Kaffee angerührt zu haben. »Aber wir müssen uns beeilen. Diese Nervensäge von einem Reporter, dieser Bryce Harriman, schnüffelt dort herum wie ein Jagdhund. Die Nachricht kann jeden Augenblick an die Öffentlichkeit gelangen. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass Ozmian aus der Boulevardpresse vom Tod seiner Tochter erfährt.«
»Nun gut.« Pendergast wandte sich um. Plötzlich stand Proctor wie herbeigezaubert in der Tür zur Bibliothek.
»Proctor?«, sagte Pendergast. »Fahren Sie bitte den Wagen vor.«
4
Der alte Rolls-Royce Silver Wraith mit Proctor am Steuer – der in dem engen, von Fußgängern wimmelnden Labyrinth von Lower Manhattan enorm auffiel – zwängte sich durch einen Verkehrsstau auf der West Street und näherte sich der Firmenzentrale von DigiFlood, die in einem unter der Bezeichnung Silicon Alley bekannten Viertel lag. Der firmeneigene Komplex bestand aus zwei großen Gebäuden, die einen ganzen Straßenblock zwischen West Street, Hubert, North, Moore und Greenwich einnahmen. Bei dem einen handelte es sich um eine große ehemalige Druckerei aus dem 19. Jahrhundert, beim anderen um einen brandneuen Wolkenkratzer mit fünfzig Stockwerken. Aus beiden Gebäuden, dachte D’Agosta, musste man einen Wahnsinnsblick auf den Hudson und in die andere Richtung, die Skyline des südlichen Manhattan, haben.
D’Agosta hatte im Unternehmen angerufen und angekündigt, dass sie Anton Ozmian treffen wollten und dass es dabei um seine Tochter gehe. Und als sie jetzt in die Tiefgarage unter dem DigiFlood-Wolkenkratzer hineinfuhren, zeigte der Parkwächter, der mit Proctor redete, auf eine Parkbucht direkt neben dem mit OZMIAN 1 gekennzeichneten Platz. Noch bevor sie ausgestiegen waren, erschien ein Mann in dunkelgrauem Anzug.
»Meine Herren?« Er trat auf sie zu, schüttelte ihnen jedoch nicht die Hand, gab sich ganz geschäftsmäßig.
Pendergast zückte sein Ausweismäppchen und klappte es auf, D’Agosta tat das Gleiche. Der Mann musterte beide Ausweise, fasste sie aber nicht an.
»Mein Fahrer bleibt im Wagen«, sagte Pendergast.
»Wie Sie wünschen. Hier entlang, meine Herren.«
Sollte sich der Kerl fragen, warum ein Polizist und ein FBI-Agent in einem Rolls vorfuhren, so ließ er sich das jedenfalls nicht anmerken.
Sie betraten hinter ihm einen Privataufzug, der direkt an den Parkplatz angrenzte und den ihr Begleiter mit einem Schlüssel bediente. Mit leisem Zischen sauste der Lift in die Höhe, und binnen einer Minute waren sie im obersten Stockwerk angelangt. Flüsterleise öffnete sich die Tür, und sie betraten Räumlichkeiten, bei denen es sich offensichtlich um die Vorstandsetage handelte. Dominierende Materialien waren, wie D’Agosta sah, Mattglas, fein geschliffener schwarzer Granit und gebürstetes Titan. Der Raum wirkte geradezu Zen-artig in seiner Leere. Der Mann ging schnellen Schrittes voran, und sie folgten ihm durch einen großen Wartebereich, der wie die Brücke eines Raumschiffs gebogen war und zu einer Tür aus Birkenholz führte, die bei ihrem Näherkommen geräuschlos aufglitt. Dahinter befanden sich mehrere Vorzimmer, in denen Männer und Frauen saßen. Ihre Kleidung entsprach, wie D’Agosta vermutete, ganz dem Casual Chic von Silicon Valley: schwarze T-Shirts und Leinensakkos mit Slim-fit-Jeans und diesen spanischen Schuhen, die der letzte Schrei waren – wie hießen die noch gleich? Pikolinos.
Schließlich gelangten sie vor den Eingang zur, wie D’Agosta annahm, eigentlichen Höhle des Unternehmers. Wieder eine Doppelflügeltür aus Birkenholz, wobei diese so groß war, dass in den einen Flügel eine kleinere Tür eingelassen war, für das normale Kommen und Gehen.
»Meine Herren, bitte warten Sie hier einen Augenblick.« Der Mann verließ das Zimmer durch die kleinere Tür und schloss sie hinter sich.
D’Agosta warf Pendergast einen kurzen Blick zu. Durch die Tür erklang eine gedämpfte, in beherrschtem Zorn erhobene Stimme. D’Agosta konnte die einzelnen Worte zwar nicht verstehen, aber was sie bedeuteten, war auch so ziemlich klar – irgendein bedauernswerter Mensch bekam gerade einen gewaltigen Anschiss. Der Ton der Stimme stieg und fiel, als wollte der Sprechende eine Liste von Beschwerden aufzählen. Dann herrschte plötzlich Stille.
Kurz darauf öffnete sich die Tür. Ein Mann erschien – silberne Haare, groß, gutaussehend, makellos gekleidet. Er flennte wie ein Baby, sein Gesicht war nass vor Tränen.
»Und vergessen Sie nicht, ich mache Sie dafür verantwortlich!«, rief ihm eine Stimme aus dem Büro hinterher. »Wir streuen proprietären Quellcode übers gesamte Internet, und zwar dank dieses gottverdammten Insider-Leaks. Entweder Sie finden das verantwortliche Schwein, oder ich schmeiße Sie raus!«
Der Mann lief blindlings weiter und entschwand in den Wartebereich.
Wieder sah D’Agosta Pendergast kurz an, um festzustellen, wie der reagierte, aber es war nichts zu erkennen; seine Miene war so ausdruckslos wie immer. D’Agosta war froh darüber, dass Pendergast zu alter Form zurückgefunden hatte, wenigstens von außen betrachtet – das wie gemeißelte Gesicht so blass, als wäre es aus Marmor gehauen, die Augen besonders hell in dem kühlen natürlichen Licht, das den Raum erhellte. Allerdings war er dürr wie eine verdammte Vogelscheuche.
Der Anblick eines Mannes, dem man derart übel mitgespielt hatte, machte D’Agosta ein wenig nervös, sodass er im Geiste rasch seine äußere Erscheinung musterte. Seit der Heirat sorgte seine Frau Laura dafür, dass er doppelreihige Anzüge trug, und zwar nur von den besseren italienischen Herrenausstattern – Brioni, Ravazollo, Zegna –, dazu Hemden aus hundert Prozent Baumwolle von Brooks Brothers. Als »Uniform« konnte nur der einzelne Streifen am Revers gelten, der ihn als Lieutenant auswies. Laura hatte, das musste gesagt werden, wirklich erreicht, dass er sich zusammenriss, was seine Kleidung betraf, und seine braunen Polyester-Anzüge samt und sonders ausgemustert. Und D’Agosta hatte festgestellt, dass er sich in Millionärsklamotten sicher fühlte, auch wenn seine Kollegen witzelten, dass er im Doppelreiher ein bisschen wie ein Mafioso aussah. Was ihm im Grunde genommen gefiel. Er musste bloß aufpassen, dass er nicht seinen Chef, Captain Glen Singleton, übertrumpfte, der, wie das gesamte NYPD wusste, großen Wert auf ausgesucht feine Kleidung legte.
Wieder erschien ihr Begleiter. »Mr. Ozmian wird Sie jetzt empfangen.«
Sie traten nach ihm durch die Tür in ein großes, aber nicht riesiges Eckbüro, das Blicke nach Süden und Westen bot. Durch eines der Fenster sah man die kühlen, eleganten Seitenfassaden des Freedom Tower, scheinbar so nahe, dass D’Agosta glaubte, sie fast berühren zu können. Ein Mann trat hinter seinem großen Schreibtisch aus schwarzem Granit hervor, der aussah wie die Steinplatte eines Grabmals. Ozmian, schlank, hochgewachsen und asketisch wirkend, war sehr gutaussehend. Er hatte schwarzes, an den Schläfen ergrautes Haar, einen kurz geschnittenen, grau melierten Bart und trug eine Metallbrille. Bekleidet war er mit einem weißen Strick-Rollkragenpullover aus dicker Kaschmirwolle, schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen. Der monochromatische Effekt war extrem beeindruckend. Der Mann sah zwar nicht gerade aus wie jemand, der soeben einen Mitarbeiter abgekanzelt hatte, doch freundlich wirkte er auch nicht gerade.
»Das wurde aber auch Zeit«, sagte er und deutete zu einem Sitzbereich seitlich des Schreibtisches, was aber nicht als freundliche Aufforderung gemeint war, sondern als Befehl. »Meine Tochter ist seit vier Tagen verschwunden. Und endlich beehren mich zwei Behördenvertreter. Nehmen Sie Platz und setzen Sie mich über den Stand der Ermittlungen in Kenntnis.«
D’Agosta warf Pendergast einen Blick zu und sah, dass er gar nicht daran dachte, Platz zu nehmen.
»Mr. Ozmian«, sagte Pendergast, »wann haben Sie Ihre Tochter das letzte Mal gesehen?«
»Ich werde Ihnen das nicht noch einmal alles erzählen. Ich habe Ihnen die Geschichte doch schon ein halbes Dutzend Mal am Telefon –«
»Nur zwei Fragen, bitte.«
»Beim Abendessen. Vor vier Tagen. Hinterher ist sie mit Freunden ausgegangen. Und nicht wieder nach Hause gekommen.«
»Und wann genau haben Sie die Polizei gerufen?«
Ozmian seufzte. »Am nächsten Tag, so gegen zehn.«
»Waren Sie es nicht gewohnt, dass sie spät nach Hause kommt?«
»Nicht so spät. Was genau …«
Ozmians Miene wandelte sich. Er musste, dachte D’Agosta, irgendetwas in ihren Gesichtern gelesen haben. Der Typ war ziemlich helle. »Was ist denn? Haben Sie sie gefunden?«
D’Agosta atmete tief durch und wollte gerade etwas erwidern, als ihm Pendergast zu seinem großen Erstaunen zuvorkam.
»Mr. Ozmian«, sagte Pendergast in seinem ruhigsten, sanftesten Tonfall, »wir haben eine schlechte Nachricht: Ihre Tochter ist tot.«
Ozmian wirkte, als wäre er gerade eben angeschossen worden. Er taumelte etwas und musste sich an einer Stuhllehne festhalten, um nicht zu stürzen. Alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen, die Lippen bewegten sich, aber er brachte nur ein unverständliches Flüstern zustande. Er sah aus wie ein lebender Toter.
Als er abermals wankte, trat D’Agosta einen Schritt auf ihn zu und packte ihn am Arm und an der Schulter. »Sir, bitte setzen Sie sich.«
Ozmian nickte stumm und ließ sich von D’Agosta zu einem Stuhl führen. Der Mann fühlte sich leicht wie eine Feder an.
Fast unhörbar formten Ozmians Lippen das Wort »Wie?«.
»Sie ist ermordet worden«, sagte Pendergast, dessen Stimme immer noch ganz ruhig klang. »Ihr Leichnam wurde gestern Abend in einer leer stehenden Autowerkstatt in Queens aufgefunden. Wir konnten heute Morgen eine Identifizierung vornehmen. Wir sind gekommen, um Sie offiziell darüber zu informieren, ehe die Zeitungen die Geschichte bringen – was sie jeden Augenblick tun werden.« Obgleich Pendergast seine Sätze völlig emotionslos vorbrachte, gelang es ihm doch, tiefe Anteilnahme und Betrübnis zum Ausdruck zu bringen.
Wieder bewegten sich Ozmians Lippen. Mit erstickter Stimme fragte er: »Ermordet?«
»Ja.«
»Wie?«
»Man hat ihr ins Herz geschossen. Sie war auf der Stelle tot.«
»Geschossen? Erschossen?« Langsam kehrte die Farbe in Ozmians Gesicht zurück.
»In einigen Tagen wissen wir mehr. Ich fürchte, Sie haben die Aufgabe, die Leiche zu identifizieren. Wir begleiten Sie natürlich gerne dorthin.«
In Ozmians Zügen spiegelten sich Verwirrung und Entsetzen. »Aber … ermordet? Warum?«
»Die Ermittlungen sind erst wenige Stunden alt. Wie es aussieht, wurde Ihre Tochter vor mehreren Tagen getötet und ihr Leichnam in der Werkstatt zurückgelassen.«
Jetzt packte Ozmian die Stuhllehnen und erhob sich erneut. Seine Gesichtsfarbe war von Weiß zu Rosa gewechselt und wandelte sich nun in ein Feuerrot. Einen Augenblick lang stand er unschlüssig da und blickte von Pendergast zu D’Agosta und wieder zu Pendergast. D’Agosta merkte, dass der Mann seine Fassung wiedergewann. Wahrscheinlich würde er gleich in die Luft gehen.
»Ihr … Mistkerle.«
Stille.
»Wo war das FBI eigentlich in den vergangenen vier Tagen? Das war Ihr Fehler – Ihr Fehler!« Ozmian hatte den Satz im Flüsterton begonnen, zum Ende hin brüllte er die Worte. In seinen Mundwinkeln hatten sich winzige Speichelbläschen gebildet.
Pendergast unterbrach ihn ganz ruhig. »Mr. Ozmian, Ihre Tochter war vermutlich bereits tot, als Sie sie als vermisst gemeldet haben. Aber ich kann Ihnen versichern, dass alles getan wurde, um sie zu finden. Alles.«
»Ach, das sagt Ihr stümperhaften Schwachköpfe, Ihr lügnerischen Drecksäcke doch immer –« Er stockte. Es hörte sich fast so an, als hätte er einen allzu großen Bissen verschluckt. Er hustete und prustete, wurde fast violett im Gesicht. Vor Wut brüllend, trat er einen Schritt vor, griff sich von einem Glastisch in der Nähe eine schwere Skulptur, hob sie hoch und schmiss sie auf den Boden. Wankend ging er zu einem Whiteboard und kippte es um, stieß mit dem Fuß eine Lampe um, schnappte sich einen auf dem Schreibtisch stehenden Pokal aus Keramik und zerschmetterte diesen auf dem Glastisch; beides zersprang mit lautem Krachen. Ein wahrer Hagelschauer aus Glassplittern und Tonscherben ging auf den Granitboden nieder.
Woraufhin Pendergasts und D’Agostas Begleiter im dunklen Anzug ins Zimmer gelaufen kam. »Was geht hier vor?«, fragte er hektisch, als er völlig verdattert die Verwüstungen überall in dem Büro und seinen Chef derart in Rage erblickte. Dann schaute er entgeistert zu Ozmian, dann zu Pendergast und D’Agosta.
Sein Eintreten hatte irgendetwas in Ozmian ausgelöst, denn er hielt daraufhin in seinem Wutanfall inne und blieb schwer atmend mitten im Zimmer stehen. Eine kleine herumfliegende Glasscherbe hatte seine Stirn geritzt. Ein Blutstropfen trat aus der Wunde.
»Mr. Ozmian –«
Ozmian drehte sich zu dem Mann um und sagte in schroffem, aber ruhigem Tonfall: »Raus! Schließen Sie die Tür ab. Holen Sie Isabel. Niemand kommt hier rein außer ihr.«
Plötzlich brach Ozmian in Tränen aus, wobei seine hysterischen Schluchzer in Schüben kamen. Schließlich trat D’Agosta nach kurzem Zögern einen Schritt vor, packte Ozmian am Arm und half ihm abermals, sich auf den Stuhl zu setzen, wo er zusammensank, die Arme um den Oberkörper legte und vor und zurück schaukelte, schluchzte und nach Luft rang.
Ein, zwei Minuten später löste sich Ozmian allmählich aus seiner Verzweiflung. Er zog ein Taschentuch aus der Hosentasche, wischte sich sorgfältig das Gesicht trocken, sammelte sich einen langen Augenblick und saß schweigend da.
Mit tonloser Stimme sagte er schließlich: »Erzählen Sie mir alles.«
D’Agosta räusperte sich und übernahm das Gespräch. Er erklärte, dass zwei Jungen den Leichnam unter Laub versteckt in einer Autowerkstatt gefunden hätten und sich die Mordkommission des Falls umgehend angenommen habe. Er habe ein komplettes Spurensicherungsteam für die Ermittlungen bereitgestellt, unter Leitung des Besten seines Fachs, und fügte hinzu, dass inzwischen mehr als vierzig Detectives ermittelten. Die gesamte Mordkommission räume dem Fall höchste Priorität ein und arbeite mit dem FBI eng zusammen. D’Agosta trug so dick auf, wie er sich nur traute. Ozmian hörte mit gesenktem Kopf zu.
»Haben Sie schon irgendeine Idee, wer es getan haben könnte?«, fragte er, als D’Agosta zu Ende berichtet hatte.
»Noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wir werden die Person finden, die das getan hat, darauf gebe ich Ihnen mein Wort.« Er zögerte und fragte sich, wie er Ozmian sagen sollte, dass seine Tochter enthauptet worden war. Irgendwie brachte er es nicht fertig, dieses Detail in seine Erzählung einzubauen, aber vor dem Ende dieses Treffens musste er es zur Sprache bringen. Und was am schrecklichsten von allem war: Man würde Ozmian auffordern, eine Leiche ohne Kopf zu identifizieren – den Leichnam seiner Tochter. Dass es sich dabei um die Tochter handelte, wussten sie aufgrund der Fingerabdrücke, aber die Identifizierung war gesetzlich vorgeschrieben, auch wenn sie in diesem Fall unnötig und grausam war.
»Nachdem Sie den Leichnam identifiziert haben«, fuhr D’Agosta fort, »möchten wir Sie, falls Sie sich dazu imstande sehen, befragen – je früher, desto besser. Wir brauchen Namen und Kontaktinformationen der Freunde und Bekannten Ihrer Tochter. Wir werden Sie bitten, uns von möglichen Schwierigkeiten im Leben Ihrer Tochter sowie in Ihrem beruflichen und privaten Umfeld zu erzählen – alles, was möglicherweise mit dem Mord in Zusammenhang steht. So unangenehm diese Fragen auch sein werden, ich bin mir sicher, Sie verstehen, warum wir sie stellen müssen. Je mehr wir wissen, desto schneller können wir die verantwortliche Person oder die verantwortlichen Personen fassen. Selbstverständlich dürfen Sie einen Anwalt hinzuziehen, wenn Sie möchten, aber es ist nicht erforderlich.«
Ozmian zögerte. »Sofort?«
»Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir es vorziehen, Sie im Polizeipräsidium zu befragen. Nachdem Sie … die Identifizierung vorgenommen haben. Vielleicht heute Nachmittag – aber nur, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen.«
»Schauen Sie, ich … bin bereit, Ihnen zu helfen. Ermordet … O Gott, hilf mir …«
»Da wäre noch eine Sache«, sagte Pendergast mit leiser Stimme, was sogleich bewirkte, dass Ozmian innehielt. Er nahm die Hände vom Gesicht und sah Pendergast ängstlich an.
»Ja, was denn?«
»Sie sollten darauf gefasst sein, Ihre Tochter anhand körperlicher Merkmale zu identifizieren – Hautmale, Tätowierungen, OP-Narben. Oder anhand ihrer Kleidung und persönlicher Dinge.«
Ozmian blinzelte. »Ich verstehe nicht ganz.«
»Man hat Ihre Tochter enthauptet vorgefunden. Den Kopf haben wir noch nicht gefunden.«
Einen langen Augenblick sah Ozmian Pendergast fassungslos an. Dann schwenkte sein Blick zur Seite, suchte D’Agosta.
»Warum?«, flüsterte er.
»Eine Frage, die wir sehr gern beantwortet hätten«, sagte Pendergast.
Ozmian blieb zusammengesunken auf dem Stuhl sitzen. Schließlich sagte er: »Geben Sie meinem Assistenten auf dem Weg nach draußen die Adresse des Leichenschauhauses und den Ort, an dem Sie mich befragen wollen. Ich werde um vierzehn Uhr dort sein.«
»Wie Sie wünschen«, sagte Pendergast.
»Und jetzt lassen Sie mich bitte allein.«
5
Marc Cantucci riss es aus dem Schlaf, gerade als das Flugzeug in seinem Traum kurz davor war, ins Meer zu stürzen. Er lag im Dunkeln, und sein rasendes Herz begann langsamer zu schlagen, während die vertraute und behagliche Umgebung seines Schlafzimmers rings um ihn herum Gestalt annahm. Er hatte diesen immer gleichen Traum gründlich satt, in dem er in einem von Terroristen entführten Flugzeug saß. Diese waren ins Cockpit eingedrungen und hatten die Tür abgeschlossen. Augenblicke später kippte die Maschine ruckartig nach vorn und ging bei voller Schubkraft in einen übelkeitserregenden Sturzflug auf die ferne, stürmische See über, während er durchs Fenster beobachtete, wie das schwarze Wasser immer näher auf ihn zuraste, und wusste, dass das Ende unvermeidlich war.
Er lag im Bett und überlegte, ob er das Licht einschalten und ein bisschen lesen oder lieber versuchen sollte, wieder einzuschlafen. Wie spät war es eigentlich? Im Zimmer war es sehr dunkel, und die Rollläden aus Stahl vor den Fenstern waren heruntergelassen, sodass er unmöglich wissen konnte, wie spät es war. Er griff nach seinem Handy, das er stets auf dem Nachttisch liegen hatte. Wo steckte es bloß? Er konnte keinesfalls vergessen haben, es dort abzulegen. Seine Gewohnheiten waren so verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk. Aber vielleicht hatte er das Handy doch verlegt, denn es war tatsächlich nicht zur Hand.
Jetzt war er zu verärgert, um wieder einschlafen zu können, setzte sich auf, schaltete die Nachttischlampe ein und suchte nach dem Handy. Er warf die Bettdecke beiseite, stieg aus dem Bett und ging schließlich zum stummen Diener, auf den er seine Hose und das Sakko gehängt hatte. Eine rasche Durchsuchung ergab, dass das Handy sich auch nicht in den Taschen befand. Das war allmählich mehr als ärgerlich.
Er besaß keinen Wecker, aber die Alarmanlage war mit einer Uhr mit LCD-Anzeige ausgestattet, deshalb ging er dorthin und schob die Abdeckung zur Seite. Und da erlebte er eine höchst unliebsame Überraschung: Die Alarmeinheit war dunkel, der LCD-Monitor schwarz, das alarmaktivierte Lämpchen aus. Und das, obwohl der Strom im Haus noch an war und die Videoüberwachungsanlage neben der Alarmeinheit nach wie vor funktionierte. Sehr seltsam.
Zum ersten Mal verspürte Cantucci ein wenig Angst. Die Alarmanlage war das Beste und Neueste, was es zu kaufen gab. Sie war nicht nur fest ins Haus installiert, sondern verfügte darüber hinaus über eine eigene Stromversorgung und nicht weniger als zwei Back-ups für den Fall eines Stromausfalls oder technischer Probleme. Hinzu kamen Festnetz, Handy und Satellitenverbindungen mit der Zentrale der Sicherheitsfirma. Aber es war unbestreitbar – die Alarmanlage funktionierte nicht.
Cantucci, der ehemalige Generalstaatsanwalt des Bundesstaates New Jersey, der die kriminelle Familie der Otrantos zur Strecke gebracht hatte, ehe er selbst als Mafiaanwalt die rivalisierenden Bonifacci vertreten und mehr Racheblutschwüre anwaltlich betreut hatte, als er zählen konnte, machte sich natürlich Sorgen um seine Sicherheit.
Der Bildschirm der Überwachungsanlage funktionierte einwandfrei, er zeigte wie immer in einer automatischen Endlosschleife die Bilder sämtlicher Kameras im Gebäude. Es gab derer fünfundzwanzig, fünf auf jedem Stockwerk in dem Brownstone-Haus in der East 66. Street, in dem er allein wohnte. Er hatte zwar einen Leibwächter, der tagsüber mit ihm im Haus wohnte, aber das Haus verließ, sobald sich die stählernen Rollläden allabendlich um 19 Uhr automatisch senkten, wodurch das Haus in eine uneinnehmbare Miniaturfestung verwandelt wurde.
Und während er den Bildern zuschaute, die die Überwachungskameras aus jedem Stockwerk zeigten, erblickte er mit einem Mal etwas Bizarres. Er drückte eine Taste, um den Durchlauf zu stoppen, und starrte erschrocken auf das Bild. Die betreffende Kamera deckte den Eingangsflur des Hauses ab – und zeigte einen Eindringling. Einen Mann im schwarzen Turnanzug, mit einer schwarzen Gesichtsmaske. Er hielt einen Bogen aus verstärktem Karbon und vier Pfeile in den Händen. Ein fünfter Pfeil war in den Bogen gespannt, den er so vor sich hertrug, als wollte er den Pfeil im nächsten Augenblick abschießen. Der Schweinehund hielt sich offenbar für Batman und Robin Hood in einem.
Das war scheißverrückt. Wie war der Kerl an den stählernen Rollläden vorbeigekommen? Und wie war er ins Haus gelangt, ohne einen Alarm auszulösen?
Cantucci drückte den Panik-Button, der aber natürlich nicht funktionierte. Und sein Handy war auch weg – ein Zufall? Er griff nach einem Festnetztelefon in der Nähe und hielt den Hörer ans Ohr. Tot.
Während der Mann aus dem Blickfeld der Überwachungskamera verschwand, drückte Cantucci die Taste für die nächste Kamera. Ah, wenigstens die Videoüberwachungsanlage funktionierte.
Jetzt, wo er darüber nachdachte, fragte er sich, warum der Mann nicht auch diese deaktiviert hatte.
Die Gestalt ging Richtung Aufzug. Cantucci sah, wie sie davor stehen blieb, eine ihrer schwarz behandschuhten Hände ausstreckte und eine Taste drückte. Er hörte das Brummen der Mechanik, während der Lift aus seiner Position in der vierten Etage, wo sich Cantuccis Schlafzimmer befand, ins Erdgeschoss hinabfuhr.
Cantucci meisterte seine Furcht sofort. Sechsmal hatte man bereits versucht, ihn umzubringen; alle Versuche waren fehlgeschlagen. Dieser Mordversuch war der bislang irrste, aber auch der würde scheitern. Der Strom war noch eingeschaltet. Mit einem Knopfdruck könnte er den Aufzug stoppen, sodass der Mann in der Falle saß – aber nein. Nein.
Rasch streifte sich Cantucci einen Bademantel über, zog die Schublade des Nachttisches auf und holte eine Beretta M9 sowie ein zusätzliches Fünfzehn-Schuss-Magazin daraus hervor, das er in die eine Tasche seines Bademantels steckte. In der Pistole befand sich zwar bereits ein volles Magazin, mit einem Projektil in der Kammer – so bewahrte er die Waffe immer auf –, aber er checkte das trotzdem. Alles gut.
Leise, aber schnell trat er aus dem Schlafzimmer in den davor befindlichen schmalen Flur und stellte sich vor dem Aufzug auf. Jetzt fuhr dieser wieder herauf. Cantucci hörte das Brummen der Maschinenanlage, während die Zahlen aufleuchteten und anzeigten, auf welcher Etage sich der Lift befand: drei … vier … fünf.
Cantucci wartete in Feuer-frei-Position, bis er hörte, dass der Aufzug zum Stehen kam. Und dann feuerte er, bevor die Tür sich öffnen konnte, durch diese hindurch, wobei die großen Neun-Millimeter-Projektile den dünnen Stahl derart durchschlugen, dass noch jede Menge Zerstörungskraft auf der anderen Seite übrig blieb. Der Lärm war ohrenbetäubend in dem beengten Raum. Cantucci zählte die Schüsse, schnell, aber präzise – ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs –, wobei er kreuz und quer und nach unten zielte, sodass er die Person, die sich im Aufzug befand, mit hundertprozentiger Sicherheit traf. Außerdem hatte er so noch jede Menge Munition übrig, um das Ganze zu Ende zu bringen, sobald die Tür aufging.
Die Tür glitt auf. Zu Cantuccis großem Schreck war der Aufzug leer. Er ging hinein und gab zwei Schüsse nach oben durch die Decke ab, um den Kerl, der sich möglicherweise da oben versteckte, zu erwischen, dann drückte er die STOPP-Taste, wodurch der Aufzug auf dieser Etage feststeckte und nicht mehr benutzt werden konnte.
Verdammte Scheiße. Es gab noch eine andere Möglichkeit, wie der Killer bis hinauf in seine Etage gelangen konnte: über die Treppe. Der Mann war mit Pfeil und Bogen ausgerüstet, Cantucci andererseits besaß eine Handfeuerwaffe – und konnte hervorragend damit umgehen. Schnell fasste er einen Entschluss: Warte nicht, geh zum Angriff über. Die Treppe war schmal, auf jedem Stockwerk befand sich ein Treppenabsatz – ein ziemlich schlechtes Umfeld, um einen Pfeil abzuschießen, aber ideal für den Einsatz einer Handfeuerwaffe auf kurze Distanz.
Natürlich konnte es sein, dass auch der Eindringling eine Handfeuerwaffe besaß, aber wie es aussah, wollte er unbedingt seinen Bogen zum Einsatz bringen. Wie auch immer, Cantucci wollte keinerlei Risiko eingehen.