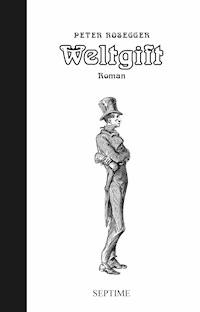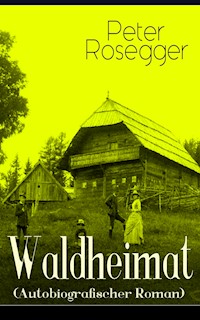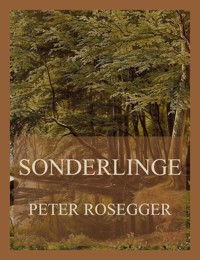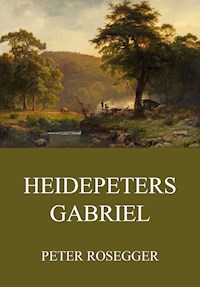
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Titelheld hungert nach Bildung, die er in seiner sehr ländlichen Heimat nur selten antrifft. So zieht er in die Stadt, wird Lehrer und versucht nach seiner Heimkehr das Gelernte weiterzugeben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heidepeters Gabriel
Peter Rosegger
Inhalt:
Peter Rosegger – Biografie und Bibliografie
Heidepeters Gabriel
I. Buch - Die Einöde
Ein Besuch in später Nacht
Der Hirsch an der Wand
In der Einöde
Nach zehn Jahren
Morgendämmerung in einer jungen Seele
Eine Christenlehre in der Einöde
Gabriel geht davon
Auf der Gant
Der junge Haberturm will was
Haus- und heimatlos
Zutiefst in der Einöde
Ein Morgen im Walde
Stürmische Zeit
Es will finster werden auf der Welt
II. Buch - Das Daheim
Sie gehen ins stille Dorf hinein
Wer die Leut' nur sind, und was sie wollen!
Sie wandern in den Wald hinaus
Im Neste des Waldsing
Das Blümchen wollt' er entfalten
Die Binde wieder trocken
»Gott grüße Sie in unserem Hause!«
Bei Mildau an der Tafel
»Mägdlein, die Himmelslieder spielst nur du!«
Anna, werden Sie mein Weib!
Ein heißer Gang unter den Flocken
Willkommen, Professor
Waldsings Hochzeitstag
Der Abend
Wie sie Honigwochen hielten
Ein Schatten im sonnigen Tag
Der Annenhof
Arm in Arm mit Gott
Was lieben heißt und glücklich sein
Mir graut inmitten meiner Lust!
Allzu glücklich sein – es kann nicht taugen
Dies ist der Tag von Gott gemacht!
Die Geliebte im Tode
Die Liebende nach dem Tode
Heidepeters Gabriel, P. Rosegger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849653071
www.jazzybee-verlag.de
Peter Rosegger – Biografie und Bibliografie
Namhafter österr. Volksschriftsteller, geb. 31. Juli 1843 in Alpl bei Krieglach in Obersteiermark als Sohn armer Bauersleute, verstorben am 26. Juni 1918 in Krieglach. Erhielt nur den notdürftigsten Unterricht und kam, weil er für einen Alpenbauer zu schwach war, mit 17 Jahren zu einem Wanderschneider in die Lehre, mit dem er mehrere Jahre lang von Gehöft zu Gehöft zog. Dabei kaufte und las er, von Bildungsdrang getrieben, Bücher, namentlich den »Volkskalender« von A. Silberstein, dessen Dorfgeschichten ihn so lebhaft anregten, daß er selbst allerlei Gedichte und Geschichten zu schreiben anfing. Durch Vermittelung des Redakteurs der Grazer »Tagespost«, Svoboda, dem R. einige Proben seines Talents zusandte, ward ihm endlich 1865 der Besuch der Grazer Handelsakademie ermöglicht, an der er bis 1869 seiner Ausbildung oblag; später wurde ihm zu weitern Studien vom steirischen Landesausschuß ein Stipendium auf drei Jahre bewilligt. Er ließ sich dauernd in Graz nieder, wo er seit 1876 die Monatsschrift »Der Heimgarten« herausgibt, und wo der freundschaftliche Verkehr mit Hamerling, der auch seinen Erstling mit einem Vorwort in die Literatur einführte, auf seine Bildung bestimmend einwirkte. Seiner ersten Veröffentlichung: »Zither und Hackbrett«, Gedichte in obersteirischer Mundart (Graz 1869, 5. Aufl. 1907), folgten: »Tannenharz und Fichtennadeln«, Geschichten, Schwänke etc. in steirischer Mundart (das. 1870, 4. Aufl. 1907), dann fast jährlich gesammelte Schilderungen und Erzählungen, die vielfach aufgelegt wurden (meist Wien), nämlich: »Das Buch der Novellen« (1872–86, 3 Bde.); »Die Älpler« (1872); »Waldheimat«, Erinnerungen aus der Jugendzeit (1873, 2 Bde.); »Die Schriften des Waldschulmeisters« (1875); »Das Volksleben in Steiermark« (1875, 2 Bde.); »Sonderlinge aus dem Volk der Alpen« (1875, 3 Bde.); »Heidepeters Gabriel« (1875); »Feierabende« (1880, 2 Bde.); »Am Wanderstabe« (1882); »Sonntagsruhe« (1883); »Dorfsünden« (1883); »Meine Ferien« (1883); »Der Gottsucher« (1883); »Neue Waldgeschichten« (1884); »Das Geschichtenbuch des Wanderers« (1885, 2 Bde.); »Bergpredigten« (1885);»Höhenfeuer« (1887); »Allerhand Leute« (1888); »Jakob der Letzte« (1888); »Martin der Mann« (1889); »Der Schelm aus den Alpen« (1890); »Hoch vom Dachstein« (1892); »Allerlei Menschliches« (1893); »Peter Mayr, der Wirt an der Mahr«, (1893); »Spaziergänge in der Heimat« (1894); »Als ich jung noch war« (Leipz. 1895); »Der Waldvogel«, neue Geschichten aus Berg und Tal (das. 1896); »Das ewige Licht« (das. 1897); »Das ewig Weibliche. Die Königssucher« (Stuttg. 1898); »Mein Weltleben, oder wie es dem Waldbauernbuben bei den Stadtleuten erging« (Leipz. 1898); »Idyllen aus einer untergehenden Welt« (das. 1899); »Spaziergänge in der Heimat« (das. 1899); »Erdsegen. Vertrauliche Sonntagsbriefe eines Bauernknechtes«, Kulturroman (das. 1900); »Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben« (das. 1901); »Sonnenschein« (das. 1901); »Weltgift« (das. 1903); »Das Sünderglöckel« (das. 1904); »J. N. R. J. Frohe Botschaft eines armen Sünders« (das. 1904; neu bearbeitete Volksausgabe 1906); »Wildlinge« (das. 1906). Diese Werke erschienen auch mehrmals gesammelt (zuletzt in Leipzig). In steirischer Mundart veröffentlichte R. noch: »Stoansteirisch«, Vorlesungen (Graz 1885, neue Folge 1889; 4. Aufl. 1907); ferner in hochdeutscher Sprache: »Gedichte« (Wien 1891), das Volksschauspiel: »Am Tage des Gerichts« (das. 1892), »Persönliche Erinnerungen an Robert Hamerling« (das. 1891) und »Gute Kameraden, Erinnerungen an Zeitgenossen« (das. 1893). Genaue Kenntnis des Dargestellten, Gemüt und Humor zeichnen die Erzählungen Roseggers aus; seine Stärke liegt in der kleinen Form der Skizze und kurzen Erzählung; in eine Reihe solcher hübschen kleinen Bilder zerfallen auch die besten seiner größern Romane, wie »Jakob der Letzte«, »Der Waldschulmeister«. Vgl. Svoboda, P. K. Rosegger (Bresl. 1886); Ad. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart (Dresd. 1895); O. Frommel, Neuere deutsche Dichter in ihrer religiösen Stellung (Berl. 1902); Hermine und Hugo Möbius, Peter R. (Leipz. 1903); Seillière, R. und die steirische Volksseele (deutsch von Semmig, das. 1903); Kappstein, Peter R., ein Charakterbild (Stuttg. 1904); Latzke, Zur Beurteilung Roseggers (Wien 1904).
Heidepeters Gabriel
Eine Geschichte aus der Steiermark
I. Buch - Die Einöde
Ein Besuch in später Nacht
Auf dem Rasenplatz vor dem Heidehause liefen Leute herum in großer Verwirrung.
»Schlagt ihn tot! Schießt ihn nieder! Werft ihm den Schädel ein!« riefen sie und zerrten Stangen herbei und haschten nach Steinen und stürmten im Hause umher nach einem Gewehr.
Den Kettenhund wollten sie umbringen.
An der Hausecke unter dem breiten Dache stand der Holzkobel, und an diesen war das Tier gefesselt. Mit aller Kraft riß und rasselte es an der Kette und stöhnte und winselte dabei. Es lechzte, es schnappte um sich in die Luft hinein, es wand und wälzte sich, es zerrte mit den Vorderpfoten an den Ohrläppchen und kratzte im Sand und rieb den Kopf an dem Boden und schnappte fort und fort um sich. Der kleine Gabriel hatte beim Fenster herausgesehen, weil gerade Zapfenwirts Davidl vorüberhopste; da sah er an dem Hunde das seltsame Gebaren. Der Knabe lief hinaus und wollte das ihm sonst so anhängliche Tier streicheln, aber klapps, biß es ihn in den Schenkel, daß das Blut durch das Höslein rann. Ganz kleinlaut kam er zurück in die Stube. Darauf gewahrte es auch seine Mutter, die Heidepeterin, und sie sagte zum Knecht:
»Was hat denn heut' der Waldl? Gar den Buben hat er 'bissen.«
Der Knecht schlug sogleich einen wahnsinnigen Lärm und lief zu den Nachbarn, und die Nachbarn machten neuen Lärm und liefen wieder zu anderen Nachbarn, und so kamen nach und nach die Leute zusammen vor dem Heidehause und schrien:
»Wütend ist das Best! Nur gleich totschlagen, niederschießen!«
»Die Hundswut!« kreischten die Weiber.
»Peterin, habt's denn keine Büchsen im Haus?« lärmte ein Bauer durch das Gehöft.
Die Peterin hörte ihn kaum, sie hatte den kleinen Gabriel in einen Wasserkübel gestellt, und in wahrer Todesangst wusch sie die Bißwunde am Schenkel.
Der Heidepeter kam vom Walde heim.
– Was denn heut' bei mir so viel Leut' herumrennen? 's ist doch 'leicht nichts geschehen! – dachte er bei sich, da hörte er schon:
»Der Hund ist wütend!«
Der Peter sah dem Tier eine Weile zu und lehnte dann langsam seine Holzart an die Wand. Der Heidepeter überstürzte sich nie in etwas. Schon kam der Hahnenkamp mit einer Flinte dahergeeilt, da sagte der Peter ruhig:
»Was willst denn, Steffel, wirst mir doch meinen Haushund nicht niederschießen! Ist gar kein' Red', daß er die Wasserscheu hat, da tat' er ganz anders ausschauen.«
Darauf nahte er sich dem winselnden, keuchenden Tier, das unablässig die Pfote an das Ohrläppchen schlug.
»Nu, mein Waldl, was hast denn heut'? Bist ja sonst ein gescheites Tier, 's muß dich was beißen; halt' still!« sagte er zum Hund und untersuchte das Halsband und die Ohren. »Aha, da haben wir's!« rief er plötzlich und hielt einen glimmenden Feuerschwamm in der Hand. »Das Ding da ist ihm im Ohr gesteckt.« – Das Tier war einen Augenblick ruhig, dann sprang es seinem Herrn freudig bellend an die Brust und wedelte mit dem Schweif.
Hinter der Tannengruppe, die in der Nähe des Hauses stand, brach jetzt ein Gekreische los. Der Heidepeter hörte es; sogleich drängte er den Hund von seiner Brust zurück und schritt gegen die Bäume. Da lief von denselben weg und hin über die Felder Zapfenwirts Davidl. Hub der Peter an und ließ seine Beine aussetzen und rannte dem Flüchtling nach, daß der Hut abflog und das ungeschnittene Haar des Bauers in der Luft flatterte. Die Leute lachten; selten hatten sie den Heidepeter so wild gesehen. Der Davidl lief verteufelt gut, und als er zum hohen Rain kam, husch war er über denselben hinabgekugelt. Dennoch verließen ihn seine guten Geister – als er zum Bach kam, erfaßte ihn die Hand des Schicksals am Rockkragen und schlenderte ihn zu Boden.
»Hab's nicht 'tan, hab's nicht 'tan!« schrie der Knirps.
»Hast es 'tan, Bub!« rief der Heidepeter, »wirst's leugnen auch noch! Ich hau' dich in den Steinboden!«
»Ja, jetzt; aber ich tu's nicht mehr!« – stotterte der Davidl; der Peter ließ sich keine Schrift darüber geben.
»Fuchsbartl, du«, knurrte er und faßte die roten Haare und schüttelte den Jungen so heftig, daß diesem all sein Zetern und Bitten von den klappernden Zähnen zermalmt wurde.
Als der Heidepeter müde war, setzte er aus und fragte ganz sanftmütig:
»Hast jetzt genug, Davidl?«
»Meinem Vater sag' ich's!« schrie der Knabe.
»Schau, nachher hast noch nicht genug«, sagte der Peter und setzte das Schütteln fort, so daß ein wahres Meckern entstand.
»Feuerschwamm steck' ich dir keinen in die Ohren, aber merk' dir's! So, und jetzt troll dich!«
Der Knabe schlich brüllend davon, und als er sich jenseits der Schlucht in Sicherheit glaubte, schrie er laut:
»Meinem Vater sag' ich's, der zündet dir das Haus an, du dalketer Heidepeter, du!«
Der Peter ging jetzt langsam seinem Gehöfte zu; aber er schnaufte noch immer; er war ein hagerer, etwas schwächlicher Mann und das Laufen nicht gewohnt. Die Leute hatten sich verloren.
»'s macht mir so leicht keiner die Nägel heiß«, sagte er zu seinem Weibe. »Aber wenn einem so ein Tunichtgut schier alle Tage einen Schur antut, daß zuletzt gar der Kettenhund vor ihm nicht mehr sicher ist, so steigt einem halt doch die Gallbirn auf. Wenn ich ihm in der Hitz nur nicht etwa zuviel getan hab'!«
»Und was ich ausgestanden hab' in der Stund'!« sagte die Peterin, »gar nicht glauben kannst es. Alle Heiligen im Himmel hab' ich angerufen, und ich hab' mir gar nichts anders mehr gedacht, als wir kriegen jetzt all miteinand' die Wasserscheu, und den Gaberl tragen sie zuerst hinaus. Das frisch' Blut hab' ich ihm aus der Wunde gesogen in der Angst. Mein Gott, mir schlottern noch Händ' und Füß'!«
Gabriel lief schon wieder in der Stube umher und kletterte auf die Bank, sah zum Fenster hinaus und dem Kettenhund zu; der schlürfte ruhig seine Abendsuppe. Dann schlich Gabriel auf den Zehenspitzen zur Wiege, in welcher eben sein Schwesterlein erwacht war und flüsterte diesem zu:
»Regina, derweil du geschlafen, hat mich der Waldl gebissen, schau.«
Und er hob den kleinen Fuß auf, zog das Höschen empor und zeigte dem Kinde die Zahnwunde. Er bildete sich schier was darauf ein.
Es begann zu dunkeln; auf den Waldbergen lagerte sich Herbstnebel. Der Halter kam mit den schellenden Kühen heim. Auf der Tenne hörte man noch lange das Auskörnen der Hafergarben, die der Knecht über einen liegenden Baum schlug, bis das letzte Körnchen herausgesprungen war. Endlich schloß sich das Scheunentor zu, und das kleine Häuflein Leute verzehrte in der Stube die Roggensuppe und das Erdäpfelmus. Dann suchten sie ihre Strohbetten auf.
Die Kinder schliefen bald.
In der Stube brannte ein Span, den die Bäuerin noch mehrmals im Haken zurechtsteckte. Der Peter zog die rauchgebräunte Hänguhr auf. Aber es sollte noch nicht Ruhe sein an diesem Abend.
Als sich die Eheleute zur Ruhe begeben wollten, schlug der Kettenhund an. Es klopfte leise an der Fensterscheibe.
»Wer denn?« rief der Bauer, und sein Weib setzte unwirsch hinzu:
»Heut' ist mehr kein Fried!«
»Um die Nachtherberge tät einer bitten!« sagte draußen eine heisere Stimme.
»Ein Armer wird's sein, ja das ist was anderes,« sagte die Bäuerin, »geh, Peter, riegle die Tür auf.«
Bald hernach stolperte ein Mann in die Stube, gebeugt, mit der rechten Hand einen langen Stock umklammernd, in der Linken ein Bündel tragend. Ein breiter, entfärbter und zerdrückter Filzhut saß ihm auf dem Kopfe, und unter der Krempe hingen graue Haarsträhnen nieder.
Der Peter nahm den Span in die Hand, räusperte die Kohle ab und leuchtete dem Fremdling unter den Hut. Da rief er aus:
»Du liebe Zeit, solch's ist doch leicht nicht möglich, das ist ja der Schulmeister von Rattenstein!«
»Ja, ja, mein lieber Heidepeter,« entgegnete der Alte, sich ausschnaufend, »'s wird wohl so sein. Mit Erlaubnis, ich setz' mich gleich nieder.«
Die Bäuerin warf noch einmal den Rock über und eilte in die Küche, daß sie eine warme Suppe bereite, dann rief sie zurück in die Stube hinein:
»Geh, Peter, zünd' eine Kerze an, der Span will frei nicht scheinen, und der Rauch brennt einem schier die Augen aus.«
Als hernach auf dem Tisch eine Talgkerze brannte und als der alte Mann den Schweiß von seinem abgehärmten Antlitz gewischt hatte, hielt ihm der Heidepeter fast schüchtern die rechte Hand hin und sagte: »Ja, wie hat sich denn der Herr Schulmeister verrennt in die Einöde herein?«
»Es hat sich schon so geschickt,« antwortete der Greis, »bei mir heißt's: Verlassen, verlassen wie der Stein auf der Straßen. Hab' den Gebirgsfußsteig genommen und bin fortgegangen über Hald' und Berg, wie der Herrgott die Welt erschaffen hat. So bin ich halt da zu Euch in die Einöde gekommen.«
»Und wenn ich fragen darf, wo will der Herr Schulmeister denn hin?«
Der Alte antwortete nicht, sein Haupt nickte abwärts. Seine Hand haschte nach dem blauen Sacktuch, aber noch eh' er dieses mit zitternder Hand zum Antlitz führte, begann es ihn zu stoßen, von innen heraus.
»Aber Schulmeister! – Aber Herr Schulmeister!« – rief der Peter und sprang bei, um ihn zu stützen, denn der Greis drohte zusammenzubrechen.
»Nimmermehr hält' ich mir das gedacht,« sagte dieser endlich, »daß mir in meinen alten Tagen noch eine solche Stunde schlagen sollte. Du weißt es, mein Gott, verdient hab' ich's nicht!«
»'s wird wohl ein rechtes Unglück sein,« meinte der Bauer, »aber tu' sich's der Herr Schulmeister nicht gar so schwer legen. Und wenn ich was helfen kann, tu' Er's sagen.«
»Vergelt's Gott, Heidepeter! Ihr seid eine gute Seele, ich kenn' Euch schon lang' – wohl gar schon seit fünfunddreißig Jahren. Hab' Euch ja das Häubl zurückgeschoben, wie Euch der Pfarrer getauft hat. Ja mein, wenn derselb Pfarrer noch leben tät'! Der hätt' mich nicht abgedankt, nicht fortgeschickt wie einen Taglöhner zur Feierabendzeit, und wenn ich dem Halterlois schon zehn Glocken geläutet hätt'. Bin wohl schon alt und kann der Schule nicht recht mehr vor sein. Zum neuen Kirchenregiment kann ich mich auch nicht schicken. Dasselbe wißt Ihr noch, wie mich der neue Herr Provisor einen Beelzebubenpropheten geheißen hat. Ich hab' gewußt, daß ich damit nichts Unrechtes tu' und hab' meine Extralehrstunden fortgesetzt. Nachher müßt Ihr's auch gehört haben, daß sich letzthin der irrsinnige Halterlois das Leben genommen hat» Der Herr Provisor hat dem Unglücklichen die Verscheidenglocke verweigert, und da ist die Mutter des Toten zu mir gekommen, weil ich ja auch der Mesner bin, und hat mich gebeten um Gottes willen, daß ich die Glocke läute für ihren Sohn. Der Lois ist immer ein rechtschaffener Mann gewesen, die alte Frau hat ihr Lebtag gar soviel gehalten auf ein Sterbegeläute, und tief in die Seele hinein hat sie mir erbarmt, wie sie so bitter bitterlich geweint hat, und ich hab' gedacht bei mir selbst, der Herr Provisor ist bei einem Amtsbruder in Großhöfen, da nehm' ich's auf mich, und weil sie um Gottes willen bittet, so läute ich die Glocken; man kann der armen Frau keinen besseren Trost schenken. Der Lois ist begraben worden im Schachen, wo sie ihn gefunden haben, und wie jetzt die Glocken klingen, eilt die Mutter hin zum Grab und betet ein Vaterunser. Der Herr Provisor hat die Glocken nicht gehört, und das Gebet nicht, und er hat das Leid und den Trost der armen Mutter nicht empfunden – aber von den Glocken haben ihm die Leute berichtet. Gestern morgens, wie ich ihm das Meßkleid umhüll', lacht er mich noch an, und ich denk': Ei ja, der Herr Provisor ist zuletzt doch auch ein recht braver Herr, ich getrau' mich mit ihm schon auszukommen. Darauf bin ich mit meiner Holzkraxe gegangen und hab' mir von den Bauern meine Getreidegebühr zusammengetragen. Die Leut' meinen's recht gut mit mir und fassen mir tüchtig auf, hätt' mir den ganzen Winter durch kein Schnittel Brot kaufen dürfen. Zwei heiße Tagwerk sind's freilich für unsereinen, aber mein, wer trägt nicht gern schwer, was ihm gehört, 's hat schon zu dämmern angefangen, wie ich mit der letzten Trag ins Dorf gekommen bin. Drauf, wie ich vor meiner Haustür steh', den Schlüssel aus der Tasche zieh' und mich schon freu' auf das Rasten, denk' ich mir: Der Tausend, wer hat sich denn da heut' einen Spaß gemacht? – Ist das Schloß versiegelt gewesen. Ich setz' ab, guck das Ding besser an – ja, Heidepeter, da seh' ich's wohl! – Mit dem Gemeindesiegel ist mir das Schulhaus verschlossen. – Na, denk' ich mir, das ist jetzt schön! Werf' meine Trag ab und lauf' in den Pfarrhof, wo jetzt auch das Gemeindeamt ist. Nach dem Provisor schrei' ich. Nicht daheim, ruft die Wirtschafterin, unten auf dem Steinhaufen sollt ich's suchen, wenn ich was verloren hätt' – und schlägt mir die Türe vor der Nase zu. – Da ist mir schon das Blut zum Herzen gefahren.«
Dem alten Manne preßte es schier die Kehle zusammen, die Worte waren halb erstickt.
»Aber steh'n bleib' ich nicht vor der Pfarrhoftür und anklopf' ich auch nicht. Zum Steinhaufen lauf' ich hinab, und da find' ich Euch meine Sonntagswäsch', meinen schwarzen Rock und meine Geige. Und zwischen den Saiten steckt so ein schmales Blättel Papier. Nu, da ist's, mögt es lesen, Heidepeter.«
»Rechtschaffen gern,« entgegnete der Heidepeter gedehnt, »aber 's ist halt so eine Sach', die Schul' ist so viel weit weg – ich kenn' keinen Buchstaben.«
»Je nu, dann wär' das Lesen freilich eine Kunst,« sagte der Schulmeister, »indes, allzeit ist's auch nicht gut, wenn man lesen kann. Das Briefl tut mir altem Mann folgendes kund:
»Es schmerzt uns, im Namen des hochw. Konsistoriums und der hiesigen Gemeinde Euch Nachstehendes mitteilen zu müssen. Nachdem Ihr, Michel Bieder, Schullehrer in dasiger Pfarre, in dem Unterrichte der Jugend zu wiederholten Malen gegen die Verordnungen gehandelt, Euch trutzig widersetzet und Euch letzther sogar unterfangen habet, in beispielloser Eigenmächtigkeit eine kirchliche Funktion zugunsten eines Selbstmörders zu verrichten, sei Euch kund und zu wissen getan, daß wir Euch Eures Amtes entheben.
Das Pfarramt zu Rattenstein.«
Der Alte schwieg.
Peter putzte in großer Verlegenheit die Kerze und sagte dann:
»Ja, das hätt' der Herr Schulmeister halt wissen sollen, daß man nicht jedem mir nichts, dir nichts ins Grab nachläuten darf.«
»Und so lieg' ich da auf dem Steinhaufen, und nichts fehlt mir mehr zum Bettelmann als der Sack und der Stecken. Die Sterne sind schon am Himmel gestanden, vom Walde her hat ein Uhu gelacht – hat mich ausgelacht. Was fang' ich jetzt an? Verstoßen, ich armer, alter Mann, der vierzig Jahre in der Pfarre Schullehrer war, der eine Gemeinde begraben und eine getauft hat. Ich lieg' jetzt auf dem Steinhaufen in der kalten Nacht, und mein Haar ist feucht vom Tau. Von der Kirchenuhr herab hör' ich das Ticken; wie ein Vogel die nackten Körner von der herbstlichen Saat, so pickt sie mir von meinem armen Lebensrest eine Sekunde um die andere weg. Nur zu, nur zu, Pendel, 's ist schon spät. Da fällt's mir ein: Wer läutet denn heut' die Abendglocke? – Bin aufgesprungen und hinauf über den Hügel zur Kirche, wo man durch den Turm geht. Die Glocken hab' ich alle beim Strick gefaßt und geläutet, all' auf einmal. Und das war der Abschied von meiner lieben Kirche und von der Gemeinde. Die Toten in den Gräbern hätt' ich aufwecken mögen und ihnen das Unrecht klagen; – sie haben fortgeschlafen in der Ruh', ich hab' meine Bettelschaft eingeläutet. Dann hab' ich mir im Gesträuche an der Kirchhofsmauer meinen Stock geschnitten und bin fort und fort – ich kann noch rechtschaffen laufen. Kaum drei Stunden bin ich gewandert, bis da herauf in die Einöd.«
Der Alte stützte seinen Kopf und hielt die flache Hand vor die Augen.
»Närrisch!« sagte die Bäuerin, die schon eine Weile mit der Suppenschüssel an dem Tisch gestanden war, »und jetzt will der Herr Schulmeister in die Wildschroffen hinauf?«
»Komm' ich denn da in die Wildschroffen?« entgegnete der Schulmeister, »o Gott, was tät' ich denn in diesem Gestein?«
Er verdeckte wieder sein Gesicht.
»Es ist ein rechtes Kreuz und kein Herrgott drauf, sagt die alte Einschicht-Res, und 's ist richtig«, sprach das Weib. »Tu der Herr Schulmeister jetzt in Gottes Namen die Suppe essen, daß Er was Warmes kriegt. Der lieb' Herrgott wird's schon recht machen, dasselb' ist keine Sach'. – Peter, komm' ein Eichtel mit mir in die Küch'. Du mußt mir das Rauchtürl zumachen, ich kann's völlig nicht derlangen.«
Aber es war nicht des Rauchtürls wegen.
Als die beiden Eheleute in der Küche waren, sagte das Weib:
»Du wirst es einsehen, Peter, daß wir den Schulmeister nicht so fortgehen lassen können. Ich bin zu ihm in die Schul' gangen, und ich kann ein Gebetbüchel brauchen; 's tät mir mein Lebtag kein Bissen Brot mehr schmecken, wenn ich mir sagen müßt: Dein alter Lehrer geht betteln. Was meinst, wenn wir ihm das obere Stübel herrichten täten? Im Winter könnt' er uns die Spän' klieben, und im Sommer, wenn wir auf der Weid' sind, tät er uns auf die Kinder schauen, und lernen könnten sie auch wohl was bei ihm. Schau, 's wär' halt doch gut, wenn sie was lesen könnten, und der Bub' hätt' so eine Freud dazu; und in der Schrift auch, ich will nicht nachgeben, bis er seinen Namen schreiben kann.«
»Dasselb' ist kein Muß, Klara,« entgegnete der Peter, »wer ist denn in der Einöd, der seinen Namen schreiben kann? Kein Mensch. Die Arbeitsleute haben auch zu grobe Händ' für so was; wenn's d'rauf ankommt, so macht man's Kreuz.«
Die Bäuerin darauf:
»Da wundert's mich nachher gar nicht, daß wir soviel Kreuz haben in der Einöd. Aber mir steht's nicht an, und ich mein', mit dem Schulmeister könnten wir uns eine Stufe in den Himmel bauen.«
»Du denkst ans eine, und ans andere nicht. Du weißt es recht gut, daß wir nur fünf Metzen Korn bauen, und daß wir im Winter kein' Milch und kein Schmalz haben; du weißt, daß wir kein Fleisch im Kasten haben, daß wir kein ordentliches Bettgewand aufzutreiben wissen, und daß es in jeder Eck' bei uns armselig zugeht. Und jetzt willst du noch den Schulmeister aufnehmen; das wär' doch gar kein' Red', Bäuerin.«
Und sie:
»Nun, wenn dir schon um den Bissen Brot leid ist und um das Zinkerl Schmalz, das der Schulmeister ißt, so spar' ich mir's halt von meinem eigenen Mund ab, und ich lieg' in Gottes Namen auf dem bloßen Stroh, und ich mach' mir ein Ehr' daraus, wenn ich den alten Lehrer unter meinem Dach haben kann.«
Und er:
»Halt ja, und wenn wir fertig sind, nähst für ihn einen Bettelsack, und für mich auch einen, und für dich auch einen, und die Kinder binden wir einander auf den Buckel.«
»Weil du kein Vertrauen auf den Herrgott hast!« – versetzte die Bäuerin etwas aufgebracht. »Meine Mutter hat allweg gesagt: Jede Guttat auf Erden marbeln die Engel im Himmel in den goldenen Thron Gottes ein. Aber mich deucht schier, du willst dort deinen Namen gar nicht drin haben.«
»Wer nichts hat, der kann nichts geben,« sagte der Peter gelassen, »was hilft's dem Bettelmann, wenn ich ihm die leere Hand hinhalte?«
»Nu, so faßt er an und hat eine Stütze.«
»Geh, geh, auf die eigenen Kinder muß man zuerst schauen und nicht auf die fremden Leut'. Und letztlich täten wir uns gar mit dem Pfarrer verfeinden, was wäre das?!«
»Du bist ein alter Steinschädel!« sagte das Weib und stieß einen Topf auf die Herdplatte, daß er schrillte, »wer mit dir was ausreden will, der muß eine besondere Gnad' Gottes haben. Wie froh würdest nicht sein zu einer Zeit, wenn dein Schutzengel zum Herrgott sagen tät: Da bring' ich den Heidepeter, der hat auf die armen Leut' was gehalten, und den mühseligen Schulmeister von Rattenstein hat er auch in sein Haus genommen und hat ihn warm gehalten in seinen alten Tagen; und der Heidepeter ist doch auch selber arm gewesen, aber dir zu Lieb', Gottvater, hat er's tan, und derowegen tu ihm gnädig verzeihen, wenn er sonst Fehler gehabt hat, und führ' ihn in deinen Himmel, und seine Kinder auch, und sein Weib halt auch! – Wie würdest du froh sein, Peter, zu einer Zeit!«
Der Peter hatte sich jetzt ein wenig den Kopf gekratzt, und endlich antwortete er mit weichem Tone:
»Du schreist auch so und weckst die Kinder auf, und der Schulmeister hört's auch noch gar. Meinetwegen magst ihn ja dabehalten, ich sag' nichts mehr.«
Mit weltlich vernünftigen Gründen war beim Peter nie viel auszurichten, da konnte eins sagen schwarz oder weiß, er folgte seiner eigenen Nase. Aber sein Weib kannte ihn von außen und von innen wie ihre Schlafhaube; sie faßte es höher an, und wenn sie ihm in ihrer gewandten Redeweise Himmel und Herrgott vorhielt, da wurde er allemal weich.
Als die Eheleute nun wieder in die Stube kamen, sagte Klara:
»Man meint, 's Rauchtürl wär' nicht zum derlangen, man muß sich frei auf die Zehen stellen. – Ja, mag denn der Herr Schulmeister die Suppen nicht? Hab' sie meines Gedankens gut kochen wollen, und hab' auch recht viel Kümmel hineintan, daß sie dem Magen taugt. Ja, und jetzt ist noch was auszureden; ich weiß nicht, was meinem Peter da eingefallen ist, er will den Herrn Schulmeister schnurgerad im Haus behalten, daß er unseren Kindern ein Eichtel das Lesen lernen könnt! Ich hab' drauf gesagt: Der Herr Schulmeister bleibt uns nicht, so ein Mensch, hab' ich gesagt, weiß sich was Besseres. Wenn wir ihm auch das obere Stübel herrichten und ihm gleichwohl aufwarten täten wie einem gern gesehenen Hausmenschen, er bleibt uns nicht. Schulgeld können wir ihm auch keins geben, hab' ich gesagt, und Kost nur, wie wir sie halt selber haben. – Wenn Ihm das genug wäre? – Mir wär's von Herzen recht, wenn Er dableiben wollt'.«
Der Greis erhob sich und rief:
»Oh, ihr lieben, guten Leute! Weil ihr es denn selber zuerst gesagt habt, so getrau ich mich, Euch zu bitten. Ich habe kein Ziel, und über die Wildschroffen dürft' ich mich gar nicht wagen. Nur für einige Tage gebt mir Obdach und einen Löffel Suppe; dann geh ich wieder hinaus nach Rattenstein und verleg mich aufs Bitten. Die Leute werden eine Barmherzigkeit mit mir haben, und der Pfarrprovisor wird doch kein Stein sein.«
»Zu Gnaden fallen tät ich ihm auch nicht, just nicht!« sagte die Bäuerin, und der Heidepeter meinte, es werde schon alles recht werden, so lang' der lieb' Herrgott nicht eine andere Anstalt mache, sei der Herr Schulmeister im Heidehaus daheim.
Da schrie der kleine Gabriel plötzlich im Schlafe auf: »Waldl, Waldl, Waldl!«
»Kindisch,« sagte die Klara, »jetzt kommt ihm der Hund unter.« Dann trat sie ans Bett und machte mit dem Daumen das Kreuzzeichen über das Antlitz des Knaben.
Der Peter bereitete dem Gaste in der Scheune ein Nachtlager, und bald war es dunkel und still in der Stube des Heidehauses.
Der Hirsch an der Wand
Heidepeters war das höchstgelegene Haus in der Einöde. Es stand oben an der Moosheide, wo die Waldungen begannen. Es lag sehr hoch auf einem fast ebenen Platze, vor dem Hause guckten zwischen dem Rasen viele graue Steine hervor.
Auf der Heide lag eine Unzahl großer Felsblöcke mit grauem Moos. Zwischen diesen Blöcken auf dem sandigen Boden stand hie und da eine Weißbirke, deren Blätter immer flüsterten und zitterten, bis sie im Spätherbste verloren über die Heide wehten.
Das Heidehaus trug auf dem Trambaum der großen Stube die Jahreszahl 1744; es war das erste Haus, das sie in der Einöde gebaut hatten.
Peters Vorfahren sollen wohlhabend gewesen sein, weil sie viel Wald besaßen und Viehzucht getrieben. Der Wald war alle geworden und wieder gewachsen; aber der Graf Frohn – der jenseits des Gebirges ein Schloß, die Frohnburg, in der Einödgegend viele Waldungen nebst Jagd und bisher auch den Robotdienst der Bauern besaß und inne hatte – bemächtigte sich allmählich des Bodens der Ansiedler, und es stand nun so, daß ohne seine Erlaubnis kein Stamm geschlagen, kein Ast gebrochen werden durfte. Die arme entlegene Gemeinde der Einöde war von allen Ämtern und Behörden verwahrlost, fast vergessen.
So hielten sich die Einödbewohner an den Strohhalm – an den kärglichen Ackerbau.
Zum Heidehause fest gehörte nur der steile Feldrain gegen die Schlucht hinab und eine schmale Wiese. Alles andere, was früher dazu gehört hatte, als Holzung, Hald und Viehweide, war mit Abgaben und Robotverflichtungen belegt.
An der wettergrauen Holzwand des Heidehauses, gegen Morgen hin, unter der hervortretenden Dachung, befand sich eine aus Brettern geschnitzte Tiergestalt. Jeder Fremde, wenn dann und wann ein solcher über das Gebirge wandernd an dem Hause vorüberging, blieb vor demselben stehen und betrachtete das Bild. Hausierer mit Kleinwaren, Krämer mit Sieben und Holzgeschirren, Rastelbinder, Glaseinschneider, Hadernsammler, wie sie im Sommer in der Einöde manchmal umhergingen, setzten, noch bevor sie in das Haus traten, den Stock unter ihre Rückentrage und beschauten die Figur an der Wand. Selbst Bettler taten dieses und machten dabei ein süßliches Gesicht, als lobten sie den Mann, der das Bild geschnitzt hatte.
Hierin jedoch, was der Gegenstand darstellen sollte, gingen die Urteile auseinander. Man hielt das Tier für eine Kuh, für einen Esel, für eine Gemse, einige jedoch meinten, es müsse ein Hirsch sein. Diese letzte Meinung hatte einen wohl zu beachtenden Umstand für sich; an dem Haupte des Tieres ragten nämlich zwei schmale Brettchen mit sägezahnartigen Einschnitten empor, welche möglicherweise die Hirschgeweihe darstellen sollten. Der Heidepeter wußte darüber bestimmten Bescheid, das Tier war wirklich ein Hirsch.
Für das Heidehaus knüpften sich Sprüche und Redensarten an die Gestalt.
Wenn der Peter zum Gabriel sagte: »Bübel, morgen heißt's roten Hirsch jagen!« so meinte er damit nichts anderes, als daß der Knabe am nächsten Morgen um Sonnenaufgang aus dem Bette müsse. Der Hirsch war nur um diese Zeit glutrot.
Wenn der Schroffenwind ging, so schlug die Gestalt mit den Füßen zeitweilig an die Wand; da sagten die Hausbewohner immer:
»Es klöpfelt schon wieder der Hirsch, 's wird ein anderes Wetter anheben.«
Einen Sommer hindurch hatte Gabriel einmal lange Zeit beobachtet, wie zwischen den Holzgeweihen zwei Spatzen sich ein Nest bauten. Gabriel hielt damals ein frisches Vogelnest für das größte Glück auf Erden. Er konnte dem Drang nicht widerstehen, lehnte eine Leiter an die Wand und wollte hinaufklettern. Da kam sein Vater herbei und, sonst so sanftmütig, gab ihm in nachdrücklicher Weise zu verstehen, daß er ein für allemal das Nest und den Hirschen in Ruh' lassen möge.
Man hätte meinen mögen, das Geschnitze sei eine Erinnerung an den »laufenden Hirschen«, wie solcher aus dem Brette dargestellt und mit dem Strick durch das Gebäume gezogen zu werden pflegte, ein beliebtes Schützenspiel; und ein Vorfahre des Peters werde ihn getroffen haben. Aber es hing an dieser Tiergestalt für den Heidepeter eine andere Sache.
Als der Heidepeter noch in der ersten Zeit seiner Ehe war, da gab es Mißjahre, und in der Einöde wollte nichts wachsen und nichts reifen als die Rüben und das Kohlkraut. Roggen und Hafer gingen im Frühjahr hoffnungsvoll auf und grünten und sammelten sich zum Ausbruche der Ähren. Da kam mitten im Sommer anhaltender Regen und Kälte, und in den Wildschroffen lag wochenlang der Nebel. Das Getreide erbleichte und duckte sich wieder zusammen, als möchte es am liebsten zurückkriechen in die schützende Scholle. Wohl kamen darauf noch einige Wochen mit Sonnenschein, doch noch bevor das Korn zur Reife gelangen konnte, war der Schnee da.
So kam es mehrere Jahre nacheinander.
Die Leute waren mutlos und wollten im Frühjahre nichts mehr säen, oder hatten keinen Samen dazu.
Auch der Feldkasten des Heidepeters leerte sich, und er konnte den Nachbarn nicht mehr das Gesäme borgen, wie er es sonst gewohnt; er war kaum imstande, sein eigenes Hauswesen zu versorgen. Aber er wurde nicht mutlos, denn er hatte ein junges, sorgsames, fleißiges Weib im Hause – eine glückliche Sache, die Mißjahre zu allen Zeiten erträglicher macht.
Sein Weib hatte den Vorschlag getan, mehr Feldrüben als gewöhnlich und einen großen Garten voll Kohlkraut anzubauen, damit für das Korn doch irgendein Ersatz da sei.
Der Heidepeter tat danach, und es wurden im Juni frische, schöne Setzlinge gepflanzt. Im Juli war wieder Regen und Kälte und Nebel in den Wildschroffen; die Gartenfrucht aber wuchs langsam fort.
Klara blieb die rauhen Tage über viel in der Stube, weil der Peter, ihren Umständen gemäß, nicht zugab, daß sie in die frostige Luft gehe. Eines Tages aber kam er zu ihr in die Kammer und sagte:
»Du, ich weiß nicht, was das ist, Klara, es muß ein Tier dagewesen sein, ein ganzer Jaun (Streifen) der schönsten Kohlpflanzen ist abgefressen.«
Der Knecht erzählte, er habe am Morgen vom Kohlgarten gegen den Wald einen Hirschen laufen gesehen.
Der Heidepeter erhöhte nun den Bretterzaun um den Garten, und als darauf einmal der Graf Frohn mit Büchse, Pulverhorn und der stolz gebogenen Hahnenfeder über das Feld ging, rief ihn der Heidepeter an:
»Euer Gnaden, tät wohl untertänigst bitten, 's kommt alleweil ein Hirsch, und der will uns das Kraut fressen.«
»So«, antwortete der Jäger lachend, pfiff seinem Hund und schritt vorüber.
Und in einer der nächsten Nächte kam das Tier wieder und fraß eine Reihe Kohlpflanzen. Hierauf rief der Heidevater bei einer nächsten Begegnung mit dem Hütlein unterm Arm dem Grafen ein zweites Mal zu:
»Messen mir's Euer Gnaden doch nicht übel auf, aber ich kann mir nicht anders helfen. Es sind halt soviel schwere Zeiten, und wir haben schier nichts mehr zu beißen. Tut uns doch den Hirschen weg, er frißt uns ja das Kraut bei Putz und Stingel!«
»Aha,« sagte der Graf launig, »tätest wohl gern du den Hirschen zum Kraut fressen, wär' dir lieber, gelt?«
Er pfiff seinem Hund und ging vorüber.
Ganz traurig kam der Peter in die Stube, setzte sich auf die Bank und sagte lange kein Wort. Jählings schlug er die Faust auf den Tisch und sprang auf. Bevor er jedoch wieder davonging, trat er hin zu seinem Weibe und sagte gelassen:
»Klara, ich bin ein Mensch, der sich um den Finger wickeln läßt, sie nennen mich den Dalkerd; aber jetzt kann's wohl sein, daß ich einmal einen Unfried anheb'. Mach' dir nichts draus. Hab' gemeint, 's käm nicht drauf an, aber jetzt seh' ich's wohl, 's kommt drauf an.«
Dann ging er hin und machte den Gartenzaun noch höher und flocht Dornengestrüpp hinein und hing den Kettenhund an eine Ecke des Zaunes.
Aber der Hirsch kam und fraß Kohlpflanzen.
Nun machte sich der Heidepeter auf, nahm den Weg unter die Füße und zog über die Schroffen, bis er jenseits des Gebirges hinaus kam, in das Schloß Frohnburg. Dort war gerade ein großes Festschießen; Grafen und Herren waren versammelt, und bei schäumenden Bechern tranken sie auf Weidmannsheil.
Der Peter schritt mitten durch und gerade auf seinen Jagdherrn los. Er schien heute aus seiner Natur zu sein.
»Ich wehr' mich um mein Brot, Herr!« sagte er mit gedämpfter Stimme, »und daß ich kein Unrecht hab', komm ich den weiten Weg, um Euch's zu sagen. Nieder schieß' ich den Hirschen!«
Da lachte der Graf überlaut und rief:
»Du Närrchen, was tust dir denn die Mühe an?«
Er pfiff nach seinen zwei Bulldoggen. Der Peter sagte kein Wort mehr, sondern machte sich davon.
In derselben Nacht schoß er den Hirschen nieder.
Und schon am nächsten Morgen drangen Jäger in seine Stube und legten ihm Eisen an die Hände. Er ließ es ruhig geschehen und sagte zu seinem Weibe:
»Mach' dir nichts draus, es wird noch einen gerechten Herrn geben!«
So wurde der Peter fortgeführt und als Wildschütze in das Gefängnis geworfen.
Wochenlang saß er. Er dachte weder an das Kohlkraut, noch an den Hirschen, noch an den Grafen, er dachte nur an sein Weib. – Die Stunde ist vielleicht morgen, vielleicht heute schon, und dein Weib bringt dir den Erstgeborenen. Sie will ihn dir entgegenhalten, und du bist nicht da! Oder es ist Unglück, und du bist deiner Gattin nicht zur Seite in der Not, und wenn du heimkehrst in dein Haus, findest du eine Mutter ohne Kind, oder ein Waise, oder keines von beiden. Durch die Mauer hätte er den Kopf rennen mögen, aber er blieb ruhig, nur murmelte er vor sich hin auf den Ziegelboden:
»Das Menschsein ist ein Rad; heut' bin ich unten, du oben, morgen ist's anders. Graf Frohn, rund und im Kreislauf, so hat Gott die Welt erschaffen!«
Endlich, als die Zeit um war, wurde der Heidepeter freigelassen. Er eilte heimwärts, er fand Weib und Kind in Wohlfahrt.
Jenseits der Schachenschlucht des Heidepeters lag der Haberturmhof. Der stand auch auf steinigem Boden, hatte aber größere Felder und auch zweimal soviel Wiesengrund als der Peter.
Der Haberturmhof war weithin bekannt.
Es war in diesem Hause eine große Eigentümlichkeit. Der Besitzer des Haberturmhofes duldete in seinem ganzen Hauswesen keine Weibsperson, sowie er auch keine Hausfrau hatte, ohne daß aber dadurch das Geschlecht der Habertürmer ausstarb.
Dag war ein wunderlicher Mann, der vor mehr denn vierzig Jahren den Haberturmhof besaß, die Wirtschaft dem guten Glück überließ und vor seinem Tode, weiß Gott, ob welcher Ursache, folgende Urkunde niederlegte:
»Ich, Gotthelf Haberturm, der Erbauer dieses Hauses, hab' ein Weib geehelicht, männiglich Leid erfahren und bin kinderlos geblieben. Ich habe einen Waisenknaben zu mir genommen und erzogen und ihm meinen Namen gegeben. Er sei Herr und Besitzer von Wiese und Feld, von Wald und Heide, so dem Haberturmhofe zugemessen. Aber den Rat erteile ich ihm: Er nehme kein Weib; das Weib macht Übel. Er soll auch einen Waisenknaben zu sich nehmen und ihn erziehen und ihm seinen Namen geben.«
Was den Mann zu dem Testament veranlaßt hatte, ist zurzeit nicht bekannt worden.
Viele meinten, der Alte hatte die Verordnung nur armen Waisenknaben zuliebe so gemacht. Das sei ja gar zu häufig, daß so ein Waisenkind verkomme und verderbe, wenn sich niemand seiner annehme. Der Wille aber war seither wohl beachtet worden; der Hof hatte stets seine ehrenwerten Besitzer, das weibliche Geschlecht blieb verbannt, und der Wohlstand wuchs immer mehr.
Der gegenwärtige Eigentümer war ein großer, starker Mann, der aber seine Kraft nicht gern in der Wirtschaft verwendete, der am liebsten beim Zapfenwirt saß und sich den reichen Haberturm schelten ließ.
Vom Haberturmhofe eine halbe Stunde abwärts, in einer Talung, über welche der Gemeindeweg ging, stand das Zapfenwirtshaus. Es unterschied sich von den anderen Bauten der Gegend; es hatte eine blau angestrichene Tür, die immer offen stand, es hatte große, zierlich vertäfelte Fenster, durch welche Gäste heraussahen oder die Wirtin. An der braunen Wand unter dem breiten, lichtgrauen Schindeldache hingen weiße Schießscheiben mit schwarzem Zentrum, reichlich mit Bleikugeln bespickt und durchlöchert. Hinter dem Hause unter einigen alten, lang und dicht beästeten Fichtenbäumen war eine Kugelbahn angelegt.
Wenn der Sturmwind ging, sausten von den Bäumen häufig dürre Zapfen nieder auf die Kugelbahn und auf das Dach des Hauses, daß es knatterte. Davon soll der Name »Zapfenwirtshaus« stammen. Einmal prellte dem kleinen Davidl, Zapfenwirts Sohn, so ein rauhschuppiger Zapfen an die Wange, daß sie blutete; darauf wollte der Wirt sogleich die Bäume umhauen lassen, aber der Nachbar Hahnenkamp widerriet es ernstlich, weil dann das Haus den Stürmen bloßgestellt sei.
Vor dem Wirtshause auf dem großen Anger stand eine Kapelle aus Stein mit einem Holztürmchen. Unter dieser war die Gruft des Zapfenwirtes – aber nein, ich sollte es nicht verraten. Zu dieser Kapelle kam dreimal des Jahres der Pfarrer von Rattenstein und las die Messe oder hielt wenigstens eine Christenlehre, weil es in der Einöd Leute gab, die »verludern« und verlottern wollten und jahraus, jahrein in keine Kirche kamen. –
Weiter draußen, wo die Wiesengründe und Äckerlein endeten und wieder die Waldungen begannen, die sich bis gegen Rattenstein erstreckten, stand die Hahnenkamphütte. Der Hahnenkamp war Holzmeister gewesen und hatte sich vor Jahren diese Baracke zusammengenagelt; nun besaß er dazu eine kleine Bauernwirtschaft.
Der Hahnenkamp war der größte und stärkste Mann in der Einöd; und seit der Hahnenkamp da war, hatte der Zapfenwirt sein Pferd verkauft. Wenn des Weges ab und zu ein besonderes Fuhrwerk zu besorgen war, so kam der Hahnenkamp mit seinem Hanfstrick und förderte die Last weiter. Der Mann hatte nie ein Hemd auf dem Leibe, und in den Sommertagen warf er auch seinen Leibelfleck weg und ließ den dicken Nacken und die breite, braune Brust mit ihrem ganzen Haarwald frei.
In dem hintersten Schroffeneckgraben stand eine kleine Köhlerhütte, die, aus den Holzreutzeiten noch übriggeblieben, dem Haberturm gehörte. Dieser äußerte einmal an einem gemütlichen Wintertag beim Wirt:
»Ihr alle seid arme Teufel, aber ich hab' zwei Häuser!«
»Ja, mit deinem Rauchkobel im Schroffeneckgraben,« entgegnete der Wirt, »hörst, die kannst heut' versaufen noch vor Sonnenuntergang.«
»Recht!« schreit der Haberturm, »ich versaufet den Kobel, wenn ich ihn da hätt'!«
Das hört der Hahnenkamp, und in drei Stunden darauf, just wie die Sonne untergeht, steht er mit der Köhlerhütte vor dem Wirtshaus. Niedlich zerlegt hatte er sie auf eine »Schlarpfe« geladen und so auf dem mächtigen Halbschlitten herbeigeschleppt. Kein Balken und kein Holznagel fehlte, gar das Bettstroh war dabei. Der Haberturm hielt Wort, und das Holz wurde noch in derselben Nacht vertrunken. Als sie damit fertig waren, sagte der Haberturm:
»So, meine Hütte wär' unten, jetzt, Hahnenkamp, bring' uns deine!«
Und der Hahnenkamp ging zu seiner Hütte und – legte sich schlafen. – Nicht ein Splitterl von meinem Güterl! – war sein Grundsatz, und sein Sprichwort: Der Schenker ist gestorben, und der Henker hat sein Gut erworben.
Haare kämmen, Gesicht und Hände waschen, das erkannte der Hahnenkamp nicht an, so ein Übermut schicke sich nicht für einen ordentlichen Bauer. Seinem Gesinde gegenüber war er sehr schroff und grämig; auch hatte er es nicht gern, wenn eines lachte oder während der Arbeit sprach; das sei ein leichtsinniges Zeit- und Kraftverschwenden. Nur wenn der Oberknecht vor den Mahlzeiten das Suppenbrot aufschnitt, sagte der Bauer gern:
»Pfeif' was, Toni, ich pfeif' auch mit.«
Und der Toni pfiff, und die Brotspalten, die er sonst während des Ausschneidens in den Mund zu stecken gewohnt war, blieben im Trog. – Eines Tages indes brummte der Toni auf die Anrede beim Aufschneiden des Suppenbrotes:
»Mag nicht pfeifen; bin fuchsrabenwild.«
»Wild bist?« sagte der Bauer, »was sollst denn du wild sein? Du hast 's schönst' Leben und kein' Sorg'. Hat dir leicht gar der Heidepeter wieder eine Predigt gehalten, seines Prinzen wegen?«
»Der Dalkerd mag meinetwegen seinen Gaberl in ein Papier wickeln und es mit einem roten Seidenschnürl fest zubinden. Fuchsrabenwild bin ich wegen was anderem. Der Großteufel ist wieder da.«
Jetzt blinzelte der Hahnenkamp.
»So?« machte er hernach, »und hast ihn gesehen?«
»Auf dem Schroffenstuhl steigt er herum; andere hat er auch bei sich: puff und paff geht's, und der ganze Wald ist voll Hundegeheul.«
Da trat der Bauer ganz nahe zum Knecht und sagte halblaut:
»Wenn ich's Leben noch eine Zeit hab', und ich kauf' mich ordentlich an in der Einöd, so setzt's einmal was. Und wo ich anfaß, da gibt's nach, oder es bricht was! – Merk' auf, Toni, da an der Tischeck hab' ich's gesagt!«
Der Ton, mit dem diese Worte gesprochen wurden, sagte ungleich mehr als die Worte selbst. Der Knecht schnitt Brot und aß dabei nicht einen einzigen Bissen.
Dann kamen die anderen Leute, und die Bäuerin brachte ein Milch- und Mehlgericht.
Als sie noch um den Tisch herumsaßen, kam der Forstjunge Herbert zur Tür herein und sagte:
»Gott besegne die Mahlzeit!«
»Hol' dich der Teufel!« murmelte der Hahnenkamp in den Löffel, und die Leute sahen auf das Roggenmus und hatten zu würgen, daß ihnen kein Lachen hervorbrach.
Der Forstjunge sagte:
»Im Auftrage des Herrn Grafen Frohn! Morgen und übermorgen ist's in den Schroffenwäldern zum Jagen. Der Hahnenkamp soll zwei Treiber schicken!«
»Schon recht!« brummte der Bauer, »werden wohl kommen.«
Bei diesen Worten biß er die Zähne zusammen, daß es knackte; es wär' nicht so hart gewesen, das Roggenmus.
»Beim Pfaffenhut kommen wir zusammen, um vier Uhr früh!« – sagte der Jägersmann noch, dann verließ er das Haus.
Es war still. Aber der Toni wurde unruhig, und er rückte sein Sitzfleisch.
»Dann mögen wir«, murmelte er endlich in das Mus hinein, »wohl schon um Mitternacht vom Haus forttrotten; 's ist vier gute Stunden bis hin.«
»Aha, red'st schon wieder um das Eichtel Schlaf«, fiel der Bauer ein; »ihr dummes Volk denkt nur ans Schlafen und ans Kauen und Verdauen. Wäret lieber Maulwürfe worden. Wenn man euch die fetten Fleischtöpf' ins Nest brächt', gleich tätet ihr noch schreien nach dem Mostkrug, und wenn man euch den auch noch hinstellte, so tätet ihr doch wohl nicht schimpfen über die harte Arbeit und das Hungerleiden – heißt das, derweil nicht ihr die Mäuler voll hättet. Schon gut so. – Wenn aber jäh einer käm und sagen tät: Leut', rafft's Sensen und Hacken und Mistgabeln auf – die Frohnherr'n erschlagen, daß einmal ein Fried' ist auf der Welt! – ei, wie schon langsam ihr da zurückkriechen möchtet in eure Strohlöcher! Ein rechtes Schmalzschnecken-Gesindel übereinander!«
Der Hahnenkamp hatte einen kurzen, dicken Hals, der indes noch zusehens anschwoll, wenn der Mann in Wut kam. Da hoben sich auch seine borstigen Haare unter der rotgestreiften Baumwollhaube, und die mächtige Haubenquaste auf der Achsel begann beträchtlich zu tänzeln.
*
Gegen die Abend- und Mitternachtseite der Einöde ragt ein wüster, zerrissener Gebirgszug auf. Die Leute nennen ihn wegen seiner steilen Wände und unerklimmbaren Kanten die Schroffen. Schon von weitem sieht man über den dämmernden Wäldern der Einöde die weißen Kalkwände leuchten. Um die Mittagsstunden aber werden sie stets ein dunkler, zackiger Wall, der seine Schatten allmählich hinlegt über die Einöde, und endlich weiter und weiter hinaus in die unteren Wälder und in das Tal; und zur Abendstunde liegen auf den Fluren die Kanten und Hörner der Schroffen breit und lang hingezeichnet.
Die ganze, fast furchtbare Herrlichkeit dieses Gebirges entfaltet sich aber erst in den Wild- und Hinterschroffen. Da ragen Hörner und Riffe auf, die zur Sommerszeit bis in die Mitternacht hinein schimmern in matter Glut, und da sind Tiefen und Schluchten, in welche kein Sonnenblick je gefallen, solange die Welt sieht. Hier wächst kein grünes Blatt mehr, und die Alpenrose wuchert weiter unten auf den Almen. Hier hört man keinen Vogelsang und keinen Kuhreigen, und die Gemse klettert an tieferen Hängen. Hoch über alles Leben haben sich die wilden Felsen aufgebaut; still und tot ruhen die kleinen, beeisten Seen, kahl sind ihre Ufer, nur das Murmeltier und die Spinne hausen hie und da noch in den Klüften des Gesteins. In den Tiefen rauschen die stürzenden Wildbäche, um die Grate und Hörner ächzt und braust und pfeift die Windsbraut. Jahr um Jahr schichten sich in den Einsenkungen der Felshäupter größere Eismassen auf, Jahr um Jahr fahren an den Mulden und Schrunden Schnee- und Steinlawinen nieder, und ohne Ende meißeln Luft und Wasser mit ehernen Armen an diesem Gebilde; ewig bauen sie an den Alpen, und ewig reißen sie sie ein.