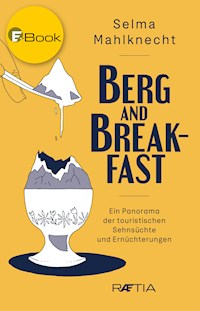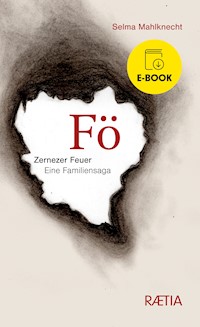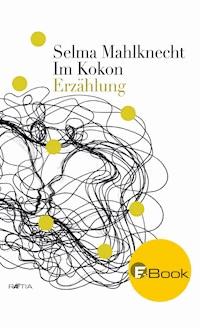Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Raetia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vergötterung, Flucht, Liebe, Entführung, Vergewaltigung. "Bin ich noch Helena?", fragt sich die schöne Prinzessin aus Sparta, nachdem sie von Paris verschleppt und geschändet wurde. Schönheit verspricht in Mahlknechts Neuerzählung der griechischen Sage kein Glück. Um dem Werben der Freier zu entkommen, entflieht Helena mit Theseus nach Aphidnai. Doch nach diesem freiwilligen Akt muss sie sich Zwängen unterwerfen, die von Männern bestimmt werden: Von den Lakoniern wieder nach Hause geholt, wählt sie unter den Werbern Menelaos, den Prinzen von Mykene, weil eine Entscheidung getroffen werden muss. Während dessen Abwesenheit wird sie von Paris entführt, doch wie schon bei Euripides kommt Helena nie in Troja an, sondern landet an einen hohen Beamten verkauft in Ägypten. Als Gesellschafterin der schönen Nofret, der jungen Gemahlin des Seti, lebt sie in einer fremden Welt fernab vom Toben des Krieges in Troja.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Selma Mahlknecht:Geboren 1979 in Meran. Studium Drehbuch und Dramaturgie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.Wohnhaft in Rabland/Partschins (Südtirol) und Zernez (CH).
Preise/Stipendien: 2012 wird ihr Roman „Helena“ mit dem Sir-Walter-Scott-Preis zum besten deutschsprachigen historischen Roman der Jahre 2011/12 ausgezeichnet. 2009/2010 Arbeitsstipendium des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur in Wien. Im Oktober und November 2008 ist sie Stadtschreiberin von Kitzbühel. 2008 gewann Selma Mahlknecht vor 360 Mitbewerbern den ersten Ötztaler Literaturpreis. 2002 erster Platz beim Literaturwettbewerb "Wasserworte" in Algund sowie erster Platz beim Südtiroler Sparkassenwettbewerb in der Kategorie "Drama" und zweiter Platz in der Kategorie “Prosa”. 2001 erhielt sie von der österreichischen Verwertungsgesellschaft “Literar-Mechana” ein Förderstipendium für Drehbuchautoren. 1998 erster Platz beim Südtiroler Sparkassenwettbewerb in den Kategorien “Prosa” und “Drama”.
Theater (mit KWer-Theater): 2012 gesellschaftskritische Komödie „Die Glückskekse“. 2011 Tragödie „Korea“ über die unheilbare Krankheit Chorea Huntington. 2010 sozialkritisches Jugendstück “Eingeklemmt - eine Generation zwischen den Fronten”. Ebenfalls 2010 inszeniert die Theatergruppe Kortsch Mahlknechts satirisches Lustspiel “xunthait” über die Wunderheilerin Petra Oberperfler alias “Enguana”. 2009 inszeniert Mahlknecht das Singspiel “Mein Tirol” in Naturns, 2008 Neuinszenierung des Shakespeare-Stücks “Othello”, in welchem die Frauen im Vordergrund stehen, im Stadttheater Bruneck; 2004 Uraufführung der Komödie “EX” als Koproduktion der Vereinigten Bühnen Bozen und des Theaters in der Altstadt Meran; Drehbuch zur Spielfilmserie “Von hier bis zum Mond” mit Karl Prossliner für den RAI-Sender Bozen.
Inhaltsangabe:Vergötterung, Flucht, Liebe, Entführung, Vergewaltigung. „Bin ich noch Helena?“, fragt sich die Prinzessin aus Sparta, nachdem sie von Paris aus ihrer Heimat verschleppt und geschändet wurde. Schönheit verspricht in Mahlknechts Neuerzählung der griechischen Sage kein Glück. Um dem Werben der Freier zu entkommen, entflieht die schöne Helena zusammen mit Theseus nach Aphidnai in Attika. Doch nach diesem freiwilligen Akt muss sich Helena den Zwängen des Schicksals unterwerfen, das von Männern bestimmt wird: Von den Lakoniern wieder nach Hause geholt, wählt sie unter den Werbern Menelaos, den Prinzen von Mykene, weil eine Entscheidung getroffen werden muss. Dem späteren König von Sparta gebiert sie drei Kinder, doch während der nächsten Schwangerschaft und als die gesamte Familie nach Kreta reist, wird sie von Paris und Hektor entführt und während der monatelangen Überfahrt nach Illion (Troja) als Sklavin gehalten. Wie schon bei Euripides kommt Helena nie in Troja an, sondern landet in Ägypten, ihres mittlerweile geborenen vierten Kindes von Paris beraubt und gegen Hilfsgüter an einen hohen Beamten des schwarzen Landes verkauft. Als Amme und später als Gesellschafterin Nofrets, der jungen Gemahlin des greisen Beamten Sethos in Men Nefer (Memphis), lebt sie als willenlose Gefangene einer fremden Welt fernab vom Toben des Krieges in Troja. Das Schicksal Nofrets, nämlich die Bürde der Schönheit, erkennt sie als ihr eigenes und beginnt zu verstehen, dass dieses nur durch Selbstbestimmung überwunden werden kann.Mahlknechts Neuakzentuierung des Sagenstoffs blickt hinter das Trugbild der Legende und bringt eine Geschichte zutage, wie sie sich zugetragen haben könnte.
Ausgezeichnet mit dem Sir-Walter-Scott-Preis zum besten deutschsprachigen historischen Roman der Jahre 2011/12!
Selma Mahlknecht
Helena
Roman
Die Drucklegung erfolgte mit freundlicher Unterstützung durch die Abteilung deutsche Kultur der Südtiroler Landesregierung über den Südtiroler Künstlerbund. Die Autorin dankt der Abteilung deutsche Kultur für die großzügige Unterstützung ihrer Arbeit.
Für die fachkundige Beratung dankt die Autorin Jan Casalicchio (Dipartimento di Discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo, Università di Padova) und Michael Neumann (Institut für Ägyptologie, Universität Wien).
© Edition Raetia, Bozen 2010
Umschlag: Dall’O & Freunde, BozenUmschlagbild: Conny Cossa
ISBN: 978-88-7283-384-1 ISBN e-book: 978-88-7283-473-2
www.raetia.com
Inhalt
Sparta
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Das Meer
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Das Schwarze Land
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Kapitel XXXVI
Kapitel XXXVII
Kapitel XXXVIII
Kapitel XXXIX
Kapitel XL
Kapitel XLI
Kapitel XLII
Kapitel XLIII
Kapitel XLIV
Kapitel XLV
Kapitel XLVI
Kapitel XLVII
Kapitel XLVIII
Kapitel XLIX
Kapitel L
αλλίστ
Sparta
I.
Vor allem habe ich blaue Augen. Sie sind nicht nur einfach blau, womöglich durch gelbliche oder braune Punkte getrübt wie bei so vielen anderen. Sie sind tiefblau und rund, riesige blaue Scheiben im Wimpernbett. Wer mich sieht, ist gebannt von diesen „funkensprühenden Sternen am Himmel eines vollkommenen Gesichts“, wie es Xenon in einem seiner besten Gedichte über mich geschrieben hat. Unsterbliche Verse, sagen manche. Aber alle sagen, dass der Ruf meiner Schönheit selbst diese überdauern wird.
An keine Zeit meiner Jugend kann ich mich erinnern, in der mein Liebreiz nicht besungen worden wäre. Alte Tafeln zeigen mich als rosigen Wonneproppen inmitten meiner Geschwister, allesamt wie aus dem Ei gepellt. Und doch gibt es keinen, der zweifelt, welches der fast gleich zurechtgemachten Kinder ich bin. Deine Augen, rufen alle, unverkennbar! Ihnen verdanke ich die Kosenamen, die man mir gab: die Sternenblickende, die Meerblitzende. Aus meinen Augen haben sie alle zu lesen versucht, meine Mutter, mein Vater, die Dienstboten, jeder, der mir begegnete. Und alle wollten mir zu Willen sein, oder genauer: diesen Augen, nur ihnen.
Meine Brüder waren in mich verliebt, beide. Sie lieben mich noch heute, ich weiß es. Keine Frau wird ihnen jemals bedeuten, was ich ihnen bedeute. Vielleicht fahren sie deshalb auf das Meer hinaus, wieder und wieder, weil sie nur dort dasselbe tiefe Blau finden können wie in meinen Augen. Ja, möglicherweise ist es wirklich die betörende und Angst einflößende Anziehungskraft des Meeres, die alle verspüren, die mir in die Augen sehen, und vielleicht liegt darin das Geheimnis jener schrecklichen Schönheit, die jeden, der ihr nahekommt, zu den Sternen hebt, ehe sie ihn zerschmettert.
II.
Mit acht versteckten wir uns in den Stallungen. Dort, im warmen Geruch von Stroh und Pferdedung, hielten wir uns bei den Händen. Unzertrennlich wollten wir sein.
„Aber die Hochzeit“, flüsterte ich, „was ist mit der Hochzeit?“
„Wir heiraten dich“, sagten die Zwillinge, „und dann gehören wir für immer zusammen.“ „Aber das geht ja nicht, das könnt ihr nicht, ihr seid doch meine Brüder.“
„Nein“, sagte Kastor, „nein, du irrst dich. Du bist nicht unsere Schwester. Mutter und Vater haben dich aufgezogen, aber du bist nicht ihr Kind.“
„Nein, bin ich nicht?“
Es klang verzaubert und wahr, was sie mir wispernd erzählten. Eine Göttin sei meine Mutter, eine Göttin mit dem furchtbarsten Blick der Welt, und von ihr stamme die unwiderstehliche Anziehungskraft meiner Augen.
„Verstehst du?“
„Nein, ich glaube euch nicht“, sagte ich und war doch schon fast überzeugt.
„Dann frag Klytaimnestra, wenn du uns nicht glaubst“, rief Kastor.
Er sprang auf und hielt mir die Hand hin. „Komm, wir suchen sie.“
Klytaimnestra sonderte sich von uns ab. Sie hasste mich von Anfang an, denke ich heute. Ich aber liebte sie hingebungsvoll. Überallhin rannte ich ihr nach, bis sie mich anzischte und verscheuchte. Ich war zu klein, es zu verstehen. Sie war hübsch, ein nettes Kind mit lockigen Haaren. Aber schön, nein, schön war sie nicht. Fast wie ein Bauernmädchen sah sie aus mit ihrer robusten Gestalt. Die Prinzessin war ich, von Anfang an. Das hat uns früh entfremdet, und jeden Tag setzte ich mich mit Unbehagen an denselben Tisch wie sie. Nun aber stolperte ich an Kastors Hand über die trockengesengten Wiesen, und der Himmel über uns war heiß und milchig und nahm kein Ende. Auf der Anhöhe zwischen den Olivenbäumen kauerte Klytaimnestra. Ihre schwarzen Augenbrauen verdunkelten ihr sonnenverbranntes Gesicht, und mit den Händen wühlte sie im trockenen Staub.
„Sag ’s ihr!“, rief Kastor ihr zu.
„Was?“, fragte Klytaimnestra zurück und warf ihren großen Kopf in den Nacken.
„Dass sie nicht unsere Schwester ist. Dass sie nicht zu uns gehört.“
Wir hielten an. Da erhob sich Klytaimnestra. Sie war größer als ich und erschien mir vor dem weißen Himmel noch riesiger. In ihrem Gesicht blitzte Triumph auf.
„So ist es“, sagte sie mit einem grimmigen Lächeln.
„Was ist so?“, fragte ich eingeschüchtert.
„Du bist ein Kuckuckskind, ein falsches Ei in der Brut.“
„Das kann nicht sein“, stammelte ich. Der Zauber war verflogen. Sie wollten nicht, dass ich zu ihnen gehörte. Sie wollten mich wegschicken, mich allein lassen, nun begriff ich es. Tränen traten mir in die Augen. Klytaimnestra lachte und rannte fort. Kastor aber umarmte mich.
„Bist du nicht glücklich?“, fragte er. „Jetzt können wir heiraten, und dann wird uns nie wieder jemand trennen können.“
Ich aber weinte nur, und die Tränen hörten nicht auf zu rinnen.
III.
Ich mag fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein, als mein Vater zum ersten Mal die Hochzeit erwähnte. Damals verstand ich nicht alles von dem Gespräch. Ich erinnere mich aber noch an Mutters versteinertes Gesicht und daran, wie Vaters Stimme immer ungehaltener wurde.
„Es ist nur zu ihrem Besten“, sagte er.
„Zu unserem Besten, willst du sagen“, entgegnete Mutter mit starrem Blick.
„Dann eben zu unserem Besten. Und zu ihrem Besten. Es ist das Beste für alle.“
Am Abend lag ich wach und konnte nicht schlafen. Ich rutschte aus dem Bett, trippelte mit nackten Füßen über die winzigen Steinplatten des Bodenmosaiks. Wie immer verlief ich mich und stand zuletzt hilflos weinend im Flur, bis Mutter kam und mich hochhob.
„Was ist denn, mein Sternchen? Kannst du nicht schlafen?“
Sie trug mich in ihr großes, weiches Bett und legte meinen Kopf an ihre duftenden Brüste.
„Versuch jetzt zu schlafen“, sagte sie und schloss die Augen.
Ich aber sah sie unablässig an, bis sie die Augen wieder öffnete.
„Was ist das Beste für alle?“, fragte ich.
Einige Momente lang blickte sie mich nur zärtlich an und streichelte mir über das Haar.
„Du bist ein hübsches Mädchen“, sagte sie mit sanfter Stimme. „Du bist sogar mehr als das. Du bist ein Wunder. Wer dich sieht, will dich immer um sich haben. Und bald wird niemand mehr ein Kind in dir erblicken. Männer werden kommen, aus allen Teilen der Welt. Helden und Könige werden es sein, einer mächtiger und glanzvoller als der andere. Sie werden dich besitzen wollen, um jeden Preis. Und dein Vater wird diesen Preis festsetzen, und er wird hoch sein. Aber das wird niemandem etwas ausmachen, so geblendet werden sie sein von deiner Schönheit. Und dann wird einer von ihnen, der den höchsten Preis zu zahlen bereit war, mit dir fortgehen. Und du wirst immer glücklich sein mit ihm bis ans Ende deiner Tage. Das wird wunderschön sein, nicht wahr, das wird doch wunderschön sein, Helena?“
„Ja, Mama, es wird wunderschön sein, bestimmt. Aber warum weinst du denn dann, Mama?“
IV.
Ich weiß nicht, ob meinen Brüdern jemals ernst war mit der Absicht, mich zu heiraten. Wir waren Kinder, und allein schon das Wort Hochzeit hatte einen verzauberten Klang für uns gehabt. Nun aber wurde das Wort eine Bedrohung und drängte sich in die Unbeschwertheit unserer Tage. Seit einem halben Jahr gingen die Boten schon bei uns ein und aus. Immer bedrängender wurden ihre Blicke, keinen Schritt tat ich mehr unbeobachtet. Es war, wie Mutter gesagt hatte. Die reichsten Könige, die mächtigsten Herrscher, die Männer mit den klangvollsten Namen schickten ihre Gesandten zu uns. Sie sollten meinen Wert schätzen, Maß nehmen an meiner Wohlgestalt. Nicht mehr lange, und ich durfte kein Kind mehr sein in ihren unersättlichen, gierigen Augen, nicht mehr lange, und die Könige selbst würden kommen, meine Hand zu umwerben.
„Sieh doch, wie du ihnen die Köpfe verdrehst“, flüsterten mir meine Gefährtinnen zu. „Nur deinetwegen sind sie gekommen.“
Ich zuckte die Schultern. Ich duldete, dass man mich umschmeichelte, saß den Künstlern Modell und ließ mich von den Dichtern besingen. Nichts davon war mir neu. Ja, ich war die schönste Blume im Garten der Götter. Die Morgenröte nach der längsten Nacht. Mein Atem ein Frühlingshauch, mein Mund stolzer und vollkommener als die Rosenblüte, das Haar ein gleißender Wasserfall. Worte konnten meine Schönheit nicht besingen, Bronze sie nicht nachformen, nichts kam mir gleich. „Ich weiß“, sagte ich manchmal mit einem Achselzucken und begriff nicht, warum ich mir damit den wachsenden Zorn und schließlich den Hass der anderen Mädchen zuzog. Längst hatten sie begonnen, sich zurechtzumachen. Sie banden sich Schleifen ins Haar, flochten es kunstvoll, legten sich zarte Schleier auf die Schulter. Am Abend standen sie in den Fenstern und sahen hinunter auf die jungen Männer, die ihre Pferde versorgten. Dieser und jener, tuschelten sie, gefalle ihnen besonders. Wie geschäftige Vögelchen flatterten sie durch die Räume, spielten mit koketten Gesten und Blicken. Ich tat nichts dergleichen und bekam dennoch zu hören, dass ich von Tag zu Tag schöner würde, unerreichbarer. Aber noch wollte ich ein Kind sein, und nichts anderes als ein Kind hatte ich im Sinn. Auf Händen wollte ich getragen und unablässig umsorgt werden, wollte mich mit süßen Früchten verwöhnen lassen und im Mittelpunkt stehen. Das genügte mir, und ich träumte mich nicht in romantische Geschichten voller Sonnenuntergänge und heimlicher Küsse. Alle anderen aber entfernten sich mehr und mehr von mir, entwuchsen unserer Kinderwelt, die zuletzt nur noch mich umfangen hielt mit ihrem schmeichlerischen Zauber.
V.
In der ersten Neumondnacht des Sommers entzündeten wir unsere Fackeln und zogen hinaus zum Tempel der Artemis. Wir waren prachtvoll geschmückt und trugen die Amulette der Göttin. Zum ersten Mal sollte ich den Zug anführen, und mir schlug das Herz bis zum Hals. Ich kannte die Tanzschritte nicht. Wohl hatte ich zugesehen, wenn Klytaimnestra und die anderen sie übten, selbst jedoch ließ ich es bereits nach wenigen Versuchen bleiben. Nun musste ich als Erste den Reigen eröffnen, und mir sank der Mut. Immer wieder führte ich die Hand an das Zeichen der Bärin, das mir Mutter um den Hals gelegt hatte. Vor dem Tempel erwarteten uns viele Schaulustige und reckten die Hälse. Ich verlangsamte meinen Schritt und tastete mit bebenden Fingern nach Klytaimnestra, die hinter mir war. Sie jedoch schlug meine Hand aus.
„Halt dich gerade“, fauchte sie mir zu. Ich hob den Kopf und biss mir auf die Unterlippe. Starr schritt ich weiter, meiner Beschämung entgegen. Schon hatten wir den Ort erreicht, wo die ersten Wartenden standen. Da ging ein Raunen durch die Menge. Ich, natürlich ich war es, die im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Um mich tanzen zu sehen, waren sie von weit her gekommen, Junge, Alte, alle, die der Ruf meiner Makellosigkeit erreicht hatte. Wie enttäuscht würden sie sein. Wir stellten uns auf. Während wir auf die Musik warteten, sah ich, wie die Wangen der anderen Mädchen sich wie in Hitze röteten. Der reiche Prunk ihrer Kleidung, der schwere Schmuck, das aufgetürmte Haar, die vielen Menschen, die ungewohnte Stunde, auch der Wein, den man uns vor dem Aufbruch gereicht hatte, erfüllten sie mit einem prickelnden Fieber. Nur ich war blass.
Dann erklang endlich die Musik. Ich hob etwas hilflos die Arme. Die anderen unterdessen begannen ihre Kreise zu drehen und mit wohlgesetzten Schritten den Raum zu durchmessen. Jede Bewegung ihrer Hände, jede Biegung der Hüften war vollkommen. Ich hingegen stand einfach da, sah fremd auf die Tänze der anderen und ließ die Arme sinken. Meine Augen brannten, Schleier traten vor meinen Blick. Jetzt nur nicht weinen! Ich zwang mich zu einem gequälten Lächeln, doch die Häme der anderen, die mich spöttisch umschwebten und bei jedem Schrittwechsel ihre Überlegenheit genossen, entging mir nicht. Die Zeit schien unendlich lang, bis die letzten Akkorde des Tanzes verklangen.
Und dann brauste der Applaus auf. Zuerst verhalten, dann immer lauter wogte ein Name über die Reihen hin: „Helena, Helena“. Blumen flogen mir zu, ich bückte mich nicht, sie aufzulesen. Wie erstarrt stand ich da. Um mich ein johlender, trunkener Taumel, in mir eine abgrundtiefe Stille und Ernüchterung. Es gab keine Beschämung, keine Niederlage für mich. Was ich auch tat, es würde sein wie immer.
Klytaimnestra und die anderen Mädchen hoben hastig die Blumen auf, dann schoben sie mich, die noch immer wie gelähmt war, durch die Menge. Unzählige Hände griffen nach mir, strichen über mein Haar, meine Haut, zerrten an meinen Kleidern. Im Gedränge der Leiber wurde mir schwindlig, blind ließ ich mich treiben, bis endlich ein Arm meine Schultern umfing und mir ein neuer Duft in die Nase stieg. Ich kannte den Mann nicht, der mir mit entschlossenen Gesten den Weg bahnte. Er war kräftig und untersetzt und sein Schweiß roch nach Wildheit, Kampf und Wein. Er führte mich nach draußen in die Dunkelheit. Hier war es still, und nur schwach drang das Geheul der Masse herüber. Der Mann ließ mich los und stand nun wortlos neben mir. Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen, sah nur diffus die groben Stoppeln seines Bartes. Aus dem Hintergrund trat ein zweiter, etwas größerer Mann. Die beiden sprachen miteinander. Sie sprachen mit fremdem Akzent, und das Blut in meinen Schläfen dröhnte in schweren Paukenschlägen.
„Magst du mit uns kommen?“, fragte der Mann, der mich aus dem Tempel geführt hatte. Er beugte sich leicht schwankend zu mir. Ich merkte ohne Ekel, er war betrunken.
„Ja“, rief der andere nicht minder berauscht, „ja, komm mit uns, wir brechen zu neuen Abenteuern auf.“
Nun lachten sie beide, lachten und umarmten einander.
„Wo sind die Pferde“, fragte dann der eine mit schwerer Zunge, „wo in aller Welt haben wir die Pferde gelassen?“
Sie wankten davon, und ich war allein. Es war stockdunkel. Jetzt zurückkehren zu den anderen, zum Lärm, zum Jubel, zum Neid? Ich suchte nach Sternen am Himmel, die mir raten konnten, doch ihr Licht war kalt. Da rannte ich fort, dorthin, wohin ich die Männer hatte gehen sehen. Sie standen noch bei ihren Wagen.
„Nehmt mich mit“, rief ich, „bitte, nehmt mich mit.“
VI.
Ich hatte meine Heimat noch nie verlassen, war kaum aus dem Palast meines Vaters herausgekommen. Sparta galt mir als Nabel der Welt, nun aber flogen wir mit glühenden Rädern über neues Land. Arkadien. Verzaubert klang der Name in meinen Ohren. Begierig blickte ich nach allen Seiten, suchte das Neue, das Andere in den Hügeln und Wäldern. Nur Schafe sah ich, die das gilbe Gras aus dem kargen Sandboden rupften, dazwischen müde und sonnenverbrannt Hirten, die Zwiebeln aßen.
„Bist du hungrig?“, fragte mich der Mann, mit dem ich fuhr. Ich schüttelte den Kopf. Wir hielten an. Seit unserem Aufbruch in der Nacht hatten sie nicht mehr gesprochen, und auch jetzt suchten sie vergeblich nach Worten. Die Männer hielten die Köpfe gesenkt, standen dicht beieinander, musterten mich unter den buschigen Wällen ihrer Augenbrauen. Sie waren wohl ratlos, was nun werden sollte. Ihr Rausch war verflogen. „Wo fahren wir denn hin?“, fragte ich endlich, um das Schweigen zu brechen. Sie zuckten die Schultern, schoben mit den Füßen kleine Steine auf dem Boden herum, bis der eine endlich murmelte: „Da vorne ist Tegea. Da können wir etwas essen.“
Plötzlich fühlte ich mich töricht. Einfach mit diesen Männer mitzufahren, deren Namen oder Herkunft ich nicht kannte und deren Worte mir in vielem unverständlich waren. Was würden sie sich zu Hause um mich sorgen. Vater, Mutter. Meine Brüder. Nur Klytaimnestra nicht, sie nicht, froh würde sie sein, froh, endlich die Schönste zu sein unter den Mädchen. Ja, es war gut, dass ich gegangen war. Trotziger Grimm loderte in mir auf. Unterdessen hatten wir die kleine Stadt erreicht.
„Warte hier“, sagte der Untersetzte. Ich nickte und ging zum Pferd, es zu streicheln. Unerbittlich stieg die Sonne in den Mittag, und ich sah weitum keinen Brunnen, aus dem ich hätte schöpfen können. Endlich kehrten die Männer zurück. Sie gaben mir zu trinken und reichten mir Brot und Käse. Während ich eilig große Bissen in mich hineinschlang, begann der Untersetzte zu sprechen.
„Es ist das Beste“, sagte er, „wenn wir dich nach Hause bringen. Deine Familie wird in Sorge sein.“
„Nein“, fiel ich ihm schmatzend ins Wort, „ich will nicht nach Hause, nie mehr. Ihr habt gesagt, ich darf mit euch mit!“
„Kind“, seufzte der Mann.
„Lass sie doch, Theseus“, wandte da sein Gefährte ein. „Wir bringen sie einfach zu deiner Mutter. Die kann sich dann um sie kümmern.“
Theseus grub seine Hände ins dichte Haar, das schon von weißen Strähnen durchzogen war.
„Ich weiß nicht“, sagte er und blickte mich zweifelnd an. Ich kaute unbeeindruckt weiter, wurde sogar zunehmend fröhlich. Endlich erlebte ich die Abenteuer, von denen Kastor und Polydeukes immer sprachen.
„Würde dir das denn gefallen?“, fragte mich Theseus endlich.
„Ist es weit?“, erwiderte ich zwischen zwei Bissen.
In den Tagen, die folgten, wuchs ich in eine neue Welt. Theseus und Peirithoos waren freundlich zu mir, lobten auch meine Anmut, verstummten jedoch bald, als ich sie bat, nicht mehr von meiner Schönheit zu sprechen. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich auf Reisen, und ich begann zu begreifen, was das bedeutete: beständig alles hinter sich zu lassen. Ich löste mein Haar, warf die schmückenden Spangen und Bänder von mir, badete in einem seichten und träg dahinrinnenden Fluss. Es war alles so einfach. Wenn wir zu essen hatten, aßen wir, wenn wir nichts hatten, hungerten wir. Tagsüber fuhren wir dahin, abends gingen die Männer auf die Jagd und nachts saßen wir beim Feuer und ich lauschte ihren Erzählungen. Theseus war ein Prahler, und ich liebte seine Geschichten. Von Riesen und Ungeheuern wusste er zu berichten, die er mit dem wuchtigen Schlag seiner Keule besiegt haben wollte. Intrigen, Giftmischereien, Irrfahrten flocht seine Stimme in den Schauder der Nacht, und oft lag ich danach noch lange wach und ängstigte mich mit wohligem Grusel. Irgendwann jedoch erreichten wir Aphidnai, das Ziel unserer Reise. Wie oft hatte Theseus von der Pracht seines Palastes, seiner Paläste gar, geschwärmt, den ausladenden Prunk beschrieben, mit dem er, königlichster der Könige, sich zu umgeben gewohnt war.
Seine Mutter Aithra empfing uns in einem einfachen Haus, bescheidener und bäuerlicher als alles, was ich in Sparta gekannt hatte. Sie war eine kleine, harte Frau mit wachen Augen, und nichts, schien es, konnte sie mehr überraschen.
„Wer ist das Mädchen?“, bellte sie harsch bei unserer Ankunft.
„Helena von Sparta“, sagte Theseus zufrieden und legte mir eine seiner großen Hände auf die Schulter.
„Die Prinzessin?“, fragte Aithra und gab sich die Antwort selbst, „natürlich die Prinzessin, wer sonst. Kommt herein.“
VII.
Keine Bediensteten, keine Köche, keine Stallknechte oder Gärtner, nur eine kleine alte Frau, die mit krummem Rücken den Hof fegte, das war das attische Aphidnai für mich. Aithra verrichtete alles allein, kochte, wusch, versorgte das wenige Vieh. Am Abend webte sie oder flickte an zerschlissenen Kleidern herum. Ich fühlte mich wohl bei ihr und bedauerte es nicht, als Theseus und Peirithoos schon nach wenigen Tagen wieder zu neuen Fahrten aufbrachen, übermütig und lärmend wie Kinder.
„Ruhm“, sagte Aithra, „Ruhm bedeutet ihnen alles.“
„Warum?“, fragte ich. Aithra antwortete nicht gleich, zog nur die Brauen hoch.
„Haben sie dir von der Hochzeit erzählt?“, entgegnete sie endlich.
„Vom Kentaurenkampf?“
Aithra lachte auf. „Ja, Kentauren, die können sie bekämpfen.“
Sie schüttete die Milch, die sie aus ihren Ziegen herausgemolken hatte, in den Kessel. Viel war es nicht, doch zu einem Klümpchen Käse würde es reichen.
„Frauen, mit denen geht es nicht. Mit denen kommen sie nicht zurecht.“
Sie setzte sich auf einen kleinen Schemel, rieb sich die Augenbrauen.
„Am Ende sind wir immer allein, Kindchen“, sagte sie. „Sie lassen uns irgendwo zurück. Mit Kindern, ohne Kinder. Sie gehen einfach. Wir sind ihnen unheimlich. Zu schön. Zu verliebt. Zu stark. Zu undurchschaubar. Sie machen Hexen aus uns oder Göttinnen, oft sogar beides. Sie fürchten uns, wenn wir sie brauchen. Sie hassen uns, wenn sie uns brauchen. Egal, wie: Wir verlieren. Am Ende sitzen wir auf unseren Inseln und warten auf den Nächsten oder auf keinen mehr, und sie fahren hinaus und werden wieder zu den Helden, die sie mit uns nicht sein können.“
Sie sah auf, zu mir herüber.
„Du“, sagte sie nach einer Pause, „du bist die Göttin. Noch bist du die Göttin. Deswegen verstehst du mich nicht. Aber irgendwann ...“ Ihr Blick glitt ab, floh über die Hügel. „Irgendwann. Bald.“
Ich wurde ruhig bei Aithra. Ihre raue, arbeitsverschlissene Haut, ihr stumpfes, schütteres Haar ließen mich meine Schönheit vergessen. Ganze Tage durchstreifte ich den Garten, die mageren Wiesen und geizigen Felder, summte leise vor mich hin, pflückte gedankenverloren strohharte Halme aus dem Gras. Selten begegnete ich Menschen. Sie mieden mich. Sie wussten, wer ich war, und lebten in Furcht. Meine Brüder, munkelten sie, würden kommen und mich befreien, bis an die Zähne bewaffnet, zwei übermenschliche Helden in schrecklicher Schönheit. Sie würden alles niedermachen, was sich ihnen in den Weg stellt, die Tyndariden, die Prinzen von Sparta. Unbesiegbar, unsterblich wie Göttersöhne würden sie sein, die Zwillinge, die erwählten Knaben des Zeus, die Dioskuren. Von Tag zu Tag wuchs der Ruf ihrer Stärke, von Tag zu Tag wurden ihre Namen reicher ausgeschmückt.
„Ist das“, fragte ich spottend, „der berühmte Witz der Attiker, von dem ich so oft gehört habe? Ein schepperndes Gebäude hohler Worte, schwindelerregend aufgetürmt, um Angst zu säen und Schrecken?“
Aithra zuckte die Schultern. „Was ist schon die Wirklichkeit? Wir kennen sie, solange sie vor unseren Augen liegt. Kehren wir ihr den Rücken, was bleibt uns dann? Nichts als Worte. Auch von dir, Helena, Prinzessin Lakoniens, Schönste der Schönen, wird einst nichts anderes mehr bleiben. Aber das braucht dich nicht zu betrüben. Nie wirst du schöner sein als in deinem Nachruhm. Deine Brüder werden die Höhen des Olymp erklimmen. Auch mein nichtsnutziger Sohn Theseus wird mit den Jahren mächtiger und mächtiger werden, sich aufblähen zum größten Helden seiner Tage. Selbst ich werde dann eine Königin sein in einem goldenen Palast. Und wenn das so ist, bin ich es dann nicht jetzt schon?“
VIII.
Kastor und Polydeukes kamen tatsächlich. Staubbedeckt, mit wunden Füßen standen sie eines Tages vor dem Tor. Aithra trug Schüsseln mit Wasser herbei, damit sie sich waschen konnten.
„Hier finden wir dich“, seufzten die Brüder, als ich sie umarmte.
„Seid ihr allein gekommen?“, fragte ich erstaunt. „Unser Vater, der König, hat euch keine Eskorte zur Seite gestellt?“
„Nein. Das wollten wir nicht. Zu zweit sind wir beweglicher und weniger auffällig. Und zudem ...“ Sie wechselten Blicke. „Wir sind keine Kinder mehr, Helena.“
Als sie das sagten, begann ich zu weinen. Meine Brüder erschraken.
„Was ist los? Was hat dich verletzt?“
Ich wusste es selbst nicht und schwieg. Ich war noch zu sehr Kind, um den Schmerz über die verlorene Kindheit benennen zu können.
Polydeukes strich mir mitleidig über das Haar.
„Was haben sie dir nur angetan?“
Ich lachte unter Tränen auf.
„Nichts, nichts haben sie mir angetan. Mir geht es gut.“
Polydeukes schüttelte den Kopf.
„Du brauchst nicht zu lügen. Wo sind sie?“
„Wer?“
„Die Männer, die dich entführt haben.“