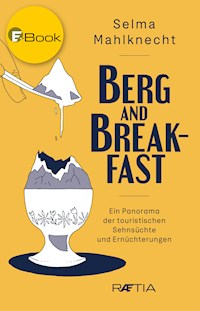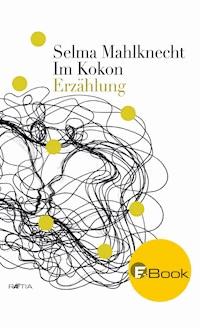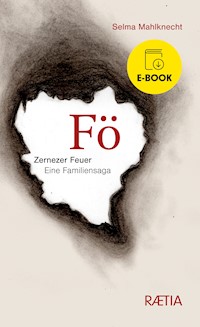
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Raetia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Nona kann den Gestank noch riechen. Die verkohlten Balken, Kissen, Tische, der kleine Hausrat eines bescheidenen Lebens, aufgezehrt von den Flammen. Fö, das Feuer, hat ein ganzes Dorf zerstört. Die Tochter weiß nichts davon. Aber eine Furcht vor dem Feuer ist ihr geblieben. Über fünf Generationen erzählt Selma Mahlknecht die Geschichte einer Familie, startend mit dem großen Brand 1872 bis hin zur Entwicklung von Zernez als Tourismusort. •kurzer, spannender Generationenroman •gekonnte Verknüpfung von Familien- und Tourismusgeschichte •ein Bergdorf zwischen Ein- und Abwanderung •Schauplatz romanische Schweiz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Selma Mahlknecht
FöZernezer Feuer
Eine Familiensaga
Mit freundlicher Unterstützung der Gemeinde Zernez
© Edition Raetia, Bozen
1. Auflage, 2023
Grafisches Konzept: Dall‘O & Freunde
Illustrationen und Umschlagbild: Anja Streit
Lektorat und Korrektur: Helene Dorner, Katharina Preindl
Druckvorstufe: Typoplus
Printed in Europe
ISBN: 978-88-7283-871-6
ISBN E-Book: 978-88-7283-874-7
Unser Gesamtprogramm finden Sie unter www.raetia.com.
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an [email protected].
Inhalt
Über dieses Buch
Prolog: IL PRÜM FÖ
LA LINTERNA
LA SBRINZLA
LAS CHANDAILAS
LA CHADAFÖ
LA FUSCHELLA
Epilog: LA TSCHENDRA
Glossar
Wohltätig ist des Feuers Macht,
Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht,
Und was er bildet, was er schafft,
Das dankt er dieser Himmelskraft,
Doch furchtbar wird die Himmelskraft,
Wenn sie der Fessel sich entrafft,
Einhertritt auf der eignen Spur
Die freie Tochter der Natur.
Wehe, wenn sie losgelassen
Wachsend ohne Widerstand
Durch die volkbelebten Gassen
Wälzt den ungeheuren Brand!
(Friedrich Schiller, Lied von der Glocke)
Über dieses Buch
1872 zerstörte ein verheerender Brand das Dorf Zernez im Engadin. Von 145 Häusern blieben nur 27 unversehrt. Die Details dieses epochalen Ereignisses hat der Historiker Paul Eugen Grimm in einer lesenswerten Gedenkschrift zum 150. Jahrestag dokumentiert.
Der Brand bedeutete aber nicht das Ende von Zernez. In den darauffolgenden Jahren wurde es wiederaufgebaut und entwickelte sich zu einer florierenden Gemeinde. Immer wieder gab es historische Einschnitte, wenn auch nicht von der zerstörerischen Tragweite des Dorfbrandes. Um aber auch diese Zeit, die bis in unsere Gegenwart führt, in unser Gedächtnis zu rufen, entstand die Idee eines literarischen Werks, das anhand verschiedener Geschichten ein lebendiges Bild der Vergangenheit zeichnet. Initiator dieses Vorhabens war Michael Schnieper, der beim Kulturkoordinator der Gemeinde Zernez Fabian Schorta ein offenes Ohr fand. Dieser war es auch, der das Projekt an mich herangetragen hat.
Als Wahlzernezerin, die seit zehn Jahren hier lebt, ehrte mich der Auftrag der Gemeinde. Zugleich war mir bewusst, wie anspruchsvoll er war. Von Anfang an war mir klar, dass ich keine historisch präzise Chronik von Zernez abliefern konnte. Die fünf Geschichten der Familiensaga, mit denen die Jahrzehnte bis in unsere Tage überspannt werden, sind allesamt fiktiv, die Figuren erfunden. Und doch könnte es sich so oder so ähnlich ereignet haben. In allen Erzählungen spielt Feuer in verschiedensten Formen eine zentrale Rolle – doch diesmal keine vernichtende, sondern eine positive. Damit soll daran erinnert werden, wie nahe Glück und Leid, Jauchzen und Schluchzen liegen. Dieses Werk soll aber auch ein Denkmal der Widerstandskraft sein, mit der Menschen selbst das schlimmste Unglück überwinden.
Ein solches Vorhaben erfordert eine eingehende Recherche. Das Internet und meine Privatbibliothek halfen mir hier nur bedingt weiter, ich konnte mich aber auf zahlreiche Leihgaben und Hinweise aus dem Gemeindearchiv von Zernez sowie von Freunden und Bekannten stützen. Hier geht ein großes Dankeschön an Daniela Denoth, Angelika Kaserer, Curdin Lansel, Claudine und Christoph Nagy, Fernanda Pinto Ribeiro Dos Santos und Rico Zala.
Zugleich war es mir ein Anliegen, aus den Geschichten und Erinnerungen der Zernezerinnen und Zernezer selbst zu schöpfen, um daraus Zeitgeist und Atmosphären zu gewinnen. Ich stieß auf einen Schatz, den ich nur zu einem Bruchteil in meinem Buch festhalten konnte. Ich hoffe, es wird in Zukunft noch weitere Gelegenheiten geben, dieses wertvolle Wissen und Gedächtnis für kommende Generationen zu bewahren.
Mein Dank gilt allen, die sich Zeit für dieses Projekt genommen und ihre Gedanken und Erinnerungen mit mir geteilt haben: Reto Lehner, Burtel Oprandi, Anja Streit, Joos und Monika Toutsch, Domenic Toutsch.
Ganz besonders danke ich Frau Ulrica Guidon, die das Projekt von Anfang an mit ihrem Scharfsinn begleitet und alle meine Geschichten mit kritischem Blick gelesen hat. Unzählige Stunden habe ich bei ihr verbracht und mit ihr über Arten des Feuermachens und den unergründlichen Geist der Zernezer philosophiert. Auch nach Abschluss dieses Buches wird uns der Gesprächsstoff nicht ausgehen.
Prolog
IL PRÜM FÖ
Wir wissen nicht, was die ersten Menschen empfanden, die das Gebiet betraten, auf dem heute Zernez liegt. An der Kreuzung zweier Hochalpentäler, dort, wo zwei Ströme zusammenfließen, von dichten Wäldern umgegeben und von Winden gepeitscht, wo die Winter lang und hart sind und die Sommer kurz und trügerisch – hier lockte kein einfaches Leben. Sich hier niederzulassen, bedeutete, den Kampf aufzunehmen: mit den rauen Elementen, der unberechenbaren Natur, den wilden Tieren. Es war kein romantisches oder idyllisches Dasein, der Alltag war hart, die Arbeit in den Wäldern und auf den Feldern anstrengend und gefährlich. Das war den Menschen bewusst, sie kannten es nicht anders. Und doch dürfen wir uns die Menschen der Vergangenheit nicht als traumlos und verhärtet vorstellen. Sie waren bodenständig, aber gemütvoll. Sie waren leidenschaftlich und phantasiebegabt, sie schmiedeten Pläne und sangen Lieder, sie tanzten und lachten und erzählten einander die tollsten Geschichten.
Schon die allerersten Menschen, die ihr Lager im Wald errichteten, setzten sich am Abend gemeinsam um das Feuer, das sie gegen die Dunkelheit, die Kälte und gegen die Bären und Wölfe entfacht hatten. Sie wärmten sich an den Flammen und vergaßen die Anstrengungen des Tages.
Sie errichteten Häuser aus Holz und Stein, bauten Brunnen und befestigten Straßen. Sie bestellten das Land und hielten Tiere, sie fällten Bäume und trieben Handel. Immer begleitete sie das Feuer, das ihnen Licht spendete, mit dem sie ihr Essen zubereiteten und dem Winter trotzten. Mit dem Feuer erschufen sie ihre Welt: die reale Welt um sie herum und die erdachte Welt in ihren Köpfen, und die eine Welt konnte ohne die andere nicht entstehen. Es war ein Spiel mit dem Feuer, ein stetiges Abstecken und Verschieben der Grenzen. Und wie oft sich die Menschen auch die Finger verbrannten, sie wagten immer wieder Neues. Was gelang, veränderte die Welt. Was scheiterte, wurde Teil der Geschichten, die zu erzählen waren. Nichts ging verloren, aber alles verwandelte sich.
Heute ist Zernez nicht mehr das Dorf, das es vor 150 Jahren war, als der große Brand es verwüstete. Es ist größer geworden, stattlicher. Das Feuer schreckt uns nicht mehr, wir haben es gezähmt – endgültig, möchten wir glauben. Doch in jeder Flamme, die am Zündholz tanzt, mit jedem flackernden Kerzenlicht, aus jeder Feuerstelle, ja aus jedem springenden Funken wispert uns eine Stimme zu, die aus Jahrtausenden kommt. Das Feuer ist ein großer Erzähler. Es begleitet unser Leben von Anfang an und es umspannt die gesamte Menschheitsgeschichte. Es weiß von uns, es kennt unsere Träume und unsere Schwächen. Es hat unseren Untergang gesehen und unsere Wiedergeburt, und es wird selbst immer aufs Neue wiedergeboren. Mehr als in jedem anderen Element erblicken wir im Feuer uns selbst. Es verrät uns, wer wir sind – und wer wir immer schon waren, seit jenem ersten Feuer, das in der Nacht loderte.
LA LINTERNA
Es gibt ein lautes Weinen und ein leises Weinen.
Das laute Weinen ist bohrend, schrill und dringt durch alle Wände. Säuglinge weinen so und Kleinkinder: verzweifelt, fordernd, wütend, gefangen in ihrer Sprachlosigkeit. Auch Erwachsene können so weinen, aber nicht aus kindischen Launen heraus. So weinen sie nur im Moment des größten Schmerzes, wenn sie das Liebste verlieren. Wie ein tierischer Schrei, ein rohes Gebrüll bricht es aus der Brust, unbeherrscht und unbeherrschbar, eine Naturgewalt. Schrecklich ist dieses Weinen, aber schrecklicher ist, was ihm folgt: die Stille danach. Wie Blei wiegt diese Stille, und noch schwerer auf schmalen Kinderschultern.
Braida trägt diese Stille mit geradem Rücken. Sie presst die Zähne zusammen. Keine Tränen. Schon gar nicht am Brunnen beim Wasserholen, wenn die anderen Mädchen sie fragend mustern. Gleichmütig schleppt sie die schweren Eimer mit ihren dünnen Armen, schleppt sie zurück zum Haus, das aus schmalen, schwarzen Fenstern kalt auf sie hinabstarrt. Dann geht sie noch ein bisschen gerader, macht sich noch ein bisschen größer, und sie reckt trotzig das Kinn nach vorn. Sie wird das Haus schon unterkriegen. Sie fürchtet sich nicht vor seiner hohen Stirn und sie schämt sich nicht für das flache Dach. Ein Schandfleck seien die neuen Häuser, murren die von Röven und Runatsch, die der Brand verschonte. Ihre Häuser sind warm und breit, Sonnen tanzen auf ihnen. Hier hält sich der alte Glanz des Dorfs. So müsste es sein. In Braidas Straße ist es nicht so. Aber Braida kennt es nicht anders. Ein Dach über dem Kopf ist ein Dach über dem Kopf, sagt der Vater. Und schon dieses hier hat ihn genug Wiesen gekostet.
Die nona kann den Gestank noch riechen. Die verkohlten Balken, Decken, Kissen, Vorhänge, Betten, Tische, Stühle, der kleine Hausrat eines bescheidenen Lebens, aufgezehrt von den Flammen. Braida weiß nichts davon. Sie kennt nur den Geruch der Kühe und Ziegen, den Geruch der Kartoffeln im Topf und den Geruch der nona, der sie so gern auf dem Schoß saß, als sie noch klein war. Aber eine Furcht vor dem Feuer ist ihr geblieben, eine Angst vor den springenden Funken, die pocht ihr im Blut. Und in ihren Ohren gellt noch der Schrei, der schreckliche Schrei, der ihr Leben zerriss in ein Davor und Danach. Doch sie lässt sich nicht beugen. Nicht von der Angst und nicht von der Stille. Stark ist sie, Braida, und stolz. La superbgia wird sie bald genannt, die Hochmütige, hinter ihrem Rücken tuscheln sie. Sollen sie. La superbgia zuckt nur mit den Schultern. Was kümmert sie das Geschwätz im Dorf.
Es gibt ein lautes Weinen und ein leises Weinen.
Das leise Weinen gräbt sich nach innen, ätzend wie Gift. Das leise Weinen verhärtet die Gesichtszüge und nimmt das Licht aus den Augen. Das leise Weinen macht einsam. Es ist so still in der Stube. Die Pendeluhr tickt. Die Mutter sitzt über ihr Flickwerk gebeugt. Der Vater stopft seine Pfeife. Die nona lässt das Spinnrad surren. Das Brüderchen liegt in der Wiege, ganz reglos, wie tot. Braida wirft die Zöpfe zurück und beugt ihr Ohr zu dem kleinen Gesichtchen. Atmet es noch?
„Braida!“
Der scharfe Ruf der Mutter lässt Braida zusammenzucken.
„Nimm Nadel und Faden, und hilf mir.“
Sie sehnt den Winter herbei. Ganz will sie sich in seine Dunkelheit hüllen und in sein weiches Schweigen. Die Kühe stehen warm und dampfend im Stall, das Schwein grunzt hinter dem Gitter. Bald wird es geschlachtet. Es stirbt einen guten, gesunden Tod zur rechten Zeit. Es wird Würste geben. Der Vater hat schon den Metzger bestellt. Braida lächelt, schon hat sie den Geschmack der geräucherten liongias im Mund. Aber wenn sie dem Blick der Mutter begegnet, senkt sie beschämt die Augen. Ein Glück, dass der Schnee fällt und seine weißen Schleier zwischen sie wirft. Ganz einschneien lassen möchte sie sich, ganz kalt und starr und still werden, unsichtbar, und nichts mehr sehen von der Welt als den gnädigen Schnee.
Wenn nicht die Wege wären am Morgen durch die Finsternis und das gefrorene Wasser der Waschschüssel, wenn die Eisblumen am Fenster nicht wie geklöppelte Spitzen von Brautkleidern aussähen, sie könnte alles vergessen und in einem endlosen Moment des Stillstands verloren gehen. Muss denn der Frühling kommen? Muss man denn älter werden? Schon wieder drücken die Schuhe und waren doch eben erst neu und ein bisschen zu groß. Die nona strickt einen breiten Rand an die Ärmel der guanella, „jetzt geht’s wieder für ein paar Monate“. Und Braida sagt Dank. Und ist ganz erschrocken. Wo soll das noch hinführen?
Carli, das Brüderchen, wächst aus der Wiege heraus. Es dreht seinen großen Kopf mit den roten Backen und gluckst, wenn es Braida sieht. Die hält ihm die Hand vor den Mund, „sei nur ruhig“. Der Vater duldet kein Geschrei mehr im Haus und die Mutter wird steingrau unter dem Kopftuch. Die nona tunkt ein Stoffsäckchen mit Gerstenkörnern in Arvenschnaps und schiebt es dem Brüderchen in den Mund.
„Dorma.“
Und Carli verdreht die Augen, sinkt zurück ins Bettchen und liegt so still, so still.
Nachts vor dem Zubettgehen trinkt Braida verstohlen aus der Flasche, zwei, drei hastige Schlucke, die im Hals und im Magen brennen. Schließt die Augen. Faltet die Hände. Schlaf, sagt sie sich, schlaf, und wach nicht mehr auf.
Kurz vor dem Heuen stürzt der Vater die Treppe hinunter. Bricht sich das Bein. Sitzt fassungslos in der Küche, sieht niemanden an. Die Mutter schweigt. Braida schneidet die Zwiebeln. Carli nuckelt am Tuch. Nur die nona wischt sich die mehligen Hände an der Schürze ab und sagt: „Wir müssen jemanden holen. Es geht sonst nicht.“
Der Bursche aus Bergamo steht breitbeinig im hohen Gras. Er schwingt die Sense. Er gibt den Takt vor wie sonst der Vater. Seine Arme sind braun gebrannt und kräftig. Braida kann sich nicht sattsehen. Dieses Gesicht! Die Lippen wie zu einem beständigen Lächeln geschwungen – und diese kleinen, fröhlichen Augen! Dass einer so strahlen kann. Als fiele ihm alles ganz leicht. Er spricht eine seltsame Sprache, ein Gemisch aus Bergamasker Dialekt und romanischen Brocken, die er sich im Dienst bei den Bauern abgehört hat, mehr Melodie als Bedeutung. Aber irgendwie macht er sich schon verständlich. Viel zu reden gibt es ohnehin nicht, umso mehr aber zu tun.
Wie er anpacken kann! Braida wird beim Zusehen schwindlig.
„Der arbeitet für zwei“, sagt die nona. „Und frisst für drei“, knurrt der Vater. Ja, Appetit hat er, der Bergamaske. Er isst mit großen Bissen, laut schmatzend, als wolle er zeigen, wie sehr es ihm schmeckt. Überhaupt ist er ein Lärmer, bei ihm hat alles ein Geräusch, selbst das Schlafen. „Il fracasch“ nennt ihn der Vater, den Krach. Die Mutter mag Fracasch nicht, sie verzieht den Mund, wenn er sich dicke Scheiben vom Brot schneidet. Die nona