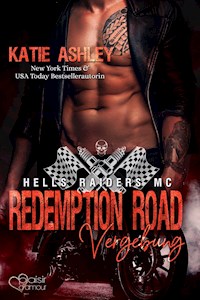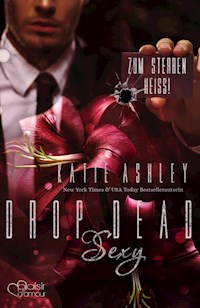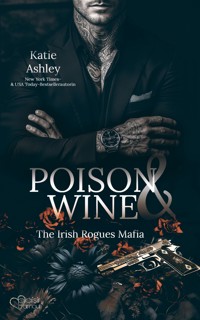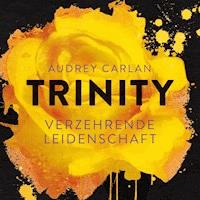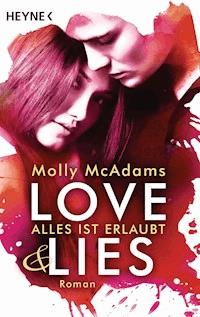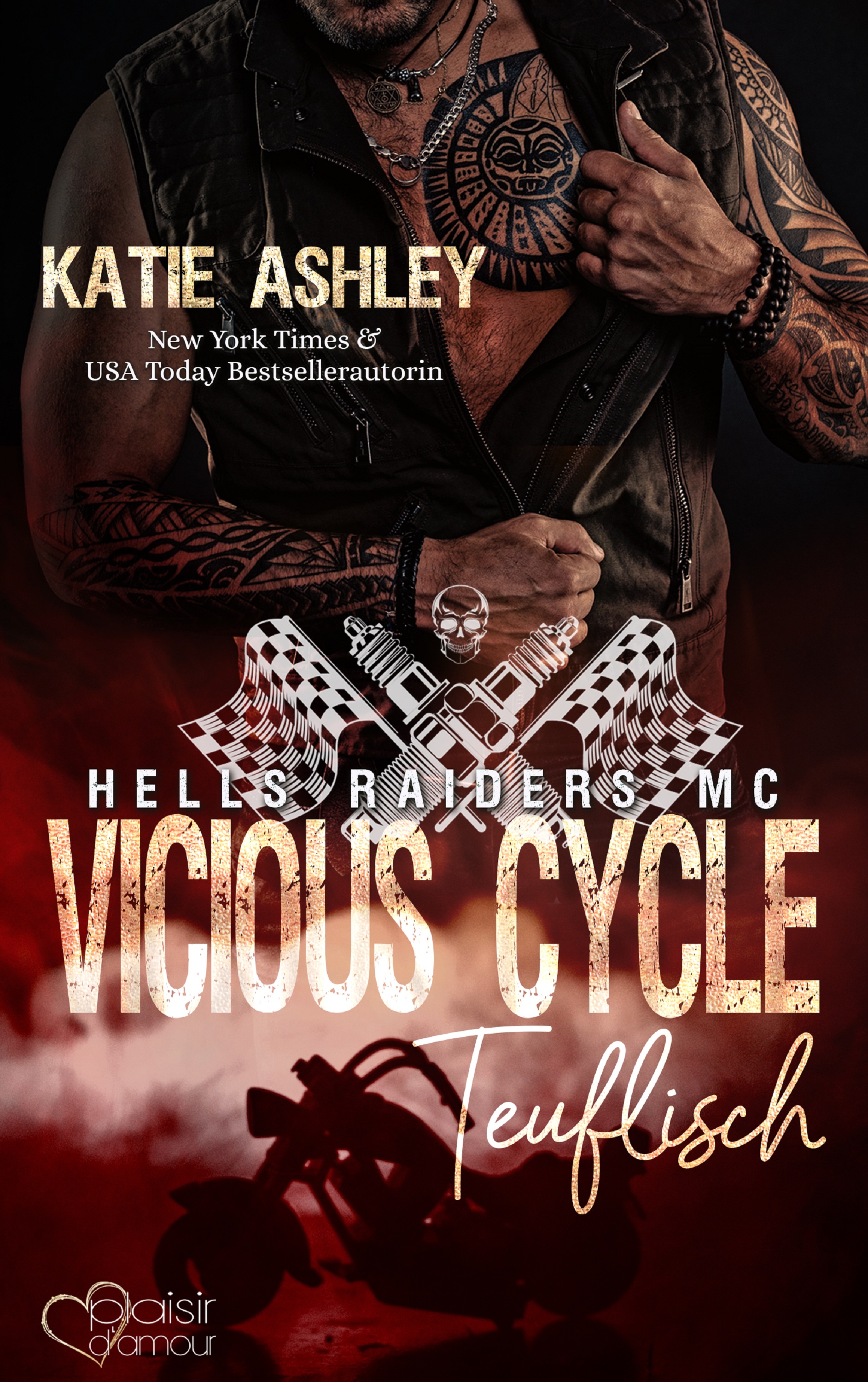
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Plaisir d'Amour Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Hells Raiders MC
- Sprache: Deutsch
David "Deacon" Malloy hat sich mit Haut und Haar dem Hells Raiders Motorcycle Club verschrieben. Bereits als Teenager fiel er auf der Straße durch seine Kampfkünste auf und er schätzt den gewalttätigen Lebensstil seiner neuen Familie. Nachdem sein Adoptivvater während des letzten Bandenkrieges ermordet wurde, schlüpft Deacon in die frei gewordene Rolle des Sergeant at Arms des Clubs. Doch dann gerät seine Welt aus den Fugen, als eine ehemalige Clubhure stirbt und er plötzlich Vater eines fünfjährigen Mädchens ist, von dessen Existenz er bis dahin nichts wusste. Das Unterrichten wurde Alexandra Evans von ihren Eltern in die Wiege gelegt. Mit viel Engagement bringt die Kindergärtnerin ihren kleinen Schülern Lesen und Schreiben bei. Besonders ans Herz wächst ihr die traurige und liebesbedürftige Willow Malloy. Als Willow plötzlich nicht mehr in den Kindergarten kommt, macht sich Alexandra auf die Suche nach ihr. Was sie vorfindet, ist ein Clubhaus voller Biker inmitten eines aggressiven Revierkampfes! Sobald Deacon Alexandra zum ersten Mal sieht, will er sie haben. Es ist ihm vollkommen gleichgültig, dass sie eine unschuldige Zivilperson ist und keinerlei Interesse daran hat, die Eroberung eines gefährlichen Bikers zu werden. Bislang hat er noch jede Frau bekommen – und nun will er Alexandra in seine dunkle Welt entführen … Teil 1 der Hells Raiders MC-Trilogie von New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin Katie Ashley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Hells Raiders MC: Vicious Cycle: Teuflisch
Katie Ashley
Aus dem Amerikanischen ins Deutsche übertragen von Joy Fraser
© 2015 by Katie Ashley unter dem Originaltitel „Vicious Cycle (A Vicious Cycle Novel Book 1)“
© 2020 der deutschsprachigen Ausgabe und Übersetzung by Plaisir d’Amour Verlag, D-64678 Lindenfels
www.plaisirdamour.de
info@plaisirdamourbooks.com
© Covergestaltung: Sabrina Dahlenburg (www.art-for-your-book.de)
© Coverfoto: Shutterstock.com
ISBN Taschenbuch: 978-3-86495-457-3
ISBN eBook: 978-3-86495-458-0
This edition is published by arrangement with Berkley, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Random House LLC.
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Danksagungen
Autorin
Widmung
Für Olivia Caroline Ash – die lang erwartete Antwort auf meine Gebete, mein kleines Wunder, meine Tochter. Auf dass du so stark, keck und süß wirst wie die Frauen, die ich schreibe, und auf dass du niemals mit schlimmen Jungs ausgehst, wie die in Mamas Büchern.
Und für Charlie Hunnam, denn ohne ihn und Sons of Anarchy wäre dieses Buch nie geschrieben worden.
Prolog
Willow
Fröhlich wippte Willow mit den Beinen auf der abgenutzten Ledercouch und verfolgte Doras Cartoon-Abenteuer im Fernsehen. Egal wohin es in der Zeichentrickserie ging, alles war besser als das heruntergekommene Apartmenthaus, in dem Willow lebte. Bei dem Geräusch von zersplitterndem Glas auf dem Küchenboden verließ Willow Doras Welt, klemmte sich ihren abgegriffenen Teddy unter den Arm und rannte aus dem Wohnzimmer. Obwohl sie erst fünf war, wusste sie nur allzu gut, was nach den wütenden Stimmen und dem Herumwerfen von Dingen kam. Sie hatte gelernt, die Zeichen zu lesen, und traurigerweise irrte sie sich nie. In dem kleinen Apartment, in dem sie mit ihrer Mama lebte, gab es nicht viele Versteckmöglichkeiten. Doch an einem bestimmten Ort konnte sie verlässlich dem Sturm der Gewalt ausharren.
Für andere Kinder ihres Alters waren die dunklen Untiefen unter dem Bett ein Ort des Schreckens. Doch für Willow war der bekannte Horror, der sie oft umgab, viel schlimmer als das Unbekannte.
Sie hob die ausgeblichene Tagesdecke aus blauen und weißen Flicken an und kroch über den schäbigen Teppich unter die eklige Matratze, die nach Rauch und Pipi stank. Wollmäuse klebten an ihren Kleidern, verstopften ihre Atemwege und machten das Luftholen schwer.
Als sie es sich einigermaßen bequem gemacht hatte, kniff sie die Augen zu und stellte sich vor, weit, weit fort zu sein. Immer wenn sie Angst hatte, ging sie zu ihrer Engelsmama. In deren Welt war man glücklich, alles war schön und rein. Regenbögen erstreckten sich am Himmel über Schlössern voller Einhörner. Doch das Beste daran war Engelsmama selbst. Sie trank niemals zu viel aus den Flaschen mit der dunklen Flüssigkeit, die ihre echte Mama erst wütend und dann traurig machte. Engelsmama hatte auch keine Männer, die Willow anbrüllten oder ihr ins Gesicht oder auf den Po schlugen. Für Engelsmama bedeutete Willow alles. Sie konzentrierte all ihre Liebe und Aufmerksamkeit auf Willow. Stundenlang spielten sie zusammen, rannten über die grünen Wiesen oder spielten Verstecken in einer Burg auf den Hügeln.
Vor zwei Jahren zu Weihnachten hatte sie zum ersten Mal von der Engelsmama geträumt. Nachdem ihre echte Mama von der bösen Flasche getrunken und ihr Freund sich selbst mit der angsteinflößenden Nadel gestochen hatte, hatten sie begonnen, sich anzuschreien. Zusammengekauert auf dem Sofa hatte Willow versucht, sich hinter den Couchkissen zu verstecken. Als Mama und ihr Freund immer lauter wurden, fingen sie an, sich gegenseitig zu schubsen. Mama stolperte über einen von Willows Schuhen, schwankte und fiel in den kleinen Weihnachtsbaum, der in der Ecke stand. Kugeln und Schmuck zerbrachen und verteilten sich über den Boden.
Nachdem Mama Willow angebrüllt und ihr den bösen Schuh ins Gesicht geworfen hatte, versuchte Willow, die Sauerei aufzuräumen, damit Mama weniger wütend war. Ein Engel in einem langen weißen Kleid war nicht zerbrochen. Er hatte weiches, dunkles Haar, das man wie bei einer Puppe streicheln konnte. Außerdem hatte er beruhigende braune Augen, die Willow die Sicherheit gaben, nach der sie sich verzweifelt sehnte. Willow passte auf, dass Mama nicht sah, dass sie den Engel nahm. Seit diesem Tag behielt Willow den Weihnachtsschmuck, den sie Engelsmama nannte, immer dicht bei sich.
Unter dem Bett griff sie in die Tasche ihrer Shorts, wo Engelsmama nur darauf wartete, sie zu trösten. Das Geschrei im Wohnzimmer wurde lauter und Willow streichelte das Haar des Engels.
Als sie sich die Finger in die Ohren stecken wollte, wurde die Haustür aufgerissen und knallte an die Wand, so wie wenn Mamas Freund wütend nach Hause kam. Noch mehr Stimmen. Noch mehr Geschrei. Noch mehr Glasscherben. Es klang, als ob sie das Wohnzimmer auseinandernähmen.
Mama flehte jemanden an. In einem Tonfall, den Willow so nicht kannte. Sie klang ängstlich, doch normalerweise hatte Willow Angst, nicht ihre Mama.
Bumm, bumm, bumm.
Bei dem Geräusch begann Willow so stark zu zittern, dass ihre Zähne klapperten. Sie versuchte herauszufinden, woher dieses Geräusch kam. Waren es Stiefelschritte? Mama mochte es nicht, wenn Willows Schuhe laut waren.
Mit nun klammen Fingern wischte sie sich die Nase ab. Sie hielt die Luft an und betete zur Engelsmama, dass der Mann mit den Stiefeln sie nicht finden würde. Doch noch während sie die Worte im Geiste wiederholte, betrat der Mann ihr Zimmer. An der Größe der Füße erkannte sie sofort, dass es sich um einen Mann handelte. Er ging zum Wandschrank. Kleider und Spielsachen landeten auf dem Boden, während er sich durch ihren spärlichen Besitz wühlte, als ob er etwas ganz Bestimmtes suchte.
Dann machte er sich über die Kommode her. Eine Schublade nach der anderen wurde ausgekippt. Als eines der leeren Schubfächer sehr nah an ihrem Kopf landete, zuckte sie zusammen und stieß sich den Kopf an der Matratze an. Ihr entkam ein Quieken. Bei dem Geräusch hielt der Mann inne.
Willows Herz überschlug sich fast und sie konnte kaum noch atmen. Sie krabbelte, so weit sie konnte, unters Bett, doch da wurde die Matratze über ihr weggerissen. Willow schrie auf und starrte den Mann an, der wie ein Abbild aus ihrem schlimmsten Albtraum aussah. Mit langen, strähnigen schwarzen Haaren, einer widerlichen Narbe im Gesicht, die bis zu seinem Nacken reichte, und einer Augenklappe. Willow kniff die Augen fest zu. Bitte, bitte, hilf mir, Engelsmama!
Doch der große Stiefelmann schnappte sich Willow und warf sie sich über die Schulter. Sie konnte kaum atmen, geschweige denn weinen oder schreien. Als ob ihr die Stimme genommen worden wäre, sobald ihr kostbarer Fluchtort entdeckt worden war. Sie zitterte vor Angst, während er ins Wohnzimmer marschierte. Er warf sie herum wie eine misshandelte Puppe. Als er endlich anhielt, wirbelte er sie so herum, dass sie nicht mehr auf seine Brust starren musste. Er hielt sie mit dem Arm um ihre Taille felsenfest.
Bei dem furchtbaren Anblick vor ihr kehrte ihre Stimme zurück. „Mama!“, schrie sie.
Mama und ihr Freund Jamey waren jeweils an einen Küchenstuhl gefesselt. Jamey sah sie genauso verärgert an wie sonst auch. Doch Mama reagierte nicht auf sie. Blut lief ihr aus Nase und Mund und ihr Kopf hing schlaff herunter. Willow trat nach dem Stiefelmann, um zu entkommen. „Mama!“, schrie sie.
Dafür kassierte sie einen Schlag auf den Kopf und einen ins Gesicht. „Halt die Schnauze, blöde Göre!“
Obwohl das nicht gut war, schrie sie schmerzerfüllt auf. Ihr Gesicht brannte, als ob sie jemand wiederholt mit etwas Winzigem und Scharfem stechen würde. Ihr verschwamm die Sicht. Bei der dunklen, barschen Stimme hinter ihr zuckte sie zusammen.
„Crank, reiß dich zusammen. Ihr wird nichts getan, ehe ich es sage. Kapiert?“
„Jawohl, Sir“, antwortete Crank.
Willow drehte den schmerzenden Kopf und sah, dass der gemeine Mann sie anstarrte. Bei seinem Blick begann sie, erneut zu zittern. Seine schwarzen Augen fixierten sie voller Hass, obwohl sie ihn noch nie gesehen hatte.
„Was haben wir denn da für ein hübsches kleines Ding?“, fragte er.
Sie traute sich nicht, zu reden, und sah den gemeinen Mann nur an. Dann blickte er zu einem der Männer, die hinter ihrer Mama standen.
„Weck die Schlampe auf“, kommandierte der gemeine Mann.
Einer der Männer griff in Mamas Haare und riss ihren Kopf hoch. Sie schrie auf und blinzelte. Als sie Willow sah, sog sie zischend Luft ein.
„Lasst sie in Ruhe. Sie hat nichts mit meinen Angelegenheiten zu tun“, wisperte sie unter Schmerzen.
„Aber sie gehört zu euch beiden, also ist sie auch meine Angelegenheit. Da du dich entschlossen hast, mich bei den Feds zu verpfeifen und dich in meine Angelegenheiten zu mischen, mische ich mich auch in deine.“ Ohne den Blick von ihrer Mama zu nehmen, trat er einen Schritt näher an Willow heran. „Ich glaube, es wird Zeit, deiner Tochter zu zeigen, was passiert, wenn du jemandem in die Quere kommst.“
Der gemeine Mann fuchtelte mit einem glänzenden silbernen Messer vor Willows Gesicht herum. Als er die Klinge an ihren Hals presste, wurde sie von Angst überwältigt und eine warme Flüssigkeit lief ihr an den Beinen hinab.
Der Kerl mit den großen Stiefeln, der Willow festhielt, zerrte sie von der Klinge fort und schüttelte sie, sodass ihre Zähne aufeinanderschlugen. „Die kleine Fotze hat mich gerade vollgepisst!“, rief er aus.
Der gemeine Mann verengte die Augen. „Stell dich nicht so an, Crank. Und jetzt halte sie still, verstanden?“
Crank grummelte vor sich hin, behielt jedoch den Arm fest um Willow geschlungen.
Der gemeine Mann sah zu Mama und Jamey hinüber, ehe er das Messer erneut an Willows Hals drückte. „Also, versuchen wir es noch einmal, nicht wahr? Wenn du uns nicht sagst, wo die verdammte Lieferung ist, fange ich an, Stücke aus deinem Kind zu schneiden!“
Jamey verdrehte die Augen und schnaubte verächtlich. So wie er es immer Willow gegenüber tat, wenn sie mit ihm über ihre Puppen oder ihre Lieblingssendung im Fernsehen reden wollte. „Nur zu, schneide ihr die Kehle durch. Ist mir scheißegal.“
Überrascht hob der gemeine Mann die Augenbrauen. „Willst du mich verarschen, Mann? Denn ich mache keine Witze.“
„Du hast richtig gehört. Mir doch egal, wenn du ihr Blut auf dem Boden verteilst, weil es nicht meins ist.“
„Wenn sie nicht deine Tochter ist, wessen dann?“
„Sie ist Malloys Bastard.“
Der gemeine Mann holte zischend Luft bei diesem Namen. „Welcher Malloy?“
„Jamey, nicht“, protestierte Mama und sah verängstigt aus.
Schon immer hatte sich Willow gefragt, wer wohl ihr Daddy war. Wenn sie Mama fragte, beschimpfte diese ihn nur. Willow hatte nicht einmal ein Foto gesehen. Anscheinend hatte Mama es ihr aus Angst nicht erzählt. Willow fragte sich unwillkürlich, ob ihr Daddy genauso ein fieser Mann war wie diese hier.
„Halt’s Maul, Hure“, knurrte der gemeine Mann. Dann hob er das Kinn in Jameys Richtung. „Sag mir, von welchem Malloy die Göre ist.“
„Von Deacon.“
Ein Name. Endlich hatte Willow den Namen ihres Daddys gehört. Aus irgendeinem Grund fühlte es sich so an, als ob sie ihn kennen würde. Doch das Glück darüber verflog sofort, als der gemeine Mann sich zu freuen schien, den Namen ebenfalls zu kennen. Willow ahnte, dass das kein gutes Zeichen war.
Er hob leicht die Lippen und lächelte. „Okay. Das ändert natürlich alles, nicht wahr?“
Er senkte das Messer an Willows Kehle. Willow lehnte sich, so weit sie konnte, zurück an den Stiefelmann, als der gemeine Mann sich zu ihr beugte.
„Heute scheint dein Glückstag zu sein, kleines Mädchen. Dich jetzt gehen zu lassen, bringt mich auf lange Sicht meinen Zielen viel näher.“ Er hob die Brauen und starrte sie an. Mit den rauen Händen umfasste er ihren Unterkiefer, neigte ihren Kopf nach hinten und betrachtete sie von allen Seiten. „Kaum zu glauben, dass es mir nicht gleich aufgefallen ist. Du bist das verfickte Spiegelbild von dem Arschloch.“
Mama beugte sich auf ihrem Stuhl nach vorn. „Lass sie gehen, okay? Sie zu benutzen, bringt dich nicht weiter. Deacon weiß nicht mal, dass sie von ihm ist. Ich habe ihn vorher verlassen. Er mag keine Kinder, also ist sie ihm scheißegal.“
Der gemeine Mann zweifelte daran. „Vielleicht interessiert es ihn nicht sofort. Ich werde ihm etwas Zeit lassen. Und auch wenn er sie nicht haben will, wette ich, dass sein Bruder Rev es wird. Und gegen Deacon und seine Brüder würde ich jedes Druckmittel einsetzen, das mir zur Verfügung steht.“ Er machte eine Handbewegung für Crank. „Lass sie los.“
Mit Erleichterung spürte Willow wieder den Boden unter den Füßen. Der gemeine Mann ging neben ihr in die Hocke.
„Hör mir jetzt gut zu. Du erzählst niemandem, was du heute hier gesehen hast, verstanden?“ Obwohl Willow wie verrückt nickte, um ihr Verstehen anzuzeigen, schien das dem gemeinen Mann nicht zu reichen. Sein heißer Atem berührte ihre Wange, als er sich ganz nah zu ihr beugte. „Wenn du jemandem auch nur ein Wort über mich oder das, was du gesehen hast, erzählst, komme ich nachts zu dir und schneide dir das Herz raus. Kapiert?“
Abgesehen von den Momenten, wenn sie mit Dora auf Entdeckungstour ging oder mit Engelsmama zusammen war, hatte Willow immer sehr viel Angst. Doch bis jetzt hatte sie noch nie eine solch intensive Furcht empfunden. Ein Zittern ergriff ihren Körper und sie brachte keine Antwort zustande.
Glücklicherweise schien der gemeine Mann dennoch endlich zufrieden. Er wandte sich wieder an Mama.
„Kann sie irgendwo unterkommen?“
Tränen liefen Mama über die Wangen. „Ja, sie geht oft zu der Lady am Ende des Flurs.“
Willows Angst verminderte sich etwas bei dem Gedanken an Mrs. Martinez, in deren warmem und gemütlichem Apartment sie immer blieb, wenn Mama mit Jamey unterwegs war oder arbeitete. Mrs. Martinez kochte Willow immer etwas, und sie durfte ihr sogar dabei helfen. Willow durfte sie Mama Mari nennen, und es war fast so, als hätte sie eine Großmutter, wie die anderen Kinder in der Schule.
„Gut. Dann soll sie da hingehen und wir beenden die Sache hier.“
„Kann ich mich zumindest von ihr verabschieden?“, fragte Mama stockend. Sie atmete schwer vom Schluchzen. Bei dem Anblick musste Willow auch weinen.
„Beeil dich“, antwortete der gemeine Mann und schubste Willow zu ihrer Mutter hinüber.
So gut sie konnte, kletterte sie auf Mamas Schoß und verbarg ihr Gesicht an Mamas Hals. Noch immer gefangen in panischer Angst, konnte sie die Lippen nicht bewegen und sagen, was in ihrem Kopf laut schrie. Egal, wie wütend und gemein Mama sein konnte, Willow hatte sie immer geliebt. Sie wünschte sich nichts so sehr, wie von Mama umarmt und geküsst zu werden, doch nur selten bekam sie, was sie sich wünschte.
„Ich liebe dich, Willow. Sei ein liebes Mädchen bei Mrs. Martinez. Sie wird dich zu deinem Daddy bringen. Und sei bei ihm auch brav, okay?“ Willow nickte. Mama weinte jetzt noch stärker. „Es tut mir leid, dass ich eine schlechte Mutter war, Baby. Ich hoffe, du bekommst bald eine bessere.“
Willow zuckte zurück und sah Mama in die Augen. Was meinte sie mit eine bessere Mama? Ging sie fort? Und wenn Willow bei ihrem Daddy wohnen sollte, hieß das etwa, dass sie ihre Mama nie wiedersehen würde? Sie musste weinen und ihr Magen schmerzte. „Ich liebe dich, Mama“, wisperte sie, als sie endlich die Worte fand, die sie so verzweifelt loswerden wollte.
„Ich liebe dich auch, Willow.“
„Okay, genug von der sentimentalen Scheiße. Crank, bring das Kind den Flur runter. Sag der Frau, dass sie für ein paar Stunden aus dem Haus gehen soll, falls sie weiß, was gut für sie ist.“
Stiefelmann schnappte sich Willow und marschierte zur Tür. Willow sah über ihre Schulter, wie der gemeine Mann näher an Mama herantrat. Als sie aus dem Apartment getragen wurde, legte der gemeine Mann das Messer an Mamas Hals an.
Mama sah Willow direkt an. „Ich liebe …“
Ihre Worte brachen ab, als die Klinge über ihre Kehle schnitt.
Willow riss den Mund zum Schreien auf, doch es kam kein Laut heraus. Sosehr sie auch versuchte, das Bild vor ihren Augen zu verdrängen, wie das Blut aus Mamas Hals lief, sie schaffte es einfach nicht. Das Letzte, was sie sah, war der gemeine Mann, der sie ansah und einen Finger auf seine Lippen legte, um sie daran zu erinnern, den Mund zu halten.
Kapitel 1
Deacon
Echte Kerle heulen nicht.
Also, dieser alte Spruch traf bei meiner Arbeit eher nicht zu. In all den Jahren hatte ich erlebt, dass selbst die härtesten und schlimmsten Kerle ihre Grenzen haben. Und das nicht nur wegen der körperlichen Folter. Manchmal genügte schon eine Drohung gegen ihre Frauen, Freundinnen oder Töchter, damit sie wie die kleinen Mädchen anfingen zu heulen und zu plaudern.
Im Grunde würden sich alle lieber fast zu Tode prügeln lassen, als ihren Gefühlen nachzugeben und Schwäche zu zeigen. Männer können mit körperlichen Schmerzen umgehen, doch es ist der emotionale Scheiß, der sie fix und fertig macht.
Zum Beweis präsentierte ich hiermit Weichei Nummer 1:
Frankie Delbraggio beziehungsweise der blöde Idiot, der vor mir saß, während ein Gemisch aus Tränen und Blut über seine fetten Wangen lief. Er war soeben der aktuelle Empfänger meines Zorns, denn er hatte etwas Idiotisches getan, indem er dachte, er könnte mich durch die Zusammenarbeit mit einem anderen Club hintergehen. Er war zu gierig nach Geld und Macht in seinem Gebiet geworden. Dabei hatte er sich übernommen, wodurch sich eine Waffenlieferung für meinen Club verspätet hatte.
Okay, auf den ersten Blick wirkte der Kerl wie der schlimmste Feind. Ein fieser Bastard mit Tattoos und Piercings, dem man auf keinen Fall im Dunkeln begegnen wollte. Seine Haut schien ledern zu sein vom jahrelangen knallharten Lebensstil und seine Arme, die momentan hinter dem Stuhl mit Kabelbindern bewegungsunfähig gemacht waren, waren voller Pockennarben und den Spuren seiner Heroinsucht, der er einfach nicht entkommen konnte.
Als Sergeant at Arms in meinem Club, den Hells Raiders, musste ich eine starke Macht sein. Derjenige, der Folter einsetzte, um Dinge zu erledigen. Wenn ich jemanden wie Frankie damit durchkommen ließe, dass er Lieferungen verzögert und seine Loyalität nicht mehr wichtig nimmt, litt der ganze Club darunter. Ich durfte und würde das nicht erlauben. Die Raiders waren mein Leben. Ich lebte und atmete für sie, seit ich ein rotznäsiger, dreizehnjähriger Punk war, den mein Adoptivvater, Preacher Man oder Preach, wie er liebevoll genannt wurde, von der Straße geholt hatte.
Hinter Frankie stand mein Adoptivbruder Benjamin, genannt Bishop, um mir zur Hand zu gehen. Er kaute auf einem Kaugummi herum und betrachtete Frankie verächtlich. Wahrscheinlich war er weniger sauer darüber, dass Frankie uns übers Ohr gehauen hatte, als darüber, dass ich ihn bei schweren Aktivitäten mit einer Süßen gestört hatte. Einer der Frauen, die für Clubmitglieder freiwillig die Beine spreizten. Mit seinen dreiundzwanzig Jahren, den babyblauen Augen und dem dunkelblonden Haar dachte Bishop hauptsächlich mit seinem Schwanz. Obwohl er bereits mit neunzehn eingepatcht, sprich zum vollwertigen Mitglied geworden war, musste er noch eine Menge lernen.
Ich bearbeitete Frankie mit ein paar rechten Haken und Schlägen in den Bauch, doch drang erst zu ihm durch, als ich ihm die Brieftasche wegnahm. Zwischen etwas Gras, Kondomen und einigen Zwanzigern befand sich ein Foto. Nachdem ich es eine Weile betrachtet hatte, musste ich grinsen. Ich wedelte mit dem Foto vor seinem Gesicht herum. „Mmmm, sieh dir diesen hübschen Arsch an.“
Daraufhin begann Frankie zu zittern. Sein Blick, der so unnachgiebig gewesen war, wurde glasig. Volltreffer. Dieses Mädchen, wahrscheinlich seine Tochter, war seine Achillesferse. „Wie alt ist die Süße? Vierzehn? Dreizehn?“ Er antwortete nicht, also verpasste ich ihm noch einen rechten Haken. „Wenn ich dich was frage, antwortest du gefälligst, kapiert?“
Schwach nickte Frankie. Seine Stimme war heiser. „Zwölf.“
„Oh, noch ein Baby, Mann. Ich wette, sie hat ne enge Pussy.“ Ich hob eine Augenbraue. „Es geht doch nichts darüber, eine Jungfrau einzureiten.“
Frankie biss den gebrochenen Kiefer zusammen und zerrte an seinen Fesseln. Wäre er freigekommen, hätte er sein Bestes getan, um mich umzubringen. Doch obwohl er mir in die Hände spielte, war ich noch nicht mit ihm fertig. Nein, ich würde mir noch seine Lebensader vornehmen. „Lass mich etwas klarstellen, Frankie. Das nächste Mal, wenn du uns verarschen willst, suche ich nach deiner hübschen kleinen Tochter. Ich werde sie nicht nur entjungfern, sondern sie auch in den Arsch ficken, während meine Brüder zuschauen. Und dann kann sie jeder, der sie will, haben.“
Als hätte ich ein Messer benutzt, drangen meine Worte Frankie unter die Haut und trafen seine emotionale Hauptschlagader. Tränen flossen ihm aus den Augen bei der Vorstellung, dass so etwas Schreckliches seinem kleinen Mädchen passieren könnte. Unter seinem Schluchzen bebte sein massiver Körper.
Damit hatte ich ein völlig verkommenes und widerliches Szenario in seinen Kopf gesetzt. Doch was er nicht wusste, war, dass es eine verdammte, raffinierte Lüge war. Ich vergriff mich nicht an Minderjährigen, schon gar nicht an kleinen Mädchen. Und ich wusste, dass es meine Männer auch nicht taten. Sollte ich je Wind von so etwas bekommen, würde ich nicht erst eine Abstimmung in der Messe – unserem Club-Meeting – abwarten und diesen Arsch rauswerfen. Nein, ich würde ihm persönlich die Eier abschneiden, sein Patch nehmen und ihn dann aus dem Club werfen. Die Hells Raiders mochten eine Menge sein, aber keine kranken Pädophilen.
Als Frankie lange genug gelitten hatte, räusperte ich mich. „Verstehen wir uns jetzt, Frankie? Keine Spielchen mehr mit den Iron Lords?“
„J-ja“, stotterte er und seine Zähne klapperten.
Ich hob die Brauen. „Ja, was?“
Er weitete die noch nassen Augen. „Ja, Sir, Deacon. Du hast mein Wort. Ich werde euch nie wieder betrügen. Ich schwöre es bei meinem Leben.“
„Und bei dem deiner Tochter?“
Er zuckte zusammen. „Ja, bei meinem und ihrem. Ich schwöre bei Gott!“
„Schön, das zu hören.“ Ich steckte das Foto seiner Tochter mit dem Engelsgesicht wieder in seine Brieftasche. „Schön, dass dein kleines Mädchen auch gesund und munter bleiben wird.“
„Ja“, wisperte Frankie. Ein Zittern durchlief ihn, wahrscheinlich vor Erleichterung.
Ich nickte Bishop kurz zu. Er holte sein Taschenmesser aus der Jeans und schnitt Frankies Fesseln durch.
„Einen schönen Tag noch, Mann. Ich freue mich schon auf unsere Lieferung nächsten Monat.“ Ich grinste ihn fies an.
Frankie nickte kurz bestätigend und rieb sich die Handgelenke. Mit einem Abschiedswinken eilte ich aus Frankies Lagerhaus, mit Bishop auf den Fersen. Als wir in die grelle Maisonne traten, freute ich mich über die Wärme, die auf meine nackte Haut traf, wo mich das T-Shirt und die Lederweste mit dem Clublogo nicht bedeckten.
Ich setzte mich auf mein Motorrad und hinter mir lachte Bishop. Ich drehte mich um und sah ihn an. „Was ist?“
Er schüttelte den Kopf und grinste. „Ich musste nur gerade denken, dass es gut war, dass ich dabei war und nicht Rev, als du mit dem Baby-Pussy-Scheiß angefangen hast. Er wäre ausgeflippt und hätte alles verdorben.“
Ich schnaubte bei der Erwähnung meines Adoptivbruders Reverend, oder Rev, wie er innerhalb des Clubs bekannt war. Eigentlich hieß er Nathaniel, doch keiner der Brüder nannte ihn so. Der einzige Mensch, der uns alle beim echten Namen nannte, war meine Adoptivmutter Elizabeth.
Obwohl Rev einsfünfundneunzig groß und ein Muskelprotz war, hatte er ein weiches Herz. Er war ein friedlicher Riese, der Hundebabys liebte, Kinder und den ganzen Regenbogenherzchen-Scheiß. Die meiste Zeit war er zu gut und anständig, um in unsere Welt zu passen. „Tja, deshalb hat ihn auch keiner zum Sergeant at Arms gewählt. Alle wissen, dass er nicht in der Lage ist, Druck auszuüben und ein harter Hund zu sein, wenn es drauf ankommt.“
„Stimmt.“ Bishop stieg auf seine Maschine.
Ich zog meinen Helm an und startete das Bike. Nichts fühlte sich besser an als das Geräusch der aufjaulenden Maschine unter mir. Nur auf der Straße fand ich Frieden. Obwohl ich nun den Rückhalt einer liebenden Familie hatte, fühlte ich mich immer noch wie ein Einzelgänger, ein Außenseiter, der noch immer nach einem Platz suchte, der ihm gehörte. Nur die Straße bot mir einen Ort an, an dem ich so sein konnte, wie ich wirklich war.
Als ich meinen Weg über die Landstraßen nach Hause machte, blieb Bishop dicht an meiner Seite.
Im Hauptquartier angekommen, standen ein paar vereinzelte Motorräder herum. Es war erst vier und die Mitglieder trudelten ein, nachdem sie ihre Tagesjobs verlassen hatten. Vor Jahren, als die alte Baumwollfabrik pleiteging, hatte Preach die Geschäftsidee gehabt, das Anwesen zu kaufen. Zu der Zeit noch nicht für die Raiders. Nein, damals war er noch auf dem religiösen Trip und total auf sein Priesteramt konzentriert. Nachdem er in der Motorradclubwelt groß geworden worden war, fand er zu Gott im Gefängnis, als er gerade mal zwanzig gewesen war. Nachdem er drei Jahre später freikam, begrub er seine Biker-Vergangenheit und wurde ein Priester. Dann traf er meine Adoptivmutter. Sie war eine jugendlich aussehende, geistig und körperlich reine achtzehnjährige Schönheit. Die Tochter eines Kirchenvorstandsmitglieds. Sie sah in ihm ein verlorenes schwarzes Schaf, das sie in die Herde zurückführen konnte.
Doch selbst nachdem er die tugendhafte Frau geheiratet hatte und Gottes Wort verkündete, kochte das Biker-Blut in ihm hoch und drängte nach außen. Zwei Jahre, nachdem ich bei ihm aufgenommen worden war, endete sein Predigen in flammendem Glanze. An dem Abend brachte er eins seiner Schäfchen um. Ich kannte nicht die ganze Geschichte, doch es hatte etwas mit dem Mann zu tun, der Rev verletzt hatte. Preach saß keine Strafe ab, sondern der Kerl verschwand einfach. Die meisten Mitglieder der Kirchengemeinde setzten sich aus verlorenen Seelen zusammen, ohne Hoffnung oder Angehörige, sodass es leicht war, ihn einfach im Wald hinter dem Anwesen zu vergraben, ohne dass irgendjemand Fragen gestellt hatte.
Danach kam der Biker in ihm stark und stolz zum Vorschein, was dazu führte, dass seine Ehe mit Mama Beth den Bach runterging. Sie trennten sich, ließen sich aber nie scheiden. Meine Mutter, meine Brüder und ich blieben im Reihenhaus in der Stadt, während Preach im Clubhaus schlief, das einst seine Kirche gewesen war. Mama Beth verabscheute die Biker-Welt und musste hilflos zusehen, wie einer nach dem anderen von uns in Preachs Fußstapfen trat und Mitglied der Raiders wurde. Ich glaube, wir drei sorgten dafür, dass sie ständig auf den Knien war und für uns betete. Doch auch wenn wir alle harte Biker geworden waren, liebten und respektierten wir sie wie verrückt. Sie war die beste Mutter, die ein Junge haben konnte, und sie behandelte mich niemals anders als ihre eigenen Söhne.
Ich hielt vor dem Clubhaus, zog den Helm aus und hängte ihn an den Lenker. Ich sprach nicht viel mit Bishop oder den beiden Anwärtern vor der Tür des Clubhauses. Nein, ich war nur auf eins aus, und zwar auf Sex. Nach einem Job wie diesem brauchte ich ein Ventil, und Sex funktionierte am besten. Zielstrebig ging ich ins Haus.
Aus der Jukebox dröhnte Guns N’ Roses. Ich ließ den Blick durch den Raum schweifen, auf der Suche nach einer Sache. Oder besser gesagt einer Person. Dann fand ich sie. Cheyenne Bates stand hinter der Bar, beugte sich über den abgenutzten Mahagonitresen und wischte Bier, Erdnuss- und Chipsreste weg. Das lange blonde Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Beim Anblick ihres üppigen Dekolletés pochte mein Schwanz gegen den Reißverschluss. Als ob sie meine Anwesenheit gespürt hätte, zuckte ihr Kopf hoch und ihre intensiven blauen Augen begegneten meinem Blick. Ein sinnliches, verführerisches Lächeln breitete sich auf ihren Lippen aus.
Mit einem Finger lockte ich sie zu mir. Sofort warf sie den Lappen auf die Theke und ging um die Bar herum. Auf ihren hohen, aber verdammt sexy Schuhen verringerte sie den Abstand zwischen uns. Sie schlang die Arme um meinen Nacken und sprang mich an, wickelte die Beine um meine Taille.
„Hey, Baby, du hast mir gefehlt.“
„Mmm, du mir auch“, antwortete ich und vergrub die Nase zwischen ihren Brüsten. Ich steuerte uns an den Männern vorbei und den Flur entlang. Vor meinem Zimmer knetete ich mit einer Hand ihren Hintern und mit der anderen öffnete ich die Tür.
Seit fast einem Jahr fickte ich nur noch Cheyenne. Ab und zu sah ich mich mal nach einem anderen Hintern um, wenn ich unterwegs war. Doch ich mochte es, dass Cheyenne genau wusste, wie sie mich am besten antörnte, während ich kam. Sie war nicht eine dieser Frauen, die erwarten, dass man sie zuerst zigmal zum Kommen bringt, bevor sie überhaupt daran denken, meinen Schwanz anzufassen. Sie kümmerte sich stets zuerst um mich. Ich mochte das.
Ich stellte sie ab und sofort sank sie vor mir auf die Knie. Sie öffnete meinen Gürtel und den Reißverschluss. Als mein Schwanz heraussprang, verlor sie keine Zeit, fuhr mit den Lippen meinen Schaft entlang und nahm ihn dann bis zum Anschlag in den Mund.
„Fuck“, stöhnte ich. Mein Kopf sank nach hinten bei den unglaublichen Empfindungen, die Cheyennes meisterhafte Blowjob-Künste in mir auslösten. Die Frau hatte einen Mund wie ein verdammter Staubsauger.
Ich nahm ihren Kopf zwischen meine Hände, spannte die Hüften an und fickte ihren Mund. Es dauerte nicht lange, da zogen sich meine Eier zusammen und mein Samen schoss in ihren Hals. Sie saugte und leckte jeden Tropfen auf. Mit einem befriedigten Lächeln sah ich ihr zu. „Du weißt echt, wie man seinen Mann gut behandelt, Baby.“
„Ich liebe es. Mein Höschen ist total feucht, nur weil ich dir einen geblasen habe.“
Dass sie noch versauter daherreden konnte als ich, sprach auch noch für Cheyenne. Sicher, sie war schon seit Jahren eine Clubsüße und von jedem einzelnen Mitglied bestiegen worden, einschließlich Preacher Man. Ihre Erfahrung war es mir jedoch wert. Da ich seit einem Jahr nur noch sie fickte, hoffte sie natürlich darauf, meine Old Lady zu werden. Aber darauf konnte sie lange warten. Das würde nie passieren. Nicht mit ihr oder einer der anderen Clubhuren. Gar keine Old Lady – basta.
Ich packte sie an den Schultern und zog sie hoch. „Zeit für mich, nachzusehen, wie nass ich dich gemacht habe.“
„Ja, bitte.“
Cheyenne zog ihr hautenges T-Shirt aus. Wie von Magneten angezogen legte ich sofort meine Hände auf ihre Titten. Nachdem ich sie aus dem durchsichtigen BH befreit hatte, saugte ich an einem ihrer Nippel und knabberte daran. Ich wechselte zwischen den Brüsten ab und brachte Cheyenne zum Stöhnen und Wimmern. Mit den Händen zog ich ihr die Jeans aus. Ich schob sie über ihre Schenkel und warf dann Cheyenne auf mein Bett. Ich hielt über ihr inne und in ihren Augen flammte Begierde auf.
Nachdem ich das winzige Höschen entfernt hatte, spreizte ich ihre Beine und tauchte mit dem Gesicht dazwischen. Cheyenne schrie begeistert auf und fuhr mir mit ihren Acrylnägeln durchs Haar.
„Oh ja, Baby. Genau so! Fick mich mit der Zunge!“
Ein lautes Klopfen an der Tür unterbrach mich, und dann folgte Revs Stimme. „Deacon, ich brauche dich draußen.“
Ich nahm nicht einmal das Gesicht von ihrer Pussy und brüllte: „Hau ab, ich bin beschäftigt!“ Ich leckte Cheyennes Klit, doch der ungewollte Störenfried blieb vor der Tür. Es klopfte erneut und ich grummelte frustriert.
„Deacon, das ist kein Spaß, Mann. Ich brauche dich hier. Sofort!“
Ich zog mich zurück und Cheyenne quittierte dies mit einem ungehaltenen Stöhnen. Sie presste die Schenkel zusammen, um weiterhin Reibung zu bekommen. Sie hatte kurz davor gestanden zu kommen, wenn wir nicht unterbrochen worden wären.
Ich hob den Kopf und brüllte zur Tür: „Wenn es nicht um Leben und Tod geht, reiße ich dir die Eier ab!“
„Tut es“, antwortete Rev.
„Verdammte Scheiße“, murmelte ich und stand auf. In Rekordgeschwindigkeit zog ich T-Shirt und Jeans an. Cheyenne wollte aufstehen. „Du bleibst, wo du bist.“ Ich schüttelte den Kopf.
Sie lächelte, spreizte die Beine und streichelte ihre Pussy. „Genau so?“
„Ja, aber mach’s dir nicht selbst, während ich weg bin. Das darf nur ich.“
Sie sah mich schmollend an, ehe ich mich der Tür zuwandte. Ich riss sie auf und Rev sah mich angewidert an.
„Um Himmels willen, wisch dir den Mund ab und kämm dir die Haare“, sagte er.
Anstatt ihm zu widersprechen, weil es mir scheißegal war, was alle von meinem Aussehen hielten, leckte ich mir über die Lippen und genoss Cheyennes Geschmack noch ein bisschen. Dann wischte ich mir mit dem Arm über den Mund. Auf dem Weg durch den Flur fuhr ich mir grob durch die Haare, um die Unordnung, die Cheyenne angerichtet hatte, zu bändigen.
Ich bog um die Ecke und erblickte eine grauhaarige spanische Frau. Ihre Unsicherheit, sich im Clubhaus zu befinden, strahlte wellenartig von ihr ab. Ihre dunklen Augen blickten unruhig umher und ihre Finger spielten nervös mit ihrem bunten, weiten Rock. Ich hatte keine Ahnung, was so wichtig an dieser Frau sein sollte, um einen guten Fick zu unterbrechen.
Als sie mich sah, legte sie betroffen eine Hand an ihre Kehle. Sie wirkte, als hätte sie einen Geist gesehen. Ich sah Bishop an. Sein übliches Pokerface war einem erstaunten Ausdruck gewichen. Das kannte ich von ihm gar nicht. Ich hob fragend die Brauen, doch er schüttelte nur langsam den Kopf.
Nachdem ich genervt ausgeatmet hatte, fragte ich: „Was ist so wichtig, dass man mich hergeschleppt hat?“
„Sie David Malloy?“, fragte die Frau mit schwerem Akzent.
Trotz ihrer Frage sah ich ihr an, dass sie genau wusste, wer ich war.
„Sí, Señora“, antwortete ich und kreuzte die Arme vor der Brust.
Ihre eigene Sprache zu hören, beeindruckte sie nicht weiter. Stattdessen warf sie mir einen missbilligenden Blick zu, als wäre ich ein riesiger Klugscheißer, womit sie wahrscheinlich recht hatte.
„Kennen Sie Lacey?“
Ich schnaubte. „Sagen Sie nicht, sie hat Sie geschickt, um Geld abzustauben oder so etwas. Ich bin seit fünf Jahren nicht mehr mit der Schlampe zusammen.“
„Ich kein Freund von ihr.“
„Was wollen Sie dann von mir?“ Hinter mir hüstelte Rev wegen meines angriffslustigen Tonfalls. Ich rollte mit den Augen. „Weshalb sind Sie wegen Lacey hier?“, fragte ich erneut.
„Sie tot.“
Mir gefiel nicht, dass sich meine Brust zusammenzog, als ich das hörte. Lacey King war meine erste Liebe, meine einzige echte Liebe gewesen, um ehrlich zu sein. Wir waren drei Jahre zusammen. Zuerst waren ihr gelegentlicher Drogenkonsum und das Trinken kein Thema gewesen. Doch nachdem ihre Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, hatte sie eine echte Sucht entwickelt. Als ich mich weigerte, ihr Geld für Drogen zu geben, schlief sie mit ein paar Kerlen aus einem anderen Club. Weil ich sie liebte, warf ich sie nicht raus, nachdem ich es erfahren hatte. Ich bezahlte ihr den Entzug. Als sie wiederkam, hatten wir einen guten Monat zusammen. In den paar Wochen dachte ich ernsthaft darüber nach, sie zu meiner Old Lady zu machen. Doch dann wurde sie mit Alkohol rückfällig. Ich stellte sie vor die Wahl. Alkohol oder ich. Sie entschied sich für den Alkohol und verließ mich. Das war vor fünf Jahren und seitdem hatte ich nichts mehr von ihr gehört. Bis jetzt.
„Lassen Sie mich raten. Überdosis oder Alkoholvergiftung?“
Die Frau schüttelte langsam den Kopf. „Sie ermordet.“
Überrascht hob ich die Augenbrauen. „Von wem?“
„Polizei weiß nicht.“ An der Angst in ihren Augen erkannte ich, dass mehr dahintersteckte, als die Bullen ihr gesagt hatten. „Ich bringe Ihnen was von ihr.“
„Glauben Sie mir, es gibt nichts, was ich von ihr will.“
„Das schon. Es ist auch Ihres.“
Ich durchforstete mein Hirn nach Dingen, die Lacey von mir haben könnte. Aber mir fiel absolut nichts ein. Plötzlich sah ich, dass die Frau von jemandem begleitet wurde. Ein kleines dunkelhaariges Mädchen versteckte sich hinter dem weiten Rock der Frau.
„Willow, komm her.“
Als das Mädchen in mein Blickfeld trat, wurde ich von einem Blitz getroffen. Mein Körper bebte wie von einer Nachwelle. Es war, als ob ich eine weibliche Version von mir selbst betrachtete, als ich in dem Alter war.
„Ach du Scheiße.“
„Das gehört Ihnen. Willow, sie Ihre Tochter.“
Der Raum kippte und drehte sich um mich, und hätte Rev nicht hinter mir gestanden, hätte ich womöglich etwas Unmännliches getan und wäre in Ohnmacht gefallen. Kurz stützte ich mich auf ihn, bis ich mich erholt hatte. Obwohl der körperliche Beweis vor mir stand, ging ich automatisch in eine Abwehrhaltung.
„Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen, ich habe keine verdammten Kinder.“
Mit großen Augen starrte mich das Mädchen an. An ihrem staunenden Gesicht erkannte ich, dass sie das Puzzle zusammensetzte. Obwohl ich es abstritt, kannte sie die Wahrheit. Ich war ihr Vater. Ich sah sie an und ein ungewolltes Gefühl des Stolzes jagte durch mich hindurch.
Meine Tochter.
Dieses engelhafte Wesen vor mir war meine Schöpfung.
Im Geiste ging ich die Zahlen durch, die Monate und Jahre. Lacey musste das Kind in dem einen perfekten Monat empfangen haben. Wir fickten Tag und Nacht, also war es nicht unwahrscheinlich, dass ich sie geschwängert hatte. Auf jeden Fall benutzte ich keine Kondome und sie hatte sämtliche Medikamente abgesetzt. Offensichtlich war auch die Antibabypille darunter gewesen.
Die Frau griff in die große Handtasche über ihrer Schulter. Sie holte ein Blatt Papier heraus und hielt es mir hin. „Sie auf Willows Geburtsurkunde“, behauptete sie.
Allein der Name des Mädchens stach mir wie ein Dolch ins Herz. Willow. Der verfickte Name meiner Tochter ist Willow. Das erste Mal hatten Lacey und ich Sex unter den Weidenbäumen den Hang hinunter vom Anwesen gehabt. Ehe wir es taten, saßen wir stundenlang unter einer Weide, redeten und lachten. Wie ein liebeskranker Schwächling ritzte ich sogar unsere Initialen in einen der Bäume. Danach ging alles den Bach runter, aber sie hatte sich genug gemerkt, um unserer Tochter einen bedeutungsvollen Namen zu geben.
„Sehen Sie“, wies mich die Frau an und fuchtelte mit dem Papier vor meiner Nase herum.
Ich nahm es entgegen und las es. Dort stand es, schwarz auf weiß. Unter Vater des Kindes stand: David Malloy. Was hatte sich Lacey nur dabei gedacht? Zwar setzte sie meinen Namen auf ein behördliches Dokument, aber nahm nie ein verficktes Telefon in die Hand, um mir zu sagen, dass ich ein Kind hatte?
Es gab eine Menge, was ich ihr ins Gesicht schreien wollte, jedoch nicht mehr konnte. Nie würde ich Antworten auf meine Fragen bekommen, weil sie tot war. Am schlimmsten war, dass sie ermordet worden war. Wo hatte sie sich da nur reingeritten?
Trotz der Beweise vor mir blieb ich skeptisch. „Alles gut und schön, aber ich will einen DNA-Test.“
Rev ergriff mit seiner starken Hand meine Schulter. „Sie ist ganz ohne Zweifel deine Tochter, Deacon.“
Ich sah ihn an. „Und wenn, was soll ich jetzt mit einem Kind machen?“
Er blickte mich ernst an. „Du machst was Verantwortungsbewusstes und ziehst es groß.“
„Vergiss es!“ Ich drückte der Frau die Urkunde wieder in die Hand. Ohne ein weiteres Wort drehte ich mich um und marschierte aus der Bar. Keine Minute konnte ich es dort mehr ertragen. Eine erstickende Panik hatte mich ergriffen.
Lacey war tot – ermordet. Ich hatte ein Kind – eine Tochter, und keine Ahnung, was ich mit ihr anstellen sollte. Bei einem Jungen wäre es vielleicht anders gewesen, aber ein Mädchen? Man musste lieb und sanft zu Mädchen sein. Und ich hatte nicht einen einzigen netten Zug an mir.
Meine unkontrollierbaren Gedanken lenkten mich auf die nicht asphaltierte Straße zu den Wohnhäusern und ich rannte. Mit den schweren Stiefeln erzeugte ich Staubwolken hinter mir. Als ich das letzte Reihenhaus auf der linken Seite erreicht hatte, riss ich die Tür auf, ohne auch nur Hallo zu sagen. Meine Mutter war in Rente und beschäftigte sich damit, ehrenamtlich in der Kirche zu helfen. Doch sie war stets um fünf zu Hause, denn sie wollte die verdammte Serie Unsere kleine Farm nicht verpassen.
Von ihrem Platz auf der Couch aus betrachteten mich ihre blauen Augen. Sie erhob sich und winkte mich zu sich. „David, was ist passiert?“ Sorge schwang in ihrer Stimme mit.
An ihrem Ausdruck erkannte ich, dass sie sich gerade Hunderte Szenarien vorstellte, die den Tod von Rev oder Bishop beinhalteten.
Obwohl ich sie gern erlöst hätte, konnte ich es nicht. Ich konnte mich nicht bewegen, war wie am Boden festgewurzelt. Wie sollte ich es ihr sagen? Ich wusste nur, dass ich mir wünschte, dass sie irgendwie alles wieder hinbiegen könnte. „Ich habe ein Kind“, stieß ich schließlich aus.
Erleichterung flackerte in ihren Augen, und sie sah kurz zum Himmel, als ob sie Gott dankte, dass ihre Jungs in Sicherheit waren. Für den Moment.
Sie sah mich an und hob erstaunt die Brauen. „Cheyenne ist schwanger?“
Ich runzelte verächtlich die Stirn bei dieser Vermutung. Meine Mutter war nicht damit einverstanden, dass ich herumschlief, und sie mochte Cheyenne nicht besonders. Sie wollte, dass ich eine nette Frau fand, mich niederließ und Babys zeugte, und nicht die Clubhure schwängerte, die schon durch die Betten sämtlicher Mitglieder gerutscht war. Doch ich sah ihr an, dass sie bereit war, all ihre negativen Gefühle zu schlucken, wenn ein Enkelkind für sie dabei herausspringen würde.
„Rede schon, David“, befahl sie.
Endlich konnte ich mich wieder bewegen und legte die paar Schritte zwischen uns zurück. Auch wenn es erbärmlich klang, aber allein das Gefühl ihrer Hand auf meinem Arm tröstete mich. Mit einem Seufzer des Kummers und gleichzeitiger Zufriedenheit ließ ich mich von ihr umarmen. Und obwohl ich die erstaunlichste Frau vor mir hatte, musste ich an meine biologische Mutter denken.
Sie war die traurige Geschichte eines guten Mädchens, das sich mit dem falschen Mann eingelassen hatte. Eine herzliche, fürsorgliche Mutter, die meine Verletzungen und Kratzer küsste und mich in die Arme nahm, wenn ich nachts Albträume hatte. Sie hatte nur nicht geplant, dass mein aggressiver Alter aus dem Knast kam, uns aufsuchte und sie eines Abends erwürgte, als ich erst sieben war.
Sie wurde beerdigt, er ging wieder in den Knast und ich kam ins Pflegeelternsystem. Ich wurde von einem Dreckloch ins nächste gesteckt. Als ich in die Pubertät kam, brachen die Wut und die Gewalt in mir hervor, die ich von meinem Alten geerbt hatte, und von da an schlug ich mich allein durch. Und ein dreizehnjähriges Kind konnte nicht viel mehr tun, als sich auf den Straßen durch Stehlen und Kämpfen durchzubringen.
Preach entdeckte mich im Boxring. Recht groß für mein Alter nahm ich an illegalen Untergrundkämpfen teil. Sechs Monate lebte ich von der Hand in den Mund, habe Nasen eingeschlagen und Kiefer gebrochen und war davon überzeugt, dass sich kein Schwein für mich interessierte. Doch da irrte ich mich.
Das Schicksal ist ein komischer Kauz. Irgendwann war meine Mutter zur Messe in Preachs Kirche gekommen. Tatsächlich hatten Preach und Mama Beth sie und mich vor meinem Vater versteckt, als er mal wieder betrunken war, bevor er ins Gefängnis kam. Mitten in der Nacht waren wir geflohen, als Mom herausfand, dass er entlassen wurde. Wahrscheinlich war das die schlechteste Idee, die sie haben konnte. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wenn sie geblieben wäre. Immerhin hatten wir ein Dach über dem Kopf und Schutz, als wir bei Preach waren.
Als Preach mir sein Zuhause anbot, wollte der wütende Teil von mir sagen, dass er sich ins Knie ficken sollte. Ich hatte keine Liebe übrig für heilige Männer wie ihn. Als hätte er das geahnt, rollte er seinen Ärmel hoch und zeigte mir seine tätowierten Arme. Er erzählte mir seine Geschichte mit allen Höhen und Tiefen. Danach hatte ich nicht mehr zurückgeschaut. Ich kehrte in sein Haus zurück. Dann adoptierte er mich und ich wurde zum ältesten seiner Söhne. Meistens ärgerten mich Rev und Bishop nicht allzu sehr deswegen. Natürlich stritten wir uns. Man kann keinen Teenager in eine Familie mit einem neun und einem sechs Jahre alten Jungen stecken, ohne mit Problemen rechnen zu müssen.
Mama Beth’ kleine Hand auf meiner Schulter brachte mich in die Gegenwart zurück. „Sprich mit mir, mein Sohn.“
Ich sah in ihre fragenden Augen. „Lacey ist tot. Sie wurde ermordet.“
Sie schnappte leise nach Luft. Obwohl es fünf Jahre her war, wusste Mama Beth, was sie mir bedeutet hatte. „Das tut mir sehr leid.“
„Da ist noch mehr“, krächzte ich.
„Setz dich, mein Lieber“, ordnete sie an und führte mich zur Couch.
Ich ließ mich auf das alte Sofa fallen und legte den Kopf in meine Hände. „Sie hat eine Tochter … ich habe eine Tochter.“
Mama Beth nahm mein Kinn zwischen ihre Finger. Sie drehte mich so, dass sie mich ansehen konnte. Dann hob sie die Augenbrauen und forderte mich damit auf, weiterzusprechen.
„Da Lacey nicht mehr lebt, ist sie jetzt meine Verantwortung. Himmel, mein Name steht sogar auf der Geburtsurkunde. Aber das Schlimmste ist …“ Ich fuhr mit meiner zittrigen Hand durch meine Haare. „Das Kind sieht genauso aus wie ich.“
Sie verengte ihre blauen Augen gefährlich. „Das ist etwas Schlimmes? Rede nie wieder negativ über dieses Kind. Du wurdest damit gesegnet, ein Kind gezeugt zu haben, David. Es gibt viele Menschen, denen das nicht vergönnt ist.“
Mir klappte der Mund auf und ich starrte Mama Beth an, als ob sie den Verstand verloren hätte. Soeben hatte ich ihr den größten Albtraum meines Lebens erzählt, und sie kritisierte mich, weil ich nicht vor Freude durch die Straßen tanzte. Sie wusste genauso gut wie ich, dass ich keine Ahnung hatte vom Vatersein. Die Wut in mir begann hochzukochen und erreichte ein bedenkliches Level. „Aber verstehst du denn nicht? Ich will sie nicht!“ Ich erhob mich von der Couch.
„Ich glaube nicht, dass das eine Option ist.“
Ich schüttelte den Kopf. „Ich kann kein Vater sein.“
Mit einem freudlosen Lachen antwortete sie: „Aber du bist ihr Vater.“
„Nur durch die DNA. Aber ich bin nicht in der Lage, ein Elternteil zu sein.“
„Du willst also sagen, dass du zu egoistisch und ängstlich bist, für dein Verhalten die Verantwortung zu übernehmen.“
Ich warf die Hände in die Höhe. „Oh nein, komm mir nicht so. Ich kann doch einem Kind gar kein stabiles Zuhause bieten.“
Mama Beth kreuzte die Arme über der Brust. „Und was schlägst du nun vor?“
„Sie zum Jugendamt zu bringen und zur Adoption freizugeben. Himmel noch mal, sie wäre viel besser dran mit zwei Elternteilen.“
„Und wie gut ist dir das Pflegeelternsystem damals bekommen?“
Ich ballte die Hände zu Fäusten und musste mich zusammenreißen, nicht den kleinen Jesus vom Couchtisch an die nächste Wand zu pfeffern. Um meine Gefühle unter Kontrolle zu halten, atmete ich ein paarmal tief durch. Egal wie wütend ich war, ich würde unter keinen Umständen meine Mutter in ihrem Heim nicht respektieren, indem ich aus der Haut fuhr. „Vielleicht läuft es für sie besser“, antwortete ich schließlich.
Mama Beth stemmte eine Hand in die Hüfte und mit der anderen erhob sie drohend den Finger. „Hör mir mal gut zu, David Malloy. Ich werde nicht zulassen, dass meine Enkelin zur Adoption freigegeben wird.“ Sie spuckte regelrecht das Wort Adoption aus, als wäre es das schlimmste Verbrechen, das sie sich vorstellen konnte. Kopfschüttelnd fügte sie hinzu: „Nicht, solange ich noch atme.“
Bei ihrem entschlossenen Ton hob ich erstaunt die Brauen. Zwar war sie eine kleine Person, doch ich wusste, dass sie es todernst meinte. „Was willst du damit sagen? Dass du sie selbst großziehst? Wenn dem so ist, glaube ja nicht, dass ich dir dabei helfen werde.“
„Setz dich, David“, befahl sie mir.
Wie immer der gehorsame Sohn, nahm ich erneut Platz. Sie atmete tief ein, ehe sie sprach.
„Mein Herz war immer so schwer bei den Abwegen, auf die du geraten warst. Egal wie sehr wir deine Brüder und dich lieben, immer bleibst du isoliert und unnahbar.“ Sie schüttelte den Kopf. „Wenn du keine Liebe geben und nehmen kannst, lebst du nicht wirklich.“
Ich öffnete den Mund, um zu protestieren, doch sie drohte mir wieder mit dem Finger.
„Du bist fast dreißig, David. Du hast so viele Jahre an Todsünden verschwendet. Es wird Zeit, endlich deinen wahren Frieden zu finden.“
„Und du glaubst, ein Kind großzuziehen, wird das erledigen?“, fragte ich ungehalten.
„Sie wird dir beibringen, selbstlos zu lieben.“
„Ich liebe selbstlos.“
Mama Beth presste die Lippen zusammen und schenkte mir ihren ehrlichen Blick, der bedeutete, dass sie wusste, dass ich mir selbst und ihr etwas vormachte.
„Ich glaube nicht, dass ich das kann“, murmelte ich.
„Aber ich weiß, dass du es kannst.“
Jemand räusperte sich und ich sah hoch. Im Türrahmen stand Rev mit Willow an der Hand. Sie klebte dicht an seiner Seite, und ich konnte mir vorstellen, was er angestellt hatte, um sie für sich zu gewinnen. Na toll. Mein Kind konnte meinen Bruder besser leiden als mich.
„Mrs. Martinez ist gegangen. Ich habe zwei Anwärter geschickt, um Willows Sachen abzuholen.“
„Ins Clubhaus?“
Rev nickte. „Ich dachte mir, wir können eine Matratze in dein Zimmer legen für heute Nacht. Und morgen besorgen wir ihr ein Bett für hier im Haus.“ Er lächelte Willow an. „Du suchst dir aus, was du haben willst, Kleines. Wir machen alles in den Farben, die du willst. Du musst es nur sagen, und du bekommst es.“
Willow sagte kein Wort. Sie lächelte Rev schüchtern an und drückte seine Hand. Zu meinem wohl verwirrten Gesichtsausdruck schüttelte Rev den Kopf. „Mrs. Martinez sagte, Willow hat nicht mehr gesprochen, seit ihre Mutter …“ Er hielt inne, als Willow sichtlich zitterte.
Mit seinen Augen beantwortete Rev die Frage, die mir durch den Kopf ging.
Fuck. Willow hatte gesehen, wie Lacey starb. Ich hatte nicht nur ein mutterloses Kind, sondern auch noch eins, das so traumatisiert war, dass es aufhörte zu sprechen. Himmel noch mal, mich und meine Welt war das Letzte, was sie brauchen konnte. Sie brauchte Eltern wie die in Unsere kleine Farm plus jahrelange Psychotherapie.
Rev durchbrach die Stille und schwang Willows Arm hin und her, weil er sie noch an der Hand hatte. „Aber das ist egal. Willow, du kannst mit uns reden, wann du willst. Nicht wahr, Leute?“
Mama Beth erhob sich von der Couch. „Ganz genau.“ Sie empfing Willow, die sie nur ängstlich anstarrte, mit offenen Armen. „Ich bin deine Großmutter, meine Süße. Ich werde deinem Daddy helfen, sich um dich zu kümmern.“
Willow blickte an Mama Beth vorbei zu mir. Wahrscheinlich wunderte sie sich, warum ich sie nicht genauso herzlich begrüßte. In Wahrheit wusste ich nur nicht, was zur Hölle ich machen sollte. War es unangebracht, sie zu berühren? Wollte ich das überhaupt? Je länger sie mich ansah, desto schlechter konnte ich atmen. Ich brauchte ein Ventil. Entweder in Cheyenne oder durch eine Tour mit dem Bike.
Doch ich bekam nicht die Gelegenheit, feige abzuhauen. Willow ließ Revs Hand los und kam ein paar Schritte auf mich zu. In ihrer anderen Hand hielt sie etwas wie einen Engel fest, der aussah, als ob er an einen Weihnachtsbaum gehörte. Sie ging an Mama Beth vorbei. Ihre dunklen Augen mit derselben Farbe und Form wie meine ließen meinen Blick nicht los.
„Sag etwas“, zischte Rev.
„Äh, ja, also … ich bin David … oder auch Deacon … dein Vater.“ Ihr starrer Blick machte mir Angst. Es war ein besessener Blick, wie ein Fan einen Filmstar anstarren würde. Ich kratzte mich im Genick und suchte verzweifelt nach den richtigen Worten. „Also, ich … das mit deiner Mutter tut mir sehr leid.“
Bei der Erwähnung von Lacey neigte Willow den Kopf zur Seite. Ohne Worte signalisierte sie mir, was sie hören wollte.
„Sie war sehr schön und lieb, wenn sie nüchtern war.“ Ich erstickte fast an meinen Empfindungen und musste mich räuspern. „Obwohl wir nicht mehr zusammen waren, habe ich sie geliebt. Damals.“ Wäre ich ehrlich zu mir selbst, hätte ich zugeben müssen, dass ein Teil von mir sie immer noch liebte. „Ich wünschte, ich hätte von dir gewusst, als du noch ein Baby warst. Es tut mir sehr leid, wie alles gekommen ist.“ Sie starrte mich immer noch an. „Ich weiß, dass du sicher jede Menge Scheiße … äh … schlimme Sachen mit angesehen hast, aber ich möchte, dass du weißt, dass du hier in Sicherheit bist. Niemand wird dir etwas tun. Okay?“
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: