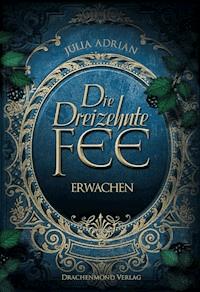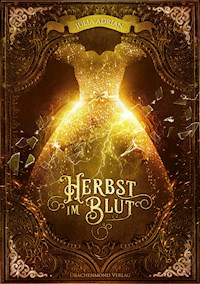
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Winters zerbrechlicher Fluch
- Sprache: Deutsch
"Alles hat seinen Preis. Erst recht ein Leben wie das unsere."Der letzte Ball naht und mit ihm die neue Ära der falschen Bräute. Während die Prinzen ums Überleben ringen, stellt sich Mary ihrer Vergangenheit und den gestohlenen Kindern, sowie einer Hexe, die seit zwölf Wintern Trauer trägt. Sie erkennt, dass jede Geschichte einem Spiegel gleich je nach Blickwinkel eine andere Wahrheit zeigt. Und sie muss sich entscheiden: für den Mut oder die Sicherheit; für das Leben oder den Augenblick. Nur eines ist gewiss: jede Entscheidung hat ihren Preis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Herbst im Blut
Julia Adrian
Copyright © 2019 by
Lektorat: Stephan R. Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Karte: Julia Adrian
Illustrationen: Soufiane El Amouri
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-247-1
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Königreiche diesseits der Eisenberge
Blutsbande
Auf den Spuren der Ahnen
Die Drachentöterin
Die Fürstin
Mary von Athos
Der Königswächter
Die Drachenbraut
Der Wüstenkönig
Der Jäger
Das gestohlene Kind
Der Jäger
Die Blutprinzessin
Der Jäger
Glassärge
Vom Sturz der Bräute
Die Fürstin
Mary von Athos
Der Wüstenkönig
Die Drachentöterin
Mary von Athos
Die stumme Königin
Der Jäger
Das gestohlene Kind
Mary von Athos
Der Sohn Westhams
Mary von Athos
Drachenbraut
Mary von Athos
Winter
Das gestohlene Kind
Der Wüstenkönig
Königszorn
Unter dem Blutmond
Mary von Athos
Das gestohlene Kind
Der Sohn Westhams
Mary von Athos
Das gestohlene Kind
Die Zofe
Der Jäger
Mary von Athos
Die stumme Königin
Die Drachentöterin
Die Zofe
Der Goldkönig
Der Jäger
Der Drachenkönig
Mary von Athos
Der Jäger
Die Zofe
Mary von Athos
Der Sohn Westhams
Der Wüstenkönig
Mary von Athos
Der Jäger
Die Drachentöterin
Winter
Der Jäger
Das gestohlene Kind
Epilog
Anhänge
Glossar
Nachwort
Danksagung
Blutsbande
Vor zwölf Wintern
Es war das Lachen, das mich den nächtlichen Flur entlanglockte, fort von der Treppe, über die Vater hinabzusteigen pflegte, über die kalten Steinfliesen und an den Zimmern der schlafenden Zofen vorbei bis zu Mutters Gemach. Die Tür war nur angelehnt, Kerzenschein glomm hinaus, ein schmaler Streifen Licht auf nackten Füßen. Mutter saß mit dem Rücken zu mir vor dem Spiegel, das Haar ergoss sich wie ein goldener Schleier um ihre Schultern, doch entgegen ihrer Gewohnheit lag die Bürste diese Nacht unberührt auf dem Holz. Schaudernd schlang ich die Arme um mich, als könnte ich so die Kälte verdrängen, die von den Steinfliesen aufstieg. Vater trat in mein Blickfeld und legte seine Hände auf Mutters Schultern. Die Geste kam mir so falsch vor, dass ich unwillkürlich zurückwich.
»Wir müssen handeln«, verlangte er mit harter Stimme.
»Ich weiß«, war alles, was sie sagte.
»Beinahe wäre es der Hexe gelungen, einen der Zwillinge zu stehlen! Wenn sie nach Mary trachtet … Bei meinem Leben, das lasse ich nicht zu!«
Mutter murmelte etwas, ich beugte mich vor, um sie besser zu verstehen.
»… verliert die Kontrolle über den Wald.«
»Sie bekommt Mary nicht!«
»Ich weiß«, sagte Mutter erneut. Ihre Hand fand Vaters, verflocht sich beinahe andächtig mit ihr. »Ich werde sie aufhalten.«
Vater knurrte. »Und wie gedenkst du das zu tun? Selbst die geballte Macht der Drachentöter konnte nicht verhindern, dass die Hexe ins Schloss eindrang. Unsere Soldaten wären ihr vollkommen unterlegen! Verfluchtes Westham, wenn sogar sie sich nur mit Not verteidigen konnten, wie sollen wir dann Mary schützen?«
Ich sah Mutter im Spiegel lächeln, es war ein Ausdruck, den ich nie zuvor an ihr gesehen hatte – und beinahe wäre ich erneut zurückgewichen, raus aus dem Streifen Licht, zurück in die Dunkelheit des Flures, vorbei an den Türen, hinter denen die ahnungslosen Zofen schliefen, wie auch ich hätte schlafen sollen. Doch ich konnte weder schlafen noch mich rühren. Denn Mutters Gesicht, beim Herbst, ihr Gesicht glich plötzlich denen der Jäger, die ich so sehr fürchtete. Nachdem sie den Wolf gefangen und ausgeweidet hatten, waren sie zu mir gekommen, um sich den Segen des Herbstes zu holen. Sie hatten vor mir gestanden und wie Mutter gelächelt, die Hände rot, die Augen schwarz.
Keine Monster, bloß böse, böse Menschen.
»Vielleicht«, sagte Mutter und selbst ihre Stimme glich jener der Jäger, sie kitzelte die Gänsehaut hervor, gleichsam das Entsetzen, »vielleicht ist es an der Zeit, dir die Wahrheit darüber zu offenbaren, wer ich bin und wie ich zu dir kam.«
»Du bist eine falsche Braut«, sagte Vater.
»Ich bin so viel mehr als das.«
»Du bist …«
»Ihre Schwester«, vollendete Mutter.
Vater taumelte zurück, während ich wie betäubt dastand und Mutter vom Stuhl aufstand – zweifach, einmal mit dem Rücken zu mir, einmal im Spiegel. Ihr Blick traf meinen flüchtig, ihre Brauen verengten sich, dann drehte sie sich zu Vater. Zoll für Zoll entblätterte sich die Seide des Nachtgewandes, bis sie nicht mehr Mutter war, sondern eine Fremde in einem blutenden Blätterkleid.
»Ich werde einen Fluch spinnen, der sie hindern wird, den Wald zu verlassen. Sie wird auf immer gefangen sein – und Mary«, erneut traf mich ihr Blick, diesmal warnend, »wird in Sicherheit sein, solange sie den Wald meidet. Niemals darf sie ihn betreten, denn wenn sie es tut, wird mein Fluch zunichte sein und mit ihm alles, was wir opferten.« Vater sank auf die Knie, Mutter ragte über ihm auf, eine Hexe, eine Fee, ein Wesen des Waldes. »Verstehst du das, mein Gemahl? Niemals darfst du sie gehen lassen! Nicht in den Wald, nicht einmal in seine Nähe. Behalte sie bei dir. Schütze sie vor allem, was da draußen existiert, denn selbst wenn sie im Wald gefangen ist, wird ihre Macht verbleiben. Jeder könnte ihr Diener sein. Jedes Kind, jede Zofe und jeder Soldat.«
»Du … du bist …?«
Mutter umfasste sein Gesicht, er zuckte zurück. »Mein wundervoller Mann – wenn ich dir doch nur hätte widerstehen können. Ich wollte dich und dieses Leben, ich wollte die Braut an deiner Seite sein und Mary, ich wollte Mary. Jetzt zahle ich den Preis für dieses Leben, das nicht mir bestimmt war, sondern einer anderen.«
»Du bist wahrlich eine Hexe«, krächzte Vater.
»Gräme dich nicht, wie hättest du es wissen können? Ich wechsle meine Namen wie meine Kleider.«
»Das Stroh«, stammelte er, »das Gold …«
»Glaubst du mir, dass ich dein Herz auf ehrliche Art zu erringen versuchte? Ich verhalf dir zu mehr Reichtum, als all deine Vorfahren je besaßen; mehr als deine Nachfahren in mühseliger Arbeit den Bergen je stehlen könnten. Du bist fürwahr der einzig wahre Goldkönig. Dank mir. Und dennoch …«
»Ich liebte dich nicht«, erkannte er heiser.
»Deshalb stahl ich dein Herz wie du das meine. Doch jetzt, da ich weiß, dass unser Glück zum Scheitern verdammt ist und ich das Ausmaß von Winters Schuld erkenne, gibt es nur einen Weg für uns. Ich werde mein Leben geben und du dein Herz.« Ihre Hand fand seine Brust, ich erstickte den Schrei, der in meiner Kehle platzte, Mutter zuckte zusammen. Als sie weitersprach, klang ihre Stimme spröde wie Glas. »Flüche werden aus Blut gewoben und ein so mächtiger, wie ich ihn schaffen werde, erfordert alles, was ich geben kann.«
»Dein Leben?«, fragte er und ich starb innerlich. Alles in mir schrie danach, die Tür aufzustoßen und mich in Mutters Arm zu stürzen, sie anzuflehen, niemals zu gehen, egal wer sie war und woher sie kam. Doch ich war unfähig, mich zu rühren. Die Kälte hielt mich fest umklammert. Tröstend und eisern zugleich. Nicht, noch nicht.
»Der größte Schutz fordert das größte Opfer«, sagte Mutter.
»Das kann ich nicht zulassen!«
»Törichter König, wenn nicht ich es tue, wer schützt dann dein Kind?«
»Du kannst zaubern …«
»Und genau das werde ich tun. Sosehr ich mir dieses Leben auch wünschte, so wenig wusste ich, wie es sich anfühlen würde, wahrhaftig ein Kind zu gebären, es in den Armen zu halten, es zu lieben und zugleich um es zu fürchten. Zu spät erkannte ich, welch Bürde ich mir aufgeladen hatte, wie schwer es mir fallen würde, sie eines Tages zu verlassen – denn das hatte ich vor: zu gehen, sobald ihr mich langweilen würdet. Doch dieser Tag kam und käme nie, wenn nicht, ja wenn ich dich nicht befreit hätte.«
»Oh Herbst«, stöhnte Vater.
»Ja«, sagte Mutter sanft. »Das bin ich.«
Damit ließ sie von ihm ab und trat an ihm vorbei. Sie ließ ihn zurück, auf dem Boden kniend, den Kopf in den Händen vergraben. Ich wollte zu ihm und von hinten die Arme um ihn schlingen, ihn halten und beteuern, dass alles gut war. So wie Mutter es stets tat, wenn ich des Nachts schreiend erwachte, gejagt von Jägern, deren Hände nach Blut schmeckten.
Mit großen Schritten kam Mutter auf die Tür zu.
Sie wusste, dass ich hier war, dass ich gelauscht hatte.
»Du irrst«, krächzte da Vater und Mutter hielt inne.
»Inwiefern?«, fragte sie leicht, das Gesicht halb mir, halb ihm zugewandt. Ich sah, wie es splitterte, kaum dass er die Worte sprach, und schaffte es endlich, mich aus der Starre zu lösen, während sie sich gänzlich zu Vater umwandte.
Ich habe dich immer geliebt. Damals wie heute.
Die Steinfliesen flogen unter mir dahin, meine Füße klatschten auf ihnen wie das Herz in meiner Brust. Die Kälte folgte mir wispernd. Selbst als ich dir Tür hinter mir zuschlug, kroch sie durch den Spalt im Boden und die Ritzen an den Seiten. Sie folgte mir bis ins Bett zwischen die Laken und das Kissen, das nach Albträumen schmeckte.
Du wirst vergessen, kleine Prinzessin.
Alles, was du heute gesehen und gehört hast, wirst du vergessen.
Es ist besser so. Besser für mich.
Und vielleicht auch für dich.
Schlaf jetzt, träume süß.
Auf den Spuren der Ahnen
Die Drachentöterin
Die Wüste schmeckte nach Staub und Verlust.
Elena konnte sich kaum vorstellen, dass Maywater einst eine Oase gewesen war. Goldglänzende Weizen- und Rapsfelder unter einem veilchenblauen Himmel. Heute war Maywater bloß noch heiß, eine verblichene Erinnerung ehemaligen Reichtums. Durch verlassene Handelsstädte, allesamt zu Ruinen verkommen, donnerte sie der letzten Stadt entgegen, die sich trotzig aus der Wüste erhob. Die Mauer wuchs in schwindelerregende Höhe, je näher sie kam. Erbaut aus dem Gebein Maywaters, bot sie Schutz vor dem Hunger der Wüste. Selten hatten sie über Maywaters Zerfall gesprochen; weder Tarek noch der Orden schien wahrhaftig daran interessiert, weshalb das einst blühende Reich zerfiel. Als Folge des großen Krieges und namensgebend für die Nachkriegszeit – die Ära der Hitze –, war alles, was Elena über Maywaters Schicksal wusste, dass es mit den Hexen zusammenhing. So wie alles mit ihnen zusammenhing. Die Ära der Hitze war mit dem Tag des schwarzen Winters in die Ära der Dunkelheit übergegangen – wenngleich beides fortbestand, die Not in Maywater und die in Athos. Ewige Wolken und glühende Hitze.
Als wären alle Reiche verflucht. Auch der Blutwald.
Hätte sie doch nur mit Tarek gesprochen! Über den Orden und den Sturz der Königin, über die Königskinder und Bräute – und über den Wald. Nichts von alledem wäre geschehen.
Kein Pakt mit der Hexe, keine Cinderella, kein drohender Krieg.
Elena kämpfte mit den Tränen, weil sie wusste, dass es zu spät war. Zu tief hatten sie sich im Gespinst der Lügen verfangen, zu feige waren sie gewesen. Tief lehnte sie sich über den Hals des Pferdes und gab sich für einen Augenblick der Ohnmacht hin, die ihr wie ein Schatten folgte. Kurz, nur kurz durfte sie schwach sein, durfte zweifeln, weinen, schreien, ehe sie sich fokussieren musste: auf die einzige Möglichkeit, den drohenden Krieg abzuwenden.
Was hat sie dir versprochen?
»Frieden«, wisperte sie und wusste doch, dass es etwas anderes gewesen war, das sie hatte zustimmen lassen. Nur du kannst ihn retten.
Das Spiegelamulett fest in den Händen, atmete sie tief durch und streifte die Ohnmacht ab. Sie blieb zurück wie ein Mantel, gebläht vom Wind und schwer zu Boden sinkend, während ihr Pferd sie durch die Ruinen trug. Ihr Atem ging ruhig, ihr Herz schlug fest, ihre Schultern spannten sich, als sie das Pferd vorwärtstrieb, in den lang gezogenen Schatten der Knochenmauer und durch sie hindurch, an unbesetzten Wehrtürmen vorbei. Niemand hielt sie auf, kein Soldat, keine Wache; selbst die Straßen waren erschreckend leer, als würde die Stadt nach einer durchzechten Nacht ruhen. Das Krachen der Hufe hallte zwischen den verstummten Häusern wider, ein vielstimmiger Chor, als würde eine ganze Armee aus Drachentötern sie begleiten.
Doch sie war allein. Und sie war nicht als Drachentöterin hier.
Zielstrebig sprengte sie zum heiligen Viertel. Sie roch das Fleisch, bevor sie es sah. Zu Bergen aufgetürmte Häute, zusammengefaltet wie Laken, dazwischen Karren mit abgetrennten Schädeln, mindestens ein Dutzend, wenn nicht gar doppelt so viele – dahinter weitere Karren, Kisten voll Fleisch, Hunde, die sich um abgeschälte Knochen balgten, Kinder, die aus Schweifhaar Zöpfe flochten. Die Panik ihres Tieres ignorierend, trieb sie es tiefer in das Viertel hinein, an Fellen vorbei, die gerade erst zu trocknen begannen, durch Pfützen aus geronnenem Blut und Schwärme von Fliegen. Die Kinder sahen nur flüchtig auf, zu vertieft waren sie in ihr neuestes Spielzeug, die Hunde tollten sich in eine abgelegene Gasse. Ein Fleischer trat aus der Tür, ein Beil in der Hand, die Augen eindringlich auf Elenas Pferd gerichtet. Sie strafte ihn mit einem flammenden Blick, er zuckte nur die Schultern.
Unter der roten Laterne sprang sie ab, band die Zügel an einen Haken, trat dann an das Portal, um zu klopfen, zögerte. Die Tür stand einen Spalt offen, dahinter gähnte kühler Schatten. Wachsam schob sie sich hinein, lauschte in die Stille, die einzig von summenden Fliegen durchbrochen wurde. Eine Ansammlung aus rauem Stoff lag zusammengeknüllt in einer Ecke, hastig abgestreift, umschwirrt von Aasfliegen.
Sie hasste Fliegen.
Geräuschlos durchquerte sie den Raum und sank neben dem Kleiderhaufen auf ein Knie. Ein derbes Kleid wie für eine Magd. Es stank elendig nach Fisch und Gedärm und ein wenig nach Blut. Der Wüstenkönig würde sein wahres Wunder erleben, käme er heim.
Was er vielleicht niemals tat, nicht, wenn Tarek ihn tötete.
Angespannt erhob sie sich von dem Stoffknäuel, trat in den angrenzenden Raum und sah sich um. Es war beängstigend still. Der Orden umfasste nur wenige Mitglieder, darunter vor allem Kinder, die auf ihre spätere Aufgabe vorbereitet wurden, dazu die Oberin und einige Schwestern. Dennoch war Elena der Tempel niemals so verlassen vorgekommen wie an diesem Morgen. Misstrauisch trat sie zur Treppe. Sie wusste, wohin der dunkle Schacht führte. Hinab, hinab. Widerwillig folgte sie den grob in den Fels gehauenen Stufen, zählte sie stumm, wissend, dass es genau vierzig waren, bis sie das Schlachthaus erreichte.
Acht.
Neun.
Zehn.
Sie hatte jede einzelne Stufe gefürchtet, damals, als sie noch ein Kind gewesen war, auserwählt, dem Orden zu dienen, von der Straße geklaubt, geformt und manipuliert.
Dreizehn.
Vierzehn.
Gekauft mit Essen, Trinken und einem Dach über dem Kopf.
Fünfzehn.
Sechzehn.
Niemals konnte sie vor Tarek zugeben, dass sie in dieses Leben gezwungen worden war. Dass sie keine Wahl gehabt hatte. Keine wirkliche zumindest.
Neunzehn.
Zwanzig.
Sie verharrte – wie sie es früher stets getan hatte – in der Mitte der Treppe. Zwanzig Stufen hinter ihr und zwanzig, die weiterführten. Hinab, hinab. Wenn sie hier gestanden hatte, zwischen oben und unten, zwischen der Stadt und der Hölle in ihren Eingeweiden, hatte sie sich stets gefühlt, als hätte sie eine Wahl. Als bräuchte sie bloß umzudrehen, die Stufen erklimmen, die Pforte durchschreiten und dem heiligen Viertel entfliehen. Hinein in die Stadt und fort von dem, was unter ihr lag.
Zwanzig Schritte bis zur Freiheit.
Zwanzig Schritte hinab, hinab.
Einundzwanzig.
Das Gleichgewicht wankte. Die Freiheit verlor – wie stets.
Zweiundzwanzig.
Weil sie niemals eine Wahl gehabt hatte. Weder damals noch heute.
Sie erinnerte sich, wie sie als Kind der Oberin durch die schummrigen Gassen gefolgt war, fasziniert von den schwankenden Laternen und bunten Farben – vielleicht auch von der Oberin selbst, deren Narben und den Geschichten, die sie erzählte. Über Monster in Wäldern und jenen in Schlössern. Von Bräuten, die sich in menschliche Häute kleideten, und Königen, die erblindeten, von lebenden Toten und gestohlenen Kindern. Sie erinnerte sich, wie sie zum ersten Mal vor der Pforte gestanden hatte, unter der roten Laterne. Das Licht hatte sich so wunderbar leicht angefühlt, anders als die klebrige Hitze in den unteren Vierteln, aus denen sie stammte. Dunkel und heiß und staubig und überbevölkert. Sie hatte nicht lange gezögert. Auch Susann nicht. Niemand von ihnen.
Achtundzwanzig.
Neunundzwanzig.
Das unsichere Leben auf den von hungernden Kindern ausgetretenen Straßen oder ein Dasein als Schwester des Roten Ordens.
Dreißig.
Auserkoren, um zu schützen.
Zweiunddreißig.
Dreiunddreißig.
Vierunddreißig.
Der Preis erschien gering, der Nutzen gewaltig.
Und doch, während hier und jetzt die letzten Stufen unter ihr dahinschwanden, wusste sie, dass der Orden ihr mehr abverlangt hatte, als es ein Leben auf der Straße je gekonnt hätte. Der Orden opferte Kinder, um einen Krieg zu fördern, dessen Spuren noch heute die Welt entzweiten. Brach liegendes Land, zerfallende Städte, Berge von Häuten und Zöpfe aus Schweifhaar. Das war die Welt, in der sie lebte – und starb.
»Damit sie eine Wahl haben«, flüsterte Elena, doch die Worte klangen hohl.
Was hat sie dir versprochen?
Achtunddreißig.
Neununddreißig.
Vierzig.
Etwas schepperte. Sie fuhr herum, die Klinke schon in der Hand. Ein Mädchen stand über ihr auf der vierunddreißigsten Stufe. Ein Mädchen, wie sie es gewesen war, mit derselben Vorsicht im Blick und gehüllt in die traditionelle Ordenstracht, damit niemand das Blut sah, sollten die Schnitte aufbrechen. Beim Anblick der langen Ärmel, dem steifen tizianroten Stoff, hochgeschlossen bis zum Hals, wurde ihr schlecht. Wie alt mochte sie sein? Acht? Neun?
»Für wen bist du vorgesehen?«, verlangte sie zu wissen.
Das Mädchen krampfte die Finger um den Eimer, den es in der einen Hand trug und in dem es dunkel schwappte. Mit der anderen hielt sie einen tropfenden Wischmopp, dazu eine flackernde Kerze. Elena ächzte innerlich, weil sie wusste, wozu das Mädchen die Stufen hinabstieg. Es gab nur einen Grund, das Schlachthaus zu säubern. Sie selbst hatte es nur wenige Male tun müssen, ehe sie in den Dienst der Drachentöter abkommandiert worden war. Andere, das wusste sie, blieben auf ewig im Tempel, um den Ritualen beizuwohnen und das Blut aufzuwischen – so wie das Mädchen, dessen Anblick ihre Zweifel nährten wie der Silberfluss das Meer.
»Für niemanden«, antwortete es kleinlaut.
Elena zwang sich, keinerlei Mitgefühl zu zeigen. Es würde dem Mädchen nicht helfen, ihm höchstens vor Augen führen, wie aussichtslos seine Lage war. Falls es das überhaupt zu begreifen vermochte. Denn all jene, die für niemanden bestimmt waren, dienten einem anderen Zweck. Von ihnen verlangte der Orden das größte Opfer.
»Wo ist sie?«
»Die Fürstin?«
Elenas Brauen schossen hoch. »Sie war hier?«
Das Mädchen zuckte verängstigt zurück und erklomm instinktiv die dreiunddreißigste Stufe.
Gut so, dachte Elena. Hinauf mit dir, hinauf in die Freiheit.
»Was wollte sie hier?«
Die Antwort kam so leise, dass Elena größte Mühe hatte, die Worte zu verstehen.
Braut. Kleid. Opfer. Genug, um zu begreifen, was geschehen war.
Die Klinke brannte sich in ihre Haut, ihr war schlecht. »Seit wann ist sie fort?«
»Im Morgengrauen waren sie fertig.«
Fertig.
Das Wort hallte in Elena nach.
Fertig.
Fertig.
»Die Oberin?«
»Ging ebenfalls.«
»Wohin?«
Das Mädchen stammelte etwas vor sich hin.
»Es ist mir gleich, dass du gelauscht hast. Ich muss wissen, was sie sagten.«
»Sie suchen ein Kleid. Weil das, welches die Fürstin brachte, das falsche war.«
»Wo sind sie?«, hakte sie nach, doch das Kind wusste keine Antwort, und so blieb Elena nichts übrig, als die Klinke hinunterzudrücken und das Schlachthaus zu betreten, jenen Raum, von dem sie wusste, dass auch ihr Leib eines Tages in ihm verschwinden würde, dann, wenn ihre Dienste nicht länger gebraucht wurden und eine jüngere Schwester an ihre Stelle treten würde. Ausgedient – wie die Person auf der Schlachtbank.
Oder eher das, was davon noch existierte.
Es war gerade genug, um die Überreste als menschlich zu identifizieren. Keine Haut, kein Herz, kein Haar. Der Körper glich einem aufgebrochenem Gefäß, das Blut sorgsam abgezapft, die Krüge, in denen es aufgefangen worden war, noch feucht. Elena trat tiefer in den Raum, fand die frisch aufgereihten Einmachgläser und träge dahintreibenden Organe im dämmrigen Nass. Das Mädchen folgte ihr, es trat zum Kopfende des Opfertisches.
»Wozu braucht sie ihr Gesicht?«
Elena glaubte sich verhört zu haben. Doch das Mädchen sah hoch, die Augen zwei blanke Kiesel, das Grauen spiegelnd, und wiederholte die Frage. Elena stutzte. Ihr Blick suchte die Einmachgläser. Da war Haut. Haufenweise Haut. Konserviert für spätere Zauber. Für dunkelste Blutmagie. Aber da war kein Gesicht.
»Sie trägt es«, sagte das Mädchen.
Elena taumelte. Das Spiegelamulett brannte in ihrer Hand, das Schwert mit der blutigen Spitze wog plötzlich schwerer.
Nur du kannst ihn retten.
Aber zu welchem Preis?
Die Fürstin
Das Kleid war das falsche gewesen, die Scherben aber, die sie in den Händen hielt, stammten von dem Schuh, den Cinderella getragen hatte. Zwar von dem, der nicht mit Winters Zauber durchtränkt war, aber immerhin. Glas blieb Glas und Scherben blieben Scherben. Behutsam, damit sie sich nicht verletzte, trug sie den Beutel zu ihrem Anwesen. Der Wachmann in den königlichen Kerkern hatte ihn ihr beinahe überhastig ausgehändigt, nutzlose Scherben – wer brauchte die schon? Er hatte sich höflich, wenngleich nervös nach dem Wohlergehen der Zofe erkundigt, ehe er die Pforte des Kerkers fest verschloss. Er fürchtete die Euphorie des vergangenen Tages, sollte sie sich gegen die überfüllten Zellen des Kerkers richten. Noch war die Stadt erstaunlich ruhig, als würde sie dem Rausch der Nacht nachhängen, als fiele ihr das Erwachen schwer, so wie es auch ihr manchmal schwerfiel.
Weil sich nichts verändert hatte.
Volle Mägen für wenige Tage, mehr nicht.
Kein Regen, keine Erlösung von der Wüste.
Wie gern würde sie es hinausposaunen, dass die eine, von der die Prophezeiung sprach – eine mehr als lächerliche Prophezeiung, wie sie fand –, keine Heilung würde bringen können. Nicht mehr. Und hätte es auch nie, fügte sie in Gedanken hinzu. Alles andere verbot sie sich zu glauben. Denn wenn es stimmte und Cinderella wahrhaftig die eine war, die den Fluch der Wüste hätte brechen können, dann war alles vergebens.
Der Lakai öffnete das Tor, durch das sie vergangenen Abend entschlüpft war. Nach Cinderella – oder besser: Colette – wagte er nicht zu fragen, genauso wenig wie er die Ordenstracht ansprach, die sie trug. Er neigte nur den Kopf, wie es die Etikette verlangte.
Sie drängte hinein. »Verweilt mein Gast im Salon?«
»Sehr wohl, Euer Gnaden.«
»Sorge dafür, dass uns niemand stört.«
»Nun«, er hüstelte, »es wünscht Euch noch jemand zu sprechen.«
»Ich erwarte niemanden.«
Er beugte sich vor, als fürchtete er, belauscht zu werden: »Es ist ein ungewöhnlicher Gast. Eine … Drachentöterin.«
Die Fürstin versteifte sich. »Wo?«
»Ich bat sie, im Orangenhain zu warten.«
»Kein Wort darüber. Zu niemandem!« Damit entließ sie ihn und eilte über die frisch gefegten Steinpfade an sorgsam gestutzten Rasenflächen vorbei, bis sich vor ihr der Orangenhain öffnete. Der gesamte Garten war von kalkweißen Mauern eingefasst, damit niemand von außen einsehen konnte, welch Paradies sich in ihrem Innern verbarg. Aprikosen, Orangen, sogar einen selten gewordenen Granatapfelbaum nannte sie ihr Eigen. Unter den ausladenden Ästen, die derzeit schwer vor Früchten gen Boden hingen, fand sie die Drachentöterin, in der Hand eine Orange, passend zu den Schuppen ihrer Rüstung.
»Wie kannst du es wagen, mich in meinem Heim aufzusuchen«, zischte die Fürstin, kaum dass sie in Hörweite war. »Du gefährdest alles!«
»Ich? Oder seid Ihr es?«
Der Blick aus umschatteten Augen traf die Fürstin wie ein Schwall kaltes Wasser. Halt suchend tastete sie nach der Bank, die der Drachentöterin gegenüberstand.
»Du warst dort?«
»Das Kind, das ihr zum Putzen dagelassen habt, ist wie alt? Acht? Neun?«
»Ich weiß es nicht«, gab die Fürstin zu. Sie hatte kein Auge zugetan, seit sie vergangenen Abend aufgebrochen und auf der Suche nach dem Kleid, nach dem es der Oberin verlangte, von Taverne zu Taverne gezogen war. Cinderella hatte ihres gegen das einer Dirne getauscht – doch die Fürstin hatte es nicht aufspüren können. Allein die Scherben, sie presste den Beutel fester an sich, allein ihrer war sie habhaft geworden.
»Ich habe ihr verboten, die Sauerei aufzuwischen.«
»Warum?«, fragte die Fürstin irritiert.
Die Drachentöterin schnaubte. »Wenn du das fragen musst, begreifst du die Antwort nicht.« Nur zu gern hätte die Fürstin beteuert, dass sie sehr wohl verstand, jetzt, da sie darüber nachdachte – doch die Wahrheit war, dass sie keinen Gedanken an das Mädchen verschwendet hatte. »Sie ist zurück auf der Straße«, fuhr die Drachentöterin fort, »besser sie schließt sich einer Diebesbande an als …«
Uns, stimmte die Fürstin im Stillen zu.
»Wem dienen wir?«, fragte die Drachentöterin unvermittelt.
»Dem Orden.«
»Und wer«, präzisierte sie bedacht, »leitet den Orden?«
Die Fürstin strich sich die Strähnen aus der Stirn, schon jetzt war es unerträglich heiß, dabei stieg die Sonne erst gen Zenit. »Die Oberin las uns von der Straße auf, sie bildete uns aus und wies uns unsere Plätze zu. Sie erwählte uns.«
»Und wer erwählte sie?«
»Herbst.«
»Wer sagt das?«
»Die Oberin. Sie ist das Oberhaupt.«
»Richtig«, sagte ihr Gegenüber gedehnt und drehte die Orange in den Händen, »denn Herbst ist tot und so gibt es niemanden, der ihre Aussage anzweifeln könnte.«
Die Fürstin zerrte am Kragen der Ordenstracht. Sie brauchte ein kühles Bad, etwas für den Magen und Wein, viel Wein. Es kostete sie ein Höchstmaß an Konzentration, nicht in die Rolle der herrischen Adeligen zu verfallen und auf der Stelle danach zu verlangen. Selbst wenn sie die Drachentöterin des Hauses verwies, verblieb die Oberin im Salon und mit ihr das schlechte Gewissen. »Worauf willst du hinaus?«, fragte sie deshalb gereizt.
»Ich rekapituliere die letzten Tage. Ich rekapituliere vieles. Die schönste Braut starb, um die Prinzessin zu schützen. Ihr Blutopfer färbte den Wald und verbot ihm, sein Laub abzuwerfen. Sie schuf ein Gefängnis für Winter – doch jetzt ist es ebendiese, die mich zu dir schickt. Zur Oberin.«
»Winter?«
Ein gedehntes Ja. Eines, das mehr sagte als bloß das. »Sie bat mich, zweierlei mitzunehmen.«
»Und das wäre?«, fragte die Fürstin unwillig.
»Weißt du das nicht?«
Der Beutel mit den Scherben zog sie nieder. Sie hatte niemals nachgefragt, hatte es nicht wissen wollen. »Was hast du dabei?«
»Blut«, sagte die Drachentöterin nachdenklich, »und etwas, das einst einer falschen Braut gehörte.« Sie zog das Spiegelamulett hervor. »Wem dienen wir?«, fragte sie mehr sich selbst als die Fürstin, während sie sich in dem blitzenden Spiegel betrachtete. »Herbst?«
Die zweite Frage hing unausgesprochen zwischen ihnen in der glühend heißen Luft.
Oder Winter?
Mary von Athos
»Glaubst du mir,
dass ich dein Herz auf ehrliche Art zu erringen versuchte?«
Die schönste Braut
in der Nacht vor ihrem Tod
Ein Sonnenstrahl kitzelte mich wach. Blinzelnd folgte ich der gleißenden Linie aus Licht und fand mich unter einem zerschlissenen Baldachin wieder, in einem Bett, das ich nicht kannte, und mit einem Gefühl in der Brust, das mir fremd war. Ranken schlangen sich um die Bettpfosten, spannen ein Netz unter dem brüchigen Gewölbe, durch das sich der Lichtstrahl geschlichen hatte. Ein Dutzend weitere brach hindurch und sprenkelte das Gemach, das einst einer Prinzessin würdig gewesen wäre. Durch ein klaffendes Loch im Mauerwerk ergoss sich ein Schwall Licht, dahinter lag still und verboten der Blutwald.
Zitternd befreite ich mich von der Decke, die sorgsam um mich gesteckt war, und schwang die Beine über die Kante. Es klirrte, etwas funkelte; ich glaubte einen Gedanken fassen zu können, doch aufkommender Schwindel zwang ihn nieder. Das Gemach begann sich zu drehen. War das hier Westham? Daran erinnerte ich mich: an den Aufbruch aus Maywater, die Wüste, den Fluss und das Licht, das sich in seinen Haarspitzen verfangen hatte.
»Tarek?«, krächzte ich.
Schritte erklangen, eine Tür wurde aufgestoßen. Zwei Frauen rauschten herein, die einander glichen, als wären sie der jeweils anderen Spiegelbild. Während eine im Hintergrund verblieb, trat die zweite zu mir. Schlank, groß und dunkelhaarig waren sie alle beide, die Lippen blutrot, die Augen verengt. Letztere taxierte mich; was sie sah, schien ihr zu missfallen.
»Sieh an, wer da von den Toten auferstanden ist. Wir dachten schon, du würdest auf ewig ruhen – wie seine Mutter.«
Ich verschloss mein Gesicht. »Wie lange habe ich geschlafen?«
»Keine zwei Tage.« Sie wirkte fast, als würde sie diesen Umstand bedauern. Ihr Blick tastete mein Gesicht ab, mein Haar, meinen Nacken. Dort blieb er hängen; unwillkürlich griff ich dorthin und zuckte zurück. Die Haut war verbrannt.
»Rose«, warnte die andere.
»Ich beiße sie schon nicht, keine Sorge.« Unbeirrt lächelnd blieb Rose, wo sie war; sie kam sogar noch näher. »Sieht aus, als würde es schmerzen. Bei Ranblut ist selbst Winter machtlos. Es heißt, die Ran seien Drachen, die während des großen Krieges fielen. Getötete Drachen, die keinerlei Ruhe fänden. Aufregend, nicht wahr?«
»Wo bin ich?«, ignorierte ich ihre Worte.
»Im Schloss der Jahreszeiten – wo sonst?« Sie sagte es so abschätzig, dass sich alles in mir zusammenzog. »Wie nachlässig. Ich vergaß, uns vorzustellen. Meine Schwester und ich, wir sind die zukünftigen Bräute Westhams.« Ich erstarrte, während sie beinahe schnurrte. »Nenn mich Rose und sie Alba. Zauberhafte Namen, ich weiß. Winter gab sie uns. Sie ist so vorausschauend.«
Hätte ich nicht jahrelang Haltung geübt, wäre mir ein wahnsinniges Gelächter entschlüpft; so jedoch starrte ich die Schwestern bloß an, die auf den zweiten Blick kaum Ähnlichkeit besaßen. Während in Roses Augen ein hintergründiges Feuer schwelte, wirkte ihre Schwester erschreckend farblos und leer.
»Du darfst nichts verraten«, zischte Alba.
»Eine Andeutung hier und dort, was schadet das schon?«
»Bräute von Westham – wirklich?«
Rose sah auf ihre Nägel. »Sie hätte es sowieso erfahren.«
»Nicht von dir!«
Ein schmales Lächeln. »Was macht das für einen Unterschied?«
»Wir dürfen uns keinen Fehler mehr erlauben …«
Da fuhr Rose herum: »Ach, jetzt ist es meine Schuld? Du warst es doch, die …«
»Rose«, warnte Alba.
Rose verdrehte die Augen. »Schon gut, schon gut. Es ist meine Schuld.«
»Ein falsches Wort von dir und …«
»Ich habe verstanden«, fiel Rose ein und sank zu mir aufs Bett; rasch zog ich die Beine an – da erblickte sie den Schuh. Das falsche Lächeln fiel von ihren Wangen wie ein Regenguss. »Cinderellas Blut steckt in diesem Schuh, so wie das des maywaterschen Kronprinzen. Nur auf ihn dürfte er wirken, nur ihr dürfte er passen …« Rose schnaubte und zog eine schimmernde Kugel hervor, die sie zornig in die Luft warf und wieder fing; warf und fing. »Winter ist nachlässig geworden. Schafft einen Schuh, der der Falschen passt. Sie verliert die Kontrolle über ihre Bräute, der Wald wird angegriffen – was kommt als Nächstes?«
»Du redest zu viel«, fuhr Alba dazwischen.
»Was schadet es? Winter lässt sie eh nie wieder gehen.«
Alba schwieg. Ich fröstelte.
»Sie sollte es wissen«, sagte Rose leichthin, »anders als wir ist sie keine Braut und wird deshalb diesen Wald und dieses Schloss niemals mehr verlassen. Sie wird gefangen sein, wie wir es all die Jahre waren. Die einzig wahre Prinzessin, wenn das nicht wahrhaft ironisch ist!«
Ich schloss die Augen. Mein Kopf schmerzte. Meine Brust war zu eng.
Für einen Augenblick glaubte ich gar, mich wieder auf seinem Rücken zu befinden, während das Jaulen der Hunde erstarb und der Waldboden unter uns dahinflog.
»Susann«, erinnerte ich mich jäh. »Ich muss zu ihr. Er sagte, sie sei hier.«
Das Spiel mit der Kugel stockte. »Er?«
»Der Jäger. Er sagte, sie sei im Wald. Meine Zofe. Ist sie hier?«
Rose Lächeln drohte ihr die Wangen zu zerreißen. »Gewiss ist sie das.«
»Sie ist hier?«
»Das sagte ich doch gerade.«
Da schwang ich die Beine aus dem Bett; der erste Schritt ließ mich schwanken, der zweite keuchen, beim dritten begriff ich, dass mein Knöchel mich unmöglich tragen konnte. Halb blind vor Schmerzen sank ich in einen Sessel, der unter Moos und Flechten verborgen kaum als solcher zu erkennen war. Während ich um Atem rang, stritten sich die Schwestern.
»Es ist nur noch dieser eine Tag.«
»Selbst eine Stunde wäre zu lang!«
»Denk an Cinderella.«
»Bei allen Geistern, das tue ich!«
»Rose …«
»Geh«, zischte diese und Alba gab nach. Kaum hatte sich die Tür hinter ihr geschlossen, da baute sich Rose vor mir auf. »Weinst du je? Alba tut es nicht. Sie lächelt auch nie. Sie sagt, es sei nutzlos. Nutzlos! Kannst du dir das vorstellen? Ich konnte einst singen, das war nutzlos.«
Ich atmete gegen den Schmerz und schwieg.
Rose fiel rücklings aufs Bett, ihre Haare ergossen sich wie schwarze Seide über die Laken. Schnaubend nahm sie das Spiel mit der Kugel wieder auf. »Du bist wie Alba. Du lachst nicht, du weinst nicht, wenn du denn wenigstens singen würdest.« Die Kugel streifte die Ranken, das einzige Anzeichen ihres inneren Aufruhrs. »Ihr seid so schrecklich kalt, als schlüge ein Herz aus Eis in eurer Brust.«
»Du weißt nichts von mir«, erwiderte ich erschöpft.
Rose begann an den Fingern abzuzählen. »Du wurdest wie ein Stück Vieh an den Kronprinzen vom Maywater verschachert, der dich vor aller Augen verschmähte, nur um anschließend nach deinem Leben zu trachten. Deine Mutter ist tot, dein Vater herzlos. Du leidest, das ist glasklar; aber du weinst nicht. Warum weinst du nicht?«
»So wurde es mir beigebracht.«
»Von wem?«
»Meiner Mutter.«
»Die sich vom Turm stürzte.« Spöttisch hob Rose die Brauen.
Vielleicht hätte ich mit Zorn reagieren sollen, stattdessen fühlte ich mich bloß schrecklich schläfrig; ich sank tiefer in den Sessel. Nur kurz wollte ich ruhen, bis der pochende Schmerz im Fuß nachließ und die bleierne Müdigkeit wich.
»Warum darf eine Prinzessin wie du nicht weinen?«, hakte Rose nach.
»Sie ist ein Vorbild.«
Verständnislos schürzte sie die Lippen. »Ist Trauer nicht erstrebenswert?«
»Es ist eine Schwäche.«
»Eine Schwäche?«, wiederholte Rose so ungläubig, dass sie es gar nicht erst auszusprechen brauchte: sie war anderer Meinung. »Warum sollten Trauer und Schmerz nicht Teil des Lebens sein? Braucht es nicht auch Regen und Sonnenschein, damit das Getreide auf den Feldern wächst?« Sie hatte ja keine Ahnung, wie oft ich mir diese Frage als Kind gestellt hatte. Der Blick, den sie mir zuwarf, war erschreckend klar. »Liebst du ihn?«
»Wen?«, fragte ich schwach. Ich konnte ihr nicht folgen.
Sie lachte blechern. »Wenn du das nicht weißt, ist es keine Liebe!«
»Woher willst du das wissen?«
Sie schnalzte mit der Zunge. Wie konnte ich es auch wagen, ihre Worte anzuzweifeln?
Naserümpfend widmete sie sich ihrer Kugel. »Dein Kleid ist ein Albtraum. Es stinkt.«
Die graue Seide war kaum noch als solche zu erkennen, ausgefranst und schmutzstarrend, vielleicht auch vor Blut, hing sie in Fetzen an mir herab.
»Meine Zofe«, fragte ich erschöpft. »Wo ist sie? Geht es ihr gut?«
Rose rollte sich lasziv herum. Ein hintergründiges Lächeln teilte ihre Lippen. »Ich würde fast sagen, es ging ihr niemals besser.« Ein letztes Mal flog die gläserne Kugel in hohem Bogen zur Decke, plumpste irgendwo zwischen den Farn und blieb unbeachtet liegen. »Du kannst zu ihr, aber nicht so! Dein Kleid ist so verdreckt, dass sie ganz bestimmt stirbt, wenn sie dich darin erblickt.« Rose schwang sich vom Bett, das Moos schluckte ihre Schritte, dann stand sie neben einem umwucherten Schrank. Drei Kleider hingen darin aufgereiht, allesamt blütenweiß. »Die Auswahl ist bescheiden, aber ich denke, es genügt.« Sie zog eines hervor, betrachtete es prüfend. »Ganz gleich, welches du wählst, ein jedes wird dich an deinen Verlust erinnern.«
Irritiert runzelte ich die Stirn.
»Der Kronprinz? Die Hochzeit? Das Brautkleid?«, half Rose mit hochgezogenen Brauen aus, spitzte dann die Lippen. »Maywater gehört dein Herz definitiv nicht. Nun, du wirst es beizeiten herausfinden.« Ihr Gesicht blieb seltsam unbewegt, als sie mich aus der Seide schälte, die wie eine zweite Haut an meinem Körper saß. Sie gab mir ein feuchtes Tuch. »Das muss reichen. Es ist nur eine Zofe und kein Königssohn.«
»Sie ist alles für mich.«
»Wie Alba für mich«, sagte sie und ich hatte das Gefühl, dass sie wahrlich verstand. »Wir wurden in der Nacht unserer Geburt gestohlen, niemals verließen wir seither das Schloss. Es ist unser Zuhause und unser Gefängnis.« Sie half mir, das Kleid über den Kopf zu ziehen und die Schnüre des Mieders zu schließen. »Niemand von uns kann den Wald verlassen. Nur er. Er hat dich getragen, nicht wahr? Wie ein verfluchter Ritter – aber das ist er nicht. Kein Ritter. Nur verflucht.« Das Mieder sträubte sich, Rose zerrte fester.
»Rose, könntest du …«
»Wir sind zusammen aufgewachsen: Alba und ich, Cinderella und er.«
»Rose«, ächzte ich, als sie gewaltsam an den Bändern riss.
»Alle hatten ihn aufgegeben. Seine Eltern. Sein Bruder. Niemand kam, um ihn zu retten – so wie niemand kommen wird, um dich zu retten.«
»Rose …«
»Ist es nicht ironisch, dass euer Schicksal einander so gleicht? Zwei ungewollte Kinder, verloren im Blutwald, tot geglaubt. Es ist beinahe tragisch.«
Panisch tastete ich nach den Schnüren. Rose schlug meine Hände weg und stieß mich zurück in den Sessel. Mein Atem ging flach. Der Schmerz in meinem Kopf schwoll an, ein dumpfes Pochen, das mir die Sicht nahm.
»Nicht du warst es, die ihn rettete, als alle anderen ihn aufgegeben hatten. Nicht du hieltest ihn Nacht für Nacht, die er starb. Es waren nicht deine Arme, in denen er allmorgendlich erwachte, nur um erneut zu sterben.« Ihre Stimme verschwamm, ihr Gesicht verzerrte sich vor meinen Augen. »Nicht du liebtest ihn, nicht du ertrugst seine Zurückweisung in dem Wissen, dass er eines Tages dir gehören würde …«
Ihre Worte verklangen.
Alles verklang. Das Ächzen meiner Lunge. Der Schmerz in meinem Kopf.
»Hättest du doch den maywaterschen Kronprinzen geliebt.«
Der Königswächter
Der Mann, der ihm entgegentrat, ähnelte dem Kronprinzen so frappierend, dass eigentlich kein Zweifel an seiner Identität bestand, dennoch war da etwas Unmenschliches in den Zügen, das ihn zögern ließ. »Ihr seid es, nicht wahr? Keine Wahnvorstellungen, keine Illusion. Ihr … seid es?«
»Leibhaftig«, sagte der gestohlene Prinz.
Der Königswächter stieß den Atem aus. »Nach all den Jahren!«
»Zwölf, um genau zu sein.«
»Ich bin Euch noch am Tag des Raubes hinterher; drei Dutzend Drachentöter starben bei dem Versuch, Euch zu retten. Seither ist es ihnen verboten, den Blutwald zu betreten; der Grund, warum ich die Garde verließ und es auf eigene Faust versuchte.«
Da war keine Regung im Gesicht des Prinzen, dennoch veränderte sich die Atmosphäre zwischen ihnen, die Luft wog plötzlich schwerer, wie vor einem drohenden Gewitter, wenn die Wolken den Himmel violett verfärbten und erste Blitze durch das Dunkel zuckten.
»Euer Bruder flehte mich an, Euch zu retten; er fürchtete sehr um Euch.«
»Nicht genug«, gab der gestohlene Prinz zurück, »um es selbst zu versuchen.«
»Er war ein Kind.«
»Das ist er schon lange nicht mehr.«
Wie wahr, dachte der Königswächter; er wagte nicht daran zu denken, was der Junge von damals alles hatte erfahren müssen, zusätzlich zu der Tatsache, dass kein Familienmitglied sich je auf die Suche nach ihm gemacht hatte. Die Züge des gestohlenen Prinzen waren kantiger als die des Drachentöters, seine Haltung glich der eines Raubtieres.
»Was hat sie Euch bloß angetan«, murmelte er.
Die Augen des Prinzen verengten sich; er sah selbst das Zucken der Fingerspitzen des Königswächters, die nach dem Schwertknauf lechzten. Der Prinz hingegen trug Dolche. Vier hatte er bereits erkannt und zweifelte keinen Augenblick, dass da weitere waren, gut verborgen am Leib des Mannes, der mehr den Wesen glich, denen er im Blutwald entgegengetreten war, als dem Jungen, den er zu finden gehofft hatte.
Er räusperte sich. »Wo ist die Prinzessin?«
Der Prinz hob eine Braue. »Ihretwegen seid Ihr hier.«
Eine Feststellung, keine Frage. Leugnen war zwecklos.