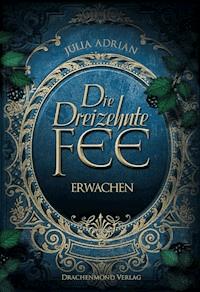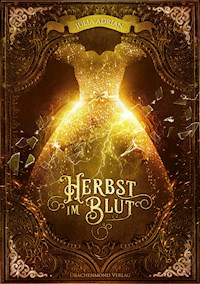Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Winters zerbrechlicher Fluch
- Sprache: Deutsch
"Verschenke dein Herz mit Bedacht, denn es ist aus Glas und Glas zerbricht in den falschen Händen."Als Cinderella auf den Ball gerauscht kommt und des Prinzen Herz stiehlt, steht Mary vor den Scherben ihres Lebens. Schließlich sollte sie selbst Duncan heiraten und Königin von Duncan werden. Doch das Schicksal gewährt ihr eine zweite Chance. Denn am Ende der Nacht ist die schöne Fremde im Himmelskleid verschwunden und der einzige Beweis ihrer Existenz verbleibt ein gläserner Schuh. Doch wer hätte gedacht, dass ein Schuh aus Glas so schwer zu zerstören ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Winters zerbrechlicher Fluch
Julia Adrian
Copyright © 2019 by
Lektorat: Stephan R. Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Karte: Julia Adrian
Illustrationen: Soufiane El Amouri
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-245-7
Alle Rechte vorbehalten
Für alle,
die bisweilen zweifeln.
Schlimmer als zu versagen, ist einzig,
es niemals zu wagen.
Erlaubt euch zu scheitern.
Es ist der Beweis eures Mutes.
Aufstehen, Krone richten, weitermachen.
Und ganz besonders für dich,
Schwesterherz
Inhalt
Königreiche diesseits der Eisenberge
Es war einmal
Schwarzer Winter
Unter falschen Sternen
Mary von Athos
Der Jäger
Mary von Athos
Der Sohn Westhams
Mary von Athos
Der Kronprinz
Mary von Athos
Der Sohn Westhams
Mary von Athos
Der Jäger
Wüstenblüte
Im Herzen der Wüste
Mary von Athos
Der Goldkönig
Mary von Athos
Der Jäger
Die stumme Königin
Mary von Athos
Die Drachentöterin
Der Jäger
Mary von Athos
Der Graf
Mary von Athos
Der Wüstenkönig
Der Mörder
Dornröschen
Von welkenden Rosen
Mary von Athos
Der Kronprinz
Der Jäger
Mary von Athos
Die Fürstin
Der Kronprinz
Die Zofe
Mary von Athos
Der Sohn Westhams
Der Graf
Der Jäger
Der Späher
Mary von Athos
Der Wüstenkönig
Der Jäger
Mary von Athos
Sie
Mary von Athos
Es war einmal
Wenn mich die Sehnsucht nach dem Nordturm überkommt und ich wie früher durch die Gänge streife, mit nackten Füßen und bloßem Herzen, glaube ich fast, dass es besser ist, wenn die Welt uns vergisst: die schönste Königin und das Kind, welches niemals hätte geboren werden dürfen. Denn wem dient schon die Wahrheit, wenn sie so viel weniger Hoffnung birgt als die Lüge? So viel weniger Stoff, aus dem Träume gewebt werden können?
Nein, sie sollen das Märchen erzählen …
Von dem Prinzen, der wahrhaftig liebte.
Von dem armen Mädchen, dessen Schicksal sich zum Guten wandte.
Von der Fee, die nur das Beste im Sinn hatte.
… und ihren Kindern die Stirn küssen, das Licht löschen und die Worte der Lüge nachklingen lassen. Auf dass sie gut schlafen. Auf dass sie süß träumen.
Anders als ich.
Schwarzer Winter
Vor zwölf Wintern
Sie waren zu mir unter die feuchten Laken gekrochen, mit klammen Fingern und fordernden Stimmen, hatten die Wärme getrunken und mich aus Morpheus’ Armen gezerrt, die verwaisten Gänge entlang und an Fenstern vorbei, hinter denen der Sturm um Einlass flehte und stöhnte. Noch mehr Winddämonen. Viel mehr.
Ich wusste, dass ich ihnen nicht glauben durfte, dass Betrug einer ihrer vielen Namen war und sie sich von Verzweiflung und Tod nährten. Dennoch folgte ich ihnen in die Dunkelheit, die tiefer zu sein schien als in anderen Nächten. Kälter. Mondlos. Weil ich ihnen glaubte. Weil das, was sie in mein Ohr hauchten, so schrecklich wahr klang, dass selbst meine Albträume daneben verblassten.
Nur du kannst sie retten!
Mutter hatte mir verboten, ihnen zu lauschen, ihrem heimtückischen Gesang, der sogar Königen die Sinne stehlen und ganze Königreiche zerstören konnte. Doch was, wenn sie diesmal die Wahrheit sagten?
Durch die schmalen Streifen der Fensterläden fiel kein Licht. Der Sturm musste die Fackeln im Innenhof gelöscht haben – oder aber die Soldaten waren es selbst gewesen. Als hofften sie, den Dämonen vorgaukeln zu können, dass niemand an diesem gottlosen Ort lebte. Ihre Bemühungen waren vergebens. Denn das, was die Nacht schwärzer färbte, hatte längst einen Weg hineingefunden. Zwischen die Mauern, ins Herz der Prinzessin.
Komm, Königstochter, komm!
Unter falschen Sternen
Mary von Athos
»Diamanten und Gold dienen einzig dazu,
um von den Tränen abzulenken.«
Die schönste Braut von Athos
zu ihrer Zofe
Tausend Bürstenstriche brauchte es, um mein Haar in Gold zu verwandeln. Oder Kupfer, je nach Lichteinfall. Sie gaben ihm unzählige Namen – Abendrot, Herbstschimmer, Rapunzelfeuer –, maßen ihm viel zu viel Bedeutung bei.
»Ihr seht heute Abend außerordentlich elegant aus, Hoheit«, versuchte Susann mich auf den ersten von drei Bällen einzustimmen, die der Höhepunkt des Jahres zu werden versprachen. Des Jahrzehnts womöglich. »Die Blicke aller Anwesenden werden Euch gewiss sein«, prophezeite sie und vollendete ihr Werk mit der Bürste. Ich seufzte entnervt, lehnte mich zurück und massierte mir die Schläfen, um den Schmerz zu bändigen, der sich als leichtes Ziehen hinter meiner Stirn bemerkbar machte. Ohne in den Spiegel zu sehen, erhob ich mich von dem Stuhl, der mich viel zu lange gefesselt hatte, und strebte zum Fenster. Susann folgte mir, mit den Fingern hastig über mein Kleid streichend, hier eine Falte ausbügelnd, dort eine Korrektur vornehmend. Dabei war ich mir sicher, dass schon jetzt alles vortrefflich saß – wie stets, wenn sie Hand angelegt hatte. Ich trat in den Lichtkegel der untergehenden Sonne, die ihre Strahlen wie flüssiges Karamell über das mir fremde Königreich Maywater goss und die Wüste jenseits der Stadtmauer in einen Traum aus Rot und Gold verwandelte. Ein Spiegelbild meiner selbst, als wäre ich für dieses Königreich geschaffen. Auf dem heutigen Ball und vor den Augen des versammelten Volkes würde Kronprinz Duncan von Maywater um meine Hand anhalten – und ich, Prinzessin Mary aus Athos, musste Ja sagen.
Weil unsere Väter es so vereinbart hatten.
Weil ein Vertrag uns band.
Das Ziehen hinter meiner Stirn verstärkte sich. Fast schon mechanisch erhöhte ich den Druck der Fingerspitzen, schloss für einen Moment die Lider und atmete tief durch. Ich roch das Meer, vernahm als leises Echo das Rauschen seiner Wellen, die unterhalb des Schlosses gegen die Klippen rollten, sich brachen und zurückzogen. Das ewig klagende Lied des Ozeans hatte mir nachts den Schlaf geraubt und Zweifel in meinem Herz gesät. Erst ein Wechsel vom königlichen Ostflügel in den abgelegenen Westturm verschaffte mir Linderung. Jetzt erstreckte sich vor meinem Fenster die niemals schlafende Hauptstadt Maywaters; gierig gegen die Klippen gedrängt und umschlossen von der Knochenmauer, dem letzten Schutz vor der unersättlichen Wüste. Mir blieb einzig die Wahl zwischen diesen Extremen – Meer oder Wüste – und ich hasste sie beide aus vollem Herzen.
»Perlen oder Gold?«, fragte Susann aus dem Hintergrund.
»Gold«, entschied ich tonlos. Was hätte besser repräsentieren können, wer ich war und woher ich kam? Keines der anderen Königreiche verfügte auch nur annähernd über Athos’ Reichtum. Glaubte ich den Gerüchten, so füllten sich unsere Minen von Zauberhand. Eine nie versiegende Quelle und der Grund, warum ich heute hier stand: Vater hatte mir einen Thron erkauft, einen Kronprinzen als Bräutigam.
Schwer und kalt legte sich das Geschmeide auf meine Haut, nahm mir die Luft, bis ich zu ersticken drohte. »Atmen«, forderte Susann, während sie die Häkchen schloss, die das Gold straff um meine Kehle fixierten. Drei Mondzyklen hatten die attischen Königsschmieden an den Federn gefeilt, die sich bleiern über meine Schulterblätter ergossen und mein Schlüsselbein umspielten. »Tief ein und langsam aus, Hoheit.«
Meine Augen brannten, die Welt zerrann goldrot. Am liebsten hätte ich die Kette vom Hals gerissen, sie hinfort geschleudert, verbannt, zertreten – doch ich würde sie tragen. Vater hatte sie eigens für meine Aussteuer fertigen lassen.
»Konzentriert Euch auf etwas Schönes, Hoheit.«
»Lass mich«, unterbrach ich sie schroff, bereute den Ton jedoch sofort. Susann zog sich knicksend zurück. Ich hörte sie hinter mir bemüht beschäftigt hantieren, die perfekten Laken glatt streichen, die Waschschüssel leeren, während meine Lunge loderte wie die Sonne am Horizont. Geblendet senkte ich die Lider und versuchte mir das Gespräch ins Gedächtnis zu rufen, das ich mit Duncan in der Abgeschiedenheit des Palastgartens geführt hatte, bevor er zur traditionellen Jagd abgereist war. Wir hatten über unsere Zukunft gesprochen, über Zuneigung und Vertrauen, die eine solide Basis bildeten, auf der die Liebe über kurz oder lang gedeihen würde – und für einen trügerischen Moment hatte ich mich in Sicherheit gewähnt, dass diese Heirat nicht nur wichtig, sondern auch richtig war.
Mein Blick fand die vertrocknete Rose auf der Fensterbank. Umrankt von feingliedrigen Spinnweben führte sie einen aussichtslosen Kampf gegen die Zeit, dem sich Blütenblatt für Blütenblatt ergab. Ich widerstand dem Drang, die silberschimmernden Netze zu zerstören, aus Angst, auch das letzte Rot zu verlieren. Nichts bliebe von ihrer einstigen Schönheit, bloß ein kahler Stiel mit spitzen Dornen.
»Soll ich frische Blumen bringen lassen, Hoheit?«
»Nein!« Ich entriss Susann ein Blatt, das sie von der Fensterbank geklaubt hatte. Es zerbröselte unter meinen Fingerspitzen wie vergilbtes Pergament, nährte meine Ohnmacht und gleichsam die Furcht. Susann murmelte etwas über Pflichten und Kronen. Ich hingegen starrte wie betäubt auf die Prachtstraße, die sich träge aus dem Halbdunkel der Stadt schälte und die letzten Klippen zum Schloss erklomm. Die königliche Jagdgesellschaft war vor Tagen heimgekehrt. Ich hatte Duncan vom Balkon aus erblickt, hoch zu Ross, laut lachend und trunken vor Siegesglück, die Beute auf Dutzend Karren am Ende des Trupps. Verrenkte Glieder, blutige Leiber. Ich hatte den Blick abwenden müssen, mich zurückgezogen in die Stille meines Zimmers und dort ausgeharrt, gewartet auf seinen Besuch – der ausblieb. Dabei war er der Einzige, der meine Zweifel hätte zerstreuen können.
»Susann?«
»Ja, Hoheit?«
»Wieso kommt er nicht?«
»Er muss in wenigen Stunden abreisen, Hoheit, die Verhandlungen mit Westham …«
»Nicht Vater«, fuhr ich dazwischen. Dass dem Goldkönig die Zeit fehlte, um der Verlobung seiner einzigen Tochter beizuwohnen, sagte mehr über unsere Beziehung aus, als ich zuzugeben bereit war. Mach ihn stolz, befahl ich mir in Gedanken und verbot mir sowohl an seinen als auch an den Grund für Duncans Fernbleiben zu denken, straffte stattdessen die Schultern und trat endlich vor den Spiegel.
Du bist ihnen nicht wichtig, flüsterte mein Spiegelbild.
Ich bezwang die Ohnmacht und reckte das Kinn. Das bleierne Grau, das seit dem Tod von Duncans Mutter im vergangenen Monat zur Modefarbe avanciert war, stand mir – im Gegensatz zum Rest des Adels – ausgezeichnet. Es betonte meine attische Blässe, die selbst unter Maywaters Sonne nicht dem dunklen Teint des Wüstenvolkes weichen wollte. Susann hatte recht, ich würde der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit sein.
Die Schönste des Abends.
Die Auserwählte des Kronprinzen.
Die zukünftige Königin, die das Land aus der Trauer ziehen würde. Das Wüstenvolk brauchte Hoffnung, es brauchte Träume – und was lud mehr zum Träumen ein als eine königliche Hochzeit? Meine verhassten Schuhe standen bereit, überzogen von tränenförmigen Diamanten, in denen Goldsplitter funkelten. Sie hatten ein Vermögen gekostet. Unter der grauen Seide würde sie niemand sehen, ich könnte genauso gut in Pantoffeln zum Ball erscheinen; doch das gehörte sich nicht – und so stieg ich in die steifen Diamantschuhe, weil es die Pflicht verlangte und Vater es wollte.
Halt dich an seinen Plan, befahl ich mir selbst. Mach ihn stolz.
Kaum hatte ich die Schultern gestrafft, schwang die Tür auf und der Goldkönig höchstpersönlich trat ein, so selbstverständlich, als seien dies seine Gemächer. Es folgten die Königswächter, lautlose Schatten, die rasch den Raum überprüften und sogar einen Blick unter das Bett und hinter die Vorhänge warfen, ehe sie Vater zunickten. Ich konnte mich kaum entsinnen, ihn jemals ohne Leibgarde gesehen zu haben. Selbst des Nachts hielten sie an seinem Himmelbett Wache.
»Lass dich ansehen.« Er umfasste mein Kinn, drehte prüfend meinen Kopf und rückte schließlich das Geschmeide zurecht. »Es muss fester«, befahl er Susann, die bei seinem Eintreffen in einen tiefen Knicks gesunken war. Ich unterdrückte ein Würgen, als sie die Verschlüsse der Kette enger zog. Ihre Finger waren eiskalt.
»Du bist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten«, stellte Vater fest, den Mund missbilligend verzogen wie stets, wenn er von Mutter sprach. »Sie hatte eine erschreckend effiziente Art, die Menschen für sich einzunehmen. Sie war so blendend. Dir hingegen fehlt ihr Feuer. Dem Kronprinzen jedoch scheint deine schlichte Anmut zu genügen.«
Die Schönste des Abends. Nur nicht für ihn.
»Die Verträge sind unterzeichnet«, fuhr er fort, die Stirn gefurcht, als plage ihn ebenfalls ein Kopfschmerz. »Ich gehe nur ungern vor der offiziellen Verkündung, zu viel habe ich dafür geopfert; doch mir bleibt bedauerlicherweise keine Wahl. Westham pfeift und wie ein räudiger Hund habe ich zu erscheinen.«
Er hasste es, dem Drachenkönig unterlegen zu sein. Irgendwem unterlegen zu sein.
»Was möchte Westham?«, wagte ich zu fragen.
Statt zu antworten, fasste er mich an den Schultern und drehte mich zum Spiegel. Ich glaubte einen Schimmer in seinen Augen zu entdecken, dann lehnte er seine Stirn an meinen Hinterkopf. Mein Atem stockte.
Noch nie war ich ihm so nah gewesen.
Noch nie hatte ich ihn emotional erlebt.
So … stolz?
Oder war ihm schlecht? War er gar krank?
Unwillkürlich fand meine Hand seine. Er riss sie fort, als habe er sich verbrannt. Ohne ein weiteres Wort verließ er das Turmzimmer, umringt von seinen lautlosen Wächtern. Er gab mir keine Anweisungen, wünschte mir kein Glück oder sprach mir Mut zu. Er ging in dem sicheren Wissen, dass ich seinen Befehlen folgen würde. Weil es das war, was ich in all den Jahren gelernt hatte: meine Pflicht blind zu erfüllen.
Susann fing sich zuerst. Betont munter umflatterte sie mich, unaufhörlich plappernd, als müsste sie die Leere füllen, die nach Vaters Anwesenheit überwältigend schien. Ich stand da, den Blick auf den Spiegel gerichtet, und sah mich mit seinen Augen: Ein Mädchen mit zu blasser Haut und zu roten Haaren und einer Kälte, die kein Herz erweichen konnte.
Susann zupfte eine letzte Strähne zurecht. »Perfekt!«
Ich versuchte mich an einem Lächeln, doch es misslang kläglich. Denn hier, in der vermeintlichen Sicherheit meines Zimmers, schaffte ich es nicht, die Maskerade der gefeierten attischen Tochter aufzulegen. Hier und jetzt war ich einfach nur ich selbst.
Mit all meiner Stille und all meinen Rissen.
Und einer verdorrten Rose auf der Fensterbank.
Der Jäger
Es stank nach verwesenden Leibern.
Der faulig süße Duft verätzte die Luft, die selbst nach Dämmerungsanbruch weder abkühlte noch ihren Hunger verlor. Diese Wüste war anders als all ihre Artgenossen. Sie gierte nach Leben, um das ihre zu nähren. Sie war verflucht. Der Jäger schmeckte das Blut auf der Zunge, das vor langer Zeit vergossen worden war, um den Zorn der Hitze aufrechtzuerhalten. Noch nie hatte er sich so weit vorgewagt, raus aus dem schützenden Dickicht des Blutwaldes und über das träge dahinfließende Wasser des Flusses. Die Barke schwankte, als er einen sehnsüchtigen Blick zurückwarf. Der Wald versank im wachsenden Schatten der Eisenberge. Das Dunkel kroch wispernd über das Gewässer, dessen silberne Oberfläche über die tückischen Strömungen hinwegtäuschte, die in seinem Innern lauerten. Der Fluss war fast so gefräßig wie die Wüste. Zwei aneinandergeschmiegte Monster. Drei, wenn er den Blutwald hinzuzählte. Sein Gefängnis, dem er heute Nacht entfliehen durfte, nur um sich im Angesicht einer noch größeren Gefahr wiederzufinden.
Er hasste die Wüste – und doch musste er sie betreten. Für sie, die schweigend im Heck der Barke saß. Ihre Haut schimmerte im fahlen Abendlicht, als sei sie mit Diamanten bestäubt, ihr Haar schien aus Gold gesponnen und das Kleid … nun, er fand keine Worte dafür. Er wusste, je länger er es ansah, desto mehr würde sie ihn gefangen nehmen. Ihm erst die Sinne und letztlich das Leben selbst stehlen. Deshalb wandte er den Blick ab und richtete ihn auf die Dünen, die im abendlichen Rot badeten. Vereinzelt ragten Säulen wie Rippen gen dunkelndem Firmament, Trümmer fluteten den Fluss. Nur mühsam fand er einen Weg durch die Gesteinsquader, die den Wassern trotzten und den Weg für jeglichen Handel unpassierbar machten. Außer für ihn. Denn die Hexe des Waldes hielt schützend ihre Hand über das kleine Boot und seine Passagiere. Die Hexe, die aus der Ferne beobachtete, lenkte und kontrollierte. Er spürte ihren Atem in seinem Nacken. Sie sprach durch die Winddämonen. Durch die Kälte. Ihr Herz bestand aus Schwärze. Wie das seine. Wie das all ihrer Geschöpfe.
Ein letztes Mal tauchte das Ruder ein, ehe er ins seichte Wasser sprang, um die Barke an Land zu ziehen. Auf ein Mahl hoffend, stürzte sich der Fluss auf seine Waden, umschlang ihn, labte sich an seiner plötzlich aufkeimenden Furcht und seufzte klagend, als er sich hastig ans Ufer rettete. Kaum gesättigt sank das Wasser zurück. Lauernd, wartend. Es besaß alle Zeit der Welt. Der Jäger hingegen würde wiederkommen, erneut das Boot besteigen und den Strom zu queren versuchen – und vielleicht, ganz vielleicht hätte er dabei weniger Glück.
Widerwillig bot er seiner Begleitung die Hand, um ihr beim Aussteigen zu helfen. Ihre Haut mochte glänzen, doch er sah die Härte hinter dem sanften Lächeln, das sie ihm zum Dank schenkte. Es war so unaufrichtig wie alles an ihr.
Über Geröll und Trümmer hinweg führte er sie einen Pfad entlang, den nur Könige auf dem Weg zur letzten Ruhestätte beschritten, getragen von treuen Dienern, die ihnen in den Tod folgten. Die Grabmäler erhoben sich trotz des Verfalls majestätisch aus dem Sand. Aus Marmor erbaute Kuppelgewölbe, die nur einem Zweck dienten. Es erschien ihm beinahe ironisch, dass ihre Reise hier begann. Dort, wo die des jetzigen Wüstenkönigs enden würde, so wie auch die dessen Sohnes und aller noch folgenden Söhne.
Die Schimmel fand er wie versprochen hinter der ersten Grabkammer. Sie scheuten, als er sich näherte, blähten die Nüstern und tänzelten nervös. Ob sie die Winddämonen spürten? Oder fürchteten sie sich ebenso wie er vor der Wüste? Vor dem, was in ihrem Innern lauerte? Sie brauchten sich nicht zu sorgen, solange die Hexe ihrer achtete.
Die Nacht streckte sich bereits nach den Dünen aus, als er Seite an Seite mit der falschen Prinzessin durch die Wüste ritt, viel schneller, als Pferde galoppieren sollten. Die Winddämonen trieben sie an, drängten vorwärts, jauchzten und gurrten. Fast schien es, als glitte der Sand unberührt unter ihnen dahin. Weit am Horizont erhob sich das Himmelsschloss funkelnd wie ein Stern in der Nacht. Ihr Ziel. Seine Mission.
Die rechte Braut, säuselte der Wind.
Mary von Athos
»Verschenk dein Herz mit Bedacht, denn es ist aus Glas
und zerbricht in den falschen Händen.«
Die schönste Braut zu ihrer Tochter Mary
am Tag ihres Todes
Die Nacht hing samtschwarz über den Kristalllüstern, ein falscher Himmel, geschaffen aus Stein, Farbe und Diamant. Der Legende nach hatten die königlichen Architekten die Sterne eigenhändig vom Firmament gestohlen, um sie in das geschwärzte Kuppelgewölbe des Mitternachtssaals einzulassen. Sie funkelten im satten Schein Tausender Kerzen und täuschten eine Tiefe vor, die mich schwindeln ließ. Es wirkte gar, als hingen die gewaltigen Kronleuchter unter dem Himmel selbst – wie die Sonne und der Mond.
Heute, am Tag des großen Balls, erstrahlten sie in vollem Glanz und doch sah kaum jemand zu ihnen und den geraubten Sternen hinauf. Als seien sie unsichtbar für die Augen all derer, die einem unablässigen Strom gleich die Treppen in den Saal hinabflossen. Der Zeremonienmeister, der jeden ankommenden Gast vorstellen musste, schrie sich heiser. Eine schier endlose Liste an Namen von Mägden, Dienerinnen und Zofen, die man zum Ball geladen hatte. Mein Blick schweifte zu der blauen Kordel, die den Saal in zwei Bereiche teilte: den des Adels, der an gewohnt üppigen Tafeln saß und speiste, und den des niederen Volkes. Letzteres musste mit der Tanzfläche vorliebnehmen, an deren Rand ein Büfett voll attischer Kostbarkeiten errichtet worden war. Es roch nach Gebratenem, dem Schweiß armer Leute und teurem Parfüm – und ein wenig nach Wald, was mich wehmütig stimmte. Die übergroßen Balkontüren, die für Riesen erbaut schienen, waren allesamt geschlossen. Erst später, wenn der Abend fortschritt und die Temperatur ins Unerträgliche stieg, würden die Diener in ihren blauglänzenden Livreen sie öffnen und eine frische Brise hineinlassen.
»… zwischen seinen Stämmen hausen knochenbleiche Ungeheuer«, erzählte Graf Blaubart wenige Stühle weiter einigen zu Tode erschrockenen Damen. Im Nachhinein hätte ich besser daran getan, ihm zuzuhören, stattdessen betrachtete ich mich gedankenverloren in einem der Spiegel, die ringsum an den Wänden hingen. Sie reflektierten das Büfett und den Mitternachtssaal, ließen beides exorbitant erscheinen – und mich ungewohnt klein.
»Denkt Ihr, sie haben die Spiegel aufgehängt, damit der Pöbel aus Scham weniger frisst?«, fragte die hagere Fürstin von gegenüber und fixierte aus schmalen Augen das bürgerliche Büfett.
»Als ob die Scham kennen!«, entgegnete die Baronin, neben der ich nahezu verschwand und die eine Weintraube nach der anderen verschlang. Der Saft tropfte ihr über das fleischige Kinn und verschwand in den Falten des gewaltigen Dekolletés. »Seht nur, wie sie über die Speisen herfallen! Man könnte meinen, sie litten den Hungertod.«
»Mir wird allein vom Zusehen schlecht«, klagte die Fürstin.
Graf Blaubart schlug diensteifrig vor: »Vielleicht möchte Euer Gnaden an die frische Luft?«
»Auf keinen Fall«, donnerte die Baronin. »Bei diesem Sturm fängt sie sich bloß eine Verkühlung ein.«
Der Graf, wie ich aus Athos stammend, zog pikiert die Brauen hoch. »Das laue Lüftchen? Wahre Stürme findet ihr einzig im attischen Hochland. Unsere Unwetter fordern jedes Jahr etliche Todesopfer!«
»Ich hörte davon.« Die Baronin drehte sich zu ihm, der Stuhl ächzte. »Seit dem tragischen Sturz Eurer Königin sind die attischen Stürme allseits bekannt.«
»In der Tat, ein schwerer Verlust für uns alle«, bestätigte der Graf gezwungen, ehe er mit plötzlich erwachtem Interesse die Kronleuchter betrachtete, die er zuvor keines Blickes gewürdigt hatte. Die Baronin verlagerte unbehaglich ihr Gewicht, der Stuhl protestierte erneut. Sie alle starrten auf irgendetwas, nur nicht zu mir. Ganz gleich, wie viele Jahre auch vergingen, kaum jemand wagte in meiner Gegenwart darüber zu sprechen. Über den Tag, der in Athos fortan Schwarzer Winter hieß.
»Euer Königreich ist keinesfalls das einzige, das um seine Monarchin trauert«, rief die Fürstin jäh. »Zumal Euer Verlust bereits – wie lange? – zwölf Winter zurückliegt?«
Der Graf richtete sich auf, die Augen verengt. »In der Tat.«
»Unsere Schwanenbraut trugen wir erst während der letzten Blutmondnacht zu Grabe. Ihr Körper war kaum erkaltet, da sandte Euer König bereits ein Portrait seiner Tochter«, Beifall heischend blickte sie in die Runde, »zusammen mit einer Kiste feinstem Schmuck.«
»Bridget«, warnte die Baronin mit vollen Backen.
»Ich spreche nur aus, was ohnehin alle Welt weiß«, verteidigte sich die Fürstin brüsk.
Betretenes Schweigen folgte. Es gab Tatsachen, über die niemand sprach. Offene Geheimnisse, die Vater das Volk zu ignorieren zwang. Wie der Mangel eines Thronerben oder die überstürzte Verlobung seiner einzigen Tochter. Doch hier, im fernen Maywater, bröckelte sein Einfluss. Dennoch waren fast alle am Tisch erbleicht, selbst der Graf, der gewöhnlich zu meiner Rettung herbeieilte, fand keine Worte. Auf Königslästerei stand der Tod.
Die Fürstin, die sich über ihren Fauxpas im Unklaren schien – ihn vielleicht sogar genoss; die stille Zustimmung all derer, denen der Mut fehlte, die Wahrheit auszusprechen –, riss die Augen auf. »Oh!« Ihre Finger krallten sich um des Grafens Arm. »Wisst Ihr, wer der stattliche Herr ist, der soeben den Saal betrat?«
Synchron reckten sie die Hälse, auch ich warf einen Blick zur Treppe, bereute es jedoch sofort. Auf der Empore standen fünf Soldaten, die gerade erst dem Schlachtfeld entstiegen schienen. Kupferne Drachenschuppen umschlossen Körper, die gestählt vom Kampf zu gewaltig wirkten zwischen denen des Wüstenadels. Drachentöter, ausgebildet und dazu auserkoren, die Grenzen der sechs Reiche vor den Bestien der Eisenberge zu schützen. Die fähigsten ihrer Art, angeführt von einem Mann, den ich am liebsten aus meinem Gedächtnis streichen würde.
Der Graf räusperte sich und erklärte, noch bevor es der Zeremonienmeister mit heiserer Stimme verkünden konnte: »Dies, werte Fürstin, ist der Königssohn von Westham.«
»Der Kronprinz?«
»Der Zweitgeborene«, stellte er richtig. »Prinz Tarek.«
»Welch Jammer«, seufzte sie. »Was ist mit dem Kronprinzen? Der sollte unter Frauen.«
»Er verlässt selten das Haus.«
»Ich sehe schon, einer an der Front und der andere die Staatsgeschäfte.«
»Man munkelt, Prinz Tarek sei der beste Krieger seines Landes«, warf die Baronin ein.
»Der beste aller sechs Königreiche«, bestätigte der Graf nicht ohne Neid. »Den Gerüchten zufolge soll er bereits im Knabenalter seinen ersten Drachen erlegt und in dessen Blut gebadet haben.«
»Nicht auszudenken«, hauchte die Fürstin begeistert. »Drachenblut, wie ekelhaft!«
Der Graf nickte verbunden, nur um kurz darauf den Neuankömmling übertrieben winkend auf sich aufmerksam zu machen. Flankiert von seinen Soldaten schritt der fremde Königssohn durch den Saal. Die Menschenmasse teilte sich wie Wasser vor einem Bug. Hastig griff ich nach meinem Weinglas und hob es an die Lippen, in der irrsinnigen Hoffnung, es würde mich verstecken.
»Prinz Tarek«, tönte die einschmeichelnde Stimme des Grafen, »welch Freude, Euch zu treffen. Wie lange mag es her sein – zwei Winter? –, seit wir einander in Athos trafen?«
»Drei«, korrigierte der westhamsche Prinz knapp.
»Es kommt mir kürzer vor.« Sie reichten sich die Hände. »Kommt Euer Bruder auch?«
Der Prinz verneinte. »Vater war der Ansicht, meine Anwesenheit reiche durchaus, um der Verlobung des Kronprinzen beizuwohnen.«
Ich verschluckte mich prompt, die Baronin tätschelte mir linkisch den Rücken. »Aber, aber, Hoheit, wir haben genug Schaumwein für alle da – es sei denn, der Pöbel säuft ihn uns weg!« Sie lachte dröhnend, die Fürstin fiel gackernd ein, Prinz Tareks Züge verhärteten sich, als er mich erblickte.
Der Graf ergriff das Wort, die Brust vor Stolz geschwollen, dass er einen so mächtigen Mann kannte: »Darf ich vorstellen? Prinzessin Mary aus …«
»Wir kennen uns«, unterbrach ihn der Prinz. Nur flüchtig, fast schon beleidigend kurz, hob er meine Hand an seine Lippen. Die Fürstin warf mir einen irritierten Blick zu – vielleicht nahm sie mich gar erst jetzt wahr? –, während die anderen wissend schwiegen. Ein weiteres Geheimnis, das keines war. Sehr zu Vaters Missfallen, der alles getan hatte, um die Gerüchte im Keim zu ersticken. Selbst die Enthauptung dreier seiner angesehensten Stadträte und die angedrohte Todesstrafe konnte dem Gerede keinen Einhalt gebieten.
Der Prinz wechselte ein paar nichtssagende Worte mit dem Grafen, ehe er sich grußlos abwandte und samt Gefolge gen Thron schritt. Einer seiner Soldaten, eine Frau, wandte sich um. Die Verachtung in ihrem Gesicht traf mich unerwartet. Zitternd stellte ich das Glas zurück und zwang mich, den Blick von Tareks Rücken zu lösen, dem Prinzen, der vor drei Jahren im Rausch einer durchzechten Nacht um meine Hand angehalten hatte.
Der Sohn Westhams
Was glaubst du? Wie viele Vögel haben sie wohl dafür geschlachtet?«
Elena, einzige Kämpferin der Drachengarde und königliche Leibgardistin, trat neben ihn, die Lippen verächtlich verzogen. Sie hasste Bälle ebenso wie er. Drachentöter gehörten an die Front statt zwischen Röcke und affektiertes Lachen. Ein Flecken Kupfer in all dem tristen Grau. Harte Schuppenpanzer zwischen federgeschmückten Häuptern.
»Sie sehen aus wie gerupfte Hühner«, fuhr sie geringschätzig fort. »Hast du gesehen, was die dicke Baronin auf dem Kopf trägt? Das ist ein halber Strauß!«
Er hatte es nicht gesehen.
Er hatte nur Augen für die Prinzessin gehabt. Für die Federn, die ihre nackten Schultern umspielten: Maywaters Wahrzeichen in Gold gegossen.
»Du solltest den Wüstenkönig grüßen. Es war ein Fehler, zuerst zu ihr zu gehen.«
Er sparte sich eine Erwiderung. Elena wusste, weshalb er der attischen Prinzessin den Vorzug gegeben hatte. Einer der Nachteile der Drachengarde: Sie kannten einander zu gut, ihre Stärken und ihre Schwächen. Seine war offensichtlich. Als ob all die Jahre nicht mehr existierten, in denen er Nacht für Nacht in Tavernen und Bars und den warmen Körpern fremder Frauen ertrunken war in dem Versuch, Mary zu vergessen.
Vergeblich, wie er erbittert feststellte.
»Dein Glück, dass der Wüstenkönig senil ist«, spottete Elena. »Dein Vater hätte dich für die Missachtung der höfischen Etikette hängen lassen, nachdem er dich zuvor geköpft hätte – oder andersrum.«
Er brachte sie mit einem Blick zum Verstummen und trat innerlich fluchend vor den Thron. Der Wüstenkönig sah kaum auf, er hätte es ebenso gut lassen können.
Senil. Elena hatte ja keine Ahnung.
»Eure Majestät«, grüßte er knapp und zwang sich zu einem höflichen Lächeln.
Die aschgrauen Augen des Königs weiteten sich, das einzige Anzeichen dafür, dass noch Leben in dem Skelett steckte. »Kronprinz Phillip …«
Das Lächeln erstarb. »Prinz Tarek, Eure Majestät.«
»Oh … Ihr seid nicht …?«
»Nein.«
Verwirrt blinzelte der Wüstenkönig. »Euer Bruder kommt ebenfalls?«
»Ich bedaure.«
Der Wüstenkönig setzte zu einer Erwiderung an, doch was auch immer er hatte sagen wollen, verlor sich mit der Schärfe seines Blickes. Ächzend sank er zurück, die Finger um die Lehnen geklammert, die Haut so blass wie die eines Toten – was er schon bald sein würde. Sie schrieben es der Trauer zu, all die Adeligen, die ihn aus verkniffenen Gesichtern begafften. Zu Lebzeiten der Schwanenbraut hätten sie es niemals gewagt, ihn derart offen zu kritisieren. Mit ihren Blicken und Gesten, sogar mit Worten. Bis zur Front waren die Gerüchte vom vergehenden Wüstenkönig gedrungen, von dessen Schwäche und verwesendem Leib. Tatsächlich war das, was vor hier auf dem Thron kauerte, nur der Abglanz eines längst verlorenen Regenten. Der Verlust der Liebe hatte den Wüstenkönig gebrochen.