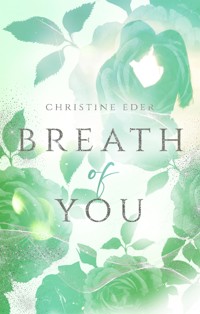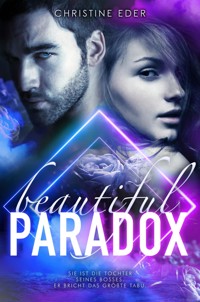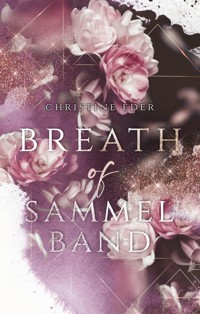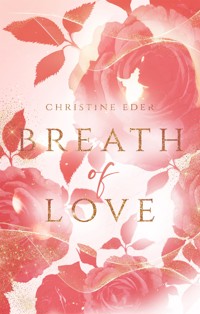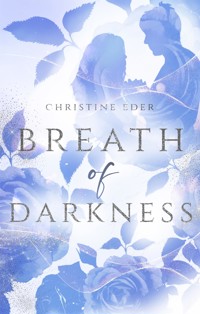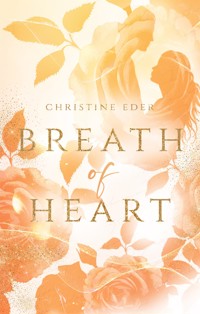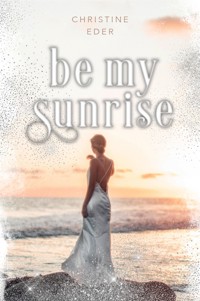3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HeroIn
- Sprache: Deutsch
Valentin kehrt nach zwei Jahren in seine Heimatstadt zurück und übernimmt die Firma seines Vaters. Auf ihn warten verborgene Familiengeheimnisse, geschäftliche Intrigen, Rache und nicht zuletzt … seine große Liebe.
Ein zufälliges Treffen und einige darauffolgende Umstände führen Valentin und Elena wieder zueinander und bringen sie näher, als es Elena lieb ist. Denn diesmal hat Elena wesentlich ernstere Gründe, sich nicht auf Valentin einzulassen.
Valentin steht nicht nur vor der Herausforderung, die Firma zu retten, sondern auch die aufgebaute Blockade in Elenas Herzen zu brechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
HeroInLove - Band 2
Liebesroman
BookRix GmbH & Co. KG81371 München.
Verlag:
BookRix GmbH & Co. KG
Implerstraße 24
81371 München
Deutschland
Coverdesign: © Licht Design – Kristina Licht
Korrektorat/Lektorat: Andreas März/Sabrina Heilmann
2. Korrektorat: Sandra Nyklasz
Gedichte: © Andreas März
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Autorin reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Alle handelnden Personen und Handlungen dieses Buches sind frei erfunden und nur aus reinen Vermutungen entstanden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen wäre rein zufällig.
© Christine Eder 2018
2. Auflage 2021
Niemand von uns ist vor Fehlern sicher.
Jeder kann in seinem Leben stolpern und hinfallen,
viele unnötige oder verletzende Dinge sagen,
Unbedachtes tun und kränken.
Denn zerstören ist immer leichter,
und abzustoßen ist noch einfacher, als zu lieben.
Auch wenn man noch lange nicht alles verzeihen kann,
ist es irgendwann an der Zeit, einem Menschen
unweigerlich eine neue Chance zu geben.
Manchmal ist es genau diese klitzekleine Chance,
die deine eigene Welt und dein Leben
für immer verändern kann.
Prolog
Elena
Zehn Monate zuvor
Mir ist heiß, verdammt heiß. Es ist so schwül und stickig, dass man nicht richtig atmen kann. Meine Bluse klebt bereits an meinem Rücken, aber ich muss trotzdem weiterlaufen.
Der Bürgersteig ist überfüllt, und ich zwänge mich durch die dichte Menschenmenge. Ich ärgere mich darüber, dass ich diese blöden und überteuerten Pumps angezogen habe, in denen ich auch nicht schnell genug vorwärtskomme.
Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Keine Ahnung, das wievielte bereits – ich habe schon längst den Überblick verloren. Es demotiviert mich ungemein. Diesmal komme ich auch noch zu spät, weil der Chef des Cafés, in dem ich momentan als Kellnerin arbeite, mich nicht früher gehen lassen wollte.
Beim Laufen schaue ich auf meine Armbanduhr und merke, dass mir nur noch wenige Minuten bis zum Termin bleiben. So ein Mist! Ich richte meinen Blick wieder nach vorne und sehe plötzlich eine breite Brust vor mir. Voller Wucht ramme ich mit meinem Gesicht dagegen. Mein Fuß knickt dabei um, und ich falle auf den Hintern.
»Oh, entschuldigen Sie bitte! Sind Sie okay?«, höre ich eine männliche Stimme.
Ich sehe lackierte Schuhe und dunkle Hosenbeine und schaue von unten hinauf. Vor mir steht ein kräftiger Mann mit einem kurzen Bart in einem eleganten Anzug. Er steckt sein Handy in die Jacketttasche und reicht mir die Hand, die ich dankbar annehme.
Er blickt mir tief in die Augen. Seine leicht schockierte Mimik wird etwas weicher. »Haben Sie sich etwas getan? Entschuldigen Sie mich, ich war so in mein Telefonat vertieft, dass –«
»Nein, schon gut. Mir fehlt nichts, danke«, falle ich ihm hastig ins Wort, denn ich muss schnell weiter.
Ich hebe meine kleine Tasche vom Boden auf und stehe mit seiner Hilfe auf. Aber ich knicke wieder um und kralle mich instinktiv am Jackett dieses Mannes fest.
»Haben Sie sich vielleicht doch verletzt?«
Peinlich berührt, lasse ich ihn wieder los und schaue auf meine Füße. Frustriert stelle ich fest, dass mein Schuhabsatz kaputt ist. Ich ächze laut, als ich meinen Schuh ausziehe.
»Scheiße! Die waren so was von teuer!« Ich könnte heulen und mustere schockiert den herunterhängenden Absatz. »Ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch«, schimpfe ich aufgebracht und resigniere sogleich wieder.
Mein Vorstellungsgespräch hat sich verabschiedet, und somit die Hoffnung auf eine Arbeitsstelle.
»Tut mir leid. Entschuldigen Sie mich –«
»Ah, hören Sie doch auf, sich immerzu zu entschuldigen! Ich war selbst schuld, weil ich auf die Uhr geschaut habe und nicht nach vorne«, reagiere ich etwas genervt. »Tut mir leid«, füge ich dann versöhnlicher hinzu.
Ich ziehe meinen anderen Schuh aus, drehe mich um und gehe den Weg zurück nach Hause.
»Warten Sie bitte!«, höre ich wieder diesen Mann hinter mir, der gleich darauf auch schon neben mir herläuft. »Vielleicht kann ich Ihnen irgendwie helfen.«
Erst jetzt sehe ich ihn mir genauer an. Er ist eindeutig älter als ich, hat hellblonde Haare und braune Augen. Eigentlich nicht wirklich ein schöner Mann, auch wenn er ein angenehmes und weiches Lächeln hat. Aber ein Mensch muss auch nicht schön sein. Er muss bloß attraktiv und sympathisch wirken. Ich muss zugeben, das tut er definitiv. Außerdem halte ich Menschen mit braunen Augen für aufrichtig und ehrlich, im Gegensatz zu einer bestimmten Person mit blauen Augen, die beinahe mein Untergang geworden wäre. Das tue ich mir nie wieder an!
Ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Danke, aber Sie können mir nicht weiterhelfen.«
»Vielleicht kann ich Sie wenigstens nach Hause bringen? Wo müssen Sie hin?«
Ich bleibe stehen.
»Sie wollen mich nach Hause bringen?«, frage ich ihn verdutzt.
Er wird etwas verlegen. »Nun ja, als Entschuldung sozusagen.«
»So, so«, erwidere ich amüsiert und bringe ihn dadurch noch mehr zum Lächeln. Das allein überzeugt mich schon. »Ich wohne in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wollen Sie sich wirklich die ganzen Staus antun?«
»Ich fahre sowieso nicht selbst«, winkt er ab. Ich runzle leicht die Stirn, woraufhin er mir erklärt: »Mein persönlicher Chauffeur wird uns fahren.«
Jetzt ist mein Erstaunen vollends ausgereift.
»Ahaaa«, kriege ich nur heraus. Ich habe nicht wahrgenommen, dass wieder mal ein waschechter Hero vor mir steht.
»Also, was sagen Sie dazu?«, fragt er. Ich überlege. »Ich heiße übrigens Michel Kampmann.«
Er streckt mir lächelnd die Hand entgegen, wobei ich die glänzende Uhr von Rado an seinem Handgelenk bemerke.
»Na gut, Sie fahren mich nach Hause, aber nur als Entschuldigung.« Ich reiche ihm meine Hand, die er sanft drückt. »Elena Neumann.«
Mit einem zufriedenen Nicken und einer einladenden Geste lässt er mir den Vortritt.
Wir gehen ein paar Schritte zu der Stelle, an der wir zusammengestoßen sind. Michel öffnet die Tür eines Maybach, der am Straßenrand steht. Mir steht vor Stauen kurz der Mund offen, den ich jedoch rasch schließe und meine Lippen aufeinanderpresse, während ich einsteige. Im Auto fällt mir auf, wie edel die beigen Ledersitze und die ganze Innenausstattung sind. Seine Uhr sieht schon teuer aus, aber das hier ist purer Luxus. Ich schlucke nervös, als Michel neben mir Platz nimmt.
»Wo soll es genau hingehen?«, fragt er mich.
Ich bemerke, dass mich sein Chauffeur abwartend im Rückspiegel ansieht. Ich nenne ihm nur die Hauptstraße, die neben meiner liegt, und bereue irgendwie jetzt schon, dass ich hier sitze und mich dabei unwohl fühle – so, als wäre ich ein schmutziges Aschenputtel.
Wir fahren los.
»Also, Sie waren zu einem Vorstellungsgespräch unterwegs?«, beginnt Michel die Unterhaltung.
»Ja.« Ich richte meinen Blick auf meine Handtasche, die ich auf dem Schoss halte.
»Für was, wenn ich fragen darf?«
»Ich habe Journalismus studiert und suche jetzt einen Job in dieser Richtung.«
Er nickt verkniffen. »Und ich bin der Idiot, der es Ihnen vermasselt hat.«
»Ach, schon gut.« Ich tue es gespielt locker mit der Hand ab, obwohl mir gar nicht danach ist.
»Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann«, er wühlt in seiner Jackettinnentasche, »hier ist meine Visitenkarte.«
Gegen meinen Willen muss ich kichern. »Davon habe ich in letzter Zeit echt genug bekommen: von Immobilienmaklern, Managern, Ingenieuren, Bankiers und anderen Unternehmern«, mache ich mich über die vielen Männer lustig, die mich in letzter Zeit beeindrucken wollten. »Zu welcher Kategorie gehören Sie?«
»Sie können meine Karte zu den Bankiers einordnen«, sagt er amüsiert und hält sie mir entgegen.
Ich nehme sie an und lese laut vor: »Michel Kampmann … Hier steht aber nichts von Bankier.«
»Die Menschen wissen eigentlich auch so, wer ich bin.« Er lächelt breiter, wobei ich Stolz an seinem Gesicht ablesen kann. Oder ist es Arroganz?
Ich lege seine Visitenkarte zu den anderen in meine Tasche und kneife meine Augen leicht zusammen. »Okay. Ich kenne Sie aber nicht!«
»Sie werden mich kennenlernen.«
»Indem Sie mir behilflich sein werden?«, erwidere ich ironisch.
»Ich kann Ihnen eine Arbeitsstelle anbieten.«
Ich schüttle schmunzelnd den Kopf. »Ich mag es nicht, wenn mir jemand etwas schönredet oder mir als Entschuldigung eine Arbeitsstelle anbietet.«
»Heutzutage sind viele Menschen sehr froh darüber, Kontakte zu haben … Sind Sie etwa von der Sorte, die alles alleine schaffen will?«
»Ja, genau so bin ich.«
Das Auto hält an.
»Mist!«, brummt der Fahrer. »Wir müssen eine andere Strecke nehmen. Hier können wir nicht durch, die Straße wurde gesperrt.«
Vor uns befindet sich eine sehr große demonstrierende Menschenmenge mit Plakaten, weswegen die Straße von der Polizei gesperrt wurde.
»Was zum Teufel …?«, murmelt Michel und betrachtet die Veranstaltung, während wir von einem Polizeibeamten auf die andere Straße gelotst werden, um den Aufruhr zu umfahren. »Was ist denn da schon wieder los?«
»Es ist eine Demonstration gegen Flüchtlinge«, erkläre ich. Davon stand heute Morgen etwas in der Zeitung.
Michel schaut mich an und seufzt. »Ja, da hat die Regierung wohl nicht nachgedacht, was sie mit ihrer Grenzöffnung wirklich auslösen würde.«
»Ich finde, die Regierung hat richtig und vor allem menschlich gehandelt!«
Sein Blick wird ernst. »Das darf sie aber nicht tun. Sie muss politisch denken!«
»Menschlichkeit beweist Stärke, und es ist keine Schwäche, sie zu zeigen.« Ich bemerke, dass es ihm die Sprache verschlagen hat. »Sie sind also gegen Flüchtlinge?«
»Nein, bin es nicht, und ich bin nicht gegen die Hilfen.«
»Also sind Sie dann gegen …?«
»Ich bin auch nicht gegen andere Nationen.« Er schmunzelt leicht. »Falls Sie das denken.«
»Genau das war mein erster Gedanke«, gebe ich zu. »Ich finde, dass ‚Nation‘ sowieso nur ein Wort ist; eine Bezeichnung, die wir benutzen. Ob nun weiß oder dunkelhäutig, wir sind doch alle Menschen … und müssen auch als solche handeln.«
»Tun aber heutzutage nur sehr wenige«, meint er und beugt sich etwas zum Fahrer. »Kannst du bitte dort am Straßenrand anhalten?«
Ich schaue währenddessen gedankenverloren aus dem Fenster und bemerke schlagartig, dass wir uns auf der Neuer Wall befinden – dort, wo die ganzen Luxusläden stehen. Der Fahrer bleibt stehen, und ich sehe Michel fragend an.
»Ich bin sofort wieder da.« Schnell nimmt er meinen Schuh und steigt aus dem Wagen.
Ich zucke erschrocken zusammen, weil ich ahne, was er vorhat.
»Michel! Nein!«, entfährt es mir. Meine Stimme klingt dabei schrill und laut.
Er schaut noch mal ins Auto, was mich prompt zurückhält und verstummen lässt.
»Ich finde es schön, dass wir auf das Du übergegangen sind«, sagt er leicht grinsend. Ich erstarre, weil ich eigentlich nicht vorhatte, ihn beim Namen anzusprechen. »Sven!« Michel deutet auf die Autotür und schließt diese.
Ich sehe ihm mit heißen Wangen hinterher und presse mich in den Sitz zurück. Bitte nicht noch ein Mr. Hero. Mir wird mulmig bei dem Gedanken. Ich bereue es immer mehr, dass ich hier sitze.
Ich greife rasch nach dem Türgriff und möchte aussteigen, doch meine Stirn stößt an die Fensterscheibe. Was? Wieso? Ich ziehe mehrmals am Griff und begreife, dass das Auto tatsächlich abgeschlossen ist. Jetzt kapiere ich, dass Michel den Chauffeur gebeten hat, das Auto zu verriegeln. Aber warum sollte er mich einsperren? Ich schaue zu Sven, der mich auch noch beobachtet.
»Ähm, würden Sie mir bitte die Tür aufmachen?«, bitte ich ihn freundlich – überaus freundlich.
»Nein«, antwortet er trocken.
»Wieso?«
»Anweisung vom Chef … Es ist zu Ihrer Sicherheit.«
Mir bleibt der Mund halb offen stehen. Ich kann zwar nur seine Augen im Spiegel sehen, aber ich spüre, dass er in sich hineingrinst. Nicht zu fassen!
»Sie können mich doch hier nicht einsperren! Machen Sie bitte auf.« Ich versuche ruhig zu bleiben. Er schmunzelt nur. »Ich werde gleich schreien.«
»Tun Sie sich keinen Zwang an.« Will er mich verarschen? Er blickt mich etwas ernster im Spiegel an. »Das Auto ist isoliert. Sie würde keiner da draußen hören«, erklärt er mir seelenruhig.
Ich lasse mir nicht anmerken, wie schockiert ich bin, und lehne mich in den Sitz zurück. Zu meiner Sicherheit? Lächerlich. Michel befürchtet wohl, dass ich weglaufe – was barfuß ja auch so ungemein bequem ist. Obwohl … ich habe es ja gerade versucht.
Es vergehen noch einige Minuten. Die Tür öffnet sich und Michel steigt wieder ins Auto ein.
»Wir können weiter«, sagt er zu Sven, der daraufhin wortlos den Motor startet und losfährt.
»Das war nicht gerade nett, mich hier einzusperren! Haben Sie schon mal von Freiheitsberaubung gehört?«
Er schaut mich lächelnd an. »Also war mein Gedanke richtig – du wolltest dich aus dem Staub machen!«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Sind wir wieder beim Sie?! Das Du gefiel mir besser.«
Ich seufze resigniert auf. »Na gut … Woher willst du gewusst haben, dass ich weglaufen würde?«
»Irgendwie habe ich es geahnt … reine Intuition.«
»Bin ich so durchschaubar?« Ich sehe ihn spöttisch an und verschränke die Arme.
»Alle Frauen sind in gewisser Hinsicht durchschaubar, und ich persönlich finde es gar nicht schlimm … eher das Gegenteil.« Sein Blick wird verspielter.
Ich muss meine Augen kurz abwenden. Nicht nur, weil ich verlegen rot werde, sondern auch, weil ich das Kribbeln in meinem Bauch bändigen muss, das sich nach Monaten plötzlich bemerkbar macht.
»Ich wollte nur etwas wiedergutmachen.«
Ich schaue ihn wieder an. Meine Fassade fängt an zu bröckeln und die Erinnerungen vom letzten Sommer überrollen mich urplötzlich, sodass es wehtut. Er hält einen Schuhkarton von Escada in der Hand.
»Ich brauche das nicht«, erwidere ich sehr ernst und wende meinen Blick wieder zur Seite ab. Sie sind doch alle gleich!
»Ich möchte mich mit dieser Geste doch nur entschuldigen, weil dein Schuh meinetwegen kaputtgegangen ist.« Ich beiße mir auf die Unterlippe, weil seine Stimme so verflucht angenehm und aufrichtig klingt. Ich wende mich ihm wieder zu. »Bitte, nimm es an.«
Er reicht mir den Schuhkarton.
Ich schüttle den Kopf. »Nein, das werde ich nicht annehmen!«
»Jede andere Frau wäre jetzt ausgeflippt, und dir ist es –«
»Unwichtig!«, beendete ich seinen Satz, um noch deutlicher zu zeigen, dass ich so etwas verabscheue.
Er schaut mich nur schmunzelnd an, als ob er eine Erklärung brauchen. Oder bilde ich mir das nur ein? Doch in seinen Augen glänzt etwas anderes – vielleicht sogar Bewunderung. Warum auch immer.
»Ich bin nicht die Frau, die Schuhen hinterherläuft, ich bin auch nicht die Frau, die teure Täschchen trägt«, sage ich und wedle mit meiner billigen kleinen Handtasche vor seinem Gesicht herum. »Ich bin nicht die Frau, die Klamotten als Entschuldigung braucht, und ich bin auch nicht die, die sich wie ein Modepüppchen anziehen muss.«
Er beäugt mein Outfit und bleibt mit den Augen an meinen Beinen kleben. Scheiße! Ich ziehe meinen Rock etwas weiter über die Knie.
»Okay … jetzt weiß ich wenigstens, was du für eine Person bist«, meint er und legt den Karton zwischen uns auf den Sitz.
»Ich bin nicht käuflich!«, verdeutliche ich ihm das Ganze noch mehr.
»Schon gut … Das dachte ich auch nicht«, beteuert er sehr ruhig. Vielleicht bin ich wieder zu früh aufgebraust. Ich kann auch nichts mehr darauf erwidern. Er lächelt. »Du bist ungekünstelt, Elena … und das gefällt mir.«
Aus irgendeinem Grund wird mir heiß. Stille breitet sich aus.
»Und was machst du so in deiner Freizeit?«, bricht Michel das kurze Schweigen.
Ich schaue ihn an und treffe auf seinen tiefgründigen Blick, der etwas in mir berührt. Ich räuspere mich kaum merklich. »Ich bin mit Gelegenheitsjobs beschäftigt, und abends arbeite ich in einem Kinderheim.«
»Liebst du Kinder so sehr, oder arbeitest du dort eher … äh …«
»Ja, ich arbeite dort, weil ich Kinder sehr liebe.« Dass ich selbst eine Waise bin, will ich ihm nicht erzählen. »Und du? Hast du Kinder?«
Er muss ja nicht nur alles über mich erfahren. Ich bin auch neugierig. Außerdem sieht er aus wie jemand, der bereits eine eigene Familie haben könnte.
»Nein, ich habe keine Kinder. Ich habe noch nicht die passende Frau gefunden«, antwortet er. »Aber ich liebe Kinder auch sehr und wünsche mir natürlich eigene. Sie sind so … rein. Mit ihnen fühlt man sich irgendwie so unbeschwert, es fühlt sich an … wie Frieden auf Erden. Zumindest stelle ich mir das so vor.«
Seine Worte lassen mich angenehm erschaudern. Erstaunt sehe ich ihn an und kann kaum glauben, dass ich das aus dem Mund eines Mannes höre. Jetzt brennt echte Neugierde in mir wie Feuer.
»Würdest du ein Kind auch adoptieren oder eine Frau mit einem Kind akzeptieren? Oder kommt das für dich nicht infrage?«
Er schaut mich völlig verwundert an. Was? Darf man so eine Frage denn nicht stellen? Er verkneift sich sichtlich ein Schmunzeln. »Sprichst du etwa von dir?«
»Nein, nein, ich frage nur so.«
Ich kann mir vorstellen, was ihn gerade so an mir amüsiert: dass meine Wangen schon wieder glühen.
»Es würde mir nichts ausmachen.«
»Und wenn die Frau … zwei Kinder hat?«
»Du hast also zwei Kinder?«
»Nein«, beeile ich mich zu antworten. »Es ist wieder nur …«
»Neugier?« Ich muss lächelnd und mit einem Nicken gestehen. »Auch das macht mir nichts aus.«
»Und drei?« Ich kichere nun auch über mich selbst. »Ich habe auch keine drei Kinder!«, erkläre ich es ihm sofort, und er lacht leise mit.
»Auch nicht. Wenn die Chemie zwischen allen stimmt, dann ist es für mich kein Problem.«
Er schaut mich erwartungsvoll an. Was soll ich dazu sagen? Er ist so perfekt …
»Warum fragst du? Also wie ‚nur Neugier‘ hört sich das nicht wirklich an«, durchschaut er mich. »Hast du vielleicht doch Kinder? Das kannst du mir ruhig sagen.«
»Selbst wenn ich welche hätte, warum willst du das wissen?«
»Hey, mit dem Thema hast du angefangen … Hast du nun Kinder oder nicht?«
»Nein, ich will aber unbedingt eins adoptieren«, sage ich entschlossen.
»Warum gerade adoptieren? Kannst du etwa keine Kinder …?«
»Doch«, unterbreche ich ihn und werde selbst stutzig, weil ich eigentlich gar nicht weiß, ob ich überhaupt Kinder bekommen kann. Michel sieht mich abwartend an, und ich lächle etwas verlegen. »Ich habe mich viel zu sehr in ein Kind verliebt, das ich nun seit vier Jahren betreue … Einen Jungen. Ich möchte ihn adoptieren.«
Michel wirkt plötzlich sehr nachdenklich. Ich werde aus seinem Blick nicht schlau und bin deshalb froh, mit der Situation und dem Gespräch abschließen zu können, als ich sehe, dass wir uns meiner Straße nähern. Ich richte mich schnell im Sitz auf.
»Können Sie hier anhalten?«, bitte ich Sven. »Danke.«
Ich möchte zu Fuß weiterlaufen, weil ich nicht will, dass Michel auch noch sieht, wo genau ich wohne. Das Auto hält an, ich nehme meine kaputten Schuhe und schaue dann Michel an, der mich wieder sanft anlächelt.
»Na dann, danke fürs Nachhausebringen.« Ich lächle zurück und er nickt.
Ich steige aus und ignoriere bewusst den Schuhkarton auf dem Sitz. Michel macht auch keine Anstalten, mich darauf aufmerksam zu machen. Gut so. Er hat es also tatsächlich begriffen.
»Tschüss, war sehr angenehm. Ruf mich an, wenn du doch etwas brauchst … Elena Neumann.«
Ich nicke, verwundert darüber, dass er meinen Namen betont, und verabschiede mich mit einem einfachen »Tschüss«.
Schnell und ohne mich noch einmal umzudrehen, gehe ich den Bürgersteig entlang und höre hinter mir, wie das Auto losfährt. Sekunden später drehe ich mich um, aber der Maybach ist nicht mehr zu sehen, und erst dann atme ich erleichtert durch.
Dieser Michel hat Charme und wirkt sehr angenehm, doch ich will nie wieder einem Hero vertrauen! Wenn einmal die Gefühle verletzt wurden, beginnt man zu zweifeln – nicht an der Liebe, nein, sondern an solchen Menschen. Einem Mann Vertrauen und Liebe zu schenken, ist für mich zu einer wahnsinnigen Herausforderung geworden, die ich nicht mehr so leicht auf mich nehmen möchte. Der Schmerz, den mir Valentin zugefügt hat, sitzt immer noch sehr tief in meinem Herzen. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum ich damals so lange versucht habe, in ihm etwas Gutes zu erkennen, obwohl er mich gar nicht wollte. Doch war es überhaupt Liebe?
Ich habe es glauben wollen. Ich spürte sie in meinem Herzen. Ich spürte sie in jedem Wort, in jeder Zeile der Gedichte, die ich seinetwegen geschrieben habe. Wie konnte ich bloß so blind vor Liebe sein? Warum müssen Frauen wie ich eigentlich immer so ein sinnloses Bedürfnis haben, die Männer vor sich selbst zu retten? Warum denken wir, dass wir sie damit verändern und verbessern würden?
Die Zeit heilt Wunden, heißt es. So ein Schwachsinn! Die Zeit heilt keine Wunden. Sie lehrt uns nur, den Schmerz zu überwinden, und macht uns stärker. Irgendwann muss man einsehen und akzeptieren können, dass manche Menschen nur als Erinnerung im Herzen bleiben können und nicht in deinem wahren Leben. So habe ich auch Valentin und meine Liebe für ihn in meinem Herz einbetoniert. Und ich will auch nicht, dass diese Liebe jemals wieder entbrennt oder herausbricht. Auch wenn ich dadurch wohl niemals wieder solche Gefühle für einen Mann haben werde.
Wenn man Dinge aus einem Gehirn löschen könnte, würde ich nicht den Herzschmerz wählen, sondern nur eines: Ich würde die Erinnerungen an Valentin löschen. Ich will ihn vergessen, kann es aber nach wie vor nicht. Ich denke noch an ihn, doch ich will es nicht. Ich will ihn sehen, würde aber alles dafür tun, dass das nicht passiert. Ich liebe und hasse ihn zugleich. Und ich will niemanden mehr lieben, um nicht wieder leiden zu müssen.
Die einzige Liebe, die ich an mich heranlasse – und auch immer tun werde –, gehört nur einem ganz kleinen, aber sehr wichtigen Menschen in meinem Leben: Vince. Er wird immer der einzige Mann sein, den ich von ganzem Herzen liebe und immer lieben werde.
Ich betrete meine Wohnung, schaue bedauernd meine Schuhe an und lasse sie mit einem schweren Seufzer auf den Boden fallen. Bereits auf dem Weg ins Badezimmer ziehe ich meine Bluse aus, dann den Stiftrock. Beides befördere ich sofort in den Wäschekorb. Vor dem Spiegel befreie ich mein Gesicht vom Make-up und gönne mir dann eine kalte Dusche. Das tut mir an so einem Hitzetag richtig gut, und ich bleibe unter den sanften Wasserstrahlen stehen, bis ich völlig abgekühlt bin.
Meine nassen und bis zur Taille reichende Haare lasse ich lufttrocknen und ziehe in meinem Zimmer ein leichtes Sommerkleid an, als mein Handy klingelt.
»Hi!« Ich gehe bereits lächelnd ran.
»Hi, Süße. Wie geht’s dir?«, schnattert Roma fröhlich wie immer in mein Ohr.
»Gut. Alles beim Alten. Lebe immer noch in der grässlichsten und lautesten Stadt der Welt und suche verzweifelt nach einem richtigen Job.«
»Was ist mit deinem Basis-Job in dem Club vor einem Monat geworden?«
»Ein Kunde hat mich betatscht …«
»Ist nicht wahr!«, empört sie sich.
»Jepp, ich hab das aber nicht auf mir sitzenlassen … Na ja, es ist etwas eskaliert und der Chef hat mich gefeuert. Ach, Nachtclubs sind sowieso nicht mein Ding, Roma!«
Ich schaue, wie immer beim Telefonieren, aus dem Fenster. Das Hupen der durch die Straßen kriechenden Autos ist zu hören. Die Menschen laufen hektisch über die Bürgersteige, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Warum machen sich alle so einen Stress? Oder laufen sie vor Einsamkeit und Trostlosigkeit davon?
»Mann, du machst ja Sachen.«
»Und wie geht´s dir?«
»Gut so weit.« Sie seufzt in den Hörer. »Ich liege meinen Eltern auf der Tasche, echt ätzend.«
»Also hast du bei der Arbeitssuche genauso viel Erfolg wie ich.«
»Kann man so sagen … Gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten bei dir?«
»Äh … nicht wirklich.«
»Nicht wirklich? Das heiiißt?« Ich höre ihr an, dass sie dabei erwartungsvoll grinst.
»Na ja, heute kam wieder mal ein Hero bei mir angefahren.«
Roma will natürlich alle Einzelheiten hören, und ich erzähle alles, woraufhin sie wie immer die Situation hochspielt.
Es klingelt plötzlich. Ich bitte Roma, kurz dranzubleiben, und öffne meine Wohnungstür. Davor steht ein Jugendlicher, der mir schnell einen Schuhkarton in die Hände drückt und sofort davonläuft. Ich beobachte blinzelnd, wie er die Treppe nach unten sprintet. Ich knalle meine Tür zu und laufe zum Küchenfenster, das auf den Bürgersteig rausgeht. Dort sehe ich, wie der Junge zu einem Maybach läuft und Michel ihm lächelnd etwas in die Hand drückt. Der Junge geht dann gemächlich weg und Michel setzt sich in sein Auto und fährt davon.
Ungläubig blicke ich auf den Schuhkarton von Escada in meinen Händen. Dabei vergesse ich glatt Roma am Telefon, bis ich ihr »Hallooo!« daraus höre.
»Oh, entschuldige«, antworte ich noch etwas irritiert. »Der Schuhkarton von Michel ist da.«
»Er hat ihn dir gebracht?«
»Nein. Er hat einen Jungen geschickt, den er womöglich auch noch dafür bezahlt hat, dass er ihn mir übergibt.« Ich schüttle den Kopf. »Es ist unfassbar, was der sich erlaubt!«
Ich gebe mir zwar größte Mühe, verärgert zu sein, bin es aber nicht wirklich – im Gegenteil: Ich erlaube mir ein klein wenig, mich geschmeichelt zu fühlen.
»Und das war’s?«
»Ja … irgendwie schon.«
»Wie sehen die Schuhe aus?«, quengelt Roma ungeduldig.
»Das weiß ich nicht.«
Ich setze mich im Wohnzimmer auf das Sofa und mache den Karton auf. Darin liegt auf den silberfarbenen Pumps ein kleiner gefalteter Zettel, den ich mit dem Daumen öffne und lautlos lese: Wir treffen uns heute um 20:00 Uhr. Michel. Ich verschlucke mich hustend.
»Was ist? Sehen sie scheiße aus?«
»Nein, die Schuhe sind echt stark. Aber er hat mir eine Notiz hinterlassen, dass wir uns heute Abend um acht Uhr treffen werden.«
»Der ist ja selbstbewusst.«
»Hm, eher kein Nein gewöhnt!«, vermute ich.
»Und, gehst du mit ihm aus?«
»Natürlich nicht«, antworte ich fest und werfe den Zettel in den Schuhkarton zurück.
»Wieso nicht?«
Ich bin hin- und hergerissen, werde nervös und komischerweise sauer, dass mich erneut das Misstrauen aus meiner Vergangenheit überrollt. »Ich gehe nie wieder mit so einem Typen aus!«
»Ist es immer noch wegen Valentin?«, will sie vorsichtig wissen. Ich atme schwer durch, schlucke den Schmerz herunter, den er bei mir zurückgelassen hat. »Er hat mich nämlich gestern angerufen.«
Mein Atem macht plötzlich einen Aussetzer. Ich weiß, dass die beiden Kontakt halten, weil Roma mir immer von ihren Gesprächen berichtet. Das wollte ich in den ersten Monaten gar nicht hören und habe abgeblockt.
Ich warte ab, was sie mir jetzt über ihn erzählen wird, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich es überhaupt hören will. Dennoch brenne ich jedes Mal darauf, zu erfahren, wie es ihm geht. Mit diesem Konflikt in mir muss ich Tag ein, Tag aus fast ein Jahr leben. Ich hasse es!
»Er hat seit ein paar Monaten eine feste Freundin und sie leben zusammen«, beendet Roma nun das Schweigen.
Jetzt presse ich irgendwie wehmütig meine Lippen auf einander. Es versetzt mir einen schmerzenden Stich mitten ins Herz, weil es ihm – im Gegensatz zu mir – gelungen ist, mich zu vergessen. Ich kann es immer noch nicht.
»Soll er doch«, werfe ich verärgert ein. »Ich will auch nichts mehr von ihm hören … Und hör auf, mir ständig von ihm zu erzählen!«
»Ja, schon verstanden.«
»Und ob du das verstanden hast!«
Scheiße, warum bin ich jetzt so wütend? Ich will nicht, dass Roma als Prellbock herhalten muss. Doch sie kennt mich viel zu gut und weiß, dass ich manchmal zu Übertreibungen neige und es nie böse meine.
Sie tut es lachend ab. »Du kannst ja bissig sein.«
»Kann sein. Das ist das einzig Gute, wo Valentin seine Spuren hinterlassen hat. Wäre ich nur damals so gewesen, dann hätte ich nicht einfach nur blöd rumgestanden und mich von ihm aufs Übelste beleidigen lassen.«
Ja, ich bin zu einer pragmatischen Zicke geworden, nur weil irgendein dahergelaufener Mistkerl meine heile Welt kaputtmachen musste. Dieses ruhige, erwärmende und mitfühlende Wesen, das mich einst ausgemacht hat, ist in die Tiefen meiner Seele gesunken. Ich habe mich gewandelt, verändert und in meinem Leben noch etwas dazugelernt. Mir wurde dadurch nur stärker bewiesen, dass die Menschen, für die ich durchs Feuer gehen würde, es nicht mal annähernd verdient haben.
Ich werde niemandem mehr etwas beweisen. Ein Mensch, der meine Achtung verloren hat, kann sich noch so sehr bemühen – ich könnte ihn nicht mehr so behandeln wie vorher.
Nach einer Weile höre ich wieder Romas Stimme. »Also willst du jetzt die Chance mit Michel ergreifen?«
»Mensch Roma, welche Chance denn? Eine von denen zu werden? Nein, danke! Außerdem arbeite ich heute um diese Uhrzeit im Kinderheim. Vince ist mir viel wichtiger als so ein Hero, der denkt, dass er mich mit Geschenken kaufen kann!«
Als ich im Kinderheim ankomme, sagt mir Lisa, dass Frau Grünhauer mich sprechen möchte. Bevor Vince mich sieht, gehe ich schnell in ihr Büro.
Sie schaut beim Zählen der Geldscheine kurz zu mir auf und konzentriert sich dann wieder auf das Geld. Ich setze mich hin und warte ab, bis sie die letzten Scheine gezählt hat. Sie breitet ein zufriedenes Lächeln aus und schaut mich an.
»Eine großzügige Spende?«
»Jaaa«, haucht sie und grinst. Sie packt rasch das Geld in die Kasse, die sie dann im Tresor einschließt.
»Sie wollten mich sprechen?«
Sie nickt. »Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie heute früher nach Hause gehen können. Ich habe die Praktikantin dafür eingeteilt, die Kinder ins Bett zu bringen«, informiert sie mich freudestrahlend.
Meine Mundwinkel sinken abrupt nach unten. »Aber ich war doch immer für den Schlafdienst eingeteilt! Warum jetzt eine Praktikantin?«
»Für heute habe ich eben so entschieden.«
»Aber –«
»Kein Aber!« Sie hebt protestierend die Hand. »Außerdem entscheide ich hier, wie die Planungen verlaufen, und nicht Sie, Elena«, entgegnet sie streng, lächelt mich aber dann freundlich an. »Einverstanden?«
Ich puste meinen Ärger aus und stürme aus ihrem Büro. Stampfend gehe durch den Flur in die Gruppe und atme tief durch, bevor ich eintrete. Die Kinder spielen kreischend und lachend und stürzen auf mich zu. Jeden Einzelnen begrüße ich und umarme Vince, dem ich viele Küsschen verpasse, während er mit seiner Wange über meine fährt und mich fest an sich drückt. Das ist immer so unglaublich warm und wundervoll. So fühlt sich wahre Liebe an. In solchen Momenten kann ich wirklich ich sein und muss nichts unterdrücken. Wenigstens meine Liebe zu Vince konnte Valentin nicht zerstören.
Ich genieße meine Zeit mit den Kindern, und als es Abend wird, will ich mich gar nicht von Vince verabschieden. Ich muss ihm auch sagen, dass ich heute nicht da sein werde, wenn er einschläft. Er ist traurig darüber und steht schmollend an der Fensterbank, weil wir zuvor nach draußen geschaut und am Himmel die Kondensstreifen der Flugzeuge gezählt haben.
»Du holst mich doch bald ganz ab, wenn die wichtigen Leute es dir erlauben?«, fragt er leise an meinem Gesicht. So habe ich ihm erklärt, warum ich ihn nicht einfach so mitnehmen darf.
Ich nicke heftig, streichle über seine Löckchen. »Natürlich, mein Kleiner.«
»Wirklich, wirklich?« Er wird leiser.
»Wirklich, wirklich.«
»Versprochen?«, wispert er.
»Versprochen«, flüstere ich zurück und drücke ihn fest an mich.
Ich kämpfe mit meinen Tränen, weil ich nicht weiß, wie ich es anstellen soll, unsere Qual zu beenden. In meinem Kopf formt sich mein alter Gedanke mit der Heirat – egal ob es aus Liebe geschieht oder nicht … Das ist meine Lösung! Vince zuliebe will ich es versuchen. Das wäre wirklich eine Möglichkeit. Und ich könnte meine Chance ergreifen – vielleicht sogar mit Michel? Wegen Vince wäre ich doch bereit, mit einem wohlhabenden Hero zu leben. Für Vince würde ich aufs Ganze gehen.
Nach einer langen Verabschiedung von Vince möchte ich so schnell wie möglich meinen Plan durchziehen, Michel so gut wie es nur geht zu gefallen. Ich eile aus dem Gebäude, dann über den Hof. Ich will quasi nach Hause laufen, in der Hoffnung, Michel nicht zu verpassen. Doch ich komme nicht weit und bleibe wie festgewachsen auf dem Bürgersteig stehen. Ich sehe verblüfft Michel an. Er steht auf der anderen Straßenseite an sein Auto gelehnt, mit einem Strauß roter Rosen.
»Wie versprochen – um zwanzig Uhr treffen wir uns.« Er lächelt mich breit an, was ansteckend auf meine Mundwinkel wirkt.
Langsam gehe ich auf ihn zu. »Wie hast du mich gefunden?«
»Ich habe viele Kontakte.« Seine Stimme ist leicht belegt und sein Lächeln wird noch unwiderstehlicher.
»Also die Dienstplanung bei meiner Chefin zu ändern, gehörte auch zu deinen Kontakten?«
Ich denke, dass er es auch war, der ihr Geld gespendet oder sie vielleicht sogar bestochen hat, damit sie mich von der Arbeit freistellt.
Er hält mir als Antwort die Blumen hin, die ich nicht beachte. Stattdessen blicke ich nur in seine Augen. Ich kann mir eigentlich doch vorstellen, mich in ihn zu verlieben – aber nur fast.
»Ich wollte dich nicht so einfach ohne irgendetwas näher kennenlernen. Da dachte ich, mit Blumen kann man nichts falsch machen.« Er wirkt etwas verlegen, was echt süß aussieht. Ich glaube, er kann mir auch viel mehr gefallen. »Also … willst du mit mir ausgehen?«, fragt er mich und dringt förmlich mit seinen Augen in meine. Schmunzelnd nehme ich seinen Blumenstrauß in die Hände. »Ich werte das als ein Ja.«
Er nickt zufrieden und macht mir die Autotür auf, woraufhin ich mich in den Luxusschlitten gleiten lasse.
Ob daraus tatsächlich Liebe wird, kann ich noch nicht sagen. Aber ich werde meine Chance, die ich eigentlich insgeheim für Valentin behalten habe, jetzt anderweitig vergeben.
Kapitel 1
Valentin
Als das Flugzeug landet, kommen mir bereits die Erinnerungen an meine Vergangenheit, und das mit so einer Intensität, dass ich beinahe körperlich spüre, was ich damals empfunden habe. Ich habe nichts von dem vergessen, was vor zwei Jahren geschehen ist. Es waren viele glückliche Momente, an die ich mich gern erinnere. Obwohl ich doch die Zeit zurückdrehen will und diesmal alles anders machen. Vielleicht wäre Enzo dann noch am Leben. Wir würden uns jetzt treffen und zusammen über unsere durchzechten Nächte lachen. Nun ist er nicht mehr da, und daran gebe ich mir nach wie vor die Schuld. Ich fühle mich nicht nur seinetwegen schuldig …
Die Zeit in den USA habe ich absichtlich verlängert, um nicht das fühlen zu müssen, was ich jetzt trotz wieder fühle: Schmerz, Sehnsucht … und immer noch den Virus namens Liebe. Wenn ich zurück in die Vergangenheit blicke und daran denke, wie viele falsche Worte ich zu Elena gesagt habe, die sie gar nicht verdient hat, so tut es mir noch mehr leid. Es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen. Die letzte Nacht, die wir zusammen verbracht haben, gehe ich noch oft in meinem Gedächtnis durch. Ich denke auch daran, welche Schmerzen ich ihr damit zugefügt habe. Ich habe es wohl verdient, dass sie mich nicht mehr zurückwollte. Die Strafe für das, was ich getan habe, war gerecht. Sie hat mich geliebt, und ich habe sie auf jegliche Art und Weise von mir gestoßen.
Was aber alles viel schlimmer macht: Die Liebe zu Elena erwacht plötzlich in all ihren Farben, als ich deutschen Boden betrete. Ich liebe sie immer noch. Und die Hoffnung, sie wenigstens noch mal wiederzusehen, gebe ich nicht auf. Ich bin mehr als bereit, mich bei ihr für alles zu entschuldigen. Doch reicht meine Entschuldigung aus? Wie kann man das Verlorene wieder zurückgewinnen oder Fehler wiedergutmachen? Und wie kann ich sie überhaupt wiederfinden?
Ich möchte so sehr ihr Lachen und ihre Stimme hören, ihre zierliche Hand fest in meiner halten. Das will ich plötzlich so sehr wie schon lange nicht mehr. Sie wenigstens für ein paar Sekunden oder nur von weitem sehen zu können, das würde mir schon reichen. Oder … vielleicht doch nicht. Es würde mich innerlich umbringen, sie nur sehen zu können und nicht in meiner Nähe zu haben.
Ich habe wirklich versucht, Elena zu vergessen, mit meiner Schuld zu leben und eine andere Frau zu lieben. Vergeblich. Ich brauche nur sie. Man kann nicht so einfach einen Menschen vergessen, den das Herz auserwählt hat. Fast ein ganzes Jahr war ich mit einer Frau zusammen und habe gehofft, mit ihr die Liebe zu finden, die ich bei Elena empfunden habe. Doch außer einer innigen Freundschaft mit Sex hat uns nicht wirklich viel verbunden. Daher fiel uns beiden die Trennung sehr leicht.
Ich muss nach Deutschland zurückkehren, weil mein Vater in Rente geht. Als Erstes will er drei Wochen in den USA Urlaub machen, was für mich aber eher danach aussieht, dass er in seinem Tochterunternehmen nach dem Rechten sehen will.
Nun bin ich wieder hier – in meiner Heimatstadt, in meinem schönen Viertel, in meinem früheren Wohnhaus. Ich öffne die Wohnungstür und atme aus, erleichtert darüber, dass ich wieder daheim bin. Aber auch mit einem Hauch von Sorge, dass ich wegen meiner Einsamkeit wieder in meine frühere Welt abstürzen könnte.
Ich stoße die Tür mit dem Fuß auf, um genug Platz mit meinen Koffern zu haben, trete ein und dann …
»Taa–daaa!« Mit einem lauten und schrillen Schrei springt sie aus meinem Wohnzimmer heraus.
Vor Schreck zucke ich zusammen, sodass mir sogar die beiden Koffer aus den Händen gleiten und auf den Boden krachen. Ich starre sie mit aufgerissenen Augen an.
»Mutter!«, keuche ich verärgert, doch sie lacht herzhaft auf und kommt auf mich zu. »Du hast mich zu Tode erschreckt! Was machst du hier?«
Sie umarmt mich so, dass ihr langes blondiertes Haar mir ins Gesicht fällt. »Darf denn eine Mutter ihren Sohn nicht besuchen?«
Sie gibt mir einen feuchten Kuss auf die Wange, den ich abwische. Ich hoffe, ihr Make-up und ihr Lippenstift sind nicht auf meinem Gesicht geblieben, so dick, wie sie aufgetragen sind, und fahre mit der Hand noch mal darüber.
»Doch, natürlich … es ist nur sehr … ungewöhnlich … Was ist der wahre Grund?«
Sie presst ihre Lippen aufeinander und sieht leicht bedrückt aus.
»Ich bin etwas knapp bei Kasse und möchte nicht zu deinem Vater gehen.« Mir kommt eine Vorahnung, die mich innerlich erzittern lässt. »Also, ich … äh … ich wollte dich fragen«, stottert sie und zuckt leicht verlegen mit den Schultern. Oh nein, bitte nicht! »Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich erst mal bei dir wohne?«
Sie schaut mich mit ihren stark geschminkten Augen an und klimpert mit den Wimpern.
Auf gar keinen Fall! Ich erinnere mich gar nicht mehr an das Gefühl, mit meiner Mutter zusammenzuleben, dennoch schwanke ich hin und her. Ich will das einerseits nicht, aber andererseits ist sie ja doch meine Mutter. Ich kann sie nicht auf die Straße setzen.
»Und wo ist dein Macker?«, frage ich stichelnd.
Sie verzieht ihr Gesicht. »Das ist doch immer das Gleiche: Wenn es keinen Honig mehr zu schlecken gibt, dann ist das Leben nicht mehr süß.«
»Oh Mutter, bitte!«, stöhne ich angewidert. »Ich hoffe sehr, du hast vom Geld geredet!« Sie lacht amüsiert auf, und ich rolle mit den Augen. Natürlich hat sie nicht vom Geld geredet. Ich atme durch und nicke schließlich. »Okay … du kannst hier wohnen. Aber verschone mich mit deinen Abenteuern.«
»Danke!«, säuselt sie und umarmt mich noch mal, was ich nicht erwartet habe. »Du wirst mich gar nicht bemerken.«
Natürlich! Wer’s glaubt. Ich befreie mich aus ihren Armen, stelle meine Koffer beiseite und gehe in mein Schlafzimmer.
»Du kannst in meinem Bett schlafen«, sage ich äußerlich ruhig, ärgere mich aber darüber, dass ich jetzt keine Privatsphäre mehr haben werde.
»Nein, nein. Mach dir bloß keine Umstände.« Sie winkt mit der Hand ab. »Dein breites Sofa gefällt mir sehr gut. Ich schlafe darauf.«
Ich ziehe zufrieden meine Mundwinkel nach oben. »Na, dann ist ja gut.«
»Unter einer Bedingung«, sagt sie nun. Ich sehe sie entgeistert an. Nicht zu fassen, dass sie mir in meiner Wohnung Bedingungen aufbinden will. »Du musst die Spinne über dem Sofa wegmachen.«
Meine Schultern entspannen sich, und ich schmunzle. »Wieso? Vielleicht ist es mein Haustierchen.«
»Nein, die musst du wegschaffen! Ich habe Angst vor denen«, bringt sie entsetzt hervor.
»Seit wann hast du denn Angst vor Spinnen?« Ich gehe in Richtung Wohnzimmer, während sie hinter mir herläuft.
»Die hatte ich schon immer! Ich könnte sterben, wenn sie in meiner Nähe sind.«
Als ich im Wohnzimmer ankomme, sehe ich die Spinne in der Ecke über dem Sofa. »Ach, die sind doch harmlos.«
»Harmlos?!«, quiekt sie. »Es war für mich schon eine Überwindung mit ihr allein in der Wohnung zu hocken.«
Ich verkneife mir einen dummen Kommentar, steige auf das Sofa und nehme die Spinne in meine Hand.
»Igitt«, würgt meine Mutter hervor, als sie das sieht.
Ich grinse sie an, während ich vom Sofa steige. Ich öffne die Terrassentür und lasse die Spinne frei.
»Bist du verrückt?«, kreischt sie auf, als ich die Tür zumache.
»Nein, wieso? Ich töte eigentlich keine kleinen Viecher.«
»Das ist kein Viech, das ist ein Miststück!«, entgegnet sie angewidert. »Außerdem wollte ich mich auf der Terrasse eigentlich noch sonnen. Jetzt kann ich das vergessen, solange das Biest da rumkriecht!«
Ich zucke mit den Schultern. »Tja, dann Pech gehabt, würde ich mal sagen.«
Es wird still. Ich schaue mich im Wohnzimmer um, weiß nicht so recht, worüber ich mit ihr noch reden soll, und bemerke dabei den Staubwedel auf dem Tisch. Sie wollte vermutlich aufräumen, bevor sie die Spinne entdeckt hat.
»Na gut. Ich muss zu Vater in die Firma, bevor er zum Flughafen fährt. Ich gehe nur noch schnell unter die Dusche.«
Sie nickt und presst gequält ihre Lippen aufeinander. Wahrscheinlich wurmt es sie, dass ich mich ihr gegenüber so distanziert verhalte. Was hat sie denn auch nach so viele Jahren Eiszeit erwartet? Kuschelzeiten und liebevolle Gute-Nacht-Küsse liegen schon so weit in der Vergangenheit, dass ich sogar anzweifele, ob sie Realität waren oder ich mir das als Kind alles bloß eingebildet habe. So ein richtiges Mutter-Sohn-Verhältnis, wie es eigentlich sein sollte, gab es nie und wird es scheinbar auch nicht mehr geben.
Es ist Freitag und die meisten Kollegen haben bereits Feierabend. Ich betrete das Büro meines Vaters. Er und seine Sekretärin Sylvia richten ihre Blicke vom Tisch auf mich. Jeder von uns hat ein Lächeln übrig. Ich begrüße Sylvia herzlich mit einer Umarmung, dann meinen Vater, während sie uns allein lässt.
Er setzt sich sofort in seinen Chefsessel, und wir reden erst einmal darüber, wie wir unsere letzten Wochen verbracht haben. Dann geht er schnell zum Geschäftlichen über und erklärt mir, welche Deals in letzter Zeit abgewickelt wurden und wie es derzeit um unsere Firma steht. Natürlich geht er viel mehr auf das Finanzielle ein und auf meine Anteile als neuer Geschäftsführer von G & G. Ich denke, dass nicht jeder Kollege – oder gar der Vorstand – froh darüber ist, mich anstelle meines Vaters im Chefsessel zu sehen. Dieses Gefühl hatte ich immer. Um ehrlich zu sein, will ich es auch nicht wirklich gerne, aber ich liebe meine Arbeit und sitze lieber ich im Chefsessel als wieder in einem Club mit einer Whiskyflasche. Das habe ich jetzt eingesehen, durchgezogen und will es auch so beibehalten.
Mein Vater lehnt sich in seinem Sessel zurück. »Am besten veranstaltest du noch für die Geschäftspartner – oder nur für die Mitarbeiter, das ist dir überlassen – eine kleine Willkommensfeier. Es ist eine gute Möglichkeit, dich als neuer Chef vorzustellen und auch deine zukünftigen Pläne oder gar neue Erzeugnisse zu präsentieren.«
»Habt ihr schon Vorschläge für neue Produkte gemacht?«, will ich wissen.
»Ja. Herr Tilge hat bereits Pläne für ein neues Produkt vorbereitet und kann sie dir präsentieren.«
Ich nicke einverstanden. »Und was soll ich noch wissen? Wer wurde gekündigt? Befördert?«
»Gekündigt wurde niemand, ein paar wurden eingestellt und deinen alten Platz hat Lasse Niemann eingenommen.«
Ich sacke innerlich zusammen. »Was? Lasse Niemann? Als Verkaufsleiter?«
Mein Vater stört sich nicht an meinem Gefühlsausbruch und nickt nur. »Und dein Stellvertreter.«
»Woaahh«, schreie ich meinen Ärger heraus und lehne mich wütend zurück. »Das hat er ja ganz toll hingekriegt.«
»Ich brauchte dringend jemanden und fand, dass er –«
»Nicht zu fassen, Niemann hat sich zu einem Leiter hochgeleckt!«, schnaube ich stinkig.
»Und ja, noch etwas Wichtiges: Lerne bitte endlich, deine Worte richtig zu wählen!«
»Ist doch wahr. Diesem Arschkriecher kann man doch nicht vertrauen, das ist doch ein Zubläser!«, wettere ich. »Mann, unsere Firma ist wie eine reine Befriedigungsmaschine: nur am Blasen und Lecken.« Darüber muss ich dann selbst schmunzeln. Mein Vater glotzt mich an und unterdrückt sichtlich ein Lächeln. »Wir lecken bei den Kunden, die Lieferanten bei uns, die Angestellten bei den Leitern, die Leiter –«
»Es reicht!«, unterbricht er mich und versucht dabei, ernst zu klingen, wobei er vom lautlosen Lachen zu zittern beginnt.
»Du willst nicht wissen, woran du bist, oder?«
»Nein, ganz ehrlich nicht! Außerdem bist du jetzt der Chef, also überleg dir, wer bei wem –«
»Oh, hör auf«, schneide ich ihm das Wort ab.
»Noch etwas, das du nicht weißt.« Er wird wieder ernster. »Wir haben überall in den Eingangsbereichen und Fluren Kameras angebracht.«
»Ist nicht wahr! Gab’s dazu irgendeinen Anlass?«
»Nein. Wir wollten einfach nur mehr für die Sicherheit sorgen.«
»Die Kollegen wissen es aber, oder?«
»Natürlich, sonst durfte ich sie ja nicht anbringen.«
»Und von wem werden die Kameras und Videos verwaltet? Sag nicht von mir!« So eine Scheißtätigkeit hat mir noch gefehlt … Obwohl, könnte vielleicht auch lustig werden. Besonders mit Lasse.
»Nein. Von einem Administrator, er sitzt im letzten Büro.«
Wir werden durch ein Klopfen unterbrochen. Sylvia schaut lächelnd herein.
»Ich wäre dann so weit.« Ihre Stimme ist sehr weich.
Ihr Blick kommt mir irgendwie … Ich sehe zu meinem Vater, der sie anlächelt und genauso anschaut wie sie ihn, so …
»Wir sind fertig. Bin gleich da, Schatz.« Er bricht beim letzten Wort halb ab und presst seine Lippen zusammen. Sie lächelt und ihr Kopf verschwindet hinter der Tür, während mein Vater seinen Blick senkt.
Ich kneife die Augen zusammen, weil ich es nicht fassen kann. »Du und Sylvia?«
Ich lache ihn nicht aus, sondern freue mich tatsächlich für ihn.
»Äh … ja.« Er fummelt nervös an den Blättern auf dem Tisch, ohne mich anzusehen, und wirkt verlegen.
»Finde ich gut«, sage ich mit ehrlicher Begeisterung in der Stimme, und er sieht mich überrascht an. »Verdammt, deswegen warst du auch so eifersüchtig, wenn ich sie angeschaut habe.«
»Nein, war ich nicht«, erwidert er ertappt.
»Warte … Kommt Sylvia etwa mit dir mit nach Amerika?« Er nickt leicht und schmunzelt. »Und wer ist dann meine Sekretärin?«
»Lass dich überraschen.« Jetzt grinst er mich an.
»Oh, deine Überraschungen kenne ich nur zu gut. Du hättest mich doch wenigstens vor Mutter warnen können!«
»Gib ihr doch einen Job«, witzelt er, weil sie in ihrem Leben kaum gearbeitet hat.
»Damit ich mir anhören muss, dass all ihre künstlichen Fingernägel beim Tippen abgefallen sind?«
Doch dann werde ich still, denn es ist nicht gut, über Mutter Witze zu reißen, auch wenn ich sie als Mutter wenig gekannt habe. Dabei bemerke ich das eingerahmte Foto auf dem Tisch, auf dem mein Vater und ich in Anzügen bei einem Empfang abgelichtet sind. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Fotos mit meiner Mutter habe. Ich glaube nicht.
»Nichtsdestotrotz … Wie deine Mutter auch sein mag, gib bitte auf sie acht«, sagt er nun eine Spur ernster.
Ich nicke, wobei ich ein Ding auf seinem Tisch bemerke, das ich noch nicht kannte. »Und was ist das?«
Ich beuge mich näher, um es besser betrachten zu können.
»Das ist eine Sprechanlage. Man kann dadurch kurze interne Nachrichten bekanntgeben – Eilmeldungen wie einen Feuer-Probealarm, oder du kannst damit jemanden in dein Büro rufen. Die Boxen sind im ganzen Firmenbüro verteilt, selbst auf dem Klo.« Er schmunzelt beim letzten Satz.
Mein Kopfkino lässt mich schon wieder grinsen. »Ich kann mir bildlich vorstellen, wie ich Lasse zu mir rufe und er gerade auf der Schüssel hockt.«
Mein Vater schüttelt fassungslos den Kopf.
»Dich kann man nicht mehr erziehen.« Ich stimme ihm heftig nickend zu. »Aber bitte, fang bloß nicht wieder mit alten Angewohnheiten an, du bist jetzt noch präsenter. Keine Partys, keine Orgien … und keine Autorennen!«
»Welche Autorennen?« Ich bin überrascht, versuche jedoch, mich so zu geben, als wüsste ich nicht, wovon er spricht.
»Tu nicht so. Ich weiß schon längst, dass du an illegalen Rennen teilgenommen hast.« Ich presse meine Lippen aufeinander.
»Versprich mir, Valentin, dass du dich jetzt am Riemen reißt.«
»Okay, versprochen«, schießt es aus mir heraus. Er sieht mich noch zweifelnd an. »Versprochen! Ich bin für aus dem Alter so einen Blödsinn raus.«
Er atmet durch. »Na gut, wir müssen jetzt wirklich los.«
Ich begleite ihn und Sylvia bis nach draußen und kann dabei nicht anders, als die beiden als Paar zu betrachten. Sie sehen zusammen klasse aus.
Mein Vater streckt mir seine Hand entgegen, um sich zu verabschieden, und ich will sie drücken. Doch er dreht seine Handfläche nach oben, in der ein BMW-Autoschlüssel liegt. Irritiert sehe ich ihn an.
»Dein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, für den Fall, dass ich bis dahin nicht zurückkomme.«
Mir fällt die Kinnlade runter. »Ist nicht wahr!«
Er nickt lächelnd und drückt mir den Schlüssel in die Hand. »Ich hätte zwar lieber einen Porsche gekauft, aber du liebst ja BMW«, hebt er das letzte Wort besonders hervor. »Er steht in der Firmengarage.«
»Danke!« Ich nicke geplättet.
Er verabschiedet sich von mir mit einer festen Umarmung. Ziemlich lange, wie mir scheint. Vielleicht deswegen, weil wir das so selten tun. Als das Taxi in Richtung Flughafen abfährt, gehe ich zuerst in die Firmengarage.
Ich pfeife, als ich den schwarzen und auf Hochglanz polierten BMW-M3 sehe. Enzo wäre ausgeflippt, wenn er das Auto gesehen hätte, und hätte wohl dazu noch gesagt: »Ist er cool oder coool, mec?«
»Coool«, hauche ich lächelnd und streiche mit meiner Hand über das Dach. Die Sehnsucht schnürt mir kurz die Kehle zu.
Ich steige ein. Der Geruch des neuen Leders dringt in meine Nase, während ich die moderne Ausstattung und die ganze Elektronik betrachte. Als ich mich endlich von meinem neuen Spielzeug trennen kann, kehre ich wieder in mein Chefbüro zurück.
Stundenlang versuche ich, mir im ganzen Papiergewusel einen Überblick zu verschaffen. Erst als hinter dem Fenster die Dunkelheit einbricht, bemerke ich, wie mir der Kopf qualmt. Ich stehe auf und betrachte meine glitzernde Stadt, während ich über den Vorschlag meines Vaters nachdenke, eine kleine Feier zu veranstalten. Dabei kommt mir Lasse wieder in den Sinn. Es nervt mich gewaltig, dass er jetzt auch im oberen Bereich mitwirkt. Verärgert wende ich mich vom Fenster ab und beschließe, für heute Schluss zu machen. Aber nach Hause möchte ich irgendwie nicht gehen. Dort warten weder Stille noch Einsamkeit auf mich, sondern meine Mutter, bei der ich nicht so richtig weiß, wie ich mich ihr gegenüber verhalten oder worüber ich mit ihr reden soll.
Auf dem Nachhauseweg halte ich an, um Geld abzuheben, um vielleicht irgendwo doch noch ein Bierchen zu trinken. In den letzten zwei Jahren habe ich nur auf einem Geburtstag und auf einer Party, zu der mich meine Exfreundin geschleppt hat, etwas getrunken. Aber ich war nur angeheitert, nie richtig dicht. Mich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken, ist nicht mehr mein Stil. Ich versuche jetzt, mich gesund zu ernähren, und habe sogar angefangen Sport zu treiben. Mein Spiegelbild hat sich verändert. Es gefällt mir dich besser, gesunde und straffe Haut zu sehen als eine zerknitterte, versoffene Visage mit roten Augen.
Während ich mein Geld sicher im Portemonnaie verstaue, stoße ich auf dem Bürgersteig mit einem Mann zusammen.
»Entschuldigen Sie bitte«, sage ich und will weitergehen.
»Valentin?« Die Stimme kommt mir bekannt vor, und ich drehe mich sofort wieder um.
Rudolf lächelt mich ziemlich müde an. Sein Aussehen entspricht nicht mehr dem des jungen Mannes, der er mal war. Seine Klamotten haben wohl seit Tagen keine Waschmaschine mehr gesehen. Sein Gesicht ist eingefallen, die Augen sind mit dunklen Ringen versehen und seine Lippen spröde und rissig. Er sieht … erbärmlich aus.
»Rudolf!« Ich ringe mir ein Lächeln ab, trete auf ihn zu und ignoriere sein Aussehen, als ich ihn umarme und er diese Geste erwidert. Er riecht auch nicht besonders angenehm, aber ich ignoriere auch das irgendwie. »Wie geht’s dir?«
Er nickt leicht. »Geht, geht.«
»Was machst du so?«
»Nichts! Ich sammle Flaschen.« Er lacht leise, was sich verzweifelt anhört.