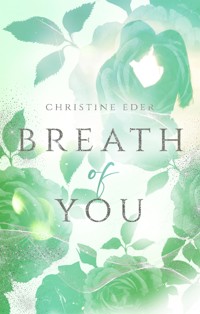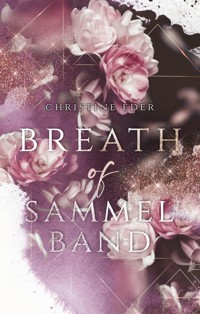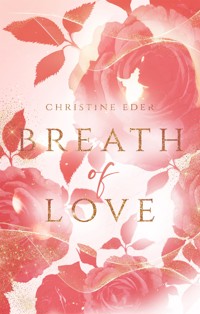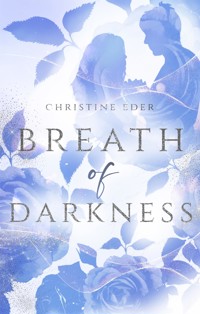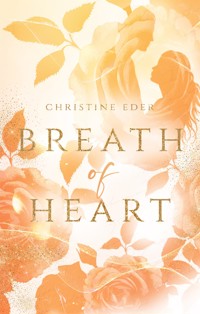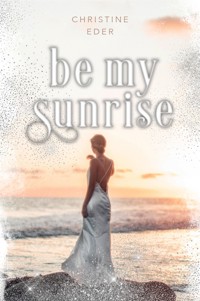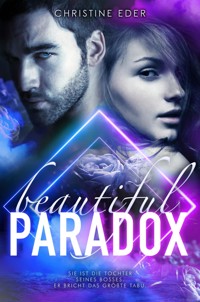
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn eine Liebe alle Regeln bricht? Ist es dann Glück oder Bestrafung? Soll man voreinander fliehen oder kopfüber eintauchen?
Valerie
Seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, als ich zehn Jahre alt war, liebe ich ihn. Auf den Tag, an dem ich ihn wiedersehen kann, habe ich jahrelang gewartet … Und nun ist er da und tut so, als würde er mich nicht bemerken. Doch ich gehöre zu den Mädchen, die alles bekommen, was sie wollen … Nur warum ist er bloß so kompliziert?
Lewis
Nie habe ich daran geglaubt, dass es die Eine geben würde, die ich wahrhaftig lieben könnte ... Sie macht es mir nicht gerade leicht, ihr zu widerstehen; stur und trotzig, bringt mich mit ihrem Gezicke um den Verstand ... sowie mein Herz zum Glühen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Beautiful Paradox
BookRix GmbH & Co. KG81371 München.
CHRISTINE EDER
.
BookRix GmbH & Co. KG
Implerstraße 24
81371 München
Deutschland
© Christine Eder 2022
Coverdesign: © Licht Design – Kristina Licht
Lektorat: Buchstabenhilfe – Peter Neuhäußer
Korrektorat: Steffis Korrekturecke,
Inna Stange
ISBN: 978-3-7554-0789-8
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Autorin reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Handlung und alle handelnden Personen dieses Buches sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen wäre rein zufällig.
Prolog
»Sprich bitte mit ihm. Auf dich hört er wenigstens noch«, bat Madison ihre Schwester, die in der Küche rauchend am offenen Fenster stand.
»Was soll ich da groß machen? Er ist ein erwachsener Junge und muss selbst entscheiden, welchen Weg er geht«, brachte Nelly hervor und zog an der Zigarette. »Vielleicht wird aus ihm was und er wird nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten!«, zischte sie den letzten Satz heraus.
»Sein Vater war ein liebevoller Mensch, egal wie sehr du ihn auch nicht gemocht hast.« Beleidigt schnitt Madison weiter das Gemüse für das Abendessen. »Für den Jungen ist und bleibt er ein Held!«
»Pff!«, pustete sie aus.
Lewis tauchte in der Küche auf. »Tante Nelly, du hast die ganze Küche verraucht!«
»Genau. Du bist ein schlechtes Beispiel für meinen Jungen«, meinte Madison und deutete ihrer Schwester mit den Augen, dass sie mit dem Jungen reden sollte.
»Als ob dieser Junge nicht selbst raucht. Nicht wahr, Lewis.«
Lächelnd wandte er sich ab. Natürlich rauchte er, seit er sechzehn war, doch traute sich nie, in der Gegenwart seiner Mutter oder seiner Tante eine Zigarette anzuzünden. Sein Anstand meldete sich dabei, es war ihm unangenehm.
»Mum, was sollte ich einkaufen?«
»Brot zum Abendessen. Aber Tante Nelly wollte noch mit dir sprechen«, stieß Madison Nelly auf das Gespräch von eben, weil ihre Schwester es nicht mal annähernd versuchte.
»Wollte ich? ... Ah ja ...« Nelly drückte ihre Zigarette aus. »Junge, ich bin stolz auf dich! Ich unterstütze deine Entscheidung voll und ganz. Ich liebe Soldis!«
»Nelly«, knurrte Madison unzufrieden und sah sie entsetzt an. Seufzend ließ sie das Messer auf den Tisch fallen. Auf ihre Schwester konnte sie doch nicht zählen.
»Was? Der Junge wird dort zu einem richtigen Mann erzogen!«
»Army ja, aber sich gleich für fünf Jahre verpflichten zu lassen mit einem Auslandseinsatz, wo es nur Krieg gibt … Das ist wie Selbstmord!«
»Mum, übertreib jetzt doch nicht. Meine Entscheidung steht fest! Du hast doch selbst gesehen, dass die Polizeischule mir abgesagt hat. Was soll ich sonst machen?«, erwiderte Lewis, auch wenn er es nicht verstehen konnte, warum sein bester Freund in der Polizeischule aufgenommen wurde und er nicht, obwohl sie den gleichen Notendurchschnitt hatten.
Dennoch gönnte er dieses Erfolgserlebnis seinem Freund und beschloss, auf eine andere Art und Weise die Menschen zu beschützen. Ja, er wollte genauso wie sein Vater Polizist werden. Für den Jungen war er ein Held, den er, als er zehn war, verloren hatte. Seine Erinnerungen verblassten sehr schnell und nur von Mutters Erzählungen, die seinen Vater hochlobte, kannte er ihn. Wenn Lewis jetzt kein Polizist werden konnte, dann würde er wenigstens als Soldat ein Held werden.
»Als ob es keine anderen Berufswege gibt«, murmelte seine Mutter, der zum zigsten Mal die Tränen in den Augen stiegen.
Madison wollte ihn nicht loslassen. Diese Entscheidung gefiel ihr nicht – welche Mutter wollte es, dass ihr Junge in einem Krieg kämpfte? Zurecht, denn es verging kaum ein Tag ohne Gefechte und Anschläge in Afghanistan, die von Taliban oder der Terrormiliz Islamischer Staat ausgingen. Madison war am Ende ihres Lateins angekommen, um ihrem Sohn diese Entscheidung auszureden, und ihre Schwester, die ihr auch noch in den Rücken fiel, war nun keine Hilfe.
Seufzend ließ sie den Kopf hängen, um ihre Tränen zu verbergen. Lewis gab ihr einen Kuss auf die Wange und lief aus der Wohnung, um für das Abendessen einzukaufen, worum seine Mutter ihn gebeten hatte.
Draußen zog er die Luft ein, die nach feuchter Erde roch. Die kühle Brise wehte ihm seine dunklen Haare ins Gesicht. Der Frühling brach in vollem Gange aus, zuerst mit seinem trügerischen Wetter aus Windböen und Regen, und dann mit grellem Sonnenschein, sodass es in den Augen wehtat und erwärmte die ersten Aprilblumen. Frühling war wie ein Neuanfang für die Natur, erneuerte sich mit Farben und Leben. So sollte auch seine Zukunft einen anderen, einen neuen Anfang nehmen.
Lewis ging zum Einkaufsladen den grau gepflasterten Fußweg entlang, den die großen Erlen an den Rändern zierten. Eine Schar von vorbeirauschenden Kindern lief ihm entgegen. Die Schule war vorbei. Bevor er zu der Einkaufsstraße abbiegen wollte, erregte eine Szene seine Aufmerksamkeit.
Er wäre sonst vorbei gegangen – was ist schon dabei, dass die Jungs sich prügelten, oder die Mädchen ärgerten, wie in diesem Fall. Lewis erschien es, dass dieses Mädchen die zwei hartnäckigen Belästiger nicht abwehren konnte, drehte sich im Kreis, als sie an ihrem Zopf zupften oder an ihrem Rock zogen. Sie schlug mit ihrer Tasche umher und rief denen zu, dass sie sie in Ruhe lassen sollen und abhauen. Der Wind zerzauste ihre Haare, als wolle er den kleinen Monstern auch noch dazu verhelfen und der Kleinen übel mitspielen. Einer der Jungen riss an ihr, sodass sie ihren Halt verlor und winselnd auf den Boden fiel.
Binnen Sekunden verkürzte Lewis den Abstand zum Geschehnis. Die Gefühle, die er dabei empfand, waren so, als hätte er es selbst erlebt, wie er dort auf dem Boden lag. In der Schulzeit musste er es häufig erleben, wie einige seiner Klassenkameraden ihn erniedrigt hatten und oft auf dem Boden sehen wollten. Doch genau das gab ihm die Kraft, so zu werden, wie er heute war.
»Was macht ihr kleinen Biester?«, knurrte Lewis einem der Angreifer zu und packte ihn am Kragen. Der Junge starrte ihn verdattert an und konnte nicht verstehen, was gerade passierte.
Lewis warf einen kurzen Blick auf das Mädchen, das ihn mit halboffenem Mund ansah. Ihre braunen Augen, die eine grüne Maserung hatten, wirkten magisch, als wäre sie eine kleine Elfe.
Das Mädchen weinte nicht mehr, vermutlich vor Staunen. So eine tiefe Stimme, die auch noch so angenehm klingen konnte, hatte sie bis jetzt noch nie gehört. Seine blau-grauen Augen strahlten eine gewisse Kälte aus, erschienen ihr aber gleichzeitig liebevoll. Dieser Mann war so groß, hatte breite Schultern und wirkte mit seinen muskulösen Oberarmen sehr stark. Er könnte diesen Blödmännern nur einen Klaps geben und schon würden sie ohnmächtig, wie Eintagsfliegen auf dem Boden liegen. Würde ihnen auch recht geschehen. Mit neuem Mut richtete sie sich auf.
»Beim nächsten Mal werde ich euch den Arsch versohlen, sodass ihr tagelang darauf nicht sitzen könnt!«, rief Lewis erbost, ließ den einen Jungen los und sie liefen sofort davon.
Das Mädchen stand mit einem in den Nacken geworfenen Kopf und sah zu Lewis hoch, dessen Blick sie traf.
»Hab keine Angst mehr, sie würden dich nicht mehr anfassen.« Obwohl Lewis das ruhig aussprach, hatte seine raue und tiefe Stimme, eine charakteristische Schärfe, die seine Persönlichkeit zeigte und für manche angsteinflößend wirkte. Jedoch nicht für sie.
»Ich habe auch keine Angst!«, erwiderte sie fest und hob ihre Tasche vom Boden auf. »Trotzdem danke!« Sie schaute etwas unsicher umher, was Lewis zeigte, dass sie sich doch noch ein wenig fürchtete.
»Soll ich dich nach Hause begleiten?«
»Nein, nicht nötig. Meine Mutter oder mein Chauffeur kommt gleich, um mich abzuholen«, sagte sie wie selbstverständlich.
Bei Lewis hoben sich verwundert die Augenbrauen. Diese Kleine, die vielleicht gerade mal zehn-elf war, hatte einen eigenen Chauffeur?! Wohl ein kleines verwöhntes Prinzesschen.
Sie richtete ihre dunkelblonden Haare, bei denen im Kampf vereinzelte Strähnen aus ihren Zöpfen rausfielen und sie steckte diese mit ihren Klammern neu zurecht – es sah nicht perfekt aus, etwas chaotisch, weshalb Lewis sein Lächeln unterdrückte.
Neugierig musterte sie ihn mit einem zufriedenen Lächeln. »Ich heiße Valerie. Und du?«
»Lewis.«
»Ein cooler Name.«
»Danke, deiner ist auch nett.«
»Wer bist du?«, fragte sie mutig.
Lewis blinzelte verwirrt, weil die Frage etwas komisch gestellt war. »Ähm … Ich werde bald ein Soldat.«
»Deswegen bist du so stark?!«, meinte sie, was Lewis zum lautlosen Lachen brachte.
»Und du? Was machst du am liebsten?«
»Ich schwimme gerne und turne, gehe auf eine Gymnastikschule. Ich kann auch Klavier spielen, aber das will ich nicht mehr machen. Turnen mag ich lieber und kann das sehr gut.«
»Wow …«, war Lewis begeistert, und es war nicht aufgesetzt oder gespielt. »Bestimmt sehe ich dich dann irgendwann mal im Fernsehen, wenn du an den Olympischen Spielen teilnimmst.«
»Hm«, dachte das Mädchen nach, denn es klang so verlockend. »Das wäre toll.« Der verträumte Blick mit dem süßen Lächeln, das kleine Grübchen an ihren Wangen entstehen ließ, entging Lewis nicht.
»Oh, ich muss los. Tschüss, Lewis«, sagte sie dann munter, ehe sie an ihm vorbeiging.
Als Lewis sich umdrehte, stand an einem schwarzen SUV eine Blondine, die ihn musterte und an der Fahrerseite saß ein Kerl in einem schwarzen Anzug und dunkler Sonnenbrille. Die kleine Valerie erklärte gerade ihrer Mutter, als diese sie ansprach, wer der fremde Mann war, mit dem sie gesprochen hatte. Da Lewis nicht wollte, dass Missverständnisse entstehen, machte er ein paar Schritte auf die Frau zu, um die Situation zu erklären, dass er ihre Tochter nicht belästigen wollte.
»Vielen Dank, dass Sie meiner Tochter geholfen haben«, sagte die Frau.
»Gern geschehen.« Lewis hatte sogar ein Lächeln für die Frau übrig, die ihn mit ihren blauen Augen beinahe durchbohrte.
Gleich bei dem ersten Blick zu Lewis stach es in Julias Brust und hinterließ einen dumpfen Schmerz.
»Ich geh dann mal«, stotterte Lewis, weil ihm ihr Blick langsam unangenehm wurde.
»Äh, wie heißen Sie?«, bremste ihn Julia jedoch ab.
»Lewis.«
»Suchen Sie vielleicht einen Job?«
»Sehe ich etwa so aus?« Sein Gesicht verfinsterte sich.
»Nein, nein, um Gottes willen … Ich wollte Sie damit nicht beleidigen. Mein Mann sucht gerade Angestellte und als meine Tochter erzählt hat, dass Sie sie verteidigt haben, da dachte ich … ich frage mal einfach nach.«
»Nein, tut mir leid. Ich habe mich für fünf Jahre bei der Army verpflichten lassen.«
»Oh«, hauchte sie. »Na dann, wenn Sie nach ihrer Armyzeit doch noch einen Job suchen sollten … dann können Sie uns anrufen.« Sie wühlte kurz in ihrer Chanel-Clutch und streckte ihm zwischen den beiden Fingern mit perfekt lackierten Nägeln eine Visitenkarte entgegen.
»Danke.« Mehr konnte Lewis nicht sagen, denn ihr tiefer Blick ging ihm unter die Haut.
»Wie alt sind Sie, Lewis?«
»Was spielt das für eine Rolle?«
Mit der Abweisung ihrer Frage hatte Julia nicht gerechnet und es warf sie leicht aus dem Konzept.
»Ich bin zwanzig«, gab er doch nach, weil er das Gefühl bekam, dass er sich unhöflich verhielt.
Lewis war noch nicht ganz zwanzig. Um genau zu sein, war er neunzehneinhalb. Er war ein spätes Winterkind und so entsprach sein Charakter dieser Jahreszeit; rau, stürmisch, abweisend und kalt. Dies hatte in seiner Vergangenheit dazu geführt, dass er oft in der Schule gemobbt wurde. Er hatte weder Bruder noch einen Vater, die auf ihn aufpassen oder ihn verteidigen beziehungsweise beschützen konnten. In der Schule musste er sich selbst durchschlagen, brachte sich selbst das Kämpfen bei und trainierte hart, damit er gegenüber seinen Angreifern Stärke zeigen konnte.
»Machen Sie es gut, Tschüss!«, verabschiedete sich Lewis von Julia schnell, die ihm nachsah. Der junge Mann erinnerte sie so sehr an denjenigen, den sie immer noch nicht vergessen konnte.
Lewis schaute die Visitenkarte an, auf der der Name Julia van Wets und eine Mobiltelefonnummer standen, mehr auch nicht. Merkwürdige Frau, dachte er. Er spürte die Blicke auf seinem Rücken und schielte über die Schulter, als der SUV an ihm vorbeifuhr. Julias Blick verfolgte ihn und dann sah er aus dem halbgeöffneten Autofenster hinten, wie ihm zum Abschied Valerie winkte, und ihm somit ein breites Lächeln auf sein Gesicht zauberte.
Niemand von ihnen ahnte, dass dieses mutige Mädchen mit einem Sonnenscheinlächeln und der Junge mit den kalten Augen sich noch mal treffen würden.
Kapitel 1
Acht Jahre später
»Ist das etwa noch eine bewohnte Umgebung?!«, stellte Lewis fest und sprach es auch in die Sprechanlage, als sie ihren nächsten Stützpunkt erreichten.
»Ja, aber die meisten, die friedlich sind, sind abgehauen. Die Terroristengruppe befindet sich genau hier. Die Objekte befinden sich im sechsten Abschnitt. Diese feststellen, vernichten und ein Bericht abgeben«, bekam er ins Ohr den Befehl, den er nicht verweigern durfte, vom Einsatzleiter.
Lewis schnitt eine unzufriedene Miene. Er war furchtlos, das wusste er, ihm würde es nichts ausmachen, das Leben eines Bösen zu beenden. Doch wenn eine Frau oder ein Kind vor ihm standen, schmerzte es jedes Mal, dass er auf sie mit seinem Gewehr zielen und sie auffordern musste, nicht näher zu kommen. Bis heute hatte er das Glück, nicht auf Unbeteiligte geschossen zu haben.
»Bryan, du bleibst hier und schaust in alle Richtungen«, kommandierte Lewis, der Gruppenführer war. Nach deren Nicken sah er die Anderen an. »Auf geht´s!«
Mit sechs Mann sprangen sie aus dem Wagen und liefen eine kurze Weile den sandigen und steinigen Weg entlang, auf dem es plötzlich zu lebhaft wurde. Eine kleine Ansammlung von circa zehn muslimischen Frauen kam auf sie zu und sie riefen in ihrer Sprache irgendetwas. Lewis und seine Kameraden legten die Waffen an und forderten sie auf, stehen zu bleiben, doch sie taten es nicht, wurden immer lauter und kamen näher.
»Vielleicht ein Warnschuss?«, schlug James Lewis vor.
Die jungen Männer riefen den Frauen in allen Sprachen, die sie kannten, zu, dass sie weggehen sollten, den Weg freimachen. Doch es brachte nichts. Erst als Lewis einen Warnschuss direkt in ihren Weg abgab, scheuchte er sie damit etwas beiseite.
Lewis Herz schlug bis zum Hals, während er mit der Waffe im Anschlag die Frauen mit den Augen inspizierte, ob sie mit Bomben verdrahtet waren. Sie schienen ein reines Ablenkungsmanöver zu sein. So gewannen die Terroristen Zeit, um sich an sie ranzuschleichen. Als sie die Frauen endlich passieren konnten, kamen sie an dem besagten zertrümmerten Gebäude an, das sie dann leise und lautlos stürmten.
Lewis zeigte eine Faust – ein Zeichen zum Stehenbleiben – dann zwei Finger nach links, zwei nach rechts. Seine Kameraden verteilten sich nach seiner Anweisung in den Räumen. James und Lewis schlichen mit aufgerichteten Waffen voran. Es fielen Schüsse im Nebenraum, zeitgleich tauchte ein vermummter Mann vor Lewis auf und schoss. Zum Glück daneben, sodass Lewis Kugel den Schützen traf. Mit einer weiteren Handgeste schickte er James in den Raum daneben und schlich allein voran in ein anderes. Die Sonne blendete ihn aus einem ausgeschlagenen Fenster und er richtete seine Waffe nach rechts, links, lief weiter nach vorn. Als er aus einer Tür vorsichtig herausschaute, fielen Schüsse in seine Richtung und er zuckte seinen Körper zurück hinter den Türrahmen, als der Kugelhagel die gegenüberliegende Wand traf und darin große Löcher hinterließ. Lewis atmete durch und scherte heraus. Schüsse. Der Mann fiel um. Eine staubige Wolke verdeckte kurz die Sicht.
Aufmerksam umging Lewis den Toten und trat in einen weiteren Raum ein. Er sah undeutlich eine Person und schoss, begriff aber zu spät … dass es eine Frau war, die zu Boden fiel. Hinter ihr war ein kleiner Schatten. Lewis riss die Waffe weg, als er es realisierte, doch sie feuerte bereits. Die Kugel traf die Wand neben dem kleinen Jungen, der vom lauten Knall stark zusammenzuckte, als die Fassade vom Schuss auf ihn herab bröckelte, während er an die Wand gepresst hockte und seine Ohren zuhielt.
Lewis Blick scannte den Jungen mit auf ihn gerichtete Waffe, denn was hatte hier ein Kind verloren, wenn er nicht selbst eine Falle, mit Dynamit um seinen Bauch, wäre? Aber der Junge war sauber, hatte nur ein schlabbriges und verschmutztes Shirt und Shorts an. Mit großen Augen sah er wie erstarrt Lewis an und gab keinen einzigen Ton von sich.
Sofort lief Lewis zu dem Kleinen, als vor ihm ein Typ aus dem Nebenzimmer heraussprang. Der Schuss sauste an Lewis Ohren vorbei, was dem Gegner eine Siegessekunde bescherte und Lewis die Chance gab, abzudrücken. Ein glatter Kopfschuss. Mit einem blutigen Gesicht fiel der Mann hart auf den Boden, zwei Meter vor dem Jungen.
Lewis überlegte … Vor ein paar Minuten meldeten seine Kameraden, dass die Räume am Eingang beziehungsweise Ausgang gesichert waren. Eigentlich durfte er das nicht machen, sollte den Jungen stehen lassen. Aber er konnte es nicht. Er nahm den Kleinen am Arm, um ihn hier raus zu bringen. Stets mit gerichteter Waffe und vor jedem Raum zur Sicherheit stehenbleibend, eilte er schnellen Schrittes zwischen den leblosen Körpern und zog vorsichtig den etwa fünf Jahre alten Jungen mit sich zum Ausgang.
Draußen ließ Lewis ihn los und zeigte ihm mit dem Finger, dass er sich hinter deren Wagen verstecken sollte. Doch dann hörte Lewis James in seinem Ohr »Granate« rufen und reagierte aus Reflex. Er warf sich über den Jungen, bedeckte ihn mit seinem Körper und mit seinen Armen das kleine Köpfchen, auf die er sein Kinn drückte. Eine ohrenbetäubende Explosion ließ den Boden unter seinem Körper erbeben, eine Druck- und Hitzewelle fegte über ihn hinweg. Lewis spürte, wie ein Hagel aus Glassplittern, Erde und Steinen seinen Rücken traktierte.
Die Zeit schien wie verlangsamt zu sein, in seinem Kopf drehte sich alles. Von dem Knall hörte er nur noch ein lautes Klingeln in den Ohren. Um ihn herum war es staubig und dunkel, bis ein kleines Licht durchdrang. Jemand befreite ihn von der Erde und Schutt, mit dem sie bedeckt waren.
»Lewis!«, hörte er jemanden dumpf wie durch einen Wattebausch sprechen. Die Explosionswelle hatte ihn verschluckt und seine Sinne geraubt. Unter ihm sah er die großen Augen, die ihn anblickten, verängstigte dunkle Knopfaugen. Der Junge überlebte dank ihm, blieb unter ihm unversehrt. Lewis Körper war schwer wie Blei, zitterte, doch er konnte sich nicht erlauben, die Kontrolle zu verlieren und den Jungen unter sich zu zerquetschen. Aus letzter Kraft kroch er zur Seite, um Halt zu finden, und fiel auf den harten Boden, spürte dabei jedes Sandkörnchen auf seinem Gesicht und atmete die staubige Luft ein, die ihm noch mehr das Atmen erschwerte.
An Lewis wurde gezerrt, doch er war wie benommen. »Lewis, kannst du mich hören?!«, sprach jemand wie in ein Metallrohr. Brian tauchte vor seinen Augen auf, der versuchte, ihn bei Bewusstsein zu halten. Aber er hatte keine Kraft mehr. Die Dunkelheit zehrte an ihm wie ein hungriges Tier, das ihn ins Bodenlose mit sich zog.
Lewis lag tagelang auf dem Bauch und war wie in einem Delirium gefangen. Sein Rücken brannte. Wenn die Wirkung von den Medikamenten nachließ, hatte er das Gefühl, dass dort nichts mehr Heiles übriggeblieben wäre. Hätte er nicht ständig seine Mutter vor Augen gehabt, hätte er sich gewünscht, zu sterben. Er wäre wie sein Vater mit Stolz gegangen.
Lewis brauchte noch lange, um sich von diesem Vorfall zu erholen – körperlich so wie seelisch. Der Schmerz ließ nach, die Wunden heilten, nur die Seele nicht. Er vermisste seinen Kameraden James, der ihn mit seinen ironischen Witzen amüsierte und nun nicht mehr da war. Lewis sah immer noch diese Augen des Jungen vor sich, den er rettete.
Dies war sein letzter Einsatz.
Genau dort auf dem Bahnsteig, stand seine Mutter und schluckte bittere Tränen, als sie sich von ihm verabschiedete – zum dritten Mal für weitere zwei Jahre. Er winkte ihr und schickte ihr einen Luftkuss, bevor sie ihre Hände vors Gesicht schlug. Beim ersten Mal war noch Nelly beim Abschied dabei, die ihre Lippen aufeinander presste, als würde sie damit ihre Tränen aufhalten wollen, und seine Mutter umarmte. Seine schlagkräftige, mutige und direkte Tante, die er dafür auch sehr liebte, sah er zum ersten Mal weinen. Lewis stand unbewegt am Fenster und wollte nicht die letzten Momente zerstören. Seine Brust drückte und es brannte in den Augen von den Tränen. Schließlich sollte er vorerst für ein halbes Jahr ins Ausland – das war nicht ein Tag. Seitdem hatte Lewis noch weitere drei Mal einen Antrag auf Auslandseinsatz eingereicht und genehmigt bekommen, konnte aber zwischendurch kurz nach Hause kommen.
Das war alles noch so frisch in seinen Gedanken, als hätten sie sich erst gestern verabschiedet. Nun kehrte er zurück nach Hause.
Als Lewis aus dem Zug ausstieg, brannte die Sonne ihm sofort ganz schön auf den Kopf. Er hatte seine Mutter und Tante absichtlich nicht benachrichtigt, wollte sie überraschen. Er ließ dieses Gequetsche auf dem Bahnsteig über sich ergehen, konnte es nicht ab, hinter jemanden zu gehen, dicht neben jemanden zu stehen und demjenigen in den Scheitel zu atmen oder derjenige zu ihm. Er hasste überfüllte Plätze, weshalb er dann versuchte, seinen Schritt zu beschleunigen, doch immer wieder abbremsen musste, weil jemand vor ihm einen schweren Koffer hinter sich herschleppte. Einer älteren Dame half er sogar beim Tragen ihres Koffers, damit es schneller ging. Diese war so angetan von seiner Geste, lullte ihn mit ihrem Dankeschön ein, worauf Lewis nur sein Lächeln herausholte.
Deshalb wollte er auch weder Bus noch ein Taxi nehmen, als wolle er die Freiheit genießen. Er konnte noch nachempfinden, mit welchen Gefühlen er das letzte Mal hier wegging. Nun war er zurück. Ein anderer Mensch … obwohl die Gefühle genauso waren, ein wenig nervös, aufgeregt und froh. Auch in seinem Viertel hatte sich nichts verändert. Dieselben Blumenbeete vor den Häusern, ein Spielplatz, auf dem eine Schar von Kindern tobte und der kleine Laden in der Nähe. Was soll sich denn auch groß ändern?
Endlich zu Hause.
So leise, wie es nur ging, öffnete er mit seinem Schlüssel die Wohnungstür und wollte ins Wohnzimmer schleichen, doch entdeckte beim Vorbeigehen seine Mutter in der Küche.
Madison stand am Küchentisch. Völlig in den Gedanken versunken, verteilte sie die Apfelscheiben auf dem Teig auf dem Blech.
»Mum, erwartest du etwa Gäste?«, fragte Lewis leise, damit sie sich nicht erschrak. Doch zuckte selbst leicht zusammen, als sie dort, wo sie stand, fast einen Sprung machte und rief: »Söhnchen! Mein Süßer!«
Geradeso schaffte Lewis, den Riemen seiner Tasche von der Schulter zu nehmen und diese auf den Boden fallen zu lassen, als seine Mutter zu ihm stürmte und ihre Arme um seinen Hals legte.
»Lewis, mein Sonnenschein!« Sie küsste seine stoppeligen Wangen ab, strich über sein kurzgeschorenes dunkelbraunes Haar, betüddelte ihn in ihren Armen, sah ihn wie ein Souvenir an, betrachtete ihn liebevoll und weinend und drückte ihn wieder an sich – als wolle sie sicher gehen, dass es kein Traum war, dass er echt war.
Eineinhalb Jahre voller Erwartung erschienen ihr wie ein halbes Leben. Sie sah ihn in dieser Zeit nur einmal pro Jahr für ein paar Wochen oder Monate. Aber das würde einer Mutter niemals reichen, die ihr Kind von ganzem Herzen liebte und jeden Tag, mit dem Gedanken aufwachen musste, wie es ihrem Kind ergeht und ob er noch lebte.
»Mum, du zerquetschst mich noch!«
»Zerquetschen? Ich dich? Sieh dich doch an ... was bist du groß geworden und so stark, diese Muskeln!« Weinend drückte sie an seinen Oberarmen. »Ach, mein Junge!«, schluchzte sie auf und warf sich ihm wieder um den Hals. Sie ist so zierlich geworden, sichtlich gealtert. Vermutlich von den ganzen Sorgen, die sie sich um ihn, in all den Jahren, machte.
Lewis schluckte immerzu, wollte seinen Freudentränen keinen Lauf geben. Echte Männer durften doch nicht weinen! Doch das erfreute Lächeln seiner Mutter erwärmte ihn so sehr, dass es seine Seele berührte. Verräterisch krochen die Tränen, die er innehielt, in seine Augen.
»Ich kann das immer noch nicht glauben!« Sie ließ ihn los. »Wie geht’s dir? Erzähl. In den Nachrichten sieht man nur einen Bruchteil und es wird so vieles Übles berichtet. Das hielt mein Herz nicht mehr aus. Und als uns noch mitgeteilt wurde, dass du ins Krankenhaus gekommen bist, ich habe keinen Schlaf mehr gefunden ... Wie denn auch, wenn ich nicht wusste, was mit meinem Jungen ist. Keiner konnte mir sagen, wie es dir wirklich geht, man vertröstete mich nur. Aber ich bin doch deiner Mutter!«
»Mum, mir geht es wirklich gut, alles super. Hör auf zu weinen. Du siehst doch. Kann man so einen Kerl wie mich kaputtmachen?« Lewis lachte, obwohl seine Brust vor seelischen Schmerzen brannte. Das Leben konnte jeden brechen, es machte keinen Unterschied bei den Menschen, ob reich oder arm, klein oder groß. Seine Mutter tat ihm sehr leid.
Nein, der Vorfall war nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Das hatte ihn innerlich gebrochen. Albträume suchten ihn Nacht für Nacht heim, die Erinnerungen ebenso. Bei jedem Geräusch, der einem Schuss ähnelte, zuckte er zusammen. Deswegen war er nun zu Hause. Niemand brauchte einen Soldaten mit einem posttraumatischen Stresssyndrom, bei dem Panik die Kehle zuschnüren könnte und man nicht mehr funktionierte.
»Setzt dich, setzt dich. Du hast doch bestimmt Hunger. Warum hast du mich nicht vorgewarnt, angerufen? Ich hätte schon etwas zum Essen gemacht. Was soll ich dir kochen? Sag, ich werde es machen. Guck, einen Apfelkuchen gibt es dann auch zum Tee.«
Allein vom Gedanken an das Essen seiner Mutter knurrte sein Magen. Er vermisste die Hausmannskost, hatte damit nicht gerechnet, dass sie ihm so sehr fehlen würde, dass er davon in der Army sogar träumte – jaja, einmal sogar von einem Rindersteak.
»Ich nehme erstmal eine Dusche, an mir klebt alles«, musste Lewis Prioritäten setzen.
»Natürlich, mein Junge.« Madison umarmte ihn noch mal vor Freude seufzend. »Geh nur, geh, ich mach dir schnell etwas Leckeres zum Essen.«
Madison sah ihm nach, endgültig beruhigt und zufrieden und atmete erleichtert aus. So viele Jahre voller Sorge und übler Gedanken waren in null Komma nichts verflogen. Obwohl die Zukunft ihres Sohnes ganz offen war und sie nicht wusste, was ihr Junge nun machen würde, hatte es ihre Freude über seine Rückkehr nicht getrübt. Es würde noch Zeit dafür bleiben, sich darüber Gedanken zu machen. Sie hoffte nur, dass er nicht in die Army zurückging oder sich noch mal verpflichten ließ.
In seinem Zimmer holte Lewis eine Jeans und Shirt aus der Tasche, die er neu kaufte, weil er wusste, dass er in seine alten Klamotten nicht mehr reinpassen würde. In diesen Jahren sind seine Schultern breiter und sein Rücken und Arme viel muskulöser geworden, was auch sein Gewicht erhöhte.
Lewis befreite seinen Körper von der Uniform und stellte sich unter die Dusche. Er konnte es kaum fassen, dass er in seiner gewohnten Umgebung die heißen Wasserstrahlen auf seiner Haut spüren konnte. Das Wasser beseitigte einen großen Teil seiner Aufregung und nur das wohlige Gefühl blieb, dass er endlich angekommen war.
Während Lewis in der Dusche war, informierte Madison ihre Schwester. Nelly kam eine halbe Stunde später und grüßte ihren Neffen genauso stürmisch und mit einem stolzen Lächeln.
»Und wo ist dein Mann?«, fragte Lewis Nelly und schob den leeren Teller von sich, den Madison gleich wegräumte.
»Hach«, tat sie mit der Handbewegung ab. »Wie immer auf seinen Geschäftsreisen.«
»Kommt denn Michael zu Besuch?«, fragte Madison ihren Sohn.
»Ich habe ihn angerufen, er kommt bald.« Auf ihn freute sich Lewis besonders, weil sie sich Jahre nicht gesehen hatten, auch nicht, als Lewis das letzte Mal zu Besuch zu Hause war.
»Na, erzähl deinem Tantchen, was du alles erlebt hast!«
Und schon war Lewis wieder im Zentrum des Gesprächs. Noch nie mochte er so viel Aufmerksamkeit um ihn und war sehr froh, als Michael mit seiner Schwester Anastasia gekommen war.
Anastasia war ein hübsche blonde und junge Frau mit einem gutausgestatten Körper – das krasse Gegenteil zu ihrem Bruder, der dunkelblondes, leicht gewelltes Haar hatte und eine Stupsnase.
Lewis und Anastasia hatten anfangs eine kurze Romanze. Doch dann wurde es viel mehr, eine offene Beziehung, nach Lust und Laune, Freundschaft Plus sozusagen. Mal waren sie verrückt nacheinander, mal waren sie bockig und sahen sich monatelang nicht. Anastasia mochte jedoch Lewis, seit er und Michael Freunde wurden – da waren sie elf. Michael wusste, dass Anastasia eine Schwäche für Lewis hatte, genauso, dass Lewis sie nur deshalb gut behandelte, weil sie seine Schwester war. Dass die beiden aber was miteinander hatten, hielten sie vor Michael geheim. Das machte die Sache umso knisternder und es brachte einem zusätzlich feurig Adrenalin, wenn man Angst hatte, erwischt zu werden.
Nach einer Begrüßung unter Männern setzte sich Anastasia zu den Frauen an den Tisch, um Tee zu trinken, und Michael und Lewis konnten sich auf den Balkon zurückziehen.
»Boahh, du bist ja ein richtiges Muskelpaket geworden!«, rief Michael begeistert, als er seine Muskeln an den Oberarmen drückte.
»Du siehst aber auch nicht mehr so mager aus«, bemerkte Lewis auch seinen sportlichen Körper.
»Tja, als ausgelernter Polizist muss ich auf meinen Körper achten und eine gute Figur abgeben«, erwiderte Michael stolz. »Na, wie ist es? Ich sehe, dir hat es nicht geschadet.«
»Nein, hat es nicht«, meinte Lewis und sprach dann leise seine Gedanken aus. »Nur meinem Kopf etwas, ich habe einen noch größeren Dachschaden, als ich es eh schon hatte.«
Sie lachten, doch wurden dann prompt ernst, weil man damit doch nicht mehr spaßen konnte.
Michael klopfte ihm auf die Schulter. »Stimmt, das kann einen den Verstand rauben. Wird schon.«
Lewis wollte sehr daran glauben, zweifelte jedoch noch an, ob die grauenhaften Bilder, sowie auch die Geräusche von Schüssen und fliegenden Bomben, aus seinem Kopf jemals verschwinden würden. Vielleicht würde man irgendwann mal lernen, damit zu leben, aber niemals würde man sie vergessen. Und dieser Junge? War er noch am Leben? Vermutlich sah er in seinem Leben nichts anderes, als nur Krieg und wie die Menschen sich umbrachten ... Das ging an einem nicht spurlos vorbei. Irgendwann mal wird auch er zum Mörder. Derjenige, der schon mal getötet hatte oder sah, wie einfach es die anderen taten, empfand man keinen Schmerz mehr, man stumpfte ab. Und Lewis? War er auch ein Mörder? Manchmal fühlte er sich so.
»Hast du schon mal einen Menschen umgebracht?«
Mit der Frage hatte Lewis seinen Freund vor den Kopf gestoßen, der ihn anstarrte und dann blinzelte. »Gott sei Dank nicht. Ich hoffe ... das bleibt auch so.«
»Du kannst dir das nicht vorstellen, wie grauenvoll das ist. Zuerst hast du Angst abzudrücken, denkst dir, er hat doch bestimmt Familie, Frau und Kinder … und dann ... Bum!«, brachte Lewis betrübt hervor, während er den Horizont von dem Balkon in der 13. Etage betrachtete, der rot wie das Blut war und die grausamen Erinnerungen ans Tageslicht brachte. »Irgendwann findet man sich damit ab … und diese Menschen bedeuten dir nichts. Es macht dir nichts aus, sie zu töten. Und du … du wirst einfach nur hart, emotions- und furchtlos.« Lewis Seele wurde schwer, so schwer wie ein Stein, in dem er seine zärtliche Seite endgültig vergraben hatte.
Michael nahm seufzend seine Zigarettenpackung aus der Hosentasche. Lewis kam zu sich, versuchte, sich zu berappeln und jetzt an das Gute zu denken. Zwischen den Blumentöpfen fand er seinen Aschenbecher, den er rausstellte, und atmete tief ein. Der ganze Balkon duftete nach Geranien und Petunien, die Madison auf der Fensterbank des Balkons und in den hängenden Kästen und Ampeltöpfen, an denen sich Lewis und Michael so manches Mal die Köpfe einschlugen, voll gepflanzt hatte. Auch wenn der Duft der Geranien für ihn wenig betörend war, sondern eher stank, so war es wenigstens schön anzusehen, was bei Lewis noch mehr Melancholie hervorrief.
»Dein gesundes Leben mit Sport und Co hält dich aber nicht davon ab weiter zu rauchen?!«, amüsierte sich Lewis, als Michael sich eine Zigarette anzündete.
Michael war froh, dass Lewis aus seinem Loch herauskroch und wieder munter war. »Eigentlich habe ich schon aufgehört.«
»Ach wirklich?«, gluckste Lewis und zündete sich auch eine an.
»Ja, nur wegen dir jetzt eine!«, unterstrich er die zwei Worte.
»Das habe ich mir auch gedacht.«
Den Witz würde keiner verstehen, nur die beiden.
»Genau wegen dir habe ich ja auch angefangen. Weißt du noch?«
Lewis schüttelte sich vor lautlosem Lachen bei der Erinnerung, als Michaels Vater sie beim Rauchen erwischt hatte. »Shit, ich werde es wohl nie vergessen, wie er uns dann in die Küche gesetzt hat und uns gezwungen hatte, diese Zigaretten in seinem Beisein aufzurauchen.«
»Mir war danach so übel«, meinte Michael angewidert und schmunzelnd zugleich. »Bis heute kann ich vor ihm nicht rauchen.«
»Ich kann vor meiner Tante oder Mum auch nicht rauchen, aber vor deinem Vater erst recht nicht. Was auch immer er uns beibringen wollte, so klappte es wohl wenigstens halbwegs.«
Sie lachten zusammen und versanken in Erinnerung.
»Welche Pläne hast du jetzt?«, durchbrach Michael die kurze Stille.
»Weiß ich noch nicht so recht. Mal sehen, suche mir vielleicht erstmal einen Job oder gehe nach einer ausgiebigen Pause wieder zurück in die Army.«
»Bewirb dich doch bei uns. Mit so einer Erfahrung würden sie dich sofort, ohne nachzudenken, nehmen. Du musst halt nur einen Lehrgang absolvieren.« Michael war begeistert dabei, ihre frühere Gemeinsamkeit, Polizisten werden zu wollen, noch mal aufzugreifen. »Ich kann mit unserer Leitung sprechen, nachfragen. Was hältst du davon?«
Lewis zögerte. Er mochte nicht, wenn jemand dank Verbindungen über Freundes- oder Bekanntenkreis Vorrang hatte. Außerdem erschien ihm der Polizeijob als zu sachtes Unterfangen. Wie es sich nun herausstellte, war er eher der Typ, der auf viel brenzligere Situationen stand. Ob es nun noch so war, bezweifelte er. Gut möglich, dass auch der Polizeijob brenzlig für ihn wäre. Ohne Adrenalin zu leben konnte er aber auch nicht.
»Komm schon. Versuchen wir es, oder? Ich frage gleich morgen nach.«
Lewis blies den blauen Dunst langsam aus und sah seinen Freund an, dessen Begeisterung auf seinem Gesicht ihn zwang, ihm zuzunicken.
»Na, klönt ihr?« Nelly tauchte auf dem Balkon auf und Lewis zuckte wie ein kleiner Junge zusammen, indem er die Zigarette in seiner Hand versteckte, weil er dachte, es sei Mutter.
»Nelly!«, jammerte Lewis.
»Ich werde nicht petzen, raucht doch.« Lachend wandte sie ihnen den Rücken zu, indem sie ihre Hände auf die Balkongeländer abstützte und das Gesicht der untergehenden Sonne entgegen streckte, bevor sie sich ihre Zigarette anzündete.
Michael und Lewis drückten ihre aber sofort aus. Sie konnten einfach nicht vor der Familie rauchen. Womöglich war die Lehre von Michaels Vaters doch wirksamer, als sie es dachten. Sie schämten sich und wussten selbst nicht, warum es ihnen noch mit ihren siebenundzwanzig Jahren unangenehm war. Schließlich waren sie schon längst erwachsen und wussten, was Gut und Böse war.
Als sie wieder in die Wohnung reingingen, wollte Lewis sich die Hände waschen, weil er eine Geranie berührte und nun ihm so vorkam, als würde dieser stinkende Duft mit ihm ziehen.
Gerade als er mit seinen Händen das warme Wasser berührte, tauchte Anastasia im Bad auf und schloss hinter sich die Tür ab. Sie stellte sich hinter ihn und ihre Hände glitten über seine Brust zum Becken, während sie sich beide im Spiegel voller Begierde ansahen.
»Ich habe dich vermisst«, schnurrte sie.
»Anastasia, nicht jetzt.« Er drehte sich um und griff nach ihren Handgelenken. »Wir sind doch nicht allein.«
»Na und?«
»Nicht hier!«
»Warum nicht?« Sie küsste seine Lippen, presste ihren Körper an seinen.
»Weil ich für nichts mehr garantieren kann! Das ist, als ob man einem Vampir, der hungrig ist, den Menschen serviert, aber ihn bittet, zu warten«, raunte er schmunzelnd und bebend, weil er seine Lust, die sie in ihm sofort aufwirbelte, unterdrückte. Anastasia lächelte jedoch nur und verführte ihn weiter mit ihren Liebkosungen am Hals.
Zu lange war er ohne eine Frau. Und vor Anastasia konnte man sich auch nicht abwenden.
»Hab Anstand, Anastasia«, knurrte er ihr ins Ohr, weil ihre Hand zu seinem Schritt fuhr und dort sanft zu drückte.
Ihr Becken stieß gegen seins. »Ich habe schon längst meinen Anstand verloren.«
Ihr heißer Kuss brachte ihn um Verstand. Seine Sicherungen flogen heraus. Rasch drückte er sie gegen die Wand und riss ihr den Tanga unter dem Kleid runter, worauf sie leise auflachte. Daraufhin folgte sogleich ein Stöhnen, das Anastasia unterdrücken musste, damit die anderen es nicht hörten, als Lewis voller Gier in sie eindrang.
»Ist das irgendein Witz, Mr. Wilson?«, hakte Michael bei seinem Vorgesetzten nach. Der Blick von Wilson sagte aus, dass er keine Scherze machte, er war auch nicht so ein Mensch. Und dennoch hegte Michael einen kleinen Hoffnungsschimmer. »Sagen Sie bitte, dass es ein Scherz war!« Seine Mundwinkel sanken langsam ab, weil sein Gegenübersitzender sehr ernst wirkte.
»Nein, das ist mein voller Ernst. Auch wenn ich das gerne gewünscht hätte, aber dennoch ist es nicht so. Wir haben einfach kein Platz.«
»Wie? Wir suchen doch Leute und das ständig«, widersprach Michael.
Mr. Wilson senkte seinen Blick auf die auf dem Tisch gefalteten Hände, die er kurz massierte und dann Michael wieder ansah. »Ich kann da leider nichts machen.«
Michael sah ihn unverständlich an. »Solche wie Lewis brauchen wir aber doch!«
»Solche wie Lewis sind unberechenbar! In brenzligen Situationen verlieren sie viel zu schnell den Kopf und mit seiner Vergangenheit ...«, hielt sich Wilson noch rechtzeitig an, was aber dem jungen Mann nicht entging.
»Vergangenheit?«, hinterfragte er. Mr. Wilson seufzte schwer und wandte seinen Blick zum Fenster ab. »Was meinen Sie damit?« Michaels Herz pumpte nun aufgeregt. Was wusste er? Verschwieg ihm Lewis etwas, obwohl sie nie voreinander Geheimnisse hatten?
Mr. Wilson sah den jungen Mann wieder an. »Na gut, ich erzähle es dir, vielleicht kannst du es dann verstehen, warum ich den Jungen nicht nehmen kann. Ob du Lewis das erzählst oder nicht, ist dir überlassen. Ich würde es ihm aber nicht sagen ...«
Gegen Abend verabredete sich Michael mit Lewis in einem Club, um ihm die Nachricht zu überbringen.
»Nett hier«, meinte Lewis grinsend und betrachtete die Bedienung im sehr knappen Röckchen, das beim Bücken bis zu den Pobacken hochrutschte. Während der eine von hinten den halbnackten Po sehen konnte, blickte ihr Gast in ihr tiefes Dekolleté.
»Du, ich habe beim Chef nachgehakt, ob wir Leute brauchen ...« Michael erzählte zögernd, kaute Worte und versuchte, ihm das alles vorsichtig beizubringen, um nicht die Wahrheit auszuplaudern. Er wollte keine Geheimnisse vor seinem Freund haben, aber diese ... die würden ihn brechen, sein schönes Bild, das er in seinem Kopf erschaffen hatte, mit einem Schlag zerstören.
»Wir brauchen momentan keine«, brachte er so auf den Punkt.
»Verstehe ich nicht«, murrte Lewis belustigt. »Ich dachte, die würden mich ohne nachzudenken nehmen.« Er war nicht wirklich enttäuscht. Er dachte nur, dass er sehr gute Chancen hatte, diesmal bei der Polizei aufgenommen zu werden.
»Wir haben momentan keine Plätze frei«, murmelte Michael. Schuld nagte an ihm. Das schlechte Gewissen fraß sich nach und nach durch sein Inneres.
Lewis zuckte mit den Schultern und hob seine Flasche. »Auf die Niederlage!«, prostete er schmunzelnd Michael zu.
Michael fühlte sich einfach nur dreckig. Wie lange würde er dieses Geheimnis für sich behalten können? Er drehte bereits jetzt vor Gewissensbissen durch.
Kapitel 2
In den letzten Tagen grübelte Lewis viel. Er musste sich nun wirklich Gedanken darüber machen, was er aus seinem Leben machen würde. Hin und wieder tauchte die Idee mit dem erneuten Versuch in der Army in seinen Gedanken auf. Doch das explodierte genauso wie die letzte Granate in seinem Kopf. Wenn er dort diesen Jungen nicht getroffen und ihn gerettet hätte, wäre er ums Leben gekommen. So gesehen rettete der Junge ihm das Leben. Wie viel Menschenleben hatte Lewis eigentlich bereits auf seinem Gewissen? Es machte ihm nichts aus, dass sie tot waren, weil es Verbrecher waren. Vermutlich war seine Grenze erreicht, vermutlich brauchte er etwas Abstand, um wieder in den Krieg ziehen zu wollen. Aber er war nicht der Mensch, der sich einschüchtern ließ. Im Gegenteil, er brauchte diesen Rausch, diesen Adrenalinkick ... Verdammtes Syndrom. Er wollte nicht daran glauben, dass er daran litt.
Der wievielte Abend war es, dass er im Nachtclub Nightrose mit Bier seine Wunden betäubte, sich nicht betrank, nur entspannte? Mit etwas Alkohol schlief er wenigstens die halbe Nacht fest durch, bis er die Promille abbaute und nach dem Aufwachen die Gedanken ihn wieder nicht losließen. So werden Menschen zu Alkoholiker, dachte er. Aber er hatte das noch im Griff und würde nicht in eine Sucht verfallen, wenn sich seine Lage ändern würde – so dachten wohl auch die meisten Alkoholiker, fiel ihm ein. Bei ihm musste sich was ändern, und zwar sofort. Er konnte die Langeweile nicht mehr ertragen, konnte ohne dieses Herzrasen nicht mehr leben. Es fehlte ihm, als ob ein Teil seines Körpers fehlte.
Der Leiter des Nachtclubs, den er schon als Oskar kannte, sagte ihm, dass er für heute schließen wollte, Lewis aber der letzte Gast sei, wegen dem er noch bliebe.
»Kein Problem«, sagte Lewis. »Kann ich aber noch schnell auf die Toilette gehen?«
»Klar, mach das, mein Junge.« Oskar kam ihm bis jetzt nett und korrekt vor.
Beim Gehen spürte Lewis, dass sein Körper den Alkohol angenommen hatte. Das war ein guter Zeitpunkt aufzuhören; man war nicht dicht und konnte noch alles wahrnehmen und Situationen, sowie seinen Körper und Geist kontrollieren, fühlte sich aber bereits so, dass man sich von dem inneren Druck befreite.
Als Lewis zurück in den Clubsaal trat, war Oskar nicht zu sehen. Doch dann stockte er. Hinter der Eingangstür waren Laute zu hören, die ihm sehr bekannt vorkamen. In all den Jahren konnte er diese Geräusche nicht vergessen. Die Schläge, die auf einen Körper trafen und mit das dabei entstehende Stöhnen des Opfers, dass mit nichts zu verwechseln war.
Lewis lief nach draußen und wurde dadurch Zeuge einer Prügelei, weswegen ihn prompt ein junger Mann angriff. Das Symptom eines verängstigten Hasen hatte ihm Afghanistan endgültig genommen, deshalb war Lewis jederzeit zur Verteidigung, gegen körperlicher sowie seelischer Gewalt bereit, und antwortete dementsprechend auf jegliche Aggression in seine Richtung. Er reagierte sehr schnell und wehrte die Schläge des Angreifers ab.
Der zweite Mann, der Oskar auf dem Boden liegen ließ und dieser schnell zu den Türen rüber kroch, attackierte Lewis ebenfalls. Ein kräftiger Tritt in die Weichteile und der zweite lag auf dem Boden. Aber der erste mit blonden Haaren rappelte sich wieder auf und zog ein Butterflymesser aus seiner Tasche her-aus. Die Klinge reflektierte das Licht von der danebenstehenden Laterne, während der Abstand zwischen den beiden sich verringerte. Lewis wich dem, auf ihn zurasenden Schlag, aus, drehte dem Blonden die Hand um und nahm ihm rasch das Messer ab, das er dann dem Angreifer gegen den Hals legte, als er ihn gegen die Fassade neben der Eingangstür drückte. Lewis erkannte Angst darin, sein Atem strich über seine Hand, in die der Typ vor Furcht seine Finger festkrallte und nicht losließ.
Alles passierte so schnell. Nur Sekunden und nun lag einer stöhnend auf den Boden und der Blonde starrte ihn mit aufgerissenen blauen Augen an und hatte Angst runterzuschlucken, sonst würde das Messer in seinen Kehlkopf schneiden.
»Mach jetzt bloß kein Scheiß, hörst du Lewis?«, warnte Oskar krächzend und hielt sich den aufgeschlagenen Kopf mit der Hand, als ob es ihm helfen könnte, das Blut anzuhalten. »Verschwinde lieber hier.«
»Wer bist du, Blondie? Was willst du von ihm?«, knurrte Lewis stattdessen dem Angreifer ins Gesicht und blickte dabei tief in seine Augen. Gleichzeitig wehte ein unangenehmes Gefühl in ihm – nicht die Angst, aber so als würde ihn gleich die Panik packen und in sein schwarzes Loch ziehen. In seinen Ohren hörte er sein Blut rauschen.
Seit dem Vorfall hatte Lewis häufig Flashbacks. Aber seitdem er wieder zu Hause war, wurde es ruhiger. Vermutlich weil er genau wusste, dass er solchen brisanten und gefährlichen Situationen nicht mehr ausgesetzt sein würde ... bis jetzt.
Oskar saß derweil am Bürgersteig und predigte etwas vor sich hin wie: »Nun haben die uns beide!«, als plötzlich hinter Lewis die grellen Scheinwerfer angingen. Der Blonde kniff die Augen zusammen, weil es ihm direkt ins Gesicht schien.
Lewis umschlang den Hals seines Gegners mit dem Arm und drückte so stark, dass der junge Mann vor Schmerzen krächzte, während er mit ihm ein paar Schritte zur Seite trat, um aus dem blendenden Scheinwerferlicht herauszutreten.
Lewis erkannte, wie aus dem Wagen, der auf der anderen Straßenseite geparkt war, zwei weitere Männer zu ihnen rüberkamen. Als die beiden aus dem Zwielicht rauskamen, konnte Lewis nun besser die Gesichter erkennen. Einen kurzen Blick warf er zu dem ersten Typen, der ihn angegriffen hatte und langsam versuchte, sich vom Boden aufzurichten.
»Lass ihn los!«, befahl einer der dazu kommenden Männer. Es bestand kein Zweifel, dass dieser Typ mit grauer Hose und einem weißen Hemd, der Anführer dieser Bande war. Dieser freie und herrschsüchtige Gang, gab ihm diese Ausstrahlung. Auch dieser durchdringende eisige Blick, der einen einschüchtern solle, passte dazu. Nur Lewis, der schon andere Blicke gewohnt war, ließ er völlig kalt.
Lewis rührte sich immer noch nicht. Wer war dieser Kerl, der es sich erlaubte, ihm Befehle zu erteilen? Der, der hinter ihm lief, blieb bei dem liegenden Typen stehen und hockte sich vor ihm.
»Lass los, lass es sein!«, sagte der Mann nun mit einer verblüffend besonnenen Stimme zu Lewis. Nicht nur seine Stimme, sondern auch sein Gesicht und seine grauen Haare, wiesen darauf hin, dass er viel älter war als die anderen. »Die Jungs können dir sonst auch eine Kugel in den Schädel jagen.«
»Ich bringe ihn wirklich um!«, knurrte der am Boden kniende Typ und der Schwarzhaarige, der neben ihm hockte, durchbohrte Lewis mit seinem Blick und schob sein Jackett beiseite, um ihm zu zeigen, dass an seiner Brust eine Waffe hing.
»Tja, Mark, das hättest du vorher machen sollen«, gab dieser alte Mann von sich. Definitiv war er der Boss dieser Bande.
»Ich habe meine Waffe im Auto liegen gelassen!«, stöhnte er und hielt sich am Schritt. Erst jetzt erinnerte Lewis sich daran, dass sein Fuß mit einem ordentlichen Tritt seine Glocken traf – der Tritt zog wohl noch nach.
»Hm, beim Treffen mit Oskar hätte ich sie auch im Auto liegen gelassen, der sieht ja immer so harmlos aus.« Der Mann schielte zu Oskar rüber, der seinen Blick sinken ließ, und schaute dann wieder voller Reue zu Lewis. »Nicht wahr, Oskar?« Dieser ließ nur seinen blutigen Kopf hängen.
Lewis sah dem Mann direkt in seine dunklen Augen, wog ab, ob er noch Chance hatte, gegen sie alle zu kämpfen und mit Oskar zu entkommen. Wäre nicht der Alkohol in seinem Blut, hätte er es vielleicht schaffen können. Er spürte, dass er nicht so schnell handelte wie sonst. Aber der ganze Körper kribbelte vor Adrenalin, eine Welle jagte die nächste, weshalb er immer fester den Blonden in seinem Würgegriff drückte und somit auch das Messer an seinen Hals, sodass seine Hand langsam taub wurde. Der Gedanke, dass es womöglich der letzte Tag in seinem Leben sein könnte, packte ihn, als der Schwarzhaarige plötzlich seine Waffe zog und diese auf Lewis richtete. Das konnte doch nicht wahr sein. Er war in viel schlimmeren Situationen, Kugeln und Raketen flogen über seinem Kopf, Bomben explodierte in seiner Nähe ... und nun sollte es hier vorbei sein? Klang wie ein schlechter Witz.
»Lass los, Junge«, forderte der Mann ihn erneut auf. »Die Jungs haben wirklich kein Problem damit, abzudrücken … Lass los und du bleibst am Leben.«
Lewis Hand löste sich langsam vom Hals des Blonden. Als dieser die Lockerung verspürte, sprang er von ihm zur Seite und japste laut. Nicht sofort verstand Lewis, warum ihm auf einmal die Luft mit einem Schlag, der ihn am Bauch traf, entwich. Er sackte zusammen.
»Andrew!«, brachte der Mann hervor, entweder spielerisch enttäuscht oder mitfühlend, das konnte man nicht definieren. »Etwas sachte, wir brauchen ihn vermutlich noch.«
»Was?«, empörte sich dieser.
»Na gut, noch einen für dein kränkendes Ego.«
Der nächste Faustschlag traf Lewis hart am Gesicht, weswegen es ihn nach hinten schleuderte. Wie er gelernt hatte, rollte er beim Hinfallen den Kopf zur Brust und knallte rücklings hart auf den Betonboden. Etwas knackste an seinem Becken, aber es war sein Handy in der hinteren Jeanstasche, das jetzt wohl platt war.
Der Blonde zog ihn hoch und stellte ihn so auf, dass der ältere Mann ihm ebenfalls in die Augen blicken konnte. Lewis spürte, wie das warme Blut aus seiner Nase in seinen Mund sickerte.
Der ältere Herr musterte nun genauer sein Gesicht. Etwas stach in seiner Brust und legte sich schwer über sein Herz. Um nicht sofort allen zu zeigen, dass er ins Straucheln kam und es ihn fassungslos machte, versuchte er seine Maske aufrecht zu erhalten.
»Wie ist dein Name?«, wollte er wissen.
»King!«, bracht Lewis verbissen hervor, aber mit Betonung, als würde er hier der Herr sein und nicht diese Möchtegern-Mafiosis. Obwohl ihm von den Schlägen mulmig war, zeigte er dennoch kein Zeichen von Schwäche.
Der Mann verengte die Augen, als wolle er sich an ihn erinnern. Langsam begriff er, wer Lewis war, auch dass er sich in seiner Vermutung nicht täuschte. Nicht nur sein Name verriet es, sondern auch seine Art, wie er sich gab, seine Körperhaltung, sein Gesicht und seine Mimik ... einfach alles kam ihm so verdammt bekannt vor.
»Okay, es reicht«, hörte Lewis diesen Mann bereits wie in einen Trichter sagen, während er versuchte, bei der Besinnung zu bleiben.
Seine seelischen Wunden machten ihm mehr zu schaffen als die körperlichen, und zogen ihn in sein gebrochenes Inneres. Lewis riss sich ernsthaft am Riemen, um nicht zu zeigen, wie es um ihn stand.
»Bringt ihn rein! Ich muss mit ihm reden«, befahl der Herr dieser Sippe.
Der Blonde griff nach Lewis Armen, die er hinter seinen Rücken drehte und zerrte ihn mit. Als sie an Mark vorbeigingen, fasste auch dieser Schwarzhaarige nach Lewis. Vermutlich zur Sicherheit, damit Lewis ihnen bloß nicht entwischte. Zu zweit schleppten sie ihn zurück in den Club und warfen ihn mit einem Schwung auf den Stuhl.
»Wartet!«, bremste Mark seine Kumpels keuchend, als würden seine Lungen in den Eiern sitzen und er noch schwer Luft bekommen. Noch konnte Mark nicht ganz aufrecht laufen. »Lasst ihn für mich, er soll dafür büßen!« Sein kaltes Starren war immer noch auf Lewis gerichtet, was ihn nicht erschüttern ließ. Vielmehr begann sich Lewis Sorgen um Oskar zu machen, der sein Gesicht mit den Händen verdeckte, und immer noch auf dem Bürgersteig saß.
»Leon, Andrew«, rief der Hauptmann den Schwarzhaarigen und den Blonden zu sich. Andrew wischte sich über seine blutige Lippe, bevor er aus dem Club gehen wollte.
Mark bremste Leon ab. »Leih mir deine Waffe mal aus!«, und nahm ihm diese ab, bevor er sich dann gegenüber Lewis auf den Stuhl niederließ.
»Nun bist du dran!« Marks Augen funkelten Lewis finster an und er wedelte mit der Waffe – sah eher lächerlich, als bedrohlich aus. Mark war bereit, wenn der Chef den Startschuss geben würde.
Lewis wandte aber seinen Blick ab und zeigte ihm so, dass er vor ihm keinerlei Angst hatte, stattdessen starrte er die Tür an und rätselte, was nun mit Oskar passieren würde.
»Was machst du bloß für Sachen? Du verstehst doch, was nun kommt, oder?«, fragte der Mann Oskar, was Lewis nicht mehr hören konnte, und hockte sich vor ihm hin. Oskar nickte beklommen und war kreidebleich im Gesicht. »Ich mag es nicht, wenn man mich hintergeht.«
»Das ist alles nur ein Missverständnis, Mr. van Wets!«
»Hm«, machte er und überlegte, was er nun mit ihm anstellen sollte. »Soll ich ihm eine Chance geben, Jungs? Oder wollen wir den Müll entsorgen?«
Leon und Andrew starrten den Chef an. Jeder von diesen Jungs wusste, dass morgen auch sie sein könnten, die da unten hocken, wenn sie die Regeln des Chefs nicht befolgen oder sich einen Fehler erlauben würden.
»Ich überlasse meinen Jungs die Wahl«, beschloss van Wets und schaute Oskar in die Augen. Oskar schluckte und hob seinen eingeschüchterten Blick zu den jungen Männern.
Diese schauten sich um. Die eine Sache wäre, sich zu wehren und dabei jemanden umzubringen, die andere, einen Menschen aus dem Weg räumen zu müssen, mit dem man fast jeden Abend nach der Arbeit ein Bierchen im Club getrunken hatte und über alles reden konnte. Doch genau den Fehler hatten sie alle gemacht: Sie vertrauten sich einem Fremden an, der alles in die falschen Hände weitergeleitet hatte.
»Erledigt es, aber leise und sauber. Wie – ist mir egal.« Van Wets richtete sich wieder auf, wollte gehen, doch wandte sich dann an Andrew, dem er dann leise zuflüsterte: »Aber bitte human!«
Die Typen gingen auf Oskar zu, der zu wimmern begann, während der Chef in den Club reinging und Mark aufforderte, den Stuhl für ihn frei zu räumen. Das Letzte, was Lewis noch im Fenster sehen konnte, war, dass Oskar hochgezerrt und weggeschleppt wurde. Lewis bekam Schuldgefühle, dass er ihn nicht schützen konnte.
»Wie ist dein Vorname?«, fragte der Mann interessiert.
»Wo bringt ihr Oskar hin? Wollt ihr ihn loswerden? Und dann mich?« Lewis Stimme war sehr ruhig, obwohl sein Herz raste. Nein, er war diese Angst ums Leben zu spüren gewohnt. Viel mehr machte ihn fertig, dass seine Mutter endlich aufatmen konnte, dass er sich nicht in einem Kriegsgebiet befand, er aber vielleicht heute nicht mehr nach Hause kommen würde. Und er hatte ihr nicht mal einen Kuss auf die Wange gedrückt, wie er das immer noch, seit seiner Kindheit, tat, wenn er aus dem Haus ging.
»Nein, dahin wo Oskar gebracht wird, kommen nur sehr unartige und böse Menschen.« Die Blicke der Männer trafen sich. »Du kommst mir nicht wie ein böser Junge vor, sondern wie jemand ... der sehr vernünftig ist und mit dem man reden kann.«
»Was wissen Sie schon!«, knurrte Lewis und wandte seinen Blick von ihm ab.
»Entspann dich, dir wird nichts passieren.«
»Ah, na dann ist ja gut ... Habe schon weiche Knie bekommen«, äußerte sich Lewis sarkastisch, weshalb Mark ihn finster anschielte. Lewis verdrehte die Augen, dass der Todesblick dieses Kerls alles andere als furchteinflößend aussah. Wäre Lewis nicht angetrunken, hätte er sie alle hier flachgelegt ...
»Wir lassen dich höchstwahrscheinlich gehen.« Dieser Satz klang so, als hätte er von einem Vater stammen können, der seinen Jungen vor einer Qual erlösen wollte.
Lewis war wie vor den Kopf gestoßen und er blinzelte ihn verständnislos an. Mark schaute unzufrieden zuerst seinen Chef, dann ihn an. Gedanklich rieb er sich bereits die Hände, um bei Lewis Rache zu nehmen, und hätte Lewis am liebsten tot gesehen, und nun ...
»Habe ich mich eben verhört? Wir werden ihn gehenlassen?«, hakte Mark empört bei seinem Chef nach.
»Nein, du hast richtig verstanden. Er hat uns doch nichts getan.« Die Stimme des Mannes klang, als würde er hier alle veräppeln, so dachte jedenfalls Lewis.
Mark sprang vom Stuhl auf und wies auf Lewis mit der Waffe in der Hand, als er erbost rief: »Er hat aber alles gesehen!«
»Ich weiß. Und jetzt setzt dich!«, erhob der Mann leicht die Stimme und dieser fiel schnaubend zurück auf den Stuhl. »Oder mach dich lieber nützlich und bring mir Whisky.«
Mark sah ihn baff an, als wolle er ihn fragen, ob er für ihn nun den Barkeeper spielen musste. Doch mit einem unzufriedenen Gesichtsausdruck stand er auf und bedachte Lewis mit einem kalten Blick, was Lewis völlig am Allerwertesten vorbeiging.
»Also, wie heißt du?« Der Mann lehnte sich im Stuhl zurück und blickte Lewis nun so entspannt an, als wären sie bereits gute Freunde. Das irritierte Lewis sehr, er traute ihm nicht. Womöglich war das die Ruhe vor dem Sturm …
»Lewis. Und wer sind Sie?«, wollte er wissen, als Mark langsam und mit einem scannenden Blick an Lewis vorbeiging und seinem Chef ein Whiskyglas auf den Tisch stellte. Abermals wischte Lewis mit der Hand über seine taube Nase, um das Blut abzuwischen, welches in seinen Mund lief.
»Hat dir etwa Oskar von mir nichts erzählt?!«
»Nein, hat er nicht. So wichtig scheinen Sie auch nicht zu sein, um über Sie zu reden!« Lewis Worte klangen kalt und abweisend. Den Mann brachte es aber zu einem aufgesetzten und lautlosen Lachen, bevor er dann seinen Namen aussprach: »Van Wets.«
Lewis leuchtete der Name nicht sofort ein, hörte ihn aber schon mal … »Was wollen Sie mit Oskar machen?«
Der Mann grinste über diese Unverschämtheit, ihm noch Fragen zu stellen. »Du bist mutig, mein Junge!«
Schnaubend grinste nun Lewis und schüttelte den Kopf, als der Mann es wagte, ihn seinen Jungen zu nennen.
»Aber hier mache ich die Regeln! Du wirst jetzt das machen, was ich dir sage. Du fährst mit uns.«
»Wohin?«, fragte Lewis unerschrocken.
»Noch mal! Ich stelle Fragen und ich sage, wie hier der Hase läuft!«, wiederholte van Wets hart und trank aus seinem Glas. »Du fährst jetzt mit uns!«
»Und das haben Sie jetzt einfach so für mich entschieden?!«, würgte Lewis hervor und gluckste amüsiert.
»Wäre dir eine Kugel in den Kopf lieber?!« Van Wets Augen durchbohrten ihn. Lewis Mut und seine kämpferische Fähigkeiten machten den Eindruck auf ihn und solche Leute bräuchte er. Und nicht nur das war der Grund.
»Ich kann das sehr gerne erledigen!«, mischte sich Mark ein und hielt die Waffe demonstrativ hoch, als wolle er James Bond mimen. Eine Witzfigur.
Aber Widerstand zu leisten, um tatsächlich eine Kugel zu kassieren, war nicht die beste Option. Lewis entschied, doch lieber erstmal mitzugehen – wohin auch immer – und dann eine Lösung zu finden, wie er diesem Mann entkommen konnte. Schließlich befand er sich nicht zum ersten Mal in einer brenzligen Situation.