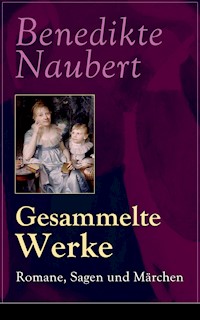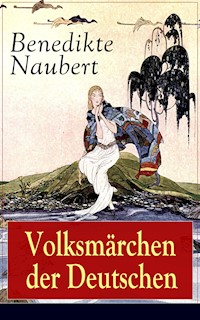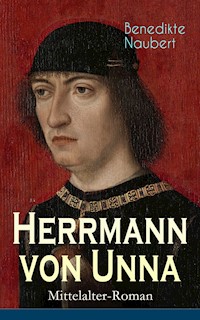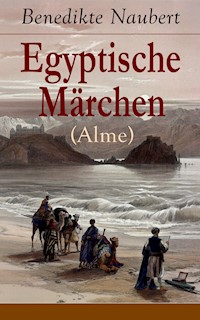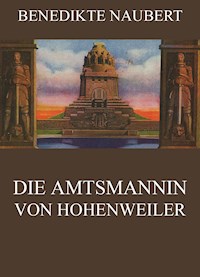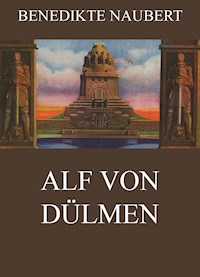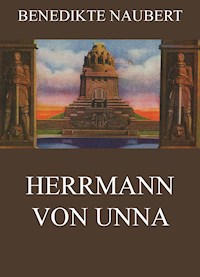
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman aus der Zeit der Vehmgerichte. Benedikte Naubert war eine deutsche Schriftstellerin, die – überwiegend anonym – über 50 historische Romane veröffentlichte. Sie gilt als eine der Begründerinnen des historischen Romans in Deutschland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herrmann von Unna
Benedikte Naubert
Inhalt:
Benedikte Naubert – Biografie und Bibliografie
Herrmann von Unna
Erster Theil
Erstes Kapitel
Zweytes Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Eilftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreyzehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Funfzehntes Kapitel.
Sechszehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Ein und zwanzigstes Kapitel.
Zwey und zwanzigstes Kapitel.
Drey und zwanzigstes Kapitel.
Vier und zwanzigstes Kapitel.
Fünf und zwanzigstes Kapitel.
Sechs und zwanzigstes Kapitel.
Sieben und zwanzigstes Kapitel.
Acht und zwanzigstes Kapitel.
Neun und zwanzigstes Kapitel.
Dreyßigstes Kapitel.
Ein und dreyßigstes Kapitel.
Zwey und dreyßigstes Kapitel.
Drey und dreyßigstes Kapitel.
Vier und dreyßigstes Kapitel.
Zweiter Theil
Erstes Kapitel
Zweytes Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreyzehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Funfzehntes Kapitel.
Sechszehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Ein und zwanzigstes Kapitel.
Zwey und zwanzigstes Kapitel.
Drey und zwanzigstes Kapitel.
Vier und zwanzigstes Kapitel.
Fünf und zwanzigstes Kapitel.
Sechs und zwanzigstes Kapitel.
Sieben und zwanzigstes Kapitel.
Acht und zwanzigstes Kapitel.
Neun und zwanzigstes Kapitel.
Dreyßigstes Kapitel.
Ein und dreyßigstes Kapitel.
Zwey und dreyßigstes Kapitel.
Drey und dreyßigstes Kapitel.
Vier und dreyßigstes Kapitel.
Herrmann von Unna, B. Naubert
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849632571
www.jazzybee-verlag.de
Benedikte Naubert – Biografie und Bibliografie
Christiane Benedicte Eugenie N. wurde am 13. September 1756 zu Leipzig geboren. Ihr Vater war der berühmte Professor der Medizin, Dr. Johann Ernst Hebenstreit, der schon im Dezember 1757 als ein Opfer seiner Berufstreue am Lazarethtyphus starb. Die vaterlose Waise wurde von einer trefflichen Mutter in allen damals üblichen weiblichen Arbeiten, vorzüglich im Sticken unterrichtet, worin sie es zu einer solchen Geschicklichkeit brachte, dass sie ganze Gegenden mit leichter Mühe mit der Nadel aufnahm. Ihre wissenschaftliche Ausbildung leitete besonders ihr Stiefbruder, der Professor der Theologie Hebenstreit, der sie sogar in die alten klassischen Sprachen, in die Philosophie und Geschichte einführte. Die Kenntnis der französischen, italienischen und englischen Sprache verdankte sie ihrem eigenen Studium. Ihre Mußestunden waren der Musik gewidmet: sie spielte Klavier und Harfe, letztere sogar noch in ihrem Alter mit einer gewissen Virtuosität. Dieser gelehrten Bildung ungeachtet, versäumte sie nie die dem weiblichen Berufe eigentümlich angewiesenen Pflichten; sie war häuslich und lebte eingezogen, führte in früherer Zeit die Wirtschaft ihrer Mutter und war die unverdrossene Pflegerin am Krankenbette derselben. Die Schriftstellerin war zweimal verheiratet, zuerst mit Lorenz Holderieder, Kaufmann und Rittergutsbesitzer in Naumburg, mit dem sie sechs glückliche Jahre verlebte, und nachmals mit Johann Georg Naubert, einem angesehenen Kaufmann ebendaselbst, der sich später nach Leipzig wandte. Die Beschäftigung ihres regen Geistes war ihr in den frühesten Zeiten Erholung, in den späteren Jahren Bedürfnis, und als sich eine Schwäche des Gehörs und Gesichts bei ihr einstellte, konnte sie doch ihren Geist nicht zur Untätigkeit verweisen, und so diktierte sie ihre Romane. Im Herbste 1818 siedelte sie nach Leipzig über, um sich hier auf eine Operation an den Augen vorzubereiten. Eine Erkältung, die sich zunächst in einer rheumatischen Hals- und Brustentzündung äußerte, ging schnell in Lungenlähmung über, und schon nach vier Tagen machte der Tod am 12. Januar 1819 ihrem Leben ein Ende. Benedicte N. war eine äußerst fruchtbare Schriftstellerin; ihre Schriften, teils Originalwerke, teils Übersetzungen aus dem Englischen, zählen mehr als 80 Bände. Bis fast an das Ende ihres Lebens war ihr eifriges Bestreben, sich in eine dunkle Anonymität zu hüllen, von einem glücklichen Erfolge gekrönt; erst ihren Roman „Rosalba“ (II, 1817) unterzeichnete sie mit ihrem Namen. Daher kam es auch, dass ihre Romane bald dem Forstrath Cramer in Meiningen, bald dem Buchhändler Heinse in Zeitz, bald Johann C. Friedrich Wilhelm Müller (Filidor) in Leipzig, bald dem Professor Milbiller in Wien zugeschrieben wurden. Zu ihren Romanen verwertete die Verfasserin vorwiegend historische Stoffe. Sie entwickelte darin mannigfaltige historische Kenntnisse und gute Auffassung der Zeitverhältnisse, besonders des Mittelalters. Bei einer reichen und lebendigen Phantasie zeigte sie klaren Verstand in der Komposition ihrer Werke, die sich außerdem durch tiefe Kenntnis des menschlichen Herzens, durch echten Sinn für alles Schöne und Gute und durch die reinste Weiblichkeit auszeichnen. Zu erwähnen wären besonders „Walther von Montbarry“ (II, 1786); „Geschichte der Gräfin Thekla von Thurn“ (II, 1788); „Hermann von Unna“ (II, 1788); „Konradin von Schwaben“ (II, 1788); „Elisabeth, Erbin von Toggenburg“ (1789); „Werner Graf Bernburg“ (II, 1790); „Konrad und Siegfried von Feuchtwangen“ (II, 1792.) u. v. a. Von ihren sonstigen Schriften sind besonders die „Neuen Volksmärchen der Deutschen“ (V, 1789–93) hervorzuheben, die man wohl hie und da für Nachahmungen des Musäus erklärt, die aber völlig freie Erfindungen sind und manchem Schriftsteller (Oehlenschläger, Hoffmann u. a.) Stoff zu seinen Dichtungen geboten haben.
Herrmann von Unna
Erster Theil
Erstes Kapitel
Ein Gespräch am Hochzeittage.
»Am Montage nach Allerheiligen, als Kaiser Wenzel Sophien, Herzog Johannes von Bayern Tochter heimführte,« so fängt die Urschrift an, welche wir uns bey dieser Geschichte zum Leidfaden erwählt haben, und wir werden keine bessere Probe von der Treue, mit welcher wir unserm Original zu folgen gesonnen sind, ablegen können, als wenn wir uns diesen Anfang gefallen lassen, und dich, lieber Leser, ohne weitern Umschweif mitten in das Gewühl lärmender Freude einführen, welches bei Kaiser Wenzels Hochzeitfeste herrschte, obgleich ein solcher Anfang dir von der Folge dieser Blätter vielleicht einen ganz falschen Begriff beybringen könnte. Wirst du wohl in einer Geschichte ernste Scenen erwarten, welche mit der Beschreibung eines Fests beginnt, von dem man weiter nichts zu sagen braucht, als daß es ganz von dem Charakter desjenigen zeigte, der es anstellte, des Hochzeiters, Kaiser Wenzels?
Nach der Gewohnheit der damaligen Zeit waren schon drey Tage in allen möglichen Arten des Wohllebens verstrichen, und der vierte, der eigentliche Tag der ehelichen Vertrauung war angebrochen, an welchem es gemeiniglich etwas sittsamer zuzugehen pflegte als an den vorhergehenden. Daher kam es, daß der erhabene Hochzeiter nicht allein seine schöne Braut aus Priesters Hand mit nüchternem unbenebelten Verstande einfing, sondern auch noch am Abend, da der Tanz bereits in den weiten Sälen des Schlosses zu Prag begann, nur erst so viele Pokale geleert hatte, als bey ihm hinlänglich waren, jenen Grad von Fröhlichkeit und Vergessenheit der Sorgen zu erkünsteln, die dem guten Herrn bey seiner bedenklichen Lage so nöthig war.
Nie hatte ihm, auch selbst in seinen jungen Jahren nicht, seine gränzenlose Liebe zur Bequemlichkeit erlaubt, einen Reiz an dem Vergnügen des Tanzes zu finden; er überließ dasselbe auch diesesmal der adelichen und unadelichen Jugend, die sein wunderlicher Sinn bey diesem Feste durcheinander gemischt hatte, und spielte mit dem Herzog von Ratibor in einer Ecke des Saals, ein Bretspiel, welches wahrscheinlich mit dem tiefsinnigen Schach nicht die entfernteste Aehnlichkeit hatte, ein Zeitvertreib, der, wir müssen es selbst bekennen, seiner Hoheit und seinen Jahren angemessener war, als das üppige Tanzen.
In einer andern Ecke des Saals saß, eben so abgeneigt an der rauschenden Freude Theil zu nehmen als der phlegmatische Kaiser, die Braut, ein holdes Geschöpf in der ersten Blüthe des Lebens, in der Einsamkeit eines Klosters erzogen, das sie gern verließ, um Kaiserin zu werden, und eben so gern wieder bezogen, es auf Lebenszeit zu ihren Aufenthalt gewählt hätte, nachdem sie denjenigen nur ein einigesmal gesehen hatte, der ihr die Krone aufsetzen wollte.
Kaiser Wenzel, ein Fürst, dem in den Jahren der besten männlichen Blüthe, – er war noch nicht vierzig, – Schwelgerey und Indolenz schon die Züge des herannahenden Alters eindrückten, er, auf dessen Wangen, in dessen Augen nicht die liebliche Röthe, das edle Feuer der Jugend, sondern nur jene Röthe, jenes Feuer glühte, welches den Trunkenbold bezeichnet, Kaiser Wenzel, dessen Seele so arm an großen Eigenschaften als seine Person an Reizen war, er, den man ohne die Zeichen seiner Hoheit unter den niedrigsten des Volks verloren haben würde, welch ein Gemahl für Sophien!
Es ist unbekannt, ob das Herz der unglücklichen Braut, je für einen andern dasjenige gefühlt hatte, was man ihr an diesem Tage vor dem Altar gebot für Wenzeln zu fühlen, aber so viel ist gewiß, daß sie in der Versammlung, in welcher sie die Hauptperson vorstellte, fast nicht einen, als etwa Wenzels Busenfreund, den alten Hanussus von Ratibor, erblicken konnte, welcher nicht mit Vortheil gegen den Bräutigam hätte vertauscht werden können, den ihr das Schicksal zugetheilt hatte. Was für eine Betrachtung für eine junge Braut mit einem zarten gefühlvollen Herzen! für sie, die mit diesem Herzen Tugend und Frömmigkeit genug verband, um jeden Gedanken von dieser Art, der etwa in ihr aufstieg, strafbar zu finden, und zu den Leiden, die sie ohnedem quälten, auch noch selbst Vorwürfe zu fügen!
Sophiewar indessen so glücklich in dem Herzoge von Bayern dasjenige zu finden, was wenige Töchter an ihren Vätern haben, einen Freund, einen Vertrauten ihrer geheimsten Gedanken; ihm zu Liebe hatte sie einen Schritt gethan, den sie so gern wieder zurück genommen hätte, wenn sie nicht gewußt hätte, daß es zum Glück dieses geliebten Vaters gehörte, sie Kaiserinn zu sehen. Sie ward Wenzels Verlobte, war nun seine Gemahlinn, und – mußte es bleiben, wenn sie nicht die liebsten Hoffnungen desjenigen zerstören wollte, der ihr alles war, wenn sie sich nicht selbst Schande und Unglück zuziehen wollte.
Herzog Johann, war klug genug, seiner Tochter an diesem traurigen Feste nicht von der Seite zu gehen, und da es ihm unmöglich gewesen war, sie zu einer zerstreuenden Theilnahme an dem Geräusch der Hochzeitfreude zu bewegen, so theilte er ihre Einsamkeit mitten in der zahlreichsten Versammlung mit ihr, hörte ihre Klagen, hörte das Bekenntniß ihrer innersten Gedanken nachsichtsvoll an, und lenkte sie durch weise Rathschläge auf den Weg, welcher nunmehr der einzige war, den sie zu gehen hatte.
Endlich, sagte er, endlich ist es Zeit, dich dieser quälenden Vorstellungen zu begeben. Vergleichungen, die zum Nachtheil deines Gemahls ausschlagen müssen, Wünsche, du möchtest nicht an der glänzenden Stelle sitzen, die dir das Schicksal bestimmt, Sehnsucht nach dem Kloster, Klagen, alles ist nun zu spät; zwar immer werde ich geneigt seyn sie anzuhören, aber immer werde ich dich auch auf die Vortheile zurückweisen, die dir dein Stand verschaft, und für welche du die Augen so ganz verschließest.
Vortheile? mein Vater, rief Sophie. Diese Krone? der Name Kaiserinn?
Freilich Kleinigkeiten für dich, erwiederte der Herzog, aber was sagst du zu dem Glück, das Wohl von ganzen Nationen in deinen Händen zu haben, zu der Möglichkeit, durch deine Tugend, durch diese holdselige unwiderstehliche Sanftmuth, die selbst mich, deinen Vater, bezaubert, einen verderbten Fürsten zu bessern, der für jedes andere Mittel unverbesserlich war?
Eben so wohl könnte ich hoffen Bley in Gold zu verwandeln! rief die weinende Braut.
Und zu dem Bewußtseyn, den Willen deines Vaters erfüllt, ihn mit Aufopferung deiner Neigungen glücklich gemacht haben? fuhr er fort.
Sophiedrückte die Hand des Herzogs an ihre Lippen, und versicherte, daß dieses das einige sey, was sie in dem Elend, das sie auf sich herandringen sähe, wenn sie sich als Wenzels Gemahlin betrachtete, aufrichten könnte.
Nichts von Elend, Sophie, sprach der Herzog, sage mir nichts von Elend, wie kann die unglücklich seyn, welche – doch mein Leser, du wirst schon errathen, wovon die Vorlesung handelte, die der weise Vater seiner Tochter hielt. Die Sage berichtet, dieser erwürdige Greis sey einer der beredtesten Fürsten seiner Zeit gewesen, nichts habe der Macht der Wahrheit widerstehen können, wenn sie aus seinem Munde floß, und auch hier waren seine Worte nicht unkräftig.
SophiensHerz ward durch das, was er ihr sagte, für den gegenwärtigen Augenblick beruhigt, und ihre nachmahlige Aufführung in einem langen traurigen Ehestande mit dem, der ihr jetzt so zuwider war, ihre Treue, ihre Geduld, ihre kluge liebreiche Sorgfalt für ihn in seinen mannichfachen wohlverdienten Unfällen, waren gewiß Folgen von den Lehren, die sie aus dem Munde ihres Vaters anhörte, und die jezt durch eine Begebenheit unterbrochen wurden, die wir im folgenden Kapitel hören werden.
Zweytes Kapitel.
Sophie vergißt ihren Stand.
Es war tief in der Nacht, das Geräusch des Tanzes schwieg, ein Theil der Anwesenden ruhte von dem ermüdenden teutschen Wirbelreihen aus, und nahmen Erfrischungen, indeß den andern von Wein und Ueberdruß die Augen geschlossen wurden, unter welchen letztern auch der hohe Bräutigam war. Ein Streit mit seinem Gegner im Bretspiel, war eben nach Gewohnheit zu seinem Vortheil von ihm selbst entschieden worden, und ein doppelter Trunk aus dem goldnen Becher hatte seinen Sieg bekrönt, und ihn auf seinen Lorbeern eingewiegt.
Sophieund ihr Vater waren zu tief in ihr Gespräch verwickelt, um sich um sein Schlafen oder Erwachen zu bekümmern, und wahrscheinlich war der Auftritt, der sich ihnen in diesem Augenblicke zeigte, das einzige was sie stören konnte.
Die Stille, welche im Saal seit einer halben Stunde herrschte, ward durch ein fernes Getön von sanftern Instrumenten, als die, welche bisher den wilden Tanz belebt hatten, unterbrochen. – Was ist das, rief Sophie, indem sie ihren Vater ansah. – Der Schall kam näher. Himmelstöne! rief sie aus und schlug in die Hände, sanft wie der Chorgesang der Jungfrauen meines lieben, lieben Klosters! – O selige, selige Tage, die ich da verlebte!
Wer kennt nicht die Macht der Musik über ein ohnedem zur Wehmuth gestimmtes Herz. Thränen traten in Sophiens Augen, und der Anblick, der sich ihr in der nächsten Minute darstellte, vollendete ihre Rührung. Die Flügelthüren flogen auf, eine Schaar junger Mädchen trat herein, und nahte sich mit abgemeßnen Schritten dem Orte, wo Sophie saß. Sie sangen zu dem Ton von Harfen und Flöten ein Lied, welches, wenn es wörtlich auf unsere Zeiten behalten worden wär, wohl schwerlich bey strengen Kunstrichtern sein Glück machen würde, denn Melodie und Text war ganz so, wie man es von den damaligen ungebildeten Zeiten erwarten konnte; doch dünkte die erste der erhabenen Zuhörerin, göttlich, und das andere erschütterte ihr Herz bis in das Innerste, und brachte, vermuthlich zum erstenmal an diesem Tage, Empfindungen in ihm hervor, die sie angenehm nennen konnte.
O du, so sangen die Mädchen, indem sie einen weiten Kreis um ihre Fürstinn zogen, o du, die heute den jungfräulichen Kranz mit der Krone vertauschte, glücklich sey – dir der Wechsel! du trittst aus der Reihe der Jungfrauen, um den ehrwürdigen Namen einer Mutter deines Volks anzunehmen, o sey es mit willigem frohen Herzen! lehre unsern Herrn väterliche Gesinnungen gegen uns, und ewig wollen wir dich die Urheberinn unsers Glücks nennen. Sieh hier einen ganzen Frühling von Blumen mitten in den rauhen Tagen des Winters; sie, der liebste Schmuck der Jungfrauen, und unsere Herzen sind das einige Opfer, das wir dir bringen können. –
Der Boden rund um Sophien ward bey diesen Worten mit Blumen übersät, die Mädchen knieten vor ihrer Fürsten nieder, und indeß eine jede von ihnen strebte, einen Theil ihres Gewands zu küssen, trat die Führerinn mit sittsamer Geberde, vor die gerührte Sophie, setzte ein Knie auf die Erde, und überreichte ihr in einer goldnen Schaale einen Blumenkranz.
Die überraschte Kaiserinn vermochte nicht zu sprechen, sie reichte der Knienden liebreich die Hand, und beugte sich, ganz uneingedenk ihres Standes, tiefer herab, sie zu küssen.
Süßes holdseliges Geschöpf! rief sie, liebe, liebe Kinder! wie habt ihr mich entzückt! Ja, ja! ich will eure Mutter seyn, euer und mein Herr soll durch mich euer Vater werden! wie lauteten die Worte eures Lieds? – o wiederholt sie noch einmahl.
Man machte sich gefaßt, den Befehl zu erfüllen, aber Sophie winkte mit der Hand, ohne Gesang, rief sie, eure Melodie ist entzückend, aber ich will jetzt blos die Worte eures Liedes.
Die Führerin gehorchte und wiederholte, was ihre Gespielinnen gesungen hatten, mit einem Nachdruck, mit einem Anstand, der dem, was sie sagte, noch mehrern Reiz gab, als es durch die Begleitung der Musik erhalten konnte.
Sophieweinte, sie hielt fest die Hand der Rednerinn in der ihrigen. Ja, rief sie, indem sie ihren Vater ansah, ja ich gelobe es euch und diesen unschuldigen Seelen, ich will ihre Mutter seyn, will es gern seyn, will nicht –
Ein Wink des Herzogs warnte sie, nicht zu vergessen, das sie in zahlreicher Versammlung, nicht mit ihm allein sey. – Sophie schwieg, und verwandelte das, was auf ihrer Zunge war, in eine Frage nach dem Namen der Sprecherin. Wie heißt du, mein Kind? sagte sie mit liebreichem Ton, – Ida: antwortete die Gefragte mit niedergeschlagenen Augen – Ida? wiederholte Sophie, ich kannte einst eine Fürstin dieses Namens, bist du vielleicht –
Mein Name ist Ida Münsterinn, erwiederte das Mädchen, indem eine glühende Röthe ihre Wangen überzog, und ich bin die Tochter eines Bildners. –
Die Tochter eines – wie? so schön? so edel? so – wie soll ich es nennen, und nur die Tochter eines –
Mein Vater ist ein sehr ehrlicher Mann, ein treuer Unterthan seines Kaisers.
Außerordentliches Mädchen! Einzige in deiner Art!
O nein, rief Ida, indem sie einige Schritte zurück trat, und auf ihre Gespielinnen zeigte. Wie manche ist unter diesen, die mir es gleich thut, wie manche die mich übertrift?
Wir können hier nicht unterlassen, unsern Lesern zu sagen, daß Ida sich in diesem Urtheil gewaltig irrte. Ihre Gefährtinnen waren alle ganz gute, schöne und artige Geschöpfe, aber keine konnte sich nur auf die entfernteste Art mit ihr vergleichen. – Allen sah man ihre Abkunft, allen sah man es an, daß sie nur zur Feyer dieses Tages über ihren Stand geschmückt waren, indessen Ida bey all ihrem Schmuck nur ihr tägliches Kleid zu tragen, und der erhabenen Dame, mit welcher sie sprach, trotz ihrer demüthigen schüchternen Geberde, an Stande gleich zu seyn schien.
Sophienahm Idas verdeckte gutherzige Weisung an. Ihr seyd alle meine Kinder, seyd mir alle lieb, rief sie, indem sie beyde Hände nach den Knienden ausstreckte! Ich muß euch belohnen, muß euch ein Zeichen meiner Gnade sehen lassen. Hier, kleine Blondine, und hier du mit den schalkhaften Augen, hier ein Andenken von mir! erinnert euch dabey eurer Mutter, eurer Kaiserin. – Arme, Brust, und Haarlocken wurden bei diesen Worten geplündert, und der kostbare Raub unter die Mädchen ausgetheilt, welche furchtsam zögerten, die Hand nach dem dargebotenen auszustrecken.
Nehmt doch, nehmt! rief Sophie, welche alle Kostbarkeiten, die sie an sich trug, für ihr ausschliessendes Eigenthum hielt, und noch nicht wußte, daß eine Fürstinn weniger über ihren Schmuck gebieten darf, als die Geringste ihrer Damen. Nehmt gute Kinder, und erinnert euch meiner!
Sophiewar in einem fröhlichen Rausche, aus welchem sie durch die Fürstin von Ratibor geweckt ward, welche ihr etwas in die Ohren flüsterte. – Wenn ich Kaiserinn bin, erwiederte Sophie, so will ich mit dem Meinigen thun was mir beliebt! – Es erfolgte noch eine Einwendung von der Fürstinn, und Sophie rief, indem sie eine goldene Kette von ihrem Halse losmachte, sie wolle sich wenigstens nicht das Eigenthumsrecht dieses ihres geliebtesten Schmucks streitig machen lassen. Hier, Ida, rief sie, es ist ein Geschenk meiner Pathe der Gräfinn von Würtemberg, kein Eigenthum der Krone.
Ida verbeugte sich. Ich trage bereits mehr Schmuck als meinem Stande zukommt, sagte sie, indem sie sich mit einer Art von Beschämung betrachtete. Wird es zu kühn von mir seyn, wenn ich die Gabe meiner Kaiserinn ausschlage, und um ein Gnadengeschenk nach meiner eignen Wahl bitte?
Fordre was du willst, rief Sophie, wer sollte dich vergebens bitten lassen.
O, rief Ida, eine von den glänzenden Locken, die auf diesem Busen spielen, welch ein Geschenk für mich! sie würde mir der schönste Schmuck, das größte Ehrenzeichen seyn! sie würde –
Schwärmerin! rief Sophie! und schnitt eine Locke ihres goldnen Haars mit einer solchen Heftigkeit ab, daß die Spitze der Scheere in ihren Busen fuhr, und ihr Gewand mit Blut färbte.
Ida war kühn genug die erste zu seyn mit ihrem Schleier das Blut zu trocknen. Es erhob sich ein Geschrey, die Kaiserin sey verwundet, ungeachtet Schmerz und Wunde nicht viel mehr sagen wollte als ein Nadelstich. Man drängte sich herbey nach dem mächtigen Schaden zu sehen. Die Kaiserin war erschrockener durch den Lärm, den man um sie machte, als durch den unbedeutenden Unfall! die Fürstin von Ratibor entließ die zitternde Ida nebst ihren Gespielen mit oberhofmeisterlicher Strenge, und – man gieng auseinander.
Drittes Kapitel.
Ein Gespräch im Brautgemach.
Schon die erste Erscheinung der Mädchen hatte die ganze Versammlung herbey gezogen, und selbst den schlafenden Kaiser erweckt. Sophie hatte bey allen ihren Handlungen tausend Zeugen, tausend strenge Beurtheiler gehabt. Der letzte Zufall vermehrte das tadelnde Geflüster. Der Kaiser sah finster, Herzog Johann bestürzt aus, und man sagt, daß die Neuvermählte noch vorm Schlafengehen eine sehr ernsthafte Verhaltung von der Fürstin von Ratibor habe aufhören müssen. Diese Dame war schon darüber aufgebracht, daß sie keine Zuhörerin von dem Gespräch hatte seyn dürfen, welches Sophie mit ihrem Vater hielt. Ein Wink der jungen Kaiserin hatte sie entfernt, und die alte Dame hatte vergebens vorgewandt, daß sie gemessenen Befehl habe, ihr nie von der Seite zu gehen. Der Verdruß über diese Sache gieng in die Vorlesung über, welche sie ihrer Gebieterin über die Sitten ihres neuen Standes hielt, und ihre Rührung bey der Erscheinung der jungen Mädchens, ihre ausschweifende Freude über eine so geringe Sache, ihre Herablassung gegen diese gemeinen Geschöpfe, ihre Gespräche mit Ida, ihre Geschenke, und vor allen, die letzte Begebenheit mit der Haarlocke, wurden auf so beissende Art vorgestellt, daß Sophie beschämt da saß und gutherzig genug war, einzugestehen, sie sey zu weit gegangen, sie wisse noch nicht recht was einer Kaiserin zieme, habe noch zu viel von der Einfalt des Klosters an sich, und – müsse sich bessern.
Sophie ward in das kaiserliche Schlafzimmer geführt, um – die Lektion, die sie von ihrer Oberhofmeisterin bekommen hatte, von ihrem neuen Gemahl zum zweytenmal zu hören. Seine Majestät hielten sich besonders bey den Geschenken auf, welche die unwissende Kaiserinn so freygebig von dem zur Krone gehörigen Schmuck hätte austheilen wollen, und die durch Vorsicht der Fürstin von Ratibor alle wieder zur Stelle waren. – Ich glaube, sagte Wenzel, indem er die Juwelen in ihrem schimmernden Gehäuse musterte, ihr wäret im Stande gewesen, den Trauungsring auch hinzugeben. O nein, sagte Sophie, den muß ich behalten, um mich immer an meine Pflicht zu erinnern. Wenzel war zu stumpfsinnig um den Stachel in diesen Worten zu fühlen, aber die Neuvermählte erschrack über das was sie gesagt hatte; sie fürchtete die Frage: ob sie eine solche Erinnerung an ihre Pflicht nöthig habe, und eilte, um sie zu verhüten, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Sie war von jenen gutherzigen Seelen, welche auf jede kleine Wunde, die sie wider Willen gemacht haben, sogleich lindernden Balsam legen, und jeden Stich ihres Witzes mit einer verbindlichen Rede heilen. Bin nicht auch ich beschenkt worden? sagte sie, indem sie zu Idas Blumenkranz hinhüpfte, den sie in seiner Schale auf einer Tafel stehen sah. Doch nein, fuhr sie fort, das liebe Geschenk ist nicht mein, ich lege es meinem Kaiser zu Füßen.
Wenzelhätte noch weniger Mensch seyn müssen als er war, wenn ihn die holde Geberde, mit welcher ihm die blühende Sophie ihren Kranz überreichte, nicht gerührt hätte. Er drückte sie an seine Brust, nannte sie ein gutes Weib, welches eine seiner größten Schmeicheleyen war, und ließ sie aus seinen Armen, um die Gabe, welche für ihn keinen Reiz hatte, an ihren ersten Ort zu legen.
Was ist das? rief er voll Bestürzung, als er die goldne Schale gewahr ward, in welcher Ida ihren Kranz überreicht hatte, und die Sophie kaum bemerkt hatte. – Man hat mir mein Blumengeschenk auf diese Art überreicht, erwiederte sie. Und dieses seidene Tuch? fuhr er fort. Sophie meynte, es sey yermuthlich darum da, damit die Feuchtigkeit der Blumen dem Glanz ihres Behältnisses keinen Schaden thun möchte.
Wenzelschüttelte den Kopf, indem er das Tuch hinweg nahm, und meynte, diese Art von Geschenken sey ihm schon bekannt. Seht ihr, fuhr er fort, indem ihm nach hinweggenommener Hülle der Glanz von einer guten Anzahl goldner Schilde1 lieblich entgegen blinkte, seht ihr? das wußte ich wohl, daß man es nicht wagen würde, einer Kaiserin ein so elendes Geschenk, wie einen Blumenkranz, anzubiethen, laßt uns zählen.
Wenzelzählte, und Sophie trat indessen an ein Fenster, um sich die Thränen zu trocknen. Sie fühlte – sie wußte nicht was. Ihr Herz war so gepreßt als wollte es zerspringen, sie öffnete das Fenster um Luft zu schöpfen, o Gott, seufzte sie, gieb mir Kraft die lange schwere Rolle zu spielen, die ich auf mir habe. Solche Gesinnungen, und ein Kaiser? ein Kaiser? mein Gemahl! ein solcher Mann?
Es sind richtig dreihundert! rief Wenzel. Wie hieß das Mädchen, das sie euch brachte?
Ida Münsterin, erwiederte Sophie mit einer Stimme, welche beynahe ihre Thränen verrathen hätte.
Ida Münsterin, wiederholte er, so so. Aber kommt, meine Liebe, wie steht ihr so in der kalten Nachtluft? doch – ihr habt geweint? was ist euch?
O es ist entsetzlich, rief Sophie mit zusammengeschlagenen Händen, entsetzlich, sich von seinen Unterthanen beschenken zu lassen, und nicht einmal so viel Macht zu haben, sie belohnen zu dürfen, die Kleinigkeiten, welche ich den gutherzigen Geschöpfen gab, wurden ihnen entrissen, und ich soll behalten was sie mir gaben.
Ihr irrt, erwiederte Wenzel, das was ihr geben wolltet, war ohne Vergleichung mehr, als ihr erhieltet.
Und mich dünkt, rief Sophie, so müssen Fürsten belohnen.
Und, fuhr er fort, über dieses sind diese Leute dazu da, ihrem Kaiser einen Antheil von dem Ueberfluß zu zollen, den sie unter seinem Schutz erwerben
O, sprach Sophie, laßt euch von euren Fürsten, von euren Edlen beschenken. Aber diese armen Leute, diese Künstler und Handwerker die –
Noch einmal, sprach der Kaiser, ihr irrt! Eben diese Leute sind es, die uns zollen können und sollen. Der Adel ist arm in Vergleichung mit ihnen; Fleiß und Arbeitsamkeit leiten Schätze in ihren Schooß, welche jene durch Krieg und Räubereyen nimmer erbeuten.
Wenzel hatte recht, die Beschaffenheit der Stände war zu den damaligen Zeiten so wie er sagte, aber Sophie konnte sich in diese Dinge nicht finden, und fuhr fort zu weinen, vielleicht aus Verdruß über ein Geschenk, das sie nicht vergelten durfte, vielleicht auch am meisten über den ganzen Umfang ihrer unglücklichen Lage.
Der Kaiser rufte seine Kammerdiener ihn vollends zu entkleiden und Sophiens Damen traten herein, sie zu Bette zu bringen.
Viertes Kapitel.
Fürstenglück und Fürstengnade.
Sophie war nicht glücklich genug, um über ihren neuen Stand, gleich andern Neuvermählten, jeden andern Gedanken zu vergessen. Der Auftritt mit dem Blumenmädchen, der Einzige auf ihrem ganzen Hochzeitfeste, der ihr Freude machte, hatte ihr des Abends zuletzt im Sinn geschwebt, und er war wieder einer der ersten Gedanken, als sie am Morgen erwachte Sie sandte nach Ida und ließ sie vor sich fordern. Ida war krank. Die Kaiserin schickte noch einmal, um, wenn sie ja nicht bey Hofe erscheinen könnte, von ihr die Namen ihrer gestrigen Gespielinnen zu erfahren, welche nicht krank waren, und auf Sophiens ersten Wink sich da einfunden, wo man ihre Gegenwart verlangte.
Wenzels großmüthige Gemahlin konnte den Gedanken nicht ertragen, von Geringern, von irgend jemand unerwiederte Geschenke anzunehmen; sie begleitete den liebreichen Dank, damit sie ihnen ihre gestrige Erscheinung belohnte, mit Gaben, die man nicht zurückfordern durfte, weil sie nicht von den Schätzen genommen wurden, welche zur Krone gehörten, sondern von den Kostbarkeiten, welche Sophie noch als Prinzessin besaß. Die Fürstin von Ratibor nannte Dank und Geschenke überflüssig, und fand die Unterredung in welche sich ihre Gebieterinn mit diesen einfältigen Kindern einließ, standswidrig. Die Benennung einfältig, mit welcher sie die guten Geschöpfe beehrte, war nicht ganz übel angebracht. Keine einige Ida war unter dem ganzen Haufen, sie wußten nichts als ihr Lied zu singen, und Sophiens Fragen mit äußerster Blödigkeit zu beantworten. Die Kaiserin erkundigte sich nach Ida, von welcher sie nicht begreiffen konnte, wie sie unter einem Haufen von zwanzig solchen Mädchen, bey ähnlichem Stande, ähnlicher Erziehung das werden konnte, was sie war. Aus den Antworten der Gefragten blickte theils heimlicher Neid, theils Verachtung von Verdiensten hervor, die sie nicht erreichen konnten, und die Fragerin wußte am Ende doch so viel, daß Idas Eltern sehr reich und ganz in diese einige Tochter verliebt waren, daß sie zu schön, zu verdienstvoll war, um von ihren Gespielen geliebt zu werden, und daß Liebe zur Einsamkeit, Bewußtseyn ihrer Vorzüge, oder Stolz, wie man es nannte, sie nur selten in den Zirkel kommen ließen, in welchem sie gestern eine so hervorstechende Rolle gespielt hatte.
Der allerhöchste Beyfall der Kaiserin, mit welchem das Bürgermädchen beehrt wurde, wär schon hinlänglich gewesen, den Beyfall des ganzen Hofs nach sich zu ziehen, aber auch ohne Rücksicht auf denselben wurde Idas Name überall genannt. Die jungen Herren des Hofs vermochten die Reize, mit welchen sie erschien, nicht zu vergessen, sie erkundigten sich nach jedem kleinen Umstande, der sie betraf, umschlichen des Haus ihres Vaters, fragten nach den Orten, wo man sie sehen könne, bewunderten, sie nie zuvor gesehen zu haben, und beklagten ihren gemeinen Stand. Einer von ihnen, der junge Hermann von Unna, ein westphälischer Edelmann, nannte sie nicht, fragte nicht nach ihr, beklagte und bewunderte nichts mit lauten Worten, das sie angieng, sondern begnügte sich, heimlich an sie zu denken, und hatte, ehe die andern die tausendfältigen Streitigkeiten über sie zu Ende bringen konnten, in aller Stille die Kirche ausfindig gemacht, in welcher sie täglich Messe zu hören pflegte.
Herrmannwar erst achtzehn Jahr, war frühzeitig an Wenzels Hof gekommen, eine Schule, welche eben nicht die beste war. Seine Grundsätze über Liebe, Tugend und Schicklichkeit konnten wahrscheinlich nicht die strengsten seyn, und er machte sich also wenig Bedenken über eine angehende Leidenschaft für ein Mädchen, an welches er bey ihrem niedrigen Stande nie mit Ehren denken konnte. – Er war der Liebling des Kaisers, hatte ihm seit seinem Knabenalter als Page aufgewartet, war Vertrauter und Unterhändler in mancher Begebenheit gewesen, wo Wenzel bewies, daß er bey der Liebe nicht auf Stand sah, und ohne Rücksicht auf denselben glücklich zu seyn wußte. Wo hätte Herrmann bey solchen Beyspielen Gesinnungen hernehmen sollen, welche seiner Herkunft und Idas Tugend geziemt hätten? doch müssen wir ihm zum Ruhme nachsagen, daß er sich keines sträflichen Gedankens bewußt war, er hieng seiner Liebe nach, ohne weiter zu bedenken was daraus werden sollte.
Es war unmöglich, so sehr der Jüngling auch darnach strebte, Zutritt in dem Hause des alten Münsters zu erhalten. Immer waren seine Thüren vor denjenigen verschlossen, welche nicht in Geschäften zu ihm kamen, und erdichtete Geschäfte zu enträthseln war er schlau genug. Hermann mußte also zufrieden seyn, das Mädchen, das er bewunderte, bey ihrer täglichen Andacht zu beobachten, die viel zu tief, viel zu herzlich war, als daß sie ihr nur einen Blick auf ihren Bemerker hätte verstatten sollen. Ueberdieses verhüllte sie, so oft sie in die Kirche gieng, immer ein dichter Schleyer, oder ein Regentuch, welches nicht angelegt wurde, um mehr anzulocken als abzuschrecken, sondern das ganz so rauh und ungekünstelt war, wie es zu der schlechten bürgerlichen Kleidung paßte, die Ida in den Wochentagen trug.
Nur des Sonntags, wenn der Vater mit der Wehr an der Seite und dem sammtnen Pelz mit goldnen Schnüren zur Kirche gieng, ließ auch Ida sich an der Seite der hochgehaupten Mutter mit offenem Gesicht sehen, und verbreitete, wie Herrmannen dünkte, neues Licht in dem Tempel. Aber dieses Licht glänzte nicht für ihn, und ach was hätte er für einen einigen der zärtlichen andächtigen Blicke gegeben, welche sie an dem Bild einer Ursula oder Maria verschwendete!
Idas Name, den man in der ersten Woche nach Allerheiligen bey Hofe so fleißig nannte, war indessen daselbst so gänzlich vergessen, daß man sich gegen Weihnachten kaum mehr auf denselben besinnen konnte; selbst Sophie dachte nicht mehr an sie; das Feuer der Zuneigung gegen sie war anfangs zu heftig, als daß es lange hätte dauern sollen, Ida versäumte es zu nähren, sie ließ sich nach den ersten genossenen Gnadenbezeugungen nicht wieder sehen, um neue einzufordern, und wahrscheinlich würden dieselben auch ohne diesen Fehler nach und nach sparsamer gekommen seyn. Sophie war ein Weib, war – eine Fürstin. Die ersten zärtlichen Gefühle für Ida waren im Grunde nichts mehr, als das, was eine jede junge unerfahrne Person gegen diejenigen empfindet, welche sie aus einem Gewühl von unangenehmem Empfindungen herausreissen, und sie Freude oder etwas der Freude ähnliches erfahren lassen.
Ueberdieses hatte Sophie täglich neue Gelegenheiten zu Gedanken, die sie so ganz beschäftigten, daß ihr kein Platz für etwas anderes überblieb. Mit jedem Tage entdeckte sie neue Züge der Unliebenswürdigkeit an ihrem Gemahl, machte sie neue Erfahrungen von der Trostlosigkeit ihres Zustandes, lernte sie neue Personen kennen, welche ihr ihre Lage erschwerten. Wenig Wochen nach der Vermählung erschien eine Dame bey Hofe, welche ihr unter dem Namen der Frau vom Bade vorgestellt wurde; Sophie fand an ihr eine so gemeine unbedeutende Person, daß sie nie wieder an sie gedacht haben würde, wenn sie sie nicht am nämlichen Tage bey der Abendtafel an der Seite ihres Gemahls wieder gesehen, und aus dem vertraulichen Tone, welcher unter beiden herrschte, gemerkt hätte, daß hier eine alte Bekanntschaft statt finden müsse.
Sophie war in den Landen ihres Vaters, in einem Kloster, in gänzlicher Unbekanntschaft mit der Geschichte ihrer Zeiten erzogen worden. Wenzels Begebenheiten mit der schönen Bademagd, welche in den jetzigen, so wie in den damaligen Zeiten jedes Kind zu erzählen wußte, war ihr Abentheuer aus einer andern Welt. Wahrscheinlich bestrebte sich niemand sie, als sie Kaiserin ward, mit den Ausschweifungen ihres Gemahls zu unterhalten, und hätte man es auch gethan, so wär sie vielleicht gutherzig genug gewesen, wenigstens die Liebschaft mit Susannen, unter die ganz vergangne Dinge zu rechnen.
Man durfte ja die sogenannte Frau vom Bade nur sehen, um sich hiervon zu überzeugen. Dieser plumpe unbeholfne Körper, dieses aufgeschwollne Gesicht, in welchem nichts gefallen konnte als ein paar Reihen weisser Zähne, diese frechen üppigen Augen, diese feuerrothen Wangen, sollten einen Kaiser, den Gemahl einer Sophie fesseln können? unmöglich!
Wenzelnahm sich selbst die Mühe über der Tafel seine und Susannens Geschichte mit Auslassung verschiedener Umstände zu erzählen, und Sophie sah nunmehr in der vorzüglichen Achtung, mit welcher der Dame begegnet ward, nichts als eine etwas übertriebene oder ungeschickt geäußerte Dankbarkeit, die sie mit ihrer gewöhnlichen Gutherzigkeit übersahe; sie ließ sich sogar so weit herab, der sich über Wenzels Lob aufblähenden Susanne, einige Verbindlichkeiten zu sagen, und nur erst nach einiger Zeit, als Wenzels Vorliebe und dieses Weibes Frechheit zu sehr in die Augen fiel, um verkannt zu werden, nur erst denn konnte sie sich überzeugen, daß zu allen ihren vielfachen Leiden auch noch dieses käme, eine unwürdige Nebenbuhlerin zu haben.
Die Einsamkeit war oft Zeuge ihrer Thränen, und die Fürstin von Ratibor, die ihre Gebieterin einst auf diese Art fand, nutzte diese Gelegenheit, sich in das Vertrauen Sophiens einzuschleichen, welches sie bisher auf keine Weise hatte erlangen können.
Sophie sehnte sich, ihre Klagen in irgend einen freundschaftlichen Busen auszuschütten. Der einige Theilhaber ihrer innersten Gedanken, ihr Vater, hatte auf diese sehr deutlichen Winke seines kaiserlichen Schwiegersohns Prag schon in den ersten Tagen nach der Vermählung verlassen, und seine unglückliche Tochter war also mit ihrem Kummer ganz sich selbst überlassen. Sophie umarmte die fragende Oberhofmeisterin zum erstenmal in ihrem Leben und obgleich diese Dame geflissen schien die Sache, wovon die Rede war, mehr zu erläutern und auseinander zu setzen, als die Traurende zu trösten, so fand diese doch schon darin einen Trost, daß sie von dem, was sie bekümmerte, sprechen und ihrem Unwillen, ihrer Verachtung gegen ihre Beleidiger freyen Lauf lassen konnte.
Von diesem Augenblick fieng die Fürstin von Ratibor an ihre Gebieterin unumschränkt zu beherrschen, erhöhte und erniedrigte alles, was sie wollte, schrieb Sophien vor, was sie lieben und hassen sollte, und daß also an Ida bey Hofe nicht mehr gedacht ward, nicht mehr an sie gedacht werden durfte, wenn es der Kaiserin auch beliebt hätte sich ihrer zu erinnern, das leidet keinen Zweifel.
Fünftes Kapitel.
Seltsame Art, einen Liebhaber Zutritt im Hause der Geliebten zu verschaffen.
Aber Herrmann dachte unaufhörlich an das geliebte Mädchen. Die Schwierigkeiten, die er fand, sie zu sprechen, oder nur von ihr bemerkt zu werden, gaben seinen Wünschen neues Feuer, und erhöhten seine Meynung von ihr. Ihr geringer Stand, der ihm anfangs so gleichgültig gewesen war, fieng an ihn zu beunruhigen, er wünschte sie zu sich erheben, oder sich zu ihr erniedrigen zu können, tausend romantische Einfälle dieses möglich zu machen schwärmten in seinem Kopfe, denn obgleich damals noch kein Roman existirte, als etwa der Theuerdank, so fehlte es doch auch zu jenen Zeiten in keinem Jünglingsgehirn an selbst erfundenen und erträumten Abentheuern, die den, der sich mit denselben abgab, so gut amüsirten, als das, was wir aus unserer heutigen Modelektür lernen.
Idazu sich zu erheben, sich ehrlich um sie zu bewerben, und sie zu seiner rechtmäßigen Gemahlin zu machen, war eine Unmöglichkeit. Zwar die Einwilligung des Kaisers zu einer Mißheirath zu erlangen, wär eben keine große Sache gewesen, denn Wenzel dachte in diesen, wie in allen Dingen sehr bequem, aber Herrmann hatte Anverwandte, welche nicht so nachsichtsvoll waren, er war arm, der Stand eines Kammerjunkers, den er seit einem halben Jahre rühmlichst bekleidete, war mit keinen großen Einkünften versehen. Idas Eltern waren zwar reich – aber, – genug Herrmann fieng an das andere Mittel sich glücklich zu machen, für bequemer zu halten. Er wollte sich zu ihr erniedrigen, wollte nicht mehr seyn, als sie war, und Stand, Verwandte, und alle künftige Hofnungen, ihr zu Liebe, aufopfern.
Es ist ungewiß, was für Schritte er zu Ausführung dieses Entschlusses that; vielleicht suchte er sich in dem Hause des alten Münsters als Lehrling einzuschleichen, aber dieser schlaue Alte mußte sich dieses Gesicht, das sich ihm bereits unter so mancherley Vorwänden gezeigt hatte, gemerkt haben, oder er hatte andere Ursach zu Verdacht geschöpft, genug Herrmann mußte abgewiesen worden seyn, denn die Geschichte stellt uns ihn bald nach der Zeit, da diese Versuche gemacht worden seyn mochten, in eben dem trostlosen Zustande als im Anfang seiner Liebe vor.
Herrmannwar Wenzels Liebling und Vertrauter; bleich und abgehärmt gieng er vor den Augen seines Herrn herum, und jeder seiner Blicke schien zu flehen, man möchte doch nach der Ursach seiner Leiden fragen, und ihm helfen. Aber Wenzel fragte nicht, er war keiner von jenen Fürsten, welche die Wünsche ihrer Favoriten, auf Unkosten tausend anderer befriedigen, er wußte nicht einmal, daß Herrmann welche hatte, er gehörte zu jenen spiegelglatten Seelen, die von allem, was sie umgiebt, nur einen vorübergehenden Eindruck annehmen. Man konnte vor seinen Augen leiden, ohne daß er es fühlte, sterben, ohne daß er es gewahr ward, und wieder lebendig werden, ohne daß er sich darüber wunderte.
Diese Fühllosigkeit gegen das Herzensweh eines achtzehnjährigen Kammerjunkers, hatte nun freylich wenig zu sagen, aber er war im Großen eben derjenige, der er im Kleinen war, und – doch zur Fortsetzung meiner Geschichte.
Herrmanngehörte zu den Glücklichen, welchen der Zufall oft ehe sie es sich versehen die Erfüllung ihres Wunsches in die Hände wirft, welche sich auf keine Art erkünsteln ließ. Der Kaiser sahe und verstand nichts von des Jünglings erbärmlichen Blicken, mit welchen er absichtlich vor ihm herumgieng, aber ohne sie zu sehen, ohne sie zu verstehen, that er einen Schritt zu Herrmanns geglaubten Besten, der sich nicht besser hätte wünschen können.
Herrmann, sagte er eines Tages zu ihm, was soll ich von dir denken? bist du blind, oder willst du den Unmuth deines Herrn nicht sehen? du hattest doch sonst immer eine Frage bereit, was mir fehle!
Herrmann verbeugte sich, ohne zu antworten; was hätte er sagen sollen? wie konnte man auf einem Gesicht, wie Wenzels, Spuren des Unmuths oder irgend eines andern Gefühls erkennen? oder heimlichen Verdruß aus dem Betragen desjenigen schliessen, dessen Sitten nie sanft oder einnehmend waren? die Forderung des Kaisers war höchst unbillig, und ließ sich nur mit Stillschweigen erwiedern.
Ja, Herrmann, fuhr Wenzel fort, du siehst mich in der größten Verlegenheit, und du hast mir schon aus so vielen seltsamen Händen geholfen, das ich glaube du wirst auch jetzt etwas ausführen können, das mir wohl thut.
Herrmann verbeugte sich wieder, doch mit einem Anstand von frohem Selbstgefühl, denn die Worte des Kaisers brachten ihm gewisse Begebenheiten in den Sinn, bey welchen er in der That eine Rolle gespielt hatte, die ihm Hofnung auf künftige, bisher vergebens erwartete, Belohnung einflößen konnte.
Du siehst, fieng der Kaiser von neuem an, du siehst mich in dem schrecklichen Geldmangel, der sich denken läßt. Die Aussteuer meines Weibes ist hin, ist auf die Unkosten bey der Hochzeit gegangen; du weißt, ich habe mich nicht schimpfen lassen. Lumpichte vierzigtausend Gulden! sie sind verzehrt, und ich habe mit ihnen eine verdrüßliche Sittenrichterin in den Kauf bekommen, welche mir bleibt, nachdem das, was mir ihre Person wünschenswerth machte, nicht mehr vorhanden ist.
Herrmann kreuzte sich. Zwar war er schon lang ein Zeuge von den sinnlosen Verschwendungen seines Herrn und seiner Blindheit gegen die Betrügereyen derer, die ihn umgeben, gewesen; aber vierzigtausend Gulden, die ganze Aussteuer einer Prinzessin, die man reich nannte, eine Summe, mit welcher der König von Engelland seine Tochter vor kurzem zu großer Zufriedenheit seines Schwiegersohns ausgestattet hatte, das gieng über Herrmanns Begriffe, und hätte Wenzel nicht bald darauf die sogenannte Frau vom Bade, als eine Ursach ungewöhnlicher Ausgaben, genannt, so hätte er sich gar nicht in diese Dinge finden können.
Herrmann kannte Susannen, er hatte von ihrer Wuth bey Wenzels Vermählung mit Sophien gehört, er wußte, daß sie frech genug gewesen war, ihrem Geliebten zu drohen, durch Bekanntmachung von mancherley Sophien und ihrem Vater verborgenen Dingen, die ganze Sache rückgängig zu machen, und es kam ihm also nicht außerordentlich vor, daß der Kaiser ihre Verschwiegenheit durch ansehnliche Summen hatte erkaufen müssen, welche er sehr sinnreich mit auf die Hochzeitunkosten rechnete.
Was ist zu thun! fuhr Wenzel fort, ich bin darum nicht arm, weil ich kein Geld in meinen Kasten habe; es ist in den Kasten meiner Unterthanen, und man muß darauf sinnen, wie es in die meinige zu leiten ist. Da ist der alte Münster, der der Kaiserin an Allerheiligen das artige Geschenk machte, er ist ein reicher Mann, man sagt mir, er wär im Stande seine Tochter wohl so gut auszustatten, als der Herzog von Baiern die seinige, und du siehst also wohl, daß er mir helfen kann und muß. Geh' zu ihm! Er soll mir tausend goldne Schilde borgen! ein Fürst hat allezeit Mittel sich seiner Schulden zu entledigen; du kannst ihm zum Anfang die Erlaubniß ankündigen, die einige andre reiche Handwerker so lang vergeblich gesucht haben, des Sontags, gleich den Edeln, eine goldne Kette um den Hals zu tragen. –
Herrmann stand wie versteinert: die Freude eine Gelegenheit zu haben in Idas Haus zu gehen, ihren Vater in Geschäften des Kaisers zu sprechen, ihm eine Ehre anzukündigen, die ihn so sehr vor allen andern seines Standes auszeichnen mußte, verschlang jeden andern Gedanken, und es fiel ihm erst, als er schon an Münsters Hausthür stand, ein, ob er ihm auch wohl mit seinem Gewerbe angenehm seyn würde? ob das kaiserliche Zutrauen, dessen oftmalige Erneuerung in ähnlichen Fällen Herrmann voraus sah, nicht den Wohlstand des Hauses, das ihm so lieb war, zerstören, und Ida mit der Zeit nebst ihren Vater in Armuth und Elend stürzen könne.
Sechstes Kapitel.
Bürgerstolz und Bürgerreichthum.
Während der Jüngling einige flüchtige Betrachtungen von dieser Art anstellte, hatte er schon zweymal an Münsters Hausthüre geklopft; ein alter Diener öffnete sie. Herrmanns Gesicht gehörte unter diejenigen, welchen Idas Vater den Zutritt in seinem Hause nicht zu gestatten pflegte. Jung, schön, in allen Glanz des Hofs gekleidet, was für einen Anblick für denjenigen, der in Abwesenheit seines Herrn, der Ehrenhüter des Hauses war! auch dünkte es dem Knechte des alten Münsters, diese zierliche Figur mehr gesehen und abgewiesen zu haben, welches bey den mannichfachen vergeblichen Versuchen, welche Herrmann seit einiger Zeit gemacht hatte, Zutritt in Idas Wohnung zu bekommen, wohl möglich seyn konnte.
Ungestüm ward die Thür zugeschlagen, und ehe noch der Klopfende andeuten konnte, wen er zu sehen verlangte, tönte ihm die rauhe Stimme entgegen: der Herr sey ausgegangen.
Und die Frau? fragte der junge Höfling mit lieblichem Accent. Die Antwort würde vielleicht die nämliche gewesen seyn, wenn nicht ein glückliches Ungefähr Idas Mutter eben über den Flur getragen, und ihr die Nachfrage nach ihr, zu Ohren gebracht hätte.
Herrmann hörte innerhalb der Thür einen kleinen Wortwechsel zwischen der Frau und dem Knechte, er klopfte noch einmal, und ihm ward aufgethan. Idas Mutter hatte den unerbittlichen Thorwächter vertrieben, sie selbst öffnete die Pforte, und der Anblick des Hofjunkers nöthigte ihr eine tiefe Verbeugung ab. Wer seyd ihr, Herr Ritter? stammelte sie mit einem kleinen Erröthen.
Mein Name thut wenig zur Sache, erwiederte Herrmann mit einigem Unwillen, aber mein Gewerbe muß mir überall Zutritt verschaffen; ich komme auf Befehl des Kaisers.
Des Kaisers? wiederholte sie, doch im Guten? – Doch Gott sey Dank, ich und die Meinigen sind uns keines Vergehns bewußt, und was sich mit Geld abkaufen läßt – Geht herein, Herr Ritter, ich muß nach meinen Mägden sehen, und gleich bin ich wieder bey euch.
Herrmann ward in ein Unterzimmer gelassen, wo das erste, was ihm in die Augen fiel, eine holdselige weibliche Figur war, die er augenblicklich für Ida gehalten haben würde, wenn sie ihm nicht unendlich schöner geschienen hätte, als er sie je sah, und doch gehörten wenig Minuten dazu ihn zu überzeugen, daß sie es wirklich sey. Herrmann hatte das junge Mädchen bisher nicht anders, als in der dichten Kirchenhülle, oder in dem steifen Staate gesehen, welcher damals Mode war. Die hohen Kragen, die dickgefalteten Kleider, und der gothische Kopfputz ließen der lieblichen Dirne noch allemal Reiz genug übrig, vor allen ihren eben so geschmückten Zeitverwandtinnen hervorzustechen, aber ganz ein anderes war es doch immer, sie im häuslichen Gewande ohne weitern Schmuck, als einen kleinen Schleier auf ihren schönen Locken zu erblicken.
Herrmann stand wie versteinert, und Ida an ihrem Spinnrocken blickte kaum auf, den Eintretenden zu betrachten. Es war in den damaligen Zeiten die Sitte der Jungfrauen, ihren neugierigen Blicken zu wehren.
Der Hofjunker war beym Eintritt von der Mutter gebeten worden, sich zu setzen, und sich die Zeit nicht lang werden zu lassen, aber so wohl er das letzte, bey Idas Anblick, der ihm alle Langeweile benahm, beobachtete, so wenig dachte er an das erste; er blieb auf der Stelle stehen, wo er war, und seine Augen verschlangen die schöne Spinnerinn, welche wohl ein bis zweymal den Mund aufthat, als wollte sie den Jüngling an die Bitte ihrer Mutter erinnern, aber ihn schnell wieder schloß, als zweifelte sie, ob es ihr in Abwesenheit ihrer Eltern ziemte, mit einem Fremden, mit solch einem Fremden zu sprechen.
Liebe Jungfrauen des achtzehenden Jahrhunderts, es war gar eine seltsame Sache um den jungfräulichen Wohlstand zu Kaiser Wenzels Zeiten, und wenn ihr etwa glauben sollet, als sey Schüchternheit auch damals nur die Sitte geringer Mädchen gewesen, so erinnert euch nur, daß Ida wie ein Fräulein erzogen war, und sich sehr wohl nach dem, was man sie gelehrt hatte, zu halten wußte. Auch hoffe ich, ihr werdet ihr Betragen nicht Einfalt oder Blödigkeit nennen, wenn ihr zurücksinnt, mit wie viel Freymüthigkeit und Anstand sie am Montag nach Allerheiligen erschien, und mit jedem ihrer Worte, jedem ihrer Blicke nicht allein das Herz Sophiens, sondern tausend andere Herzen fesselte. Höret weiter:
Herrmanns Aufführung wird nicht weniger seltsam in euren Augen erscheinen. – Die Spinnerin verlor die Spindel, und der junge Herr, an statt dieselbe aufzuheben um der Atmosphäre des Mädchens näher zu kommen, oder Gelegenheit zum Anfang eines Gesprächs zu finden, blieb stehen, und ließ es ruhig zu, daß sie selbst sich beugte, um ihr Handwerkszeug von neuem zu fassen.
Ida, welche diesen Fall nicht aus Koketterie veranlaßt hatte, glühte vor Beschämung über ihr Versehen, und fieng an das Rädchen hurtiger zu drehen, um den etwanigen Vorwurf der Unschicklichkeit in dem Herzen des Fremden hinweg zu tilgen.
Es ist schwer zu errathen, ob irgend ein Zufall den Liebenden und die Geliebte näher zusammen gebracht haben würde, da sie diesen so unachtsam vorbeygehen ließen, aber alle Möglichkeit dazu ward in diesem Augenblick durch die Ankunft der Mutter vereitelt.
Und was bringt einen Gesandten des Kaisers in mein schlechtes Haus? fragte die Matrone, indem sie Herrmannen nochmals zum Sitzen nöthigte, und sittig vor ihm stehen blieb. – Der Kammerjunker stockte, erröthete, welches jetzt bei Kammerjunkern etwas seltnes ist, und fand, daß es nicht ohne Schwierigkeit sey, einen Auftrag, wie der, mit welchem Kaiser Wenzel ihn beehrt hatte, auszurichten. Auch sagt die Geschichte nicht, wie er sich endlich dessen entledigte, sondern sie führt uns nur auf die Würkung, die er auf das Gemüth der Münsterin that. Sie lächelte, und winkte mit einem bedeutenden Blick auf Ida; Kind, sagte sie, das bedeutete mir mein Traum, ich fand in Abwesenheit des Vaters Rosen in unserm Garten, Rosen bedeuten Ehre!
Mit diesen Worten war die gutherzige Frau nach einen großen Seulenschranke gegangen, den sie mit Geräusch öffnete, und mit einem Kästchen von schwarzem Ebenholze zurückkehrte. Gut, sagte sie, indem sie sich an Herrmanns Seite setzte und das kleine Behältniß auf dem Tische ausleerte, gut daß mein Mann nicht zu Hause ist, und mir die Ehre hinwegnimmt, einem so großen Herrn zu dienen. Hier, Herr Ritter, nehmt so viel ihr wollt, nehmt alles, nehmt es ungezählt, nur diese Kette und diesen Ring nehme ich hinweg, sie gehören meiner Tochter, und, fuhr sie fort, und grüßt unsern Herrn den Kaiser schönstens von mir, und wir liebten ihn alle, seit er uns eine so gute Kaiserin gegeben hätte. Durch sie, hofften wir, sollte manches besser werden.
Herrmann erstaunte über die Bereitwilligkeit, mit welcher dieser Frau, wie er meynte, ihren ganzen Schatz dem Vergnügen aufopferte, einem Herrn, wie Wenzel, gedient zu haben. Er sah sie an, sprach etwas von sicherer Wiedererstattung, an welcher er doch selbst nicht glaubte, und trat endlich mit dem Auftrag hervor, den ihm der Kaiser vor den alten Münster zur Belohnung (vielleicht zur einigen Erstattung) für das Darlehn gegeben hatte. Wer soll nun, fragte Herrmann, das Recht haben, mit einer goldnen Kette zu prangen, derjenige, dem der Kaiser es zudachte, oder die gutherzige Frau, welche so bereitwillig ist ihm zu dienen?
Mein Mann ist so hochmüthig nicht, sprach die Münsterinn lächelnd, und ich? freylich mir sollte so ein Vorzug vor meines gleichen ganz wohl thun, aber wenn mich der Kaiser belohnen will, so will ich ihn schon einmal um etwas anders bitten, das er mir nicht abschlagen muß, wenn er dankbar seyn will.
Herrmann versicherte, er getraute sich alles für sie beym Kaiser zu erlangen was sie wünschte, und er glaubte ihr die Freyheit zusichern zu können, jeden Schmuck öffentlich tragen zu dürfen, den sie wünschte, ohne daß ihr darum für die Zukunft eine freye Bitte abgeschlagen werden sollte. – Der junge Mensch, der einen Theil der Liebe für die Tochter auf die Mutter übertrug, sprach mit einem Feuer, das der klugen Münsterinn ein neues Lächeln abnöthigte. Es freut mich, sagte sie, daß ihr so viel bey eurem Herrn geltet, auch danke ich für die Erlaubniß die Kostbarkeiten zu tragen, die ich habe; allenfalls kann ich mich auch im Hause damit schmücken, wenn mir das Freude macht. Aber wie ist das, hat euch der Kaiser, bey dem ihr so viel zu sagen habt, nie erlaubt mit goldnen Ketten zu prangen? Mich dünkt ich habe euch oft in der Kirche und anderwo gesehen, aber nie mit so etwas um euren Hals; und ihr seyd doch ein Edler!
Herrmann erröthete, denn er wußte die Ursach dieses Mangels, der seinen Grund in seinem wenigen Vermögen, und Wenzels schlechter Freygebigkeit hatte, sehr wohl.
Wie wär es, fuhr die Münsterin fort, wenn ich einmal thät als ob ich Kaiser wär, und euch eine Kette zu tragen erlaubte? Ida, willigst du ein? – die Mutter hielt bey diesen Worten die Kette in die Höhe, von welcher sie vor einem Augenblick sagte, daß sie ihrer Tochter gehöre. Ida verbeugte sich. Nun so steh auf, fuhr die Mutter fort, und lege dem Ritter selbst das Geschenk an, das ich ihm von dem Deinigen gebe.
Ida erröthete, zögerte, und erhub sich endlich auf wiederholtem Befehl ihrer Mutter, gieng zitternd auf Herrmann zu, nahm die Kette aus den Händen der Matrone, warf sie um den Hals des Jünglings, und eilte nach ihren Rocken zurück, ohne auf den zu achten, der halb ausser sich ihr nachsah, und die Arme nach ihr ausstreckte.
Eine große Pause erhub sich nach dieser Begebenheit. Ida saß mit niedergeschlagenem Auge und glühendem Gesicht an ihrem Rocken ohne zu spinnen, Herrmann heftete seine Augen mit einem Blick auf sie, welcher sich nicht beschreiben läßt, und die Münsterin saß an ihrem Stuhl zurück gelehnt und sah dem allen mit einem scharfen beobachtenden Blick zu, der schwer zu erklären war.
Eben hatte sie die lange Stille durch die Frage an den jungen Menschen unterbrochen, ob er nicht Ritter Herrmann von Unna sey, und dieser war eben im Begriff zu bejahen, und wiederum zu fragen, woher man ihn kenne? als die Münsterinn den Fußtritt ihres Mannes im steinernen Vorhaus vernahm, und ihren Beysitzer bat, Idas Geschenk in sein Wamms zu knüpfen. Er gehorchte ohne nach der Ursach zu fragen, und Münster trat ein. Ein alternder Mann von stattlichem Ansehen, als sein Stand mit sich brachte, ein stolzer Blick in seinem Auge zeigte den reichen Bürger an, der sich den Edeln gleich hielt, und eine gewisse Gutmüthigkeit in seinen Zügen, machte, daß man ihm diesen Blick nicht übelnehmen konnte. Die Anwesenheit des Kammerjunkers schien ihn zu befremden, er sah seine Frau mit einer Miene voll Unwillen an, befahl Ida das Zimmer zu verlassen, und fragte Herrmann nach seinen Begehren.
Der Name des Kaisers machte ihn etwas milder, und das Gewerbe, das derselbe seinem Vertrauten an ihn aufgetragen hatte, nöthigte ihm ein Lächeln ab. Es ist gut, sagte er, nachdem man ihm alles, ausser den Umstand mit Idas Geschenk, entdeckt hatte, es ist gut, daß mein Weib meine Stelle vertreten hat, das nächstemal, daß der Kaiser meiner nöthig hat, und ich vermuthe, dies wird bald geschehen, wird die Reihe an mir seyn: wir sind verbunden, unserm Herrn mit Gut und Blut zu dienen. In einer von Sr. Majestät treuen Reichsstädten fand ich Schutz und Brodt, als ich arm und vertrieben war, in seinen Landen erwarb ich einen Theil dessen, was ich habe, und ihm gebührt ohne Zweifel ein Theil des meinigen; also, Herr Ritter, so oft ihr wollt im Namen eures Herrn, in dem Eurigen aber – nie.
Herrmann wollte nach dieser Erklärung das Gespräch von neuem anspinnen, aber die Antworten fielen kurz aus, er sprach von Wiederkommen, und fügte einige übel angebrachte Schmeicheleyen für den alten Münster hinzu, aber man übergieng es mit Stillschweigen, und – er entfernte sich. Was sollte er hier? die, welche ihn so mächtig anzog, die geliebte Ida, war ja nicht mehr gegenwärtig, und ihre vorher so freundliche Mutter, hatte seit der Erscheinung ihres Mannes sich so ganz verändert, daß er sie nicht mehr kannte.
Der Kammerjunker gieng langsam nach Hause, und rekapitulirte, was ihm begegnet war. Idas Anblick, die Freundlichkeit ihrer Mutter, das Geschenk, das sie ihm auf so gute Art von der Hand des geliebten Mädchens zu verschaffen wußte, und eine Menge anderer Dinge, welche vorgefallen waren entzückten ihn, liessen ihm Hofnungen fassen, die er sich selbst nicht zu erklären wußte, und machten, daß er die Hauptsache, den glücklich ausgerichteten Auftrag seines Herrn ganz aus der Acht ließ.
Erst als er die Schätze der gutherzigen Münsterinn, deren Gewicht er in der Freude seines Herzens nicht gemerkt hatte, in seinen Taschen fühlte, alsdenn erst erinnerte er sich was er zu thun habe, und eilte zu seinem Herrn ihm Nachricht zu geben.
Wenzel war niemals zufrieden, und fand also auch hier Ursach zum Verdruß. Die Gaben der großmüthigen Bürgerinn reichten nicht ganz an die Summe, die er verlangt hatte, und dennoch ließ ihre Bereitwilligkeit zu geben es ihm bereuen, daß er nicht mehr gefordert hatte. Münsters Reichthum war in seinen Augen unerschöpflich, und er sann darauf ihm nächstens wieder zuzusprechen.
Sein Vertrauter hörte wenig von dem, was er ihm hierüber sagte, er sehnte sich nach Hause, um seine Abentheuer nochmals zu überlegen, und seine Augen an Idas goldner Kette zu weiden, ein Kleinod von ziemlichem Werth, an welchem er nichts auszusetzen hatte, als daß das Schaustück, das daran hieng, nicht mit Idas schönem Gesicht geziert war, ihm nichts als einen alten bärtigen Grafen von Würtemberg vorstellte, der ihn wenig interessirte. – –
Herrmann mußte über die Gedanken an die Schönheit der Tochter und die Güte der Mutter ganz die Strenge des Vaters vergessen haben, denn des andern Tages mit dem frühesten Morgen trugen ihn seine Füße vor Münsters Pforte, und er war sehr befremdet, abgewiesen zu werden. Man sagte ihm, weder Herr noch Frau seyen gegenwärtig, man vermuthe überdieses heute keine Befehle von Sr. Majestät, und andere Angelegenheiten könne und werde der Herr Ritter in diesem Hause nicht haben.
Unglück bringt uns oft dem Glücke näher.
Graf Viktor von Mayland lebte in heimlicher Fehde mit einem Fürsten aus dem Hause Visconti. Der Grund ihrer Streitigkeiten und die Ursach, warum beide sich nur heimlich zu schaden suchten, sind Dinge, welche hieher nicht gehören. Ehrgeiz und Rache trieben den Grafen an Wenzels Hof, er bot ihm hundert tausend Gulden, eine für die damaligen Zeiten ungeheure Summe, wenn ihm der Kaiser den herzoglichen Titel gewähren wollte. Der Kaiser war taub gegen die Vorstellung seiner Fürsten, Graf Viktors Bitte abzuschlagen, er hörte nur seinen Eigennutz, er gab, ganz wider die Reichsverfassung, dem Grafen was er öffentlich verlangte, und versagte ihm, wie die Sage berichtet, auch das nicht, warum er heimlich bat, das Recht in seinen Landen ein Freygericht zu stiften, das ist, wider jeden den er haßte, und einen Schein des Verbrechens ausbringen konnte, tausend heimliche Henker zu bewafnen, die ihn richten konnten, wo sie ihn fanden, ohne daß jemand sein Blut rächen durfte.
Dieser letzte Theil von Graf Viktors Gesuch liegt zu sehr in Dunkelheit gehüllt, als daß sich etwas zuverläßiges davon sagen ließ, aber so viel ist gewiß, daß er alles erhielt, was er verlangte, und des Kaisers Willfährigkeit noch großmüthiger bezahlte, als er versprochen hatte.
Jetzt waren, nach Wenzels Meynung, unerschöpfliche Schätze in seinen Händen. Ganz Prag erschallte von dem Getümmel der Freude, tausend schwelgerische Feste wurden gefeyert, zu denen Herzog Viktors Erhöhung die Veranlassung seyn mußte. Die Unterthanen, so sehr sie auch die Ausschweifungen ihres Kaisers tadelten, bildeten sich doch im Stillen ihm nach. Wenzels Verschwendung gab auch andern Mittel zum Wohlleben in die Hände, und der Rausch, von welchem bei Hofe alles taumelte, verbreitete sich in die entferntesten Quartiere der Stadt.
In einer von denen in dieser Epoche durchschwelgten Nächten, war es, da im östlichen Theil der Stadt jene schreckliche Feuersbrunst ausbrach, von welcher noch einige der ältesten Chroniken gedenken. Mitternacht war bereits vorbey, der Kaiser und sein Zechgeselle, der Fürst von Ratibor, schenkten eben den Pokal ein, der den letzten Ueberrest ihres Bewußtseyns ersäufen sollte, indessen um und neben ihnen bereits alle diejenigen ohne Verstand lagen, die den Wettstreit der Schwelgerey mit ihnen begonnen hatten. Lallend und mit wildem Gelächter erzählten sie einander, wie einer ihrer Gefährten nach dem andern, von Wein übermocht, dahingesunken war, stritten, zuweilen fast bis zur Thätlichkeit, über die Ordnung, in welcher dies geschehen war, und über den Augenblick, in welchem sie das Schicksal der andern treffen würde.