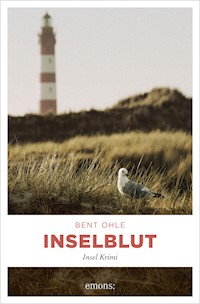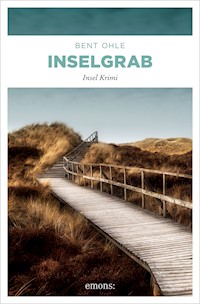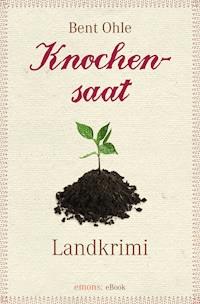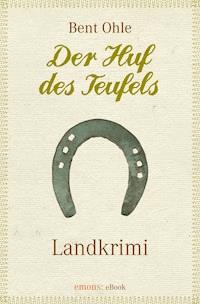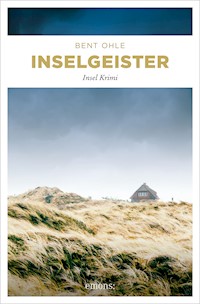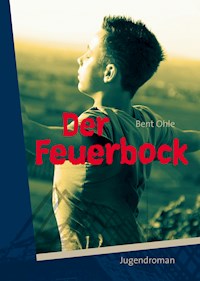Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Herz-Jesu-Feuer: In den dunklen Tiefen der Südtiroler Geschichte liegt ein mörderisches Geheimnis verborgen Südtirol: Ein Mann wird in der Herz-Jesu-Nacht erschossen unter einem Gipfelkreuz gefunden, offenbar wurde er vor seinem Tod gefoltert. Der Vater des Getöteten misstraut der Polizei und beauftragt Kriminalschriftsteller Fernando Lovecchio mit den Ermittlungen. Fernando taucht ein in die dunklen Tiefen der Südtiroler Geschichte - und stößt dort nicht nur auf weitere Morde nach ähnlichem Muster, sondern auch auf seine eigene Vergangenheit. Denn er ist nicht der Unbeteiligte, für den er sich gehalten hat, und der Mörder ist noch nicht am Ende . . . Ein packender Südtirol-Krimi von Bestsellerautor Bent Ohle, der gekonnt historische Ereignisse wie die Feuernacht von 1961 mit einer fesselnden, wendungsreichen Story verwebt. Herz-Jesu-Feuer nimmt den Leser mit auf eine atemlose Jagd durch die alpine Landschaft und in die Verstrickungen von Schuld und Sühne, Rache und Gerechtigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bent Ohle, 1973 in Wolfenbüttel geboren, wuchs in Braunschweig auf und studierte zunächst in Osnabrück, bis er an die Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg wechselte, wo er als Film- und Fernsehdramaturg seinen Abschluss machte. Heute lebt er mit seiner Familie wieder in Braunschweig.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv:iStockphoto.com/FuatKose Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-857-1 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Tayfun
Ein Vater muss lernen,
das Handeln seiner Söhne zu akzeptieren,
und zwar nicht gemessen an seinen Wünschen,
sondern an deren Möglichkeiten.
Niccolò Machiavelli
Man verdirbt einen Jüngling am sichersten,
wenn man ihn anleitet,
den Gleichdenkenden höher zu achten
als den Andersdenkenden.
Friedrich Nietzsche
Teil I
Im Namen des Vaters
1
Feiner Steinsand rieselte in einem schmalen Vorhang von der rissigen Decke herab, als draußen ein schwerer Laster über die Brücke an der Via Marconi in Richtung Drususallee fuhr. Fernando lenkte seinen Blick nach oben. Unter dem blassgelb gestrichenen Putz konnte er bereits den nackten Stein erkennen. Mit der Hand wischte er den Staub vom Tisch und hinterließ dabei einen trockenen weißen Film auf der dunklen Tischplatte. Er hatte das Gefühl, dass man ihn heute länger warten ließ als sonst. Seit einer Viertelstunde saß er nun schon hier in dem fast quadratischen Raum im zweiten Stock. Mit den Kniekehlen schob er im Aufstehen den Stuhl zurück und ging hinüber zum vergitterten Fenster. Die Bäume auf der Via Dante beschatteten die Straße, sodass sich das Sonnenlicht nur in unregelmäßigen Flecken auf den gegenüberliegenden Häusern zeigte. Ein leichter Schimmelgeruch stieg Fernando in die Nase, was vermutlich von den dunklen Sprenkeln in den Ecken der Zimmerdecke herrührte. Obwohl es Juni und sommerlich warm war, fröstelte er.
Endlich vernahm er Schritte. Die Tür wurde aufgesperrt, und der Carabiniere, der ihn eingelassen hatte, trat ein. »Signor Lovecchio, der Insasse Branzo kann aufgrund einer Fußverletzung nicht kommen. Aber der Capitano erlaubt es Ihnen, ihn in seiner Zelle zu besuchen.«
Der junge Mann, Fernando hatte ihn schon ein paarmal bei seinen bisherigen Besuchen gesehen, blickte ihm leidenschaftslos aus dunklen Augen unter kräftigen schwarzen Brauen entgegen.
»Gern«, sagte Fernando und bewegte sich auf den Polizisten zu, der ihn aus der Polizeistation hinaus und in ein zweites Gebäude führte: das Gefängnis von Bozen. Man kannte Fernando hier bereits seit einigen Jahren. Er hatte mehrere Mörder und Gewaltverbrecher zu Recherchezwecken interviewt und war also schon ein wenig an dieses Gebäude gewöhnt, in dem eine gespenstische Stimmung herrschte. In den langen Gängen hallten das Gemurmel und die Geräusche sowie die Stimmen von Hunderten Insassen wider. Verrückte, traurige, beängstigende, verwirrende Geräusche. Einen niederschmetternderen Ort hatte Fernando niemals gesehen, er stand in einem unglaublichen Gegensatz zu seinem Leben da draußen, außerhalb der maroden Mauern. Trotzdem kam er immer wieder hierher. Trotzdem traf er sich mit diesen Menschen, die dazu verurteilt waren, den Rest ihres Lebens hier zu verbringen. Er hatte sich nie ernsthaft gefragt, warum das so war, warum er sich ausgerechnet mit ihnen beschäftigte.
Was war es, das ihn antrieb? Er hatte keine Antwort, außer der, dass es sein Wunsch war, sein Interesse, sich mit diesen Männern auseinanderzusetzen, mit ihnen zu sprechen, in der Hoffnung, sie dadurch besser verstehen zu können.
Der Carabiniere blieb stehen, zog einen rasselnden Schlüsselbund hervor und öffnete mit einem großbärtigen Schlüssel den Riegel einer Metalltür. Mit der Hand an der Dienstwaffe schob er die Tür auf und ging voran. »Signor Branzo, Ihr Besuch ist da.«
Er verpasste dem auf dem Bett liegenden Mann ein Paar Handschellen, während Fernando in der Tür stehen blieb und wartete. Ein routinemäßiger Vorgang für beide Männer. Es dauerte kaum drei Sekunden, dann ließ der junge Mann Fernando mit Branzo allein. »Wie lange brauchen Sie?«, fragte er beim Rausgehen.
»Ich schätze ein, zwei Stunden.«
Der Carabiniere schaute unzufrieden auf seine Armbanduhr. »Um zwölf hole ich Sie wieder ab. Eine Wache ist immer auf dem Gang. In Notfällen klopfen Sie bitte.«
»Ich weiß, danke.«
Der Carabiniere zog die Tür zu, und Fernando drehte sich zu Branzo um. Der Gefangene war Mitte sechzig, stoppelbärtig und trug einen Kranz aus kurz rasierten grauen Haaren um seinen flachen Schädel. Die kleinen, runden Augen in seinem breiten Gesicht blickten listig, und die Fältchen in seinen Augenwinkeln hätte man bei anderen Menschen für Lachfalten halten können. Bei ihm rührten sie jedoch nicht vom Lachen, sondern von einem mimischen Automatismus her, der einem Lächeln nur optisch gleichkam.
»Buongiorno!«, grüßte Branzo und hielt Fernando seine angekettete rechte Hand hin.
Fernando schüttelte sie und nahm dabei gleichzeitig den beißenden Körpergeruch des Mannes und einen stechenden Uringestank wahr, der von der Kloschüssel in der Ecke der Zelle herrührte. »Buongiorno. Was ist mit Ihrem Fuß?«, fragte er und wies auf Branzos geschwollenen linken Knöchel.
»Keine Ahnung, manchmal wird er einfach dick, und ich kann kaum noch auftreten vor Schmerzen. Hab eine Salbe vom Arzt bekommen. Mal sehen, ob’s was bringt.«
Fernando sah sich in dem engen Raum um. Ein schmaler Schrank mit aufgeplatztem Furnier direkt neben der Tür. Ein Tisch ohne Stuhl an der Fensterwand, die Pritsche, und das war es auch schon.
»Sie können sich draufsetzen«, meinte Branzo und deutete auf die Tischplatte. Das Fenster über Branzos Kopf stand offen. Die Stahlgitter warfen Schattenstreifen an die gegenüberliegende Wand mit dem schmutzigen Spiegel über einem gelblichen Waschbecken.
Auch hier in der Zelle war der Putz rissig und porös. Es roch nach feuchtem Stein, und die Hitze stand wie ein Block im Raum. In einem fast schon gehässig zu nennenden Gegensatz dazu blickte man durch das Fenster hinaus auf die grünen, sonnenbeschienenen Berge, die Bozen umsäumten, und ihre in der Ferne leuchtenden Weinfelder. Der Talferbach plätscherte vorbei, und auf dem diesseitigen Ufer verlief ein Grünstreifen, der gern von Spaziergängern genutzt wurde. Die Freiheit und Schönheit des Ortes lagen direkt vor diesem Fenster. Branzo hatte mit Klebeband zwei Rasierspiegel an den Gitterstäben befestigt, sodass er hinausschauen konnte, wenn er im Bett lag oder am Tisch saß.
»Gibt es keinen Stuhl?«, fragte Fernando und ließ sich auf der Tischplatte nieder.
»Kaputt. Vielleicht kriege ich irgendwann einen neuen.« Branzo kratzte sich an der Schläfe.
»Na gut, wir haben mal wieder wenig Zeit«, begann Fernando.
»Was woll’n Sie denn diesmal wissen?«
Fernando lauschte einen Moment der flachen Atmung des Mannes und sah zu, wie sich dessen Brustkorb hob und senkte. Auf Branzos weißem T-Shirt lag ein Kruzifix, das an einer Kette um seinen Hals befestigt war.
Marco Antonio Branzo war ein Serienmörder. Er hatte fünfzehn Frauen innerhalb von zwanzig Jahren brutal ermordet und Dutzende weitere Überfälle begangen, bei denen die Frauen zum Teil schwer verletzt worden waren. Die Presse hatte ihn »Die Bestie von Bozen« getauft, weil er alle seine Taten in und im Umkreis von hundert Kilometern um Bozen herum begangen hatte. Seine Vorgehensweise war so simpel, dass es ein Wunder war, dass er nicht schon viel früher gefasst wurde. Er suchte sich immer einen bestimmten Ort oder einen Stadtteil aus, in dem er sich dann den ganzen Tag aufhielt und zu Fuß durch die Straßen lief. Von Mal zu Mal tarnte er sich lediglich mit verschiedenen Hüten oder ließ sich einen Bart stehen. Oft hatte er einen Hund dabei, um den Eindruck zu vermitteln, einfach nur mit diesem spazieren zu gehen. Während seiner Fußmärsche hielt er nach Frauen Ausschau, die allein lebten oder deren Männer an dem jeweiligen Tag nicht zu Hause waren. Er wählte sein Opfer aus, beobachtete es und stieg in der Nacht durch ein Fenster oder eine Terrassentür ein. Dann überfiel er die Frauen im Schlaf.
»Ich würde heute gern über Ihre Eltern sprechen. Wie waren sie so? Was haben sie gemacht? Welche Erinnerungen haben Sie an sie?«
Fernando zog ein kleines, an den Ecken zerknittertes Notizbuch aus der Gesäßtasche seiner Jeans und schlug es auf. Trotz der Hitze trug er lange Hosen und lederne Bergstiefel. Einen bis auf fünf Zentimeter heruntergeschriebenen Bleistift fand er in seiner anderen Tasche.
Branzo drehte sich halb auf die Seite und sah ihn an. Schweißperlen standen auf seinem Schädel. »Meine Eltern? Wieso meine Eltern?«, fragte er verständnislos und legte sich wieder gerade hin. Jetzt erst bemerkte Fernando, dass Branzo aus seiner Position direkt in den Spiegel über dem Waschbecken schauen konnte, in dem wiederum der am Fenster angebrachte Spiegel zu sehen war, sodass er von dort aus tatsächlich auf die Uferpromenade blicken konnte.
»Glauben Sie, dass man böse auf die Welt kommt?«, fragte Fernando.
»Gott hat uns alle geschaffen. Das Böse gehört ebenso zu dieser Welt wie das Gute. Ich bin einfach auf der falschen Seite gelandet, schätze ich.«
»Glauben Sie an Gott?«
»Sicher, ich bin Katholik.«
»Dann haben Ihre Eltern Sie katholisch erzogen. Niemand ist von Geburt an gläubig.«
Wieder drehte Branzo sich zu Fernando um, und diesmal lief diesem ein kalter Schauer über den Rücken. Schnell lenkte er seinen Blick ins Buch und notierte sich etwas.
»Meine Eltern waren gute, großzügige Menschen. Einfach und… heilig.«
»Heilige?«, hakte Fernando aufmerksam nach, bemüht, seinen Unglauben nicht zu zeigen.
»Sie wissen, was ich meine. Sie waren immer freundlich, umsorgten mich und kümmerten sich.«
Fernando kritzelte die Worte »umsorgten mich« in sein Heft und unterstrich sie. »Haben Sie Geschwister?«
»Das wissen Sie nicht? Sie haben doch sicher alles über mich gelesen.« Branzo wackelte ungehalten mit seinem verletzten Fuß.
»Sie hatten einen Bruder«, gab Fernando zu. »Was passierte mit ihm?«
Branzo faltete seine Hände über dem Bauch und löste sie gleich wieder, um sie an die Seiten seines Körpers zu legen. Seine Finger spielten mit dem schmutzigen Stoff seines Hemdes. »Er starb, als er zehn war.«
»Ein Unfall, richtig?«
»Er stürzte. In den Bergen. Ich hab ihn gefunden.«
»Das war sicher schlimm für Sie. Wie alt waren Sie da?«
»Ich war sieben.«
»Und liebten Sie Ihren Bruder?«
Ohne eine Vorankündigung schlug Branzo plötzlich mit beiden Fäusten gegen die Wand, dass es einen dumpfen Knall gab.
»Herrgott, fragen Sie schon, ob ich es war«, zischte er, und Speichel flog ihm aus dem Mund. Unterdrückte Wut zeichnete sich in seinem geröteten Gesicht ab. Fernando bekam eine ungefähre Ahnung davon, wie er aussehen musste, wenn er andere zu Opfern machte.
»Schon gut. Mein Fehler«, sagte Fernando. »Ich habe in unserem letzten Gespräch wohl nicht ausreichend deutlich gemacht, worum es mir geht. Ich bin kein Polizist, das wissen Sie, ich schreibe völlig unabhängig. Was ich will, sind echte, ehrliche Informationen. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie mit mir sprechen wollen, und Sie hatten eingewilligt. Das ist aber keine Märchenstunde hier, ich will, dass Sie mir die Wahrheit sagen und nicht irgendeinen Quatsch erzählen, von wegen ›meine heiligen Eltern umsorgten mich‹. Entweder wir reden Klartext oder gar nicht. Und ja, ich glaube wie viele andere auch, dass Sie Ihren Bruder getötet haben, das stimmt. Es spricht einiges dafür. Aber ich will kein Schuldeingeständnis von Ihnen, sondern die Wahrheit. Sie sitzen sowieso den Rest Ihres Lebens in dieser Zelle, also können Sie auch ehrlich sein.«
Fernando war voll auf Konfrontationskurs gegangen. So, wie er Branzo einschätzte, nützte es nichts, ihm Honig um den Mund zu schmieren. Und er mochte es, direkt zu sein.
Branzo entspannte sich und atmete aus. »So einer sind Sie also«, sagte er so leise, dass man es für ein Selbstgespräch halten könnte.
Danach dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, bis Branzo wieder den Mund aufmachte. Er musste sehr gut über seinen nächsten Schritt nachgedacht haben. Ein Stöhnen drang aus seiner Kehle, als er seine Hände aufs Gesicht legte. Dann stieß er einen langen, hohlen, verzweifelten Schrei aus. Sein ganzer Körper war angespannt, und seine Halsschlagader trat hervor.
Fernando meinte, dass nun sofort eine Wache kommen müsste, doch draußen auf dem Flur war nichts zu hören. Die Wache, die zu seiner Hilfe hätte kommen sollen, wenn Branzo ihn angegriffen hätte, war entweder gar nicht da, oder es war ihr egal.
Branzo krallte die Finger in sein Gesicht und ließ sie langsam nach unten gleiten, was seine Züge in eine Fratze verwandelte. Er atmete tief durch und schüttelte den Kopf. »Nein. Keine Heiligen«, sagte er. Sein trüber Blick war starr an die Decke geheftet.
Fernando bemerkte eine Gänsehaut auf Branzos Armen, er schien leicht zu zittern.
»Sie waren Feldarbeiter. Mein Vater ein Schwächling, meine Mutter eine Hexe. Sie war die Königin. Eine schmutzige, verdorbene, eiskalte Königin, die mich hasste. Ich hab nie gewusst, warum. Ich denke heute, dass sie mich so gehasst hat, weil ich ein uneheliches Kind bin. Ich sah keinem ähnlich. Nicht meinem Vater, nicht meiner Mutter oder meinem Bruder. Sie hat mich dafür bestraft. Selbst hat sie sich nie die Hände schmutzig gemacht. Das erledigten andere für sie. Mein Vater musste es tun. Im Stall. Sie stand nur da und schaute zu. Aber es machte ihr Spaß. Sie hatte Freude daran, zuzusehen.« Er schloss die Augen. Ein kurzes Schaudern ging durch seinen Körper. »Ich musste mich ausziehen. Dann bekam ich das Ochsenjoch umgehängt. Und mein Vater musste mich mit den Holzscheiten schlagen. ›Auf die Knöchel‹, hat sie immer gesagt, ›auf die Knöchel.‹ Mein Bruder durfte zusehen. Er sollte dann auf der Flöte spielen, auf dieser verdammten Scheiß-Flöte. Damit man mich nicht hörte, wenn ich schrie. Einmal warfen sie mich zu den Kühen, und sie befahl ihm, die Tiere mit einer Forke zu stechen. Sie trampelten auf mir herum, bis ich ohnmächtig wurde. Danach sagte sie den Leuten im Dorf, ich sei krank. Keiner solle zu uns raufkommen, um sich nicht anzustecken.«
Branzos Stimme war immer schwächer geworden, und jetzt pausierte er. Fernando traute sich nicht, etwas zu sagen, er ließ ihm die Zeit, die er brauchte.
»Es war an einem Sonntag, nach der Kirche. Es war kalt und neblig. Cesare und ich waren in den Bergen unterwegs. Er setzte sich auf einen Felsen, während ich nach Holz zum Schnitzen suchte, und er fing an, auf seiner Flöte zu spielen. Da hab ich einen Stein genommen, bin zu ihm hin und hab so fest zugeschlagen, wie ich nur konnte. Dafür komme ich in die Hölle, das weiß ich. Aber schlimmer als hier kann es da auch nicht sein.«
Branzo atmete so lange aus, dass Fernando schon glaubte, er täte seinen letzten Atemzug. Er hatte ihm gestanden, seinen Bruder ermordet zu haben. Wieder verdeckte er sein Gesicht mit den geketteten Händen. Da hörten sie, wie das Schloss entriegelt wurde. Fernando blickte auf seine Uhr. Es war drei Minuten vor zwölf.
»Die Zeit ist um«, verkündete der Carabiniere und kam herein, um die Handschellen zu öffnen.
»Lovecchio, tun Sie mir einen Gefallen?«, fragte Branzo gehetzt, als Fernando aufstand und sein Notizbuch einsteckte.
»Natürlich.«
»Hängen Sie bitte den einen Spiegel um? Heute ist Herz-Jesu-Nacht. Ich will die Berge sehen.«
Fernando blickte aus dem Fenster. Tatsächlich, auf einem der Gipfel hatte man ein Kreuz errichtet, das heute Nacht brennen würde. Er nahm den Spiegel aus seiner mit Klebeband gebastelten Vorrichtung heraus und hängte ihn auf die andere Seite.
»Danke«, sagte Branzo und reichte ihm die Hand. Fernando schüttelte sie.
»Kommen Sie bitte«, sagte der Polizist und machte eine auffordernde Geste in Richtung Tür.
»Ich danke Ihnen«, sagte Fernando zu Branzo und folgte dem Carabiniere nach draußen.
***
Fernando trat aus der Polizeistation heraus und genoss für einen Augenblick die frische Luft. Schräg gegenüber, vor dem Auditorium, stand eine gut gekleidete, attraktive Frau mit einer Laptoptasche unter dem Arm. Sie lächelte ihn fast mitleidig an, und Fernando fragte sich, ob sie ihn für einen Häftling hielt, der gerade entlassen worden war. Mit seinem dichten braunen Vollbart und den schulterlangen Haaren, mit seinem karierten, offen stehenden Hemd über dem weißen T-Shirt glich er mehr einem Holzfäller als einem Autor.
Er hatte seinen Land Rover Defender an der Via Marconi geparkt, weil er seine Gitarre beim Musikhaus Walter in Reparatur gegeben hatte und jetzt abholen wollte, bevor es nach Hause ging. Die alte Höfner brauchte einen neuen Steg.
»Ah, da kommt ja Kenny Loggins!«, rief der Besitzer, als Fernando eintrat. Tatsächlich hatte er ein wenig Ähnlichkeit mit dem amerikanischen Sänger, und der Besitzer machte sich einen Spaß daraus, seine Kunden mit den Namen berühmter Musiker anzusprechen.
Sie hatten einen Knochensteg eingebaut und neue Saiten aufgezogen. Gute Arbeit. Fernando bezahlte, packte seine Gitarre in den Koffer und stieg in seinen Defender. Er fuhr in Richtung Norden auf die Autobahn22 und folgte ihr bis zur Abfahrt Waidbruck, die über den Eisack verlief. Die Straße ins Grödnertal, ins Val Gardena, führte ihn durch einen Tunnel und anschließend in eine enge Schlucht, die immer weiter hinaufführte, bis sich das Tal hinter dem kleinen Ort Sankt Peter öffnete.
In Sankt Ulrich kaufte Fernando in dem kleinen Spar-Laden in der Via Rezia etwas Hartwurst und Weißbrot für sich und eine Wurst für Dante, damit sie es sich heute Abend auf dem Berg gut gehen lassen konnten. Dante, ein Irischer Terrier mit leuchtend rotem Fell und einer herzförmigen Blässe auf der Brust, war Fernandos einziger Freund und Gesprächspartner in der Einsamkeit seiner Berghütte. Er hatte dieses Leben abseits der Menschen und ohne jeglichen Kontakt zu ihnen selbst gewählt. Nach seinem Studium in Mailand war er in sein Heimattal zurückgekehrt, um zu schreiben, und hatte sich dort nach dem Erfolg seines ersten Buches eine kleine, fernab der Zivilisation gelegene Hütte gekauft, im Annatal, mitten in den bewaldeten Hängen zwischen dem Raschötz und dem Seceda. Die einzige Verbindung zur Außenwelt waren sein Laptop und ein Handy, das er nur zu Notfallzwecken besaß. Im Ort war er bekannt als »der Mann aus den Bergen«, der einsame Schriftsteller mit seinem Hund. Man kannte ihn, weil er hier einkaufte, aber so gut wie niemand hatte seine Bücher gelesen. Und wenn doch, hatte der- oder diejenige mit Unverständnis darauf reagiert.
Nur die wenigsten konnten seiner Arbeit etwas Positives abringen. Er war bei seinen Lesern als »Mörderfreund« verschrien. So hatte ihn einmal ein Kunde bei Amazon in seiner Bewertung tituliert, und Fernando hatte zwar erwirken können, dass man diesen Beitrag aus den Bewertungen strich. Aber ein Großteil der übrigen Kritiken hatte einen ganz ähnlichen Tenor.
»Schreibst du gerade ein neues Buch?«, fragte Maria, die Bedienung an der Fleischtheke. Sie war eine sehr freundliche und hübsche junge Frau, die immer lächelte und stets gute Laune zu haben schien. Sie war einer der Gründe, warum Fernando gerade hier einkaufen ging.
»Ja, ich bin sozusagen mittendrin, muss aber noch ein paar Interviews führen«, antwortete er, und eine ältere Dame hinter ihm in der Schlange beäugte ihn misstrauisch von der Seite. »Ich komme eben aus Bozen«, fügte Fernando erklärend hinzu. Maria wusste, was er dort tat, also nickte sie nur und zwinkerte ihm zu.
»Was machst du heute Abend?«, fragte sie. »Es ist Herz-Jesu-Nacht.«
Es klang fast wie eine Einladung, aber er wusste, dass es nicht so gemeint war.
»Ich geh auf den Raschötz.«
»Ich auch, vielleicht sehen wir uns ja.«
»Das wär schön.«
»Dann bis heute Abend.«
»Ciao«, sagte Fernando, nahm sein Paket entgegen und ging zur Kasse.
Der Ort war in geschäftiger Aufregung. Die Straßen voll von Menschen, viele Frauen in Trachten, die Männer vom Südtiroler Schützenbund in ihren typischen Lederhosen, Trachtenjacken, Kniestrümpfen und federbeschmückten Hüten. An den Hängen der Berge konnte man bei genauerem Hinsehen Männer erkennen, die die herzförmigen Feuerstellen an den Hängen installierten. Bald würden die Schützenmärsche durch den Ort beginnen.
Fernando wollte diesem Trubel so schnell es ging entfliehen. Er mochte große Menschenansammlungen nicht. Auch heute Abend auf dem Gipfel des Raschötz würde er sich abseits halten.
Die schmale Straße, die zu seinem Haus führte, schlängelte sich zwischen Häuserzeilen durch, in denen vielerorts gebaut und renoviert wurde. Nachdem er den kurzen Tunnel oberhalb des Ortes durchfahren hatte, standen nur noch vereinzelt Anwesen an den Hängen. Der Defender erklomm die steiler werdende Straße bis zu deren Ende, woraufhin Fernando in einen matschigen Seitenweg einbog, auf dem man nur zu Fuß oder mit geländegängigen Fahrzeugen unterwegs sein konnte. Es ging durch einen dichten Fichtenwald, bis er eine nahezu kreisrunde Lichtung erreichte, ein Plateau, das direkt auf das Seceda-Massiv blickte. Die Hütte aus dunklem, wettergezeichnetem Holz stand am hinteren Rand, mit der Veranda und einer Sitzbank und Tisch links des Eingangs in der Sonne. Dante bellte aufgeregt und sprang um das Auto herum. Er hatte das Motorengeräusch längst erkannt und konnte es kaum noch abwarten, bis sein Herrchen ausstieg.
»Hey, Dany«, begrüßte Fernando ihn und wuschelte dem Hund durch das rote Fell. »Hast du gut aufgepasst? Keine bösen Buben hier gewesen? Oder hattest du einen zum Frühstück?«
Der Hund leckte ihm die Hände und roch daran das Fleisch, das Fernando eingekauft hatte. Er war ein recht großes Exemplar für einen Irischen Terrier, sah mit seinen treuen braunen Augen jedoch wie ein harmloses, verspieltes Hündchen aus. Dieser Eindruck konnte sich allerdings als ganz falsch erweisen, wenn es darum ging, Fernando zu verteidigen. Irische Terrier waren für ihre unbedingte Zuneigung zu ihren Herren bekannt und zudem hartgesottene Kämpfernaturen, denen Schmerzen nicht viel ausmachten.
»Na komm, ich mach uns Kaffee«, sagte Fernando, holte seine Einkäufe und die Gitarre von der Rückbank und ging ins Haus.
Sein amerikanischer Briefkasten, der unten an der asphaltierten Straße stand, hatte vier Briefe für ihn gehabt. Mit seiner dampfenden Tasse Kaffee und den Umschlägen setzte er sich raus auf die Veranda. Dante nahm neben ihm Platz und genoss die warmen Sonnenstrahlen.
»Oh, vom Verlag«, sagte Fernando, als er die Absenderadresse des zweiten Briefes las. Mit dem Finger schlitzte er den Umschlag auf und entnahm ihm das Schreiben. »Sehr geehrter Herr Lovecchio, mit Interesse haben wir Ihr Manuskriptangebot gelesen, sehen jedoch keine Möglichkeit, das Buch in unserem Verlag zu veröffentlichen. Das ist kein Urteil über die Qualität Ihres Manuskripts, es ist lediglich… bla, bla, bla.« Er atmete frustriert aus und hielt Dante den Brief hin. »Hier, willst du ihn fressen?«
Der Terrier schnüffelte müde und blickte sein Herrchen verständnislos an.
»Das ist die… zwölfte Absage, glaube ich«, meinte Fernando und nahm einen Schluck Kaffee. »Irgendwann werden wir doch noch mit ’ner Hundenummer auftreten müssen, um Geld zu verdienen.«
Dante spitzte die Ohren, als ahnte er, dass er ein Teil dieser Überlegung war.
Fernando sah ihn an. »Branzo hat mir heute gestanden, dass er seinen Bruder umgebracht hat, kannst du dir das vorstellen? Er war sieben Jahre alt.« Nachdenklich blickte er rüber zum Seceda, dessen Spitzen bereits in ein goldenes Licht getaucht waren.
Hatte es überhaupt noch Sinn, weiterzumachen? Sein Buch war halb fertig, und die Interviews mit Branzo entwickelten sich vielversprechend. Aber kein Verlag wollte es haben. Wenn Branzo auch über die Taten Auskunft gab, wegen denen er verurteilt worden war, könnte er vielleicht etwas erreichen. Die sensationsgierigen Medien würden sich darauf stürzen, wenn Südtirols gefährlichster Serienmörder, die Bestie von Bozen, sein Schweigen brach. Aber das wiederum wäre Fernando nicht recht. Er wollte diese Sensationsgier nicht für seine Zwecke nutzen müssen. Wenn er allerdings seine Finanzen betrachtete, blieb ihm womöglich keine große Wahl. Es musste langsam ein finanzieller Fluss zustande kommen. Er lebte ausschließlich von seinen Reserven, die nicht gerade astronomisch waren. Seine letzten beiden Bücher hatten ihm mehr Arbeit als Geld eingebracht– und Missgunst. Das war vielleicht ein Teil des Problems, ein möglicher Grund, warum Verlage nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten: Er war unpopulär. Und dieser Fakt verkaufte eben keine Bücher.
2
Gegen siebzehn Uhr hatte Fernando seinen Rucksack gepackt: das Essen, etwas Wein und Wasser, ein Fernglas, eine Taschenlampe und eine wärmere Jacke für den Abstieg am späten Abend. Er nutzte den Aufstieg, um eine schöne Tour mit Dante zu unternehmen, der die Hänge des Raschötz als sein Revier betrachtete. Aufgeregt lief er durch den Wald und suchte alle Verstecke, Höhlen und Rastplätze der hier lebenden Tiere auf. Stets reichte ein Pfiff von Fernando, um ihn wieder zurück an dessen Seite zu holen.
Sie marschierten zwei Stunden abseits der Wege und kamen gegen neunzehn Uhr an der Flitzer Scharte heraus, wo sie den Weg in Richtung Raschötz einschlugen. Hier begegneten sie bereits vielen Touristen und einheimischen Herz-Jesu-Anhängern. Von der Alm aus hatte man einen wunderbaren Blick auf die Berge und die Almen rund um das Grödnertal. Es war die blaue Stunde. Der Himmel leuchtete kobaltfarben, und die Bergmassive zeichneten sich schwarz wie Scherenschnitte dagegen ab. Die Spitzen der Berge waren gesäumt von golden funkelnden Feuern, Kreuze und Herzen leuchteten an den Hängen, und der in den Abendhimmel aufsteigende Rauch schwebte als blaugrauer Dunst über der Alm.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!