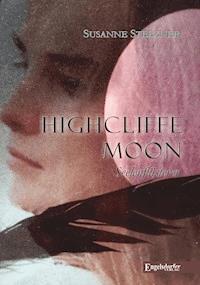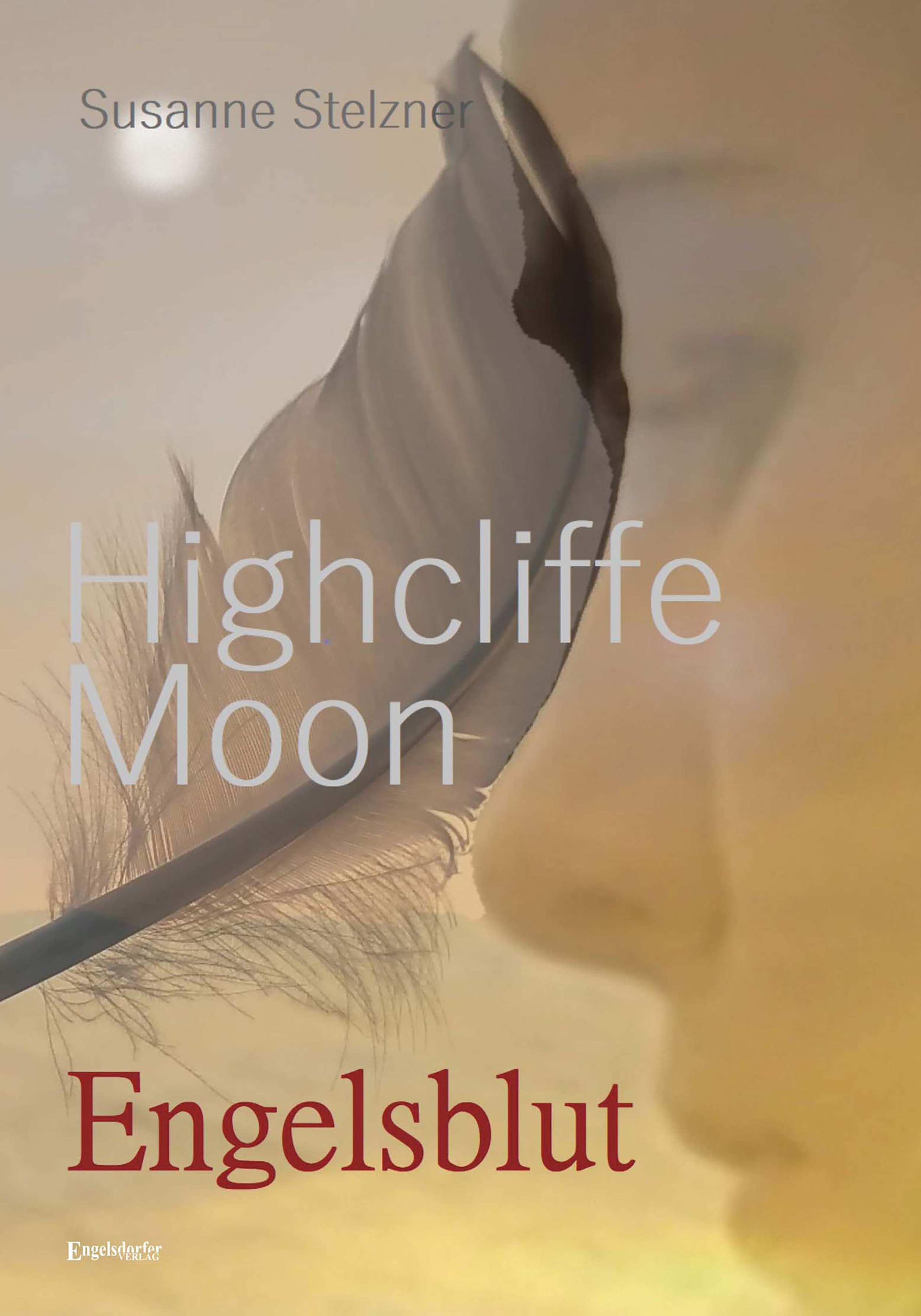
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe über irdische Grenzen hinaus: Hendrik aufgeben? Niemals. Der Gedanke ist für Val unerträglich. Daher schlägt sie alle Warnungen in den Wind. Aber kann es eine gemeinsame Zukunft für einen Menschen und einen Engel geben? Selbst wenn sie sich weiterhin erfolgreich gegen ihre dämonischen Verfolger zur Wehr setzen können, bleibt die zermürbende Angst, dass Hendrik eines Tages die Erde verlassen muss. Und die Anzeichen mehren sich, dass es bald soweit sein könnte ... Fortsetzung von Highcliffe Moon Seelenflüsterer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Stelzner
Highcliffe Moon
Engelsblut
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2020
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/DE/Home/home_node.html abrufbar.
Copyright (2020) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Wie kann eine so starke Liebe hoffnungslos sein,
wenn das Schicksal zugelassen hat, dass wir uns begegnen …
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Tagträumer
Trügerischer Frieden
Gefährlicher Einfluss
Das Superweib
Fliegender Wechsel
Eindringliche Warnung
Abschied
Spurlos
Verzweifelte Suche
Angst und Hoffnung
In den falschen Armen
Eine unerwartete Reise
Zurück im Leben
Geständnisse
Flucht aus New York
Fast vollkommenes Glück
Totale Verwirrung
Ein surreales Wiedersehen
Engelsblut
Die ganze Wahrheit
Schwüre
Dem Tode nah
Ein Traum wird wahr
Eine neue Chance
Tagträumer
Nicht der geringste Windhauch berührte die Wasseroberfläche des Blashford Lake. Die am Ufer stehenden Bäume waren darauf so klar und deutlich gespiegelt, dass es aussah, als würden zwei Welten aneinanderstoßen. Gegen die Sonne blinzelnd verlor ich mich eine Weile in dieser perfekten Illusion, bis einige Blesshühner sie mit ihren keilartigen Schwimmspuren zunichtemachten, während sie mit schrillen, abgehackten Rufen auch die Stille unterbrachen. Zwei Libellen tanzten im gleißenden Licht, dicht bei meinen Füßen, an der Wasserkante über ihrem Spiegelbild. Sie berührten einander ständig, wie in Paarungslaune, so als gaukelte ihnen der schöne, warme Tag vor, es sei Sommer. Aber es war längst Oktober geworden. Ellenlange, seidig schimmernde Spinnenfäden schwebten durch die Luft, in der ein leichter Duft von zertretenen Blättern und Pilzen lag.
Für mich war es der perfekte Tag. Denn er war hier. Hendrik schenkte mir endlich wieder Zeit, nachdem er mich zu einem harten Lernprogramm verdonnert hatte. Es war ihm sehr wichtig, dass meine schulischen Leistungen nicht unter unserer außergewöhnlichen Freundschaft litten. Ich hatte nur zugestimmt, weil er mir kurze nächtliche Ausflüge in Aussicht gestellt hatte, die ich jedoch, ohnmächtig vor Müdigkeit, oft auch noch verpennt hatte.
Es war kein Vergleich zu diesem Nachmittag. Trotz meiner fast geschlossenen Augen war ich hellwach. Ich spürte den leichten Druck seiner angewinkelten Beine, zwischen denen ich auf dem sandigen Boden der kleinen Uferlichtung eingebettet saß, wie in einem Lehnsessel, mit meinem Hinterkopf an seiner Brust und meinen Unterarmen auf seinen Oberschenkeln. Auf den männlichen Konturen unter dem gespannten Stoff sahen meine Hände beinahe zerbrechlich aus.
Unbewusst zog ich den Kragen meiner dünnen Stoffjacke enger um den Hals.
»Ist dir kalt?«, erklang Hendriks warme, dunkle Stimme dicht an meinem Ohr.
Wie sollte mir in seiner Nähe jemals kalt werden? Die Erde könnte zufrieren. Oder einstürzen. Ich würde nicht mal zucken. Ich war genau da, wo ich sein wollte.
»Nein, gar nicht«, antwortete ich nur und schmiegte meinen Kopf noch enger an ihn.
Doch Hendrik zog die Seiten meiner offenen Jacke vor meinem Oberkörper übereinander und schob seine Arme im Kreuzgriff darüber, um sie an Ort und Stelle zu halten.
Still seufzend genoss ich diese Geste, die ich als behutsame und doch bestimmte Besitznahme wertete. Denn er tat es mit einer Selbstverständlichkeit, als wollte er mich nie wieder freigeben. Wenigstens wünschte ich mir, dass es so war.
Die Ärmel seines sandfarbenen Pullovers waren bis zu den Ellenbogen hochgezogen; ich hauchte einen Kuss auf seinen Unterarm, auf die weichen Härchen, die in den goldenen Sonnenstrahlen wie Kupferfäden funkelten. Fasziniert betrachtete ich das Lichtspiel, bevor ich die erhabenen Muskellinien sanft mit den Fingerkuppen nachzuzeichnen begann, wobei der wohlgeordnete Verlauf der Härchen durcheinandergeriet, bevor ich ihn beim Zurückstreichen sorgsam wieder glättete.
»Spürst du die Wärme der Sonne auf deiner Haut?«, fragte ich, unermüdlich diese Unordnung und Ordnung herstellend.
»Ich erinnere mich, wie es sich anfühlte«, antwortete er leise.
Ich nickte still, tastete mich zu seinem Handrücken vor und schob meine Hand über seine. Sofort drängten seine Finger zwischen den meinen hindurch nach oben und klemmten sie mit sanftem Druck ein. Begleitet von einem sehr leisen Brummen, schob er sein Kinn leicht wie eine Feder auf meine Schulter, sodass ich die kitzelnde Weichheit seiner Haare an meiner Wange fühlte.
In Momenten wie diesen war die Angst vor Trennung, die mein Herz wie eine eingewachsene Eisenkralle im Griff hatte, kaum spürbar. Aber sie war eben nicht weg. Nur im Pausenmodus. Denn von Vincent wussten wir, dass Hendriks Name noch nicht im sogenannten Buch der Reisenden aufgetaucht war, einer Art Beförderungsplan für Engel, wie Hendrik mir erklärt hatte. Bei entsprechenden Verdiensten erfolgte dort ein Eintrag und er würde aufsteigen, was allerdings auch bedeutete, dass er die Erde verließ. Den gewaltigen Zusammenbruch, den ich dann erlitte, wollte ich mir nicht schon wieder ausmalen. Hör auf, darüber nachzudenken, Val! Der Tag ist zu schön. Angestrengt versuchte ich mich darauf zu konzentrieren, die Konturen der gespiegelten Baumkronen mit dem Blick nachzuzeichnen, um die Gedanken auszuknipsen. Doch war das Hirn einmal in Fahrt gekommen, übernahm es wieder die Kontrolle, wie beim Erwachen aus einem Traum, den man eigentlich festhalten möchte – was genauso wenig gelingt, wie einen Glücksmoment festzuhalten. Er ist nicht willkürlich dehnbar, das hatte ich in den letzten Wochen gelernt. Er springt auf wie eine Blütenknospe im Zeitraffer, bringt eine süße Unruhe in den Brustkorb und vergeht. Und das in kurzen, heftigen Intervallen, in den winzigen Augenblicken, in denen das Hirn alles ausblendet und sich nur auf den Moment fokussiert. Das hält es jedoch nie lange aus. Es ist seine Bestimmung, zu arbeiten; bei den meisten Menschen jedenfalls.
Vielleicht ließ mich die Angst aber auch deshalb nicht los, weil ich manchmal spürte, dass Hendrik tief in seinem Inneren dennoch nach Beförderung strebte und dass er sich nur wegen seiner Gefühle zu mir heftig dagegen sträubte, aufzusteigen. Aus purem Egoismus schob ich den Gedanken beiseite, ihn irgendwie zu behindern.
»Ich könnte ewig mit dir hier sitzen«, gestand ich leise, mit der abwegigen Hoffnung, ihm einen ähnlichen Schwur abzuringen, damit die Kralle ganz verschwand.
»Ja, es ist sehr schön hier«, erwiderte Hendrik mit der erwarteten Zurückhaltung.
Seufzend blies ich die Luft aus der Nase. »Ich war vor Jahren schon mal hier, mit meinem Dad und Ben. Es war aber nicht so zugewachsen.« Abschätzend musterte ich die ausladenden Äste, die auf dem Vormarsch waren, auch diese Lichtung gänzlich zu erobern. Ich sah meinen damals spindeldürren besten Freund Ben Cummings vor mir, der wie eine Klette auf dem Rücken meines Vaters hing und ihn mit Reitbewegungen antrieb, während mein Dad den kleinen Quälgeist lachend und mit stoischer Geduld ertrug. Wie er es oft und gerne tat. Weil er wusste, wie hart es ist, ohne Vater aufzuwachsen.
»Ben wollte einen Fisch angeln«, erinnerte ich mich. »Er hat einen fetten Regenwurm, der sich wand wie ein Aal, an eine Schnur gebunden, sie wie ein Lasso über dem Kopf geschwungen und ins Wasser platschen lassen.«
»Klingt lecker«, raunte Hendrik in mein Ohr.
»Bäh«, machte ich entsetzt. »Voll eklig.«
Hendrik kicherte. »Aber du isst doch gerne Fisch«, kam er mit unschuldigem Unterton auf die vermeintliche Beute zurück.
»Ha, ha«, machte ich. »Er hat nicht einen gefangen. Es machte ihm aber sowieso mehr Spaß, wenn ich kreischend seiner Wurmschnur auswich.«
Hendrik lachte leise. »Ja, das passt zu ihm.«
Mein Lächeln erstarb ganz langsam, als mein schlechtes Gewissen wieder einmal leise anpochte. Wie auch meine beste Freundin Charlie und alle anderen hatte ich ihn in dem Glauben gelassen, Hendrik sei ein Lehramtsstudent aus den USA, den das englische Schulsystem begeisterte. Niemand hatte das je hinterfragt. Das war seine Magie.
Ben, dessen Panzer noch schwerer zu knacken ist als meiner, hatte Hendrik nahezu auf Anhieb seine Freundschaft geschenkt. Charlie vergötterte ihn, wie leider auch viele Mädchen an meiner Schule. Und meine Nachbarn, das alte Ehepaar Adams, hatten ihn als Sohn ihres tödlich verunglückten Lieblings-Studentenpaares, das viele Sommer bei ihnen gewohnt hatte, wie selbstverständlich herzlich aufgenommen. Auch meine Mutter war von ihm mehr als angetan. Niemand war je auf den Gedanken gekommen, er sei kein Mensch.
Ben war der Einzige, der begonnen hatte, den außergewöhnlich perfekten Gast genauer zu beobachten, was mich öfter zu Notlügen zwang. Ich hasste das. Aber um nichts auf der Welt wollte ich riskieren, dass Hendrik wieder in seine Welt abtauchte, nur weil ich nicht in der Lage war, sein Geheimnis zu hüten. Denn ich glaubte fest daran, dass man dort unsere Treffen nur aufgrund meiner totalen Verschwiegenheit duldete.
Ein tiefer Atemzug hob und senkte meine Brust und die darauf ruhenden Arme Hendriks. Er drückte seine Wange an die meine; unsere Haut schien miteinander zu verschmelzen. Es war ein elektrisierendes Gefühl und mein Herz pochte ein wenig heftiger.
Am gegenüberliegenden Ufer trat ein Paar aus dem Dickicht zum Wasser. Es war weit entfernt, doch nach alter Gewohnheit aus unserer Anfangszeit, als Hendrik sich allein mir zeigte, reckte ich alarmiert den Hals.
»Bist du für die jetzt unsichtbar?«, fragte ich, ohne das Paar aus den Augen zu lassen.
»Nein. Wäre dir das lieber?« Er zog mich wieder dicht zu sich heran.
»Sparst du damit nicht Energie?«, fragte ich.
»Ich dachte, ein Mädchen, ganz alleine in der Einsamkeit … Aber ich kann mich auflösen, wenn es dir unangenehm ist, mit mir gesehen zu werden«, neckte er. Es kitzelte, als seine Lippen beim Sprechen den Rand meiner Ohrmuschel nachzeichneten.
»Ja, das wäre voll peinlich mit einem so unansehnlichen Typen.« Ich stieß meinen Ellenbogen sachte in seine Rippen. »Aber darum geht es nicht.«
»Au«, kicherte er amüsiert. Eine automatische Reaktion aus seiner Zeit als Mensch, schätzte ich. Ich wusste, dass er keinen körperlichen Schmerz mehr fühlte.
»Worum geht es dann?«
Das Paar verschwand wieder hinter dem Blattwerk.
»Das weißt du doch«, murmelte ich.
»Mich zu materialisieren oder dich mit mir zusammen optisch verschwinden zu lassen, kommt energietechnisch etwa auf dasselbe heraus. Aber keine Sorge, mein Depot ist noch gefüllt. Ich war gestern in Londons Nachtleben unterwegs.«
»Du treibst dich also nachts in Clubs herum?«, fragte ich mit gespieltem Vorwurf. Ich wandte meinen Kopf ein klein wenig und verharrte erwartungsvoll.
»Ja. Auch. Zusammen mit jungen Menschen, die im Begriff sind, sich ihre Zukunft zu verbauen, indem sie stehlen oder aus gekränkter Eitelkeit den Türsteher niederstechen wollen«, sagte er mit ernstem Tonfall.
Bei jedem Wort strichen seine Lippen über meine Haut. Ich stellte mir vor, wie er sich unsichtbar zwischen der feiernden Meute bewegte und Verirrten mit seiner Flüsterstimme ins Gewissen redete.
»Mach dir keine Sorgen um mein Energiekonto.«
Nein, ich wusste, dass seine guten Taten es füllten. Meine Befürchtung war eher, dass er zu viel verbrauchte, um meinetwegen aus dem Zwischenreich zu treten, daher umso mehr sammelte und schließlich doch noch wegen überdurchschnittlicher Leistungen frühzeitig in diesem Buch gelistet wurde. Ein Teufelskreis.
Ich wurde ebenso ernst. »Natürlich kenne ich deinen Auftrag. Aber bitte, versuch kein Streber zu sein. Nicht für mich.«
»Nur für dich«, sagte er leise, mit dem gewohnten warmen Klang in der dunklen Stimme. »Nichts anderes möchte ich.«
»Nein«, sagte ich energisch. Ich schüttelte seine Arme ab, als ich mich ihm vehement zuwandte. Sein Gesicht war mir nun ganz nah. Es war mir so vertraut, und trotzdem traf es mich jedes Mal wie ein Blitz, wenn ich es ansah. Zwei glänzende Strähnen seines stets perfekt ungeordneten braunen Haares schlängelten sich über die hohen Wangenknochen zum edel geschwungenen Nasenflügel. Seine perfekt geformten Lippen über dem markanten Kinn waren zu einem leichten Lächeln verzogen. Die wunderschönen, schwarz bewimperten, braunen Augen mit den charakteristischen Brauen darüber blickten zärtlich und, wie so oft, mit einer fühlbaren Wehmut auf mich herab.
Meine Gefühle für ihn waren kaum zu bändigen. Wenn unsere Blicke sich trafen, konnte ich in der Regel nicht mehr klar denken. Es gab nur noch den Wunsch, ihn in jeder einzelnen Sekunde meines Lebens an mich zu pressen, wieder und wieder zu küssen, nie mehr loszulassen. Und doch bewahrte ich meine Haltung, so gut es ging.
»Übertreib es einfach nicht«, bat ich ihn inständig. »Du hast selbst gesagt, dass eure Erfolge belohnt werden.«
»Es wäre keine Belohnung, die Erde zu verlassen.« Seine Augen hatten einen traurigen Schimmer.
»Eben.« Zärtlich nahm ich sein Gesicht zwischen die Hände. »Genau das meine ich.«
Hendrik verzog etwas den Mund. Ich hätte viel dafür gegeben, in seinen Gedanken lesen zu können.
Er entwand sich mir sanft. »Ich kann aber nicht wegsehen, Val. Der Junge mit dem Messer war schon in den Klauen eines Raben. Ich konnte seine Seele gerade noch retten.«
Ich erschauerte kurz. Diese verdammten Raben, die ihre Flüsterstimme, im Gegensatz zu den Engeln, dazu nutzten, die Menschen ins Verderben zu führen. Hendrik hatte diesen schwarz beflügelten Dämonen schon manches Opfer abgejagt, was zwei völlig Wahnsinnige aus ihren Reihen nicht gerade sportlich nahmen. Seit geraumer Zeit versuchten Nectobar und Tagonharis sich rachsüchtig und trickreich meine Seele zu krallen. Leise stöhnend ließ ich meine Hände sinken.
»Es waren nicht die«, sagte Hendrik. Sein Blick wurde kalt. Er wusste genau, an wen ich dachte.
Ich riss mich zusammen. »Und wenn schon. Es ist, wie du sagst: Du musst deinen Job machen.« Nie würde ich ihm vorhalten, dass sie auf mich aufmerksam geworden waren. Es war allein meine Schuld. Zu viel Neugier ist eben nicht gesund … Auch das war ein Grund für das Schweigen meinen Freunden gegenüber. Siehst du sie, sehen sie dich. Das wollte ich ihnen ersparen. Für mich war es zu spät, ich hatte die Tür geöffnet und in den Raum dahinter geblickt. Es war beinahe erschreckend, wie abgeklärt ich manchmal über diese Höllenwesen nachdachte, die mich jagten. Hatte ich mich daran gewöhnt, in einer latenten Gefahr zu sein? Brauchte ich den Nervenkitzel? Ganz sicher nicht. Es war ganz einfach so, dass ich Hendrik bedingungslos liebte. Daher nahm ich mein Leben so an, wie es jetzt war. Mit dieser Gefahr, auch wenn sie mir zuweilen mächtige Angst einflößte, konnte ich leben. Aber nicht ohne Hendrik.
Seufzend neigte ich den Kopf, atmete tief ein und schwer wieder aus. Hendrik deutete es auf seine Weise.
»Ich habe dir nur Ärger eingebrockt«, sagte er leise, während er meine Schultern zu streicheln begann.
»Das stimmt nicht«, korrigierte ich ihn entschieden. »Und es ist mir auch egal.« Es war mein voller Ernst.
»Ich weiß, dass du eine selbstzerstörerische Ader hast«, murmelte Hendrik kaum hörbar.
Das konnte ich nicht leugnen. Ich wäre lieber tot, als ihn aufgeben zu müssen.
Mit zwei Fingern hob er sacht mein Kinn an, doch ich drehte mich weg. Manchmal schmerzte sein Anblick einfach mehr, als ich ertragen konnte. Über meine Schulter blickte ich zum See, auf den die merklich gesunkene Sonne einen langen goldenen Schein geworfen hatte. Das war meine Welt. Das war real. Wenn ich brutal ehrliche Gedanken zuließ, was höllisch wehtat, war mir bewusst, dass Hendrik es nur noch bedingt war. Seit dem Moment, als er die Welt der lebenden Menschen verlassen hatte.
Und doch konnte er in konkreter Weise Einfluss auf mein Schicksal nehmen, so wie die bösen Jungs von der anderen Seite auch. Was bedeutet also real?
»Bist du okay?«, fragte Hendrik mit seiner samtenen, dunklen Stimme. Er spürte, wenn meine Gedanken mich aufzufressen drohten. Einige Fetzen davon schienen immer zu ihm durchzudringen.
Ich sah ihn nicht direkt an, als ich nickte.
»Du wolltest doch nicht mehr so viel grübeln«, sagte Hendrik und legte seine Handfläche gegen meine Stirn, als könne er damit meine Gedanken im Zaum halten.
»Kann man die Erde daran hindern, sich zu drehen?«, verteidigte ich mich.
»Schwerlich«, seufzte er. Er strich eine Haarsträhne hinter mein Ohr. »Lauf nicht immer so weit voraus«, flüsterte er zärtlich. »Bleib im Hier und Jetzt. Du verpasst sonst das Leben.«
»Ich habe bisher nur in der Gegenwart gelebt. Über die Zukunft hatte ich nie nachgedacht. Aber das hat sich geändert, seit ich dich kenne«, sagte ich mit erstickender Stimme.
»Ich weiß«, flüsterte er. Es klang schuldbewusst. Federleicht drückte er seine Lippen auf meine Stirn.
»Hendrik?«
»Hm?«
»Denkst du, es gibt noch mehr Paare wie uns?«, fragte ich leise.
»Nein, wir sind einmalig.«
Ich schmunzelte. »Ich meine … na, du weißt schon. Vincent und Marica mal ausgenommen.«
Diese einzige Verbindung zwischen einem Menschen und einem Engel, von der ich wusste, war zwar durch grenzenlose Liebe geprägt, aber, da Marica etwa in meinem Alter gestorben war und nur noch als Lichtgestalt existierte, nicht unbedingt ein ermunterndes Beispiel.
Er lehnte sich ein wenig von mir weg. »Du meinst solche wie mich, die sich mit Diesseitigen einlassen? Hm. Wenn sie masochistisch veranlagt sind …«
»So fühlst du dich?«, fragte ich erschrocken.
»Ich fühle mich eher eigenartig«, sinnierte Hendrik leise und rieb seine Stirn.
»Eigenartig gut oder eigenartig schlecht?«, hakte ich verwirrt nach.
»Fragst du das im Ernst?« Seine Stimme war nun wieder kräftig.
»Natürlich. Ich kann ja leider nicht in dich hineinsehen«, entgegnete ich ein wenig zu schnippisch. Ohne dass ich etwas dagegen tun konnte, formte meine stets lauernde Furcht wieder negative Szenarien. Während ich vor Glück fast zersprang, konnte es doch sein, dass er aus vernünftiger Überlegung seine Meinung geändert hatte und wieder darüber nachdachte, wann er aus diesem Abenteuer ausstieg, bevor die Angst vor Abschied uns völlig zerstörte. Oder nur mich. Mir war bewusst, dass ich oft ungerechte Gedanken hatte, wenn die Verzweiflung durchzubrechen versuchte, aber ich konnte es einfach nicht verhindern.
Seine im grellen Sonnenlicht kastanienfarben schimmernden Augen hatte er zu schwarz bewimperten Schlitzen zusammengezogen. Auch ein alter menschlicher Schutzreflex, schätzte ich.
»Es fühlt sich gut an«, sagte er mit beruhigendem Tonfall. Seine Hand hatte sich der meinen bemächtigt und hielt sie fest umschlossen. Wie abwesend drückte er sie ein wenig zu sehr. »Manchmal ist es aber so … als wäre ich nicht vollständig.«
Ich spannte die Finger, bis er den Griff lockerte. Natürlich ist er nicht vollständig, er ist tot, dachte ich frustriert. Auch wenn er es nicht so nannte, da es irgendwie seiner Existenz widersprach. Es war echt surreal.
Oder machte ihm auch zu schaffen, worüber ich seit geraumer Zeit sehnsüchtige Überlegungen anstellte?
»Ist es, weil wir nicht zusammen sein können wie normale Menschen? Ich meine, so richtig?«, flüsterte ich.
»Du weißt, dass es anders ist.« Es klang fast ein wenig schroff, aber er sagte es dem See.
Ja, er hatte es erklärt. Seine Liebe war pur und rein, geistig. Körperliches Begehren war ausgeknipst. Aber in mir wuchs der heftige Wunsch, eins mit ihm zu werden. Es ließ meine Gedanken immer weniger los. Wie auch? Dieser Traum von einem Jungen überhäufte mich mit Zärtlichkeiten, äußerlich war nicht der geringste Unterschied zu einem lebenden Menschen zu erkennen. Bis auf die überirdische Schönheit natürlich und sein außergewöhnlich edles Wesen. Ich spürte einen Herzschlag und in regelmäßigen Abständen wehte sein Atem an meinem Ohr vorbei. Das war schon irgendwie verrückt. Natürlich musste diese Fassade sein, damit niemand seine wahre Identität erkannte. Aber das machte es mir noch schwerer zu begreifen, dass er nur imitierte, weil er diese menschlichen Funktionen schlichtweg nicht brauchte, um zu existieren. Warum war es ihm dann nicht möglich, alles zu imitieren, was einen Menschen ausmacht? Ich hatte mir oft überlegt, ob es nicht nur eine Schutzbehauptung war, weil Hendrik den Gedanken nicht ertragen konnte, dass mein Schmerz über eine Trennung bei der größtmöglichen Nähe zwischen uns noch potenziert werden könnte und mich möglicherweise schließlich in die Fänge der Bösen trieb.
Der Tag rückte näher, an dem Mom nach London fahren würde, um für das Reisebüro, in dem sie arbeitete, neue Hotels zu testen, und ich wurde immer euphorischer, wenn ich an die daraus resultierende Möglichkeit dachte, die Tage ungestört mit Hendrik zu Hause verbringen zu können. Ich hatte mich schon in jeder Hinsicht darauf vorbereitet, doch er schien jedes Mal nervöser zu werden, sobald ich davon sprach. Überhaupt war Hendrik für mich ein einziger Widerspruch. Anscheinend war ihm gar nicht bewusst, wie verführerisch er ständig auf mich wirkte. Und dann war da immer wieder diese gewisse Reserviertheit. Als ob ein Teil von ihm nicht wollte, dass ich ihm vollends verfiel. Als ob er eine Tür offen halten wollte, durch die ich fliehen konnte. Oder er. Das machte mich wahnsinnig.
»Hast du darüber nachgedacht, zu gehen?«, presste ich mühsam hervor.
»Das ist lange her.«
»Und in letzter Zeit?«
»Nein. Natürlich nicht. Du weißt, was ich für dich empfinde.«
Er würde mich nie anlügen. Das wusste ich. Er konnte es nicht. Er war so – programmiert.
Langsam entspannte sich mein Körper wieder, doch mein Kopf senkte sich matt. Wie in Trance murmelte ich: »Ich brauche eine Überdosis von dir. Wenn du mich irgendwann verlässt, solltest du meine Erinnerung löschen. Denn ich würde nicht aufhören, nach dir zu suchen.«
»Menschen sollten sich in ihresgleichen verlieben«, sagte er. Seine Stimme klang auf einmal emotionslos und fremd, die ausgesprochene Empfehlung an mich wie aufgesagt.
»Menschen verlieben sich aber auch untereinander oft in den Falschen«, entgegnete ich trotzig.
»Schon«, gab er zu.
»Warum sagst du das denn jetzt?«
»Sie sagen, es sei nicht gut.«
»Michael und Thomas?« Die beiden grünäugigen Engel schienen den größten Einfluss auf Hendrik zu haben. Vincent hatte sich bestimmt zurückgehalten. Er saß ja gewissermaßen im selben Boot.
Hendrik kommentierte es nicht.
»Das hab ich schon mal gehört«, murrte ich.
»Es hat sich eben nichts geändert. Sie wundern sich darüber, wie sehr ich mich an das Irdische klammere.«
»Du meinst an mich«, sprach ich es scheu aus.
»Hm.«
»Sie mögen mich nicht«, mutmaßte ich. Glauben wollte ich es aber nicht wirklich.
»Blödsinn. Im Gegenteil. Denkst du, sie hätten sich dir sonst gezeigt?« Diese weiche Stimme war mir wieder sehr vertraut.
»Weiß nicht«, erwiderte ich achselzuckend.
»Sie machen sich nur Sorgen.« Er wischte mit dem Handrücken über seine Stirn. »Mir ist nun mal ein anderer Weg bestimmt.« Jetzt klang Hendriks Stimme wieder fremd.
Erschrocken versuchte ich in seinen Augen zu lesen. Sein starrer Blick in die Ferne wirkte abwesend. Doch im nächsten Moment sah er mich zärtlich an, als hätte er einen Schalter umgelegt. Auch sein Tonfall war der alte. »Es ist ihre Meinung … Du weißt ja, wie ich dazu stehe.«
»Ganz sicher?«
»Ja«, sagte er fest. »Ganz sicher.« Seine Stimme wurde seidenweich. »Nichts möchte ich mehr, als bei dir zu sein.«
»Für immer?« Ich biss mir auf die Lippen. Warum stellte ich ihm diese Frage, auf die es keine Antwort geben konnte?
Wie ich es erwartet hatte, antwortete er nicht.
»Vielleicht kannst du in einem höheren Status irgendwann selbst entscheiden, wo du … arbeitest«, sagte ich hoffnungsvoll. Das letzte Wort betonte ich so, dass er die Anführungszeichen heraushören konnte.
»Ja, vielleicht«, seufzte Hendrik.
Ein flaues Gefühl breitete sich in meinem Magen aus. Möglicherweise war ich dann schon alt und grau und er noch immer jung. Dann würde er gar nicht zu mir zurückkommen wollen.
Ein Eisvogel flog dicht an uns vorbei. Seine türkisblauen Flügel glänzten wie die Metalliclackierung eines Sportwagens.
»Hast du ihn gesehen?«, stieß ich überrascht aus. Nie war mir einer in natura begegnet. »War der schön!«
»So schön wie du«, sagte Hendrik, schnörkellos, direkt, ehrlich.
Ich schwieg. Was konnte ich darauf erwidern, ohne den betörenden Klang seiner Worte zu zerstören, die in meinem Kopf nachhallten? Bei ihm klang es nie aufgesagt oder berechnend, und so hatte er es tatsächlich geschafft, mein Selbstwertgefühl zu steigern. Und doch lag mir auf der Zunge, dass ich leider nicht für immer so aussehen würde. Einem Eisvogel würde man sein Alter nie ansehen, einem Menschen allerdings sehr deutlich. Ich kämpfte mit dem verstörenden Gefühl, mir liefe die Zeit davon.
»Du weißt doch, dass meine Mom nächste Woche für ein paar Tage wegfährt«, wagte ich zögernd einen neuen Vorstoß. »Ich habe das Haus dann für mich. Für uns.« Mit angehaltenem Atem wartete ich auf seine Antwort. Ich hoffte, er würde sich an unser stilles Abkommen erinnern, dass er versuchen würde, sich auf jede ihm mögliche Weise auf mich einzulassen, wenn ich andere wichtige Dinge in meinem Leben, wie die Schule, nicht vernachlässigte. Er hatte gemeint, er habe kein Recht darauf, Mittelpunkt meines Lebens zu sein. Natürlich sah ich das völlig anders.
Hendrik hüstelte. Es war reine Verlegenheit. Ich wusste, dass er nie husten musste, da sein Hals niemals trocken war – anders als bei mir.
»Du hast es versprochen«, flüsterte ich mit rauer Stimme, als er weiter schwieg.
Er zog die Finger durch seine Haare. »Ja«, sagte er, »natürlich werde ich dann bei dir sein, so oft es mir möglich ist.«
Es war nicht die Antwort, die mich zufriedenstellte. Ich schob meine Lippen übereinander und senkte den Kopf.
»Komm her.« Hendrik zog mich in seine Arme und hielt mich ganz fest. Es ging eine unwiderstehliche Macht von seinem Geruch aus; wie der Duft einer Sommerbrise verdrängte er die herbstliche Note in der Luft. Tief und anhaltend atmete ich ihn ein. Ich konnte nicht verhindern, dass mein ganzer Körper still vibrierte, als ich den Atem lautlos wieder ausstieß. Er schaffte es jede Minute, mir die Kraft zu rauben, ihm jemals zu widerstehen. Und ich würde es auch nie wollen. Ich schloss meine Augen. Fühlen, nicht mehr denken. Es war so viel besser.
»Du erweckst mich täglich zu mehr Leben.« Seine Stimme war nur ein Hauch. Ich konnte nicht unterscheiden, ob ich sie nur in meinem Kopf hörte oder ob er wirklich sprach. Vielleicht war es ein bisschen von beidem. Seine Lippen folgten der Linie meines Kinns bis zum Hals und glitten dann langsam hinauf zu meiner Schläfe. Dabei sog er leise und intensiv die Luft ein, als nähme er zum allerersten Mal meinen Geruch wahr.
»Ich liebe dich«, flüsterte er, den Mund an mein Haar gedrückt.
»Ich liebe dich«, schwor ich.
Im nächsten Moment fühlte ich meinen Mund von seinen vollen, weichen Lippen sanft erobert. Ein lieblicher Geschmack von Sommerbeeren umhüllte meine Zunge, Nebel legte sich über meine Sinne, ich hörte lediglich das Blut durch meine Schläfen rauschen. Mein Körper bebte still. Es war, als hätte ich mein ganzes Leben lang darauf gewartet, mich ihm bedingungslos auszuliefern. Niemals würde ich genug von diesem Gefühl bekommen. Dessen war ich mir vollkommen sicher.
Wie konnte er mich nur so küssen und nicht die Beherrschung verlieren, so wie ich beinahe jedes Mal? Wenn er mit seinem überirdischen Körper doch nur fühlen konnte, was ich fühlte.
Ich umklammerte mit einer Hand Hendriks Nacken. Die andere begrub ich lustvoll seufzend in seinem dichten braunen Haar, verzurrte es zwischen meinen gekrümmten Fingern und küsste ihn mit all meiner Leidenschaft und Liebe.
Es gelang ihm, sich leicht aus meiner Umarmung zu befreien. Seine Lider mit den langen schwarzen Wimpern öffneten sich dicht vor meinen Augen. Unter seinem ernsten, aber auch gequälten Blick wurde ich fast besinnungslos. Ich musste tief ein- und wieder ausatmen, um mich runterzufahren. »Ich bin leider nur ein Mensch«, japste ich.
»Schhhh.« Zart strich sein Zeigefinger über meine Unterlippe und brachte mich zum Schweigen.
»Du darfst mich eben nicht so küssen«, schnaufte ich.
»Nein, ich sollte dich nicht küssen«, pflichtete er mir nachdenklich bei.
Ich erschrak. »Oh, doch, das solltest du«, keuchte ich und zog seinen Mund wieder zu mir heran.
Er leistete sekundenlang keinen Widerstand. Erst als meine Hand den Weg unter seinen Pullover suchte, fing er sie ein und zog sie geduldig wieder hervor, um sie festzuhalten. »Wenn du wüsstest, wie sehr ich mir wünsche, dir alles geben zu können«, flüsterte er.
Sein Duft wurde noch betörender. Es war wie ein Zwang, ihn mit vielen tiefen Atemzügen aufzunehmen, bis ich regelrecht davon eingelullt war. Taumelnd kam mir der Verdacht, dass genau diese Wirkung beabsichtigt war. Ein Engel-Ding. Die absolute Ruhe, die sich in mir ausbreitete, durch alle Poren drang, bis ich fast wegdämmerte, legte sich wie ein Schleier über mich und verdrängte die unerfüllte Sehnsucht, die Enttäuschung, dass es wohl nie mehr als Küsse zwischen uns geben würde.
Doch dieser Zustand hielt nur für eine kurze Zeit an. Schnell kam ich wieder zu mir.
»Aber du hast Angst«, sagte ich tonlos.
Hendrik seufzte schwer. Unruhig rieb er seine Handflächen über meine Arme. »Nur Angst, dich zu enttäuschen.«
»Das kannst du gar nicht«, sagte ich unsicher.
»Das tue ich doch schon eine Weile.«
»Nein, das tust du nicht«, entgegnete ich zögernd. »Aber ich frage mich … wenn du Kälte und Hitze nicht spürst, wie du dann jemals …«
Seine Augen verengten sich. »Das stimmt so nicht. Ich fühle Kälte und Hitze«, korrigierte er mich. »Aber da sie meinen Körper nicht beeinträchtigen, musst du mir sagen, ab wann es für dich unangenehm wird. Frierst du jetzt?«
»Nein«, erwiderte ich unwirsch. Verstand er nicht oder stellte er sich absichtlich dumm? Wenn ich eine konkrete Antwort wollte, kam ich nicht drum herum, direkter zu werden. »Ich meinte, ich verstehe es immer noch nicht. Fühlst du denn überhaupt irgendetwas, wenn wir uns küssen?« Verschämt kaute ich auf meiner Unterlippe herum.
Er stieß einen Luftschwall aus und entblößte seine weißen Zähne, als er einmal kurz auflachte. Fast wirkte sein Blick jetzt amüsiert, was ich als sehr menschlich empfand, und fast ärgerte ich mich deshalb, gefragt zu haben. Bei einem menschlichen Jungen hätte ich mich niemals zu so einer beschämenden Frage hinreißen lassen.
Hendriks Gesichtsausdruck wechselte zu einer ernsten Miene. »Du weißt, dies ist nur ein Abbild meines menschlichen Körpers, Val. Nicht wirklich … irdisch, wie deiner. Ich fühle alles. Aber mit dem Geist. Das ist sehr intensiv, glaub mir«, sagte er leise, aber eindringlich, und das Licht in seinen Augen, das nur ich zu sehen bekam, blitzte auf.
»Ach ja?«, brummte ich. Wie konnte ein Fühlen mit dem Geist intensiv sein? Intensiv waren meine Magenkrämpfe, die jedes Mal aufflackerten, wenn wir uns trennten.
»Für mich fühlt es sich wunderschön an«, flüsterte er mit Überzeugung.
Zweifelnd legte ich meinen Kopf schief und hob die Brauen.
Er reagierte mit einem verschmitzt verzogenen Mund. »Auch wenn es mir nicht in die Leiste schießt«, ergänzte er und sah mich nun beinahe fröhlich an, so als hätte er seinen Frieden damit gemacht.
Schön für ihn. Ich hatte es nicht.
»Aber du sagtest, du spürst täglich mehr Leben«, begehrte ich auf. »Das hab ich doch nicht geträumt, oder?«
Hendrik ließ die Arme sinken. Sein Gesichtsausdruck wurde nachdenklich. »Nein, es stimmt. Etwas verändert sich, ganz langsam, aber stetig. Ich kann es spüren, doch ich kann es noch nicht einordnen. Hab Geduld. Bitte.«
»Natürlich«, murmelte ich. Was blieb mir auch anderes übrig?
Verlegen zeichnete ich wieder die Sehnen seiner Hand nach, die nun auf seinem Oberschenkel ruhte. Ich war mir sicher, dass er es deutlicher spürte, als er zugab, ob mit seinen Sinnen oder sonst wie, denn seine Hand zuckte ein ganz klein wenig. Vielleicht war er doch auf bestem Wege, den Sperrcode, wie er es mal genannt hatte, zu knacken.
Ein schnell näher kommendes schepperndes Geräusch ließ mich aufschrecken. Auf dem schmalen, unwegsamen Uferweg, der hinter unserer Lichtung entlangführte, sah ich durch das Grün hindurch einen Jungen auf einem Mountainbike mit irrem Tempo vorbeirasen. Er wurde ziemlich durchgeschüttelt und die alte Kette rasselte ununterbrochen.
»Ziemlich überlaufen hier«, murrte ich.
»Möchtest du gehen?«
»Nein«, brachte ich gequält hervor. Doch unser verschwiegener Platz war irgendwie entweiht.
Und als hätte Hendrik die geheime Sprache der Frauen entwirrt, lachte er. »Gut, hauen wir ab.«
Trügerischer Frieden
Schneller, als ich mich je bewegen könnte, war Hendrik aufgesprungen, zog mich mit einer Hand hoch und unter tief hängenden Zweigen hindurch weg von der kleinen Lichtung am Ufer.
»Es wird sowieso langsam Zeit«, meinte er. »Du willst doch nicht Desirees Party versäumen, oder?«
Ich würde alles versäumen wollen, um mit ihm zusammenzubleiben. Doch anstatt ihm meine beschämende Selbstaufgabe unter die Nase zu reiben, fragte ich: »Kannst du nicht doch hinkommen?«
Sein Blick beantwortete mir die Frage. Er hatte anderes zu tun, als auf Partys zu gehen.
»Fürs Alibi. Sie werden mich nach dir fragen.«
»Mal sehen.«
Hendrik war an dem von hohen Gräsern gesäumten Trampelpfad stehen geblieben und sah sich um. Von dem Jungen auf dem Rad war nichts mehr zu sehen. Auch das Knarren der Kette war fast verhallt.
»Ich denke, von hier können wir starten«, entschied er, als er sicher war, dass wir nicht gesehen werden konnten. »Verschwinden wir von der Bildfläche.«
Und das war hundertprozentig wörtlich zu nehmen, denn in dem Moment, als er meine Taille umfasste, machte er uns beide für menschliche Augen unsichtbar. Ich spürte den Vorgang nie wirklich. Alles war eigentlich wie immer, vielleicht ein bisschen so, als wäre eine Glasscheibe zwischen mir und der Welt. Jedenfalls sah man uns nicht mehr. Und das war gut so, denn jeden hätte auf der Stelle der Schlag getroffen, wenn er erlebte, woran ich mittlerweile gewöhnt sein müsste, was für mich aber nie an Faszination verloren hatte. In Hendriks Körper kam Spannung. Die Flügel schossen rasant aus seinem Rücken, durchdrangen den Pullover, als sei er nicht vorhanden. Er breitete sie zur vollen Spannweite aus und schüttelte sie einmal ganz kurz. Mir war aufgefallen, dass er es routinemäßig tat. Wie ein Ritual. Ein Ruck ging dann durch alle Federn bis hin zu den Spitzen, als würden sie dadurch noch einmal gesondert geordnet. Jede einzelne von ihnen war von makelloser Präzision und schimmerte in einem warmen Braunton, so zart und weich, als wäre sie von einem mikroskopisch feinen Flaum umgeben.
»Startklar?«, fragte Hendrik.
»Jederzeit«, bestätigte ich.
Er presste meinen Rücken gegen seinen Oberkörper wie bei einem Tandem-Fallschirmsprung, nur dass keine Gurte mich hielten, sondern ausschließlich seine starken Arme. Und es ging auf- statt abwärts. Schon mit dem ersten Flügelschlag erreichten wir einen beträchtlichen Abstand zum Boden.
Im Handumdrehen wären wir so nach Hause gelangt, doch irgendwo bei einem der anderen Seen hatte ich den Wagen der Adams geparkt, den diese kaum nutzten und gerne ausliehen, damit ich als Führerschein-Neuling mehr Fahrpraxis bekam. Außerdem stimmten so die Faktoren Entfernung und Zeitaufwand, falls hier jemand herumschlich, der uns kannte. Man brauchte kein mathematisches Genie wie Ben zu sein, um zu checken, dass etwas faul ist, wenn ich, Minuten nachdem ich nachweislich in Highcliffe war, plötzlich woanders gesichtet werde – zum Beispiel von seiner Mutter am Brighton Pier vor einiger Zeit. Gut, statt zu leugnen, es gewesen zu sein, was Futter für sein Misstrauen war, hätte ich ihm wahrheitsgetreu sagen können: Mein Freund hat Flügel und er benötigt für die zweistündige Autofahrt nur einen Wimpernschlag. Das war allerdings keine so gute Idee.
Der Gegenwind strich mir über Gesicht und Haar. Meine Augen hatte ich zum Schutz etwas zusammengekniffen, der Geschwindigkeit angepasst. Manchmal musste ich sie ganz schließen, wenn es Hendrik übermütig einfiel, mir zu imponieren, und er ordentlich aufs Flügelpedal trat. Doch nicht heute. Ganz ruhig, ohne Eile bewegte er seine Flügel, die voll ausgebreitet mindestens doppelt so lang wie seine Arme waren. Der sonore Ton, der das Auf und Ab begleitete, hatte etwas unendlich Beruhigendes. Das Fliegen war mir so vertraut geworden, dass ich mir einbildete, er könne mich ruhig loslassen und ich würde ganz allein durch die Lüfte segeln. Ich streckte beide Arme aus und imitierte in zart angedeuteten Bewegungen seinen Flügelschlag.
»Wie schnell kannst du eigentlich fliegen?«
»Soll ich es dir zeigen?«
»Äh, nein danke. Ich habe meine Sauerstoffmaske gerade nicht dabei.«
Er lachte. »Schnell«, antwortete er nur, während er das Gleiten eher verlangsamte, als er die Bäume am gegenüberliegenden Ufer überflog und den nächsten See anpeilte.
»Wie hab ich das vermisst«, seufzte ich, in die Sonnenstrahlen blinzelnd. »Obwohl der Mondschein auch wunderschön ist.«
»Stimmt, wenn man wach ist.« Weich wie Samt klang seine Stimme dicht an meinem Ohr.
Ich drehte ihm mein Gesicht zu. Er grinste breit und in meinen Gedanken formte sich die beklemmende Vorstellung, wie ich laut schnarchend in seinen Armen gelegen hatte, während er, elegant wie ein Adler, an meinen geliebten weißen Kreideklippen entlanggeschwebt war.
Errötend wandte ich mich ab und bemerkte, wie dicht wir nun über dem Wasser flogen. Deutlich wie in einem Spiegel konnte ich unseren Flug beobachten.
Ich erschrak. »Wir sind nicht unsichtbar, Hendrik«, zischte ich ihm zu.
»Füreinander nicht«, lachte er.
Erleichtert widmete ich mich wieder dem Bild auf der orange leuchtenden Wasseroberfläche. Unter mir war der fantastischste Anblick des Universums. Ein perfekt gestalteter Engel mit sich majestätisch hebenden und senkenden Flügeln trug mich über den See. Es war wie in einem Märchen. Eines, in dem ich die Ehre hatte, die weibliche Hauptrolle zu spielen. Doch ein Blick über meine Schulter bewies mir, dass es Wirklichkeit war. Unfassbare Wirklichkeit.
»Wenn das jemand sehen könnte …«, murmelte ich tonlos.
»Besser nicht. Wir wollen doch keine Panik unter den braven Menschen von Dorset auslösen«, meinte Hendrik, ohne in meinen Flüstermodus zu verfallen. Im Gegensatz zu meiner Stimme war seine jetzt nicht hörbar für Menschen. Ich hatte mich daran gewöhnt, leise sein zu müssen, damit niemand auf unsere unsichtbaren Ausflüge aufmerksam wurde.
Die Bewegung seiner Schwingen wurde so langsam, dass der Flug schließlich nur noch ein Gleiten war. Ich glaubte, er würde mit der Flügelspitze im nächsten Moment das Wasser berühren, als er in extremer Schräglage eine Schleife vollführte, um dann noch knapper über der Wasseroberfläche zu segeln. Nun erkannte ich, dass auch er unsere Spiegelung eingehend betrachtete. Sein Kopf rollte leicht hin und her und ich glaubte, ein leichtes Lächeln auf seinen Lippen zu entdecken. Ich erwiderte es glücklich.
Plötzlich griff Hendrik sich an die Schläfe. Sein Gesicht verzerrte sich und ein Ruck ging durch seinen Körper. Es ging alles wahnsinnig schnell. Wir sackten nur für eine Sekunde ab, da wir aber nicht einmal eine Körperlänge über dem Wasser waren, tauchten wir platschend in den kalten See ein. Ich kreischte vor Schreck laut auf, als das kühle Wasser mich bis zu den Hüften umschloss. Das unerwartete Bad war allerdings kürzer als mein anhaltender Schrei, denn nur einen Wimpernschlag später katapultierte uns Hendrik wieder hinauf in schwindelerregende Höhe. Ich war so schockiert, dass meine Selbstbeherrschung aussetzte.
»Was war das denn?«, quiekte ich gedankenlos in höchster Tonart.
Mit energischem Blick legte Hendrik sofort den Zeigefinger auf die Lippen.
Oh shit. Der See war wie eine offene Bühne. Auch wenn ich niemanden sah, konnten Menschen auf verdeckten Wegen spazieren. Ich nickte und schloss fest den Mund. Es war auch nötig, da Hendrik das Tempo im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend erhöht hatte. Damit ich überhaupt noch atmen konnte, musste ich das Kinn gegen die Brust senken, um meine Nasenlöcher zu schützen. Die Seenlandschaft unter mir nahm ich kaum noch wahr. Ohnehin hatte ich keine Orientierung mehr. Meine Gedanken wirbelten durcheinander. Wieso hatte er die Kontrolle verloren? Dass das überhaupt passieren konnte, hatte ich nicht für möglich gehalten. Es beunruhigte mich in hohem Maße.
Hendrik wechselte in den Sturzflug auf das geparkte Auto zu, stoppte dann überraschend sanft und setzte mich besonders behutsam auf dem Sandboden des Parkplatzes ab, so als wollte er mir beweisen, Herr der Lage zu sein. Mein Kopf fühlte sich an wie in eine Salatschleuder geraten.
»Alles klar«, sagte Hendrik, als er mich losließ.
Schwankend stützte ich mich an dem dunkelgrünen alten Rover ab. Es standen nur zwei weitere verlassene Fahrzeuge auf dem Sandplatz, also war unser plötzliches Auftauchen kein Problem.
»Nichts ist klar!«, schnaubte ich unter Atemnot. Es brauchte ein paar kräftige Atemzüge, bis meine Lunge sich wieder mit Luft angefüllt hatte und ich weiter schimpfen konnte. »Du hast die Kontrolle verloren! Wie kannst du die Kontrolle verlieren?« Meine Stimme überschlug sich fast.
Hendrik schwieg, aber es war offensichtlich, wie unangenehm ihm der Vorfall war.
»Du hattest wohl doch ein Energieproblem?«, keuchte ich.
Er schüttelte kaum merklich den Kopf.
Fahrig begann ich das Wasser aus dem Saum meines Pullovers zu wringen. »Es war wie damals bei den Wildpferden im New Forrest«, erinnerte ich mich und hob abrupt den Kopf. »Du kannst mir nicht erzählen, dass das normal ist.«
»Normal?« Er lächelte schwach. »Definiere normal.«
Touché!
»Beunruhigt dich das überhaupt nicht?«, fragte ich gereizt.
»Es tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe«, meinte er mit entschuldigendem Lächeln. Es wirkte nicht souverän. »Ich war wohl einfach unkonzentriert, hab mich ablenken lassen.«
Von unserem Spiegelbild? Wollte er es jetzt mir in die Schuhe schieben? »Na, dann hoffe ich, dass du dich in großen Höhen nicht so leicht ablenken lässt – meinen Knochen zuliebe«, nuschelte ich mit sarkastischem Unterton, denn ich nahm ihm seinen schwachen Erklärungsversuch nicht ab.
Hendrik schloss eilig den Wagen auf. »Wir sollten sofort zurück und dich in trockene Klamotten kriegen. Möchtest du wieder fahren?«, fragte er.
Von der Taille abwärts durchtränkt, verspürte ich ausnahmsweise keine große Lust. »Nein, danke«, knurrte ich.
»Gut.« Er öffnete die Beifahrertür, stoppte mich aber, als ich einsteigen wollte. »Warte kurz.« Er zerrte eine gefaltete alte Decke aus dem Kofferraum. »Leg die lieber drunter.« Er tat es selbst und war dann im Nu auf der Fahrerseite eingestiegen.
»Du weichst mir immer aus«, nörgelte ich, als ich mich fröstelnd auf der Decke niederließ. Ich zog die Tür zu und verschränkte missmutig die Arme. »Aber diesmal lasse ich mich nicht mit irgendwelchen Ausflüchten abspeisen. Diesmal erklärst du es mir. Und komm mir nicht mit Migräne oder so. Ich weiß, dass du keine menschlichen Schwächen hast!«
Das Wageninnere war durch die Sonne aufgeheizt und so legte sich wenigstens das Zähneklappern.
Erst als er den Motor gestartet hatte und meinen strengen, unnachgiebigen Blick nicht mehr ignorieren konnte, wandte er sich mir zu: »Ich kann es nicht erklären.«
Bei seiner rasanten Abfahrt knirschte der Sand unter den Reifen und etwas Staub wirbelte auf. An der Ausfahrt schlug er das Lenkrad beim Abbiegen hart rechts ein und richtete seinen Blick dann stur nach vorn, als wäre das Thema mit diesen fünf Worten abgehakt.
»Das glaube ich dir nicht«, protestierte ich.
Seine Lippen mahlten übereinander. »Mach doch kein Drama draus«, bat er.
»Doch. Diesmal schon.«
Er bedachte mich mit einem kurzen, unglücklich wirkenden Blick, was nicht zur Besserung meines Befindens beitrug. Meine Miene blieb fordernd. Eingefroren.
»Ich kann dir nur sagen, was ich dabei fühle«, räumte er schließlich ein.
»Dann sag’s mir«, beharrte ich.
»Es wird dir nicht gefallen«, murmelte er.
Ich atmete tief ein und wieder aus. »Egal. Ich will es hören.«
Er drehte den Kopf zu mir, wirkte unentschlossen. Dann starrte er wieder auf den schnurgeraden Weg.
Am Ende der holprigen Strecke konnte ich bereits die befestigte Straße erkennen.
»Wenn du es wirklich unbedingt wissen willst …« Er machte eine Pause. Seine Brauen verengten sich. »Es ist, als ob jemand nach mir greifen würde. Als ob ich für eine Sekunde gar nicht mehr hier wäre.« Er wirkte selbst erschrocken, nun, da er es ausgesprochen hatte.
Panik schoss mir ins Mark. »Oh«, stammelte ich. »Das ist nicht gut.« Ein Zittern packte mich mit aller Macht, obwohl die Sonne noch längst nicht aufgegeben hatte.
»Es ist sicher nichts«, meinte er mit fester Stimme.
Aber ich konnte mich nicht beruhigen. »Nichts? Haben denn die anderen ähnliche Attacken? Passiert so etwas Engeln ab und zu? Der große Ruf oder so?«, hoffte ich.
Statt eine Antwort zu geben, runzelte er die Stirn noch ein wenig mehr.
Frustriert ließ ich den Kopf hängen. Hatte Vincent sich geirrt? War die relative Ruhe, die ich in der letzten Woche empfunden hatte, doch nur ein trügerischer Frieden?
Der Motor begleitete unseren Heimweg mit sonorem Brummen. Die Sekunden, in denen wir schwiegen, kamen mir wie eine Ewigkeit vor.
Ohne den Blick von der Straße abzuwenden, legte Hendrik mir seine Hand auf die Schulter. »Du wolltest es unbedingt wissen und ich habe es dir ehrlich gesagt. Es ist wahrscheinlich nichts Bedeutendes.« Es schien, als spreche er mehr zu sich selbst. »Vincent hat sich ganz sicher nicht geirrt.«
»Wie kannst du schon wieder wissen, was ich gedacht habe?«, fragte ich, ohne mein Schmollen aufzugeben.
»Vielleicht kenne ich dich inzwischen ein bisschen.« Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Er fädelte sich auf der Hauptstraße ein und trat das Gaspedal durch. »Du solltest dir keine Sorgen machen.« Der Wagen hielt konstant die Spur, obwohl er mich nun sekundenlang direkt ansah. Dann zog er eine Braue hoch und begann unverhohlen zu grinsen. »Höchstens darüber, was du heute Abend anziehst. Das könnte ein echtes Problem werden.«
Okay, dachte ich, du willst mal wieder das Thema beenden. Ich spürte förmlich, wie seine Gedanken sich darauf konzentrierten, dass ich mich beruhigte und nicht weiter bohrte. Fast so, als verbinde uns eine unsichtbare Brücke.
Während ich noch überlegte, ob ich auf den plumpen Themenwechsel eingehen wollte, ergänzte Hendrik mit zärtlichem Blick: »Wobei es für mich nicht wichtig ist. Du kennst meine Meinung. Ich sehe nicht deine Kleidung, ich sehe dich.«
Sein Lächeln raubte mir kurzfristig den Atem und so entkam er einer Aufnahme des schwebenden Verfahrens.
»Ich hatte keine Zeit, einkaufen zu gehen. Ich musste ja lernen«, rechtfertigte ich mich schnippisch. Mit spitzen Fingern zupfte ich am Saum des nasskalten Pullovers. »Wieso hast du eigentlich nichts abgekriegt?«, beklagte ich mich mit einem Seitenblick auf Hendrik. Kein Wassertropfen haftete ihm an. Wohingegen meine Jeans bereits die alte Decke zu durchfeuchten begann.
»Die Elemente tangieren mich nicht, wenn ich es nicht will, weil ich genau genommen nur noch ein Schatten in dieser Welt bin«, meinte er übertrieben pathetisch.
Ich beäugte ihn kritisch. »Ja, das klingt sehr theatralisch.«
»Aber es ist wahr«, verteidigte er sich, dramatisch die Brauen nach oben ziehend.
Ich verzog das Gesicht. Der Wind zerzauste doch seine Haare, wenn er in meiner Welt war. Manchmal wusste ich nicht, wie ich seine Metaphern einordnen sollte. Irgendwie war auch er ein Meister darin, Wahrheiten auf seine Weise zu interpretieren. Nur ein Schatten. Davon jedenfalls wollte ich nichts hören. Schatten verschwinden ohne Licht.
Daher wechselte dieses Mal ich das Thema. »Wir haben noch ein Problem.«
»Reichen unsere nicht?«, murmelte er.
»Anscheinend nicht. Sicher hast du dir schon eine plausible Geschichte für Mom und Mrs Adams wegen meiner klitschnassen Klamotten ausgedacht, oder?«, fragte ich herausfordernd.
»Hmmm. Mal sehen …« Er kratzte sich mit großer Gebärde am Kinn. »Du wolltest die Wassertemperatur prüfen und bist in den See geplumpst?«, schlug er ohne sichtbare Erwartung für meine Zustimmung vor.
»Wäre ich dann nicht völlig nass?«
»Das können wir ja noch nachholen«, grinste er frech.
Ich schnaubte durch die Nase. »Untersteh dich. Es fühlt sich auch so schon scheiße genug an.«
»Ich verstehe. Entschuldige.« Er warf mir einen mitfühlenden Blick zu, der allerdings nicht mit voller Inbrunst ausgeführt war und so mein Misstrauen heraufbeschwor. Seine engelhafte Fürsorge hatte wohl gerade Urlaub. Oder er versuchte auf diese Weise, den Badeunfall als Lappalie abzutun.
Vorwurfsvoll kniff ich die Augen zusammen. »Du kannst ja mal versuchen, dich daran zu erinnern, wie sich eine Badetemperatur von fünfzehn Grad anfühlt«, knirschte ich.
»Nicht so schlimm wie zehn Grad«, flachste er, um sich einen bösen Blick von mir einzufangen.
»Als hättest du das ausprobiert«, bezweifelte ich.
»Nein, aber ich kann rechnen.«
»Ein sehr konstruktiver Beitrag.« Erneut warf ich ihm einen strafenden Blick zu.
Ich wusste, dass nicht allein die Nässe für mein Frösteln sorgte. Auch die Hilflosigkeit, dass Dinge geschahen, die ich nicht verstand. Ganz langsam, aber hämisch begann die Eisenkralle wieder mein Herz zu streicheln.
»Ernsthaft, es fühlt sich wirklich scheußlich an, Hendrik«, nörgelte ich. »Kannst du uns nicht samt Auto nach Hause beamen?«
Seine Gesichtszüge wurden ernst. »Offizielle Ausflüge haben so ihre Beschränkungen, was die Magie betrifft.« Seine Lippen mahlten kurz übereinander. »Aber wir lösen das mal eben anders. Ich möchte nämlich nicht schuld sein, wenn du krank wirst.«
»Ich werde nie krank«, konterte ich bockig. »Ich steh nur nicht darauf, in Klamotten zu baden und mich hinterher wie ein nasser Sack zu fühlen.«
Hendrik lenkte den Wagen in einen schmalen Feldweg, der auf beiden Seiten von hohen Büschen und Sträuchern gesäumt war. Tiefe Muster waren in den Sand gedrückt, die Spur von gewaltigen Reifen, die vermutlich zu einem Traktor gehörten. Unter einem Dach aus Zweigen ließ er die Räder vorsichtig auf dem leicht abschüssigen Grasstreifen am Rande ausrollen. Die Achsen des betagten Wagens ächzten.
Hendrik drehte sich zu mir. »Warte kurz.«
»Was –?« Bevor ich fragen konnte, saß ich allein im Wagen. Wunderbar. Klatschnass ausgesetzt in der Walachei. Es lief super.
Als ich mich gerade ausgiebig in meinem Selbstmitleid suhlen wollte, erschien Hendrik neben dem Seitenfenster, auf dem Arm frische Sachen zum Anziehen, obendrauf ein Handtuch. Mit der freien Hand öffnete er die Beifahrertür. »Entschuldige, hat etwas länger gedauert. Deine riesige Kleiderauswahl hat mich überfordert«, grinste er.
Ich strafte die Ironie des zweiten Satzes mit Nichtachtung. »Stimmt, du bist ganz schön langsam«, erwiderte ich mit überheblichem Unterton. In Wahrheit war er keine halbe Minute weg gewesen und ich beneidete ihn ein bisschen – nein, sehr – um seine Art der Fortbewegung.
»Hier!« Lachend warf er mir das Handtuch zu. Schuhe und Klamotten legte er auf das Autodach und öffnete auch die hintere Tür, sodass beide parallel zueinander standen und mir Sichtschutz boten. »Ich lass dich dann mal allein in der Umkleidekabine«, meinte er schmunzelnd und ging zur Vorderseite des Wagens, um sich mit dem Rücken zu mir mit verschränkten Armen gegen die Haube zu lehnen.
Ich stieg aus und begutachtete den vollständigen Stapel in dem Bewusstsein, endlich bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet worden zu sein, nachdem er nun offensichtlich auch den Inhalt meiner Wäscheschublade kannte.
Als ich mich umgezogen hatte, verschwand Hendrik für Sekunden mit den nassen wie trockenen Sachen und erschien dann aus dem Nichts neben mir auf dem Fahrersitz.
»Ich hab alles in den Trockner getan«, erwähnte er beiläufig.
Ha! Aus seinem Mund klang das kurios, sehr weltlich.
»Die Schuhe hoffentlich nicht«, tat ich unbeeindruckt.
»Nein. Die hab ich in die Mikrowelle gestellt«, meinte er schmunzelnd.
»Du weißt, wie ein Trockner funktioniert?«, fragte ich ungläubig, während ich noch den zweiten Schnürsenkel verknotete.
»Ich sagte nicht, dass ich ihn angeschmissen habe. Das machst du nachher.«
»Denkst du nicht, meine Mutter wundert sich darüber, wie die Sachen hineingekommen sind?«
»Sie wird das Gerät heute ignorieren.«
»Du hast sie also manipuliert«, bemerkte ich und blickte gespielt vorwurfsvoll zu ihm auf.
Er zog den Mund schief und verbarg ein Grinsen. »Eine völlig neutrale Angelegenheit. Hat keinerlei Auswirkungen auf irgendetwas.« Seine schönen braunen Augen ruhten wärmend auf mir. »Und, fühlst du dich jetzt besser?«
»Nein«, tat ich beleidigt. »Ich möchte mich auch so bewegen können wie du.«
Hendrik lachte lautlos und startete den Motor.
Der grüne Rover im fortgeschrittenen Alter passte perfekt zu dem historischen, reetgedeckten Steinhaus der Adams, das von immer noch blühenden roten und rosafarbenen Rosensträuchern bewachsen war. Hendrik ließ den Wagen die Auffahrt hinaufrollen und hielt dicht vor dem Schuppen.
»Also, versuchst du zu Desiree zu kommen?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Vielleicht werde ich mich kurz mal blicken lassen«, blieb Hendrik unbestimmt.
Mir war bewusst, dass er andere Verpflichtungen hatte, dass mein Schutz zwar ein wichtiger Bereich war, wie er mir versichert hatte, aber dass er ihn schon sehr ausgeweitet hatte. Dazu kam seine Anwesenheit in der Schule und bei den Adams – oder bei Ben, der mit ihm zu gern über Astronomie diskutierte. Auch alles meinetwegen. Um sein Alibi zu bedienen. Waren die Aussetzer vielleicht Warnschüsse von seinem Boss?
Und obwohl ich genau wusste, wie egoistisch ich war, entfuhr mir: »Ohne dich hab ich eigentlich keine Lust.«
»Du solltest deine Freundin nicht enttäuschen.«
Sie gehörte mittlerweile tatsächlich zu meinem engeren Freundeskreis und erwartete natürlich, dass ich kam.
»Man wird nur einmal siebzehn«, erinnerte Hendrik.
»Normalerweise, ja.« Ich betrachtete seine samt schimmernde Haut über den Wangenknochen. »Wirst du dich je verändern?«
»Was meinst du?«, fragte Hendrik.
»Ich meine, Engel werden nicht älter, oder?«
Er zog die Brauen zusammen. »Das beschäftigt dich?«
»Entschuldige, dass ich mir Sorgen mache, in zwanzig Jahren auszusehen wie deine Mutter.«
Er sah mich ernst an. Hatte ihn die Vorstellung nun doch irritiert? »Sicher werden wir älter, schätze ich, die Zeit bleibt ja nicht stehen. Auch wenn sie für mich nun irgendwie anders läuft.«
»Aber sieht man es euch auch an?«
Er hielt kurz inne. »Vielleicht nicht. Ach, Val, ich weiß nicht …«
»Vincent zum Beispiel –«
»Vincent war kein Mensch wie ich.«
»Ich weiß, er war schon immer ein Engel. Trotzdem. Er ist doch mindestens so alt wie Nectobar. Also vierhundert? Fünfhundert?«
»Wenn das mal reicht«, murmelte Hendrik.
»Und? Sieht er vielleicht einen Tag älter aus als fünfundzwanzig?«
»Eher nicht, nein«, gestand Hendrik ein.
»Dann verstehst du meinen begründeten Frust?«
»Du solltest darüber jetzt noch nicht nachdenken. Du bist siebzehn.«
»Und in dreizehn Jahren schon dreißig«, rechnete ich ihm missmutig vor.
Er stöhnte und entzog seinen Arm meiner Umklammerung. »Das ist eine Diskussion, die ich nicht gewinnen kann, hätte mein Vater gesagt. Wenn es bei Frauen um das Aussehen und Alter geht, haben Männer keine Chance, etwas Richtiges zu sagen.«
»Du nimmst mich nicht ernst«, schmollte ich.
»Val, das ist eine sinnbefreite Diskussion. Wir wissen, wo wir stehen. Wir sind nun mal leider verschieden.« Er verschränkte abweisend die Arme.
Aber ich ließ nicht locker. »Ich denke, man sieht es in den Augen. Michael sieht höchstens aus wie neunzehn, aber in seinen Augen erkennt man Erfahrung aus mindestens fünfzig Jahren.«
»Wenn du meinst.«
Ich streichelte über seine Schulter und er löste die Arme friedlich aus der Verschränkung.
»Wann hast du eigentlich Geburtstag?«
»Wir haben doch gerade geklärt, dass ich nicht älter werde.«
»Ich weiß. Nur so«, drängelte ich.
»Ich bleibe achtzehn, also ist es doch egal«, wiegelte er stur ab.
»Im Sommer oder im Winter?«
Er stockte kurz. »Im Sommer. Und nun reicht es, Sherlock.«
Wieder einmal kam ich nicht dahinter, ob er sich nicht erinnern wollte oder konnte.
Hendrik stieß seine Tür auf und verließ behände den Wagen. Als ich ausstieg, war er schon ums Auto herumgekommen und schloss die Wagentür hinter mir. Er ging mit mir bis zu unserer Grundstücksgrenze, die lediglich durch ein paar niedrige Ziersträucher markiert war. Mein Blick fiel auf das Dachfenster des Adams-Hauses, hinter dem ich Marica das erste Mal erblickt hatte. »Marica wäre jetzt Ende fünfzig«, bemerkte ich leise. »Sie sieht keinen Tag älter aus.«
»Sie ist nach menschlichem Ermessen tot. Ihr Aussehen wurde eingefroren.«
»Siehst du? Das meine ich. Du bist nach menschlichem Ermessen auch tot.«
»Ja, vielen Dank, dass du mich daran erinnerst », erwiderte er finster.
»Aber du bist zum Glück keine Lichtgestalt«, stellte ich mit Genugtuung fest. Ich sah wieder zum Fenster hinauf. »Wann kommen Marica und Vincent eigentlich zurück?«
»Keine Ahnung.«
»Denkst du, sie kommen überhaupt zurück?«
»Nachdem sie ihr Wiedersehen ausgiebig genossen haben – vielleicht.«
Es wollte mir nicht so recht gelingen, mir eine Vorstellung davon zu machen. In meinem Kopf entstand das Bild zweier verschmolzener Körper, die wie ein leuchtender Komet durch die Galaxie reisten.
»Denkst du, Vincent hat Ärger bekommen? Ich meine, die Info über das Buch ist ja wohl kaum für Menschen gedacht.«
Hendrik wiegte unschlüssig den Kopf. »Er wollte dir damit danken. Immerhin hast du seine geliebte Marica aus der Dämonenfalle gerettet.«
»Na ja, eigentlich hat er –«
Ich stockte. Hendriks Gesichtsausdruck hatte sich plötzlich verändert, seine Augen rollten in die äußersten Winkel. Ich verstand sofort, dass sich ein Zuhörer näherte.
Meine Mutter kam mit zwei Papiertüten aus der Haustür geeilt, verschwand kurz hinter der Ecke, wo unsere Biotonnen standen, und tauchte im nächsten Moment wieder auf. »Hallo, ihr beiden. Hattet ihr einen schönen Nachmittag?«, rief sie herüber, als sie uns erspähte.
»Hallo, Mrs Summers«, sagte Hendrik, höflich wie immer.
»Hallo, Hendrik.« Ihre Augen strahlten. Seine Wirkung auf Menschen war unfassbar. Mütter, Lehrer, Mitschüler – alle bekamen einen Glanz in den Augen, sobald sie ihn sahen. Aber niemand wunderte sich darüber.
»Ja, danke, Mom«, antwortete ich sehr knapp.
Feingefühl besaß sie. »Das ist schön«, erwiderte sie lächelnd und zog sich zurück ins Haus, ohne dass ich jedoch die Haustür zuschnappen hörte.
»Also, vielleicht bis später«, sagte ich leise.
»Ich schau mal, was ich tun kann.« Er blickte seufzend zu mir herab. »Geh schon, sonst bittet uns deine Mutter noch zum Tee herein.« Er grinste aufmunternd und ich ließ widerwillig seine Hände los.
»Na gut«, sagte ich zerknirscht.
Hendrik gab mir einen langen Kuss auf die Wange. »Ich vermisse dich genauso«, hauchte er in mein Ohr. Dann ging er mit schnellen Schritten davon und ich sah ihm nach, bis er sich an der Haustür winkend umdrehte und dann in dem von der sinkenden Sonne in ein unwirkliches Rot getauchten Cottage verschwand. Erst dann wandte ich mich zum Gehen. Der Himmel hinter unserem Haus sah in seiner intensiv orangeroten Färbung aus, als ob er brannte.
Durch die nur angelehnte Tür schlüpfte ich ins Haus, einer Duftwolke frisch gebackenen Kuchens entgegen. Moms Apfelverwertungsmaschinerie lief auf Hochbetrieb. Unsere Bäume hatten schier unerschöpfliche Reserven.
Mit einem Geschirrtuch in der Hand kam sie aus der Küche. »Ach, Hendrik ist schon fort?«, bemerkte sie enttäuscht. »Ich habe gerade Vanilletee vorbereitet. Und der Kuchen ist ofenfrisch.«
Ich biss mir auf die Lippen, um ein Grinsen zu unterdrücken. Hendriks feine Antenne hatte die richtigen Schwingungen aufgefangen.
»Er hat noch einiges zu tun«, gab ich als Grund für seinen schnellen Aufbruch an.
»Lernen? Am Sonntag? Geht er nicht mit dir zur Party?«
Ich hatte inzwischen ein großes Talent entwickelt, mich so auszudrücken, dass es streng genommen der Wahrheit sehr nahe kam. Für die Interpretationen meiner Zuhörer konnte ich schließlich nichts. Ja, es war fadenscheinig, doch es war besser, als eine direkte Lüge auszusprechen. »Er hat nicht alles geschafft, weil er den ganzen Nachmittag mit mir zusammen war. Er kommt wohl später nach«, sagte ich und spürte, dass meine Wangen sich blitzartig erwärmten, was vermutlich mit einer leichten Rötung einherging. Zum Glück war das Licht im Flur schummrig.
»Aha.« Sie rieb das Geschirrtuch zwischen den Händen. »Na gut. Lust auf einen Vanilletee?«
Die Aussicht auf ein durchwärmendes Heißgetränk war verlockend. »Klar. Etwas Zeit hab ich noch.«
»Sehr schön.«
Sie verschwand wieder in der Küche, doch bevor ich ihr folgte, ging ich kurz in unseren kleinen Hauswirtschaftsraum und linste in den Trockner. Meine Sachen lagen tatsächlich darin. Ich konnte mir ein leises Lachen nicht verkneifen, stellte ihn an und ging zu Mom hinüber. Normalerweise kommentierte sie derartige häusliche Aktivitäten. Heute nicht. Sie war noch im von Hendrik verordneten Ignorier-Modus. Ich schmunzelte in mich hinein. Das war echt irre.
Auf Grandmas altem Eichentisch, dem Herzstück unserer mediterrangelb gestrichenen Küche, stand der duftende Kuchen, den Mom gerade anschnitt. Um mehr Platz für den Tee und die Tassen zu schaffen, hievte ich die riesige Schale mit Cox-Orange-Äpfeln auf die lange Arbeitsplatte neben dem Herd.
»Willst du die alle heute noch verarbeiten?« Ich setzte mich und schob mir ein paar Krümel vom Kuchenteller in den Mund.
»Nein. Ich treffe mich gleich mit Rita.«
»Alles klar«, nuschelte ich kauend. Wenn ihre Freundin Rita die Probleme des Singlelebens dozierte, war das meist abendfüllend. Das konnte von Vorteil sein, falls ich mich heute Nacht verspätete.
»Iss doch ein ganzes Stück«, meinte Mom, als sie dampfenden Tee in zwei große Henkeltassen goss.
»Lieber nicht, es gibt bei Desiree was zu essen.«
»Verstehe. Aber du bringst ihr einen mit«, bestimmte sie. »Ich habe drei Stück gebacken.«
»Okay.« Ich wärmte meine Hände an der getöpferten Tasse, bevor ich Milch hineingoss.
»Frierst du, Schatz?«, fragte Mom besorgt. »An diesem wunderschönen warmen Tag?«
»Nein. Es fühlt sich einfach nur gut an«, seufzte ich. Verdammt gut. Die Wärme breitete sich noch schneller in meinem Körper aus, als ich unauffällig die Pulsadern an die Tasse schob.
Sie musterte mich. Gleich würde sie Fragen zum Nachmittag stellen, also kam ich ihr zuvor: »Desiree hat echt Glück. Sie macht nämlich ’ne Grillparty.«
»Und Hendrik arbeitet lieber, als mit dir zur Party zu gehen? Ich dachte, ihr seid unzertrennlich.«
»Das ist doch lobenswert, oder nicht?«, antwortete ich etwas schnippisch.
»Aber er wird doch gar nicht benotet«, wusste sie.
Ich schluckte.
»Machst du dir Gedanken, dass er etwas anderes vorhaben könnte?«, fragte sie mit einfühlsamer Stimme und schräg gelegtem Kopf, als wäre sie meine Therapeutin.
Ich musste heftig lachen. Es brach aus mir heraus, ohne dass ich es aufhalten konnte.
»Was? Was hab ich denn gesagt?«, fragte sie völlig verständnislos.
»Nichts, Mom. Alles gut. Ich denke, ich mache mich mal lieber fertig.« Unter ihrem irritierten Blick trank ich den restlichen Tee in einem Zug aus.
Worauf sie hinauswollte, war klar. Aber das Thema Eifersucht hatte ich in den Griff bekommen. Ich bekam nur noch bedingt Mordgelüste, wenn bestimmte Mitschülerinnen wegen Hendrik zu geifernden Hyänen mutierten. Damit hatte ich meinen dämonischen Stalkern Nectobar und Tagonharis Angriffsfläche entzogen. Eifersucht war eine riesige Einladung an sie, sich auf die Seele zu stürzen. Mir wurde mulmig zumute. Sie hatten mich schon länger nicht heimgesucht. Was heckten sie aus? Warteten sie auf eine neue Schwachstelle?
»Du scheinst dir ja sehr sicher zu sein«, meinte Mom mit prüfendem Blick.
»Ja.« Ich stand auf und sprintete ohne ein weiteres Wort die steile Treppe zu meinem Zimmer hinauf.