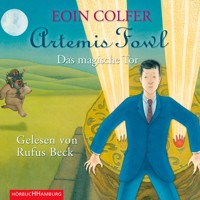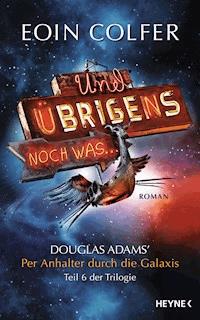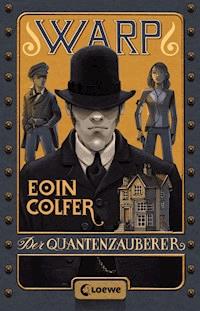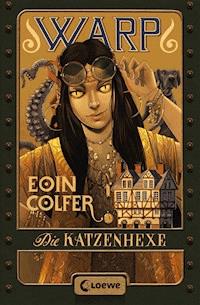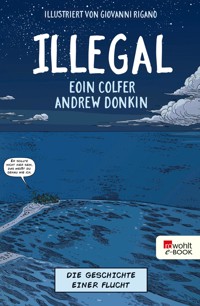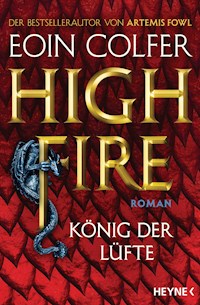
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Einst waren Drachen die Herrscher der Erde und die Könige der Lüfte, aber das ist lange vorbei. Vern, ehemals unter dem Namen Lord Highfire verehrt und gefürchtet, ist der Letzte seiner Art. Desillusioniert und deprimiert hat er sich in die Sümpfe Louisianas zurückgezogen, wo er, von den Menschen unbemerkt, seine Tage mit Wodka und schlechten TV-Serien verbringt. Seine selbstgewählte Einsamkeit gerät jedoch in Gefahr, als er eines Tages dem vierzehnjährigen Halbwaisen Squib Moreau begegnet. Gerade als der grummelige Vern beginnt, sich mit Squibs Anwesenheit in seinem Leben abzufinden, wird dieser von einem korrupten Polizisten entführt und der Mafia übergeben. Vern beschließt, dass es an der Zeit ist, den Menschen eine Lektion zu erteilen. Schließlich ist er immer noch der mächtigste Drachenlord, den es je gegeben hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Einst waren Drachen die Herrscher der Erde und die Könige der Lüfte, aber das ist lange vorbei. Vern, ehemals unter dem Namen Lord Highfire verehrt und gefürchtet, ist der Letzte seiner Art. Desillusioniert und deprimiert hat er sich in die Sümpfe Louisianas zurückgezogen, wo er, von den Menschen unbemerkt, seine Tage mit Wodka und schlechten TV-Serien verbringt. Seine selbstgewählte Einsamkeit gerät jedoch in Gefahr, als er eines Tages dem fünfzehnjährigen Halbwaisen Squib Moreau begegnet. Gerade als der grummelige Vern beginnt, sich mit Squibs Anwesenheit in seinem Leben abzufinden, gerät dieser dem korrupten Polizisten Regence Hooke in die Hände. Vern beschließt, dass es an der Zeit ist, den Menschen eine Lektion zu erteilen. Schließlich ist er immer noch der mächtigste Drachenlord, den es je gegeben hat …
Der Autor
Eoin Colfer wurde 1965 in Wexford, einer Küstenstadt im Südosten Irlands, geboren. Nach seinem Studium in Dublin kehrte er in seinen Heimatort zurück und arbeitete als Grundschullehrer. Mit seiner international gefeierten Jugendbuchserie Artemis Fowl gelang ihm der Durchbruch als Schriftsteller. Seine Bücher erscheinen in vierundvierzig Ländern und wurden bislang weltweit über achtzehn Millionen Mal verkauft. 2004 erhielt er den »Deutschen Bücherpreis«. Highfire ist sein erster Fantasy-Roman für Erwachsene. Eoin Colfer lebt mit seiner Familie in Wexford.
Eoin Colfer
HIGH
FIRE
KÖNIG DER LÜFTE
ROMAN
Aus dem Englischen übersetzt von Marcel Aubron-Bülles
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
HIGHFIRE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 05/2021
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2020 by Eoin Colfer
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe und der
Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München,
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-25134-5V001
www.heyne.de
1
Kurz gesagt, Vern traute den Menschen nicht. Nicht einem. Er hatte in seinem Leben viele kennengelernt und einige wenige sogar gemocht, aber am Ende hatten sie ihn alle an den geifernden Mob verraten. Deshalb versteckte er sich im Honey-Island-Sumpf, und hier war er sicher.
Vern kam mit dem Sumpf klar, wie man mit ihm nach all der Zeit klarkommen konnte. Verdammt, diese langen Jahre reihten sich aneinander wie die Ziegel der Straße, die der gute alte König Darius vor langer Zeit, irgendwann vor Christi Geburt, hatte legen lassen. Komisch, dass all das aus heiterem Himmel wieder auftauchte, wie diese alte persische Straße. Er konnte sich kaum an letzte Woche erinnern, und dann blitzten vor seinem geistigen Auge Erinnerungen auf, die Tausende von Jahren zurückreichten – Pi mal Daumen. Vern hatte die Hälfte der Ziegel selbst gebrannt, als für ihn ordentliche Maloche noch infrage gekommen war. Hätte ihn fast den eigenen Verbrennungsmotor gekostet. Wegen dieses Scheißjobs hatte er sich zwei Stadien früher als geplant gehäutet, was an der Arbeit und seiner Kost gelegen hatte. Damals hatte niemand Ahnung von Ernährung gehabt. Heute ernährte sich Vern grundsätzlich ketogen, fettreich, und nahm wenig Kohlehydrate zu sich, abgesehen von seinen geliebten Frühstücksflocken. Für einen Drachen ergab die Keto-Diät natürlich Sinn, vor allem bei seiner Kerntemperatur. Bedauerlicherweise bedeutete das, dass Bier für ihn nicht mehr infrage kam, aber er behalf sich mit Wodka. Absolut war seine Lieblingsmarke: ein paar Umdrehungen zu viel, aber äußerst verträglich. Und Waxman lieferte es ihm gleich kistenweise.
Also ertrug Vern den Sumpf. Es war nicht gerade glorreich, aber die glorreichen Zeiten waren ja schon lange Vergangenheit. Einst nannte man ihn Wyvern, Lord Highfire vom Drachenhorst derer von Highfire. So einen melodramatisch-dämlichen Namen konnte man ja kaum ernst nehmen. Jetzt war er der König von Rein Gar Nichts in Drecksschlammhausen, Louisiana. Aber er hatte schon an schlimmeren Orten gelebt. Das Wasser war angenehm kühl, und die Alligatoren taten meist, was er ihnen sagte.
Wenn ich euch Pissnelken sage, ihr sollt tanzen, dann solltet ihr mal zackzack an eurer Choreo arbeiten, gab Vern ihnen häufig in wenigen Worten zu verstehen. Es war wirklich erstaunlich, was gewöhnliche Alligatoren zustande brachten, wenn sie erst mal richtig motiviert waren.
Also verlebte er seine Tage im Bayou, passte sich den Gegebenheiten an und hielt sich windabgewandt von den Sumpfausflüglern. Natürlich gab es Tage, an denen er sich danach sehnte, richtig einen draufzumachen und einen Kahn dieser fotografierwütigen Schwachköpfe zu rösten. Aber wenn er den Touristen einheizte, dann würde man ihm die Hölle heißmachen, und Vern hätte nicht sein reifes Alter erreicht, wenn er ständig Aufmerksamkeit erregt hätte. Wer sich selbst die Zielscheibe auf den Schädel tackerte, war Verns Meinung nach ein Idiot. Und seine Meinung war die einzige, die seiner Meinung nach zählte. Schließlich war Vern seines Wissens der Letzte seiner Art. Und wenn das der Fall war, dann war er es seiner Spezies schuldig, so lange wie möglich am Leben zu bleiben.
Er fühlte sich im Augenblick auch nicht gerade selbstmordgefährdet. Das kam zwar häufiger vor, aber er hatte gelernt, sich achtsam zu verhalten. Bei seinen regelmäßigen Ausflügen zu den kleinen Köstlichkeiten des Sumpfs hatte er oft die Gelegenheit zur Meditation.
Aber der letzte Drache zu sein war schon eine ziemlich einsame Angelegenheit. Etwa fünfzig Prozent des Blues konnte Vern im Alkohol ertränken, doch es gab diese Nächte, in denen der Vollmond seine Handlanger auf dem Pearl River erhellte und Vern sich überlegte, sein Glück bei einem Alligatorweibchen zu suchen. Die standen alle Schlange bei ihrem König, weiß Gott! Und ein- oder zweimal hatte er es sogar zu ein wenig Schnüffeln im Schlick gebracht, und, nein, das war keine Anspielung. Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Die Alligatoren mochten ihm auf dem DNA-Spektrum zwar nahe genug sein, aber egal, wie viel Wodka er konsumierte, Vern konnte nicht verleugnen, dass er eine dämlichere Spezies ausnutzte. Mal ganz davon abgesehen, dass Alligatoren keinerlei Charakter besaßen und hässlicher waren als die rückseitige Ansicht eines räudigen Kojoten.
Sie waren Kaltblüter. Sein Herz bestand aus flüssigem Feuer.
Solche Beziehungen funktionierten nie.
Vern verbrachte seine Nächte in einer Fischerhütte auf Boar Island, die Mitte des letzten Jahrhunderts verlassen worden war. Die Hütte stand ein wenig abseits des Ufers von einem der Nebenarme des Bayou und wurde langsam vom Würgegriff der sie umgebenden Mangrovenwälder zerquetscht, aber für die nächste Zeit würde es schon noch reichen. Vern hatte es sich mit einem Generator und den wichtigsten Annehmlichkeiten bequem gemacht. Er besaß eine kleine Kühltruhe, um seinen Absolut eiskalt zu halten, und einen Fernseher mit ordentlichem Programm. Waxman hatte von stromaufwärts die notwendigen Leitungen zur Außenwelt verlegt, sodass sich Vern nächtens bestens beschäftigen konnte.
Alles, was zählte, war, zu überleben, und zu überleben bedeutete entweder zu hundert Prozent in der Öffentlichkeit zu stehen oder gar nicht. So richtig gar nicht. Keine Kreditkarten, keine Handys. Keine Ausflüge nach Petit Bateau, keine Online-Präsenz. Vern hatte sich vor einiger Zeit einen Social-Media-Account eingerichtet, sich Draco Smaug genannt – was er ziemlich süß fand –, und dann einen Hintergrund für diese erfundene Persönlichkeit erfunden. Doch als Facebook anfing, standortbezogene Dienste einzubauen, und einige Herr der Ringe-Fans bohrende Fragen stellten, legte Vern den Account wieder lahm.
Manche Fehler machte man nur einmal.
Von da an begnügte er sich mit Reality Shows und dem Surfen im Netz. Alle Informationen, die Vern brauchte, gab es da draußen, und er musste sie nur noch suchen.
Doch niemand durfte ihn finden.
Niemals.
Denn wann immer Menschen ihn fanden, brach, um es mit den Worten des Maximus Decimus Meridius zu sagen, auf jeden Fall die Hölle los.
Da Vern die Hölle mit sich herumtrug, konnte er sie überleben.
Doch der Mensch, der ihn fand, würde das nicht.
Squib hatte mal einen Daddy gehabt.
Und Daddy hatte früher immer Dinge gesagt wie:
»Klau mir nicht heimlich die Dollars aus der Tasche, Squib, oder ich zieh dir das Fell über die Ohren.«
Und:
»Hast du mein Bier gesehen, Junge? Wehe, du schlürfst mein Budweiser, Squib, oder ich zieh dir das Fell über die Ohren.«
Oder:
»Warum kümmerst du dich nicht um deinen Kram, Squib? Steck deine Nase nicht in Angelegenheiten, die dich nichts angehen, oder ich zieh dir nicht nur das Fell über die Ohren.«
Es hatte nicht lange gedauert, bis Squib begriffen hatte, dass Daddys Sprichwörter meist damit endeten, dass jemand das Fell über die Ohren gezogen bekam. Squib vermutete, dass es wahrscheinlich an ihm selbst lag, weil er eben Probleme damit hatte, seine Nase aus den Angelegenheiten anderer Leute herauszuhalten.
Wir leben in einem freien Land, dachte er, also geht mich alles was an.
Doch dann verschwand Daddy, an Squibs dreizehntem Geburtstag. Seinem Jungen einen Optimus Prime zu kaufen, war ihm wohl zu viel Aufwand gewesen, und seitdem war sein Gequatsche nicht mehr relevant. Tatsächlich war sein Daddy nicht einmal Squibs richtiger Daddy gewesen, egal, wie sehr sich Squib das eingeredet hatte. Waxman, der auf der anderen Seite des Flusses auf einem Hausboot lebte, behauptete, dass Squibs echtem Daddy diese Welt über den Kopf gewachsen und der jetzige Typ einfach nur ein Schmarotzer war, der sich in ihr Leben gedrängt hatte, als Squib noch ein Hosenscheißer und seine hochverehrte Mutter in Schwierigkeiten gewesen war. So wie Waxman es ihm erzählt hatte, war sein Ersatzdaddy nichts weiter als ein gottverdammter Trottel, der ständig die Klappe aufriss und Scheiße von sich gab, die er im Angola oder einem anderen Hochsicherheitsgefängnis in Louisiana aufgeschnappt hatte. Zumindest ließen das die Tätowierungen vermuten, die sich aus den Tiefen seines T-Shirts seinen Nacken hinaufzogen.
»Du und Elodie, ihr seid besser dran ohne diesen nichtsnutzigen Verlierer«, sagte er zu Squib, als der Junge ihm seine Einkäufe lieferte. »Der konnte gerade mal den Text auf einer Zigarettenschachtel lesen. Hat bloß das gute Herz deiner Momma ausgenutzt.«
Waxman gab in der Regel auch nur dumpfen Bullshit von sich, wie man es in den Mangrovenwäldern des Bayou halt machte, aber damit traf er den Nagel auf den Kopf, vor allem, was Elodie anging.
Squibs Momma war definitiv eine gute Seele. Sie pflegte Leute den ganzen lieben Tag lang für zwei Dollar über dem Mindestlohn, und dann kam sie nach Hause, um sich um seinen delinquenten Arsch zu kümmern. Squib kannte diesen Begriff nur zu gut, delinquent, weil das oft genug auf seinem Zeugnis stand oder auf einem Anklageprotokoll.
Manchmal dachte er, er sollte um seiner Momma willen einen Gang zurückschalten und nicht mehr den bösen Jungen spielen. Er liebte sie nämlich sehr und war unglaublich wütend auf all die Arschlöcher, die ihr das Herz gebrochen hatten: erst mal auf seinen richtigen Daddy, der sich in dem Augenblick verpisst hatte, sobald sich Leute auf ihn verlassen hatten, und natürlich auf Möchtegern-Daddy, der gegangen war, nachdem er Elodies Herz ausgesaugt hatte – wie so eine Art Vampir, nur dass er Liebe gewollt hatte statt Blut.
Deswegen versuchte Squib, sich immer wieder zusammenzureißen. Und es klappte nie.
Tief innen drin konnte sich Squib eingestehen, dass ihm ein Daddy fehlte, selbst einer, der nur so tat als ob. Doch so was hätte er niemals ausgesprochen.
Denn Daddy soff Bier, als ob es ihn am Leben halten würde, nicht das Gegenteil. Daddy klaute das Kleingeld aus Mommas Kaffeedose und verschwendete es für Rubbellose.
Squib vermutete, dass er seinen Daddy geliebt hatte, zumindest ein bisschen. Selbst wenn Daddy jedes Mal, wenn er besoffen war, nach Squib schlug. Man kann ja nicht anders, als seine Familie zu lieben. Aber das hieß nicht, dass er ihn nicht auch hassen konnte. Als Möchtegern-Daddy schließlich seine Momma Elodie mit nichts mehr als einer leeren Kaffeedose und einer Menge Wettscheine zurückließ, deren Spur sich bis nach New Orleans zog und die Wettbürobesitzer nicht die geringsten Probleme damit hatten, die zu begleichenden Schulden auf sie zu übertragen, obwohl sie nur in einer eheähnlichen Gemeinschaft gelebt hatten, kannte Squibs Hass auf seinen Möchtegern-Daddy kein Ende und war für einen Jungen, auf dessen Kinn sich noch nicht mal der geringste Flaum eingestellt hatte, ziemlich beachtlich.
Squib hatte heute, zwei Jahre später, kaum Fortschritte zum Thema Flaum zu verzeichnen, aber immerhin war er knapp fünfzehn Zentimeter gewachsen und gab sich alle Mühe, den harten Kerl raushängen zu lassen, was ihm im zarten Alter von fünfzehn Jahren schon eine Menge Interesse seitens der Bullen eingebracht hatte. Es gab da einen Constable namens Regence Hooke, dem Squibs Momma in der Pearl Bar and Grill vor allen Leuten einen Korb verpasst hatte. Seit diesem Abend hatte Hook Squib auf dem Kieker und machte aus jeder noch so kleinen Beschwerde gegen den Minderjährigen eine persönliche Angelegenheit. Manchmal hatte Squib den Eindruck, dass jedes Mal, wenn er einen fahren ließ, der gute alte Regence an ihrer Tür klopfte und seiner Momma anbot, alle fünfe gerade sein zu lassen, wenn sie ihm nur ein klein wenig entgegenkam.
Drecksarsch Hooke, dachte Squib. Er wird damit nicht aufhören, bis es was zu vögeln gibt.
Tatsächlich hatte Regence Hooke Squib seinen Decknamen verpasst. Eigentlich hieß er nämlich Everett Moreau. Als Squib das erste Mal ins Polizeirevier musste, hatte Hooke gesagt: »›Moreau‹, wie der Doktor mit der Insel voller Freaks, hm, Junge? Bloß bist du nicht der Doktor, sondern einer von den Freaks.«
Die Geschichte mit seinem Spitznamen war passiert, als Squibs Möchtegern-Daddy noch in der Moreau-Baracke gepennt hatte und der junge Everett eines Nachts auf den See gefahren war, um mit einer Stange Dynamit ein paar Welse in die Luft zu jagen. Das Dynamit hatte er einem der Jungen aus der Schule abgekauft, dessen Vater zu Hause dafür einen Sicherheitsschrank hatte. Im Verlauf dieses Experiments war kein einziger Wels zu Schaden gekommen, aber Everett hatte es geschafft, sich sowohl den kleinen Finger seiner linken Hand als auch das Heck eines Kanus abzusprengen, das er sich für diese Nummer geliehen hatte. Regence Hook hatte schon auf ihn gewartet, als der notdürftig zusammengeflickte Junge aufs Revier gebracht worden war, dem man übertriebenerweise auch noch Handschellen angelegt hatte.
»Hab gehört, du wolltest mit Dynamit spielen, Junge«, hatte er zu ihm gesagt. »War wohl ein Schlag ins Wasser, du Knallfrosch.«
Tja.
Squib. Knallfrosch.
Pech.
Nach dieser Nacht hatte Everett Moreau nur noch neun Finger, dafür aber einen Spitznamen. Und da seine Momma Regence Hooke die Abfuhr verpasst hatte, kannte Hooke ihn nicht nur, er hatte nun auch jemanden, den er für seine Demütigung leiden lassen konnte. Squib war mit den Händen auf seinem Kopf auch wirklich leicht zu erkennen.
Squib Moreau im Alter von fünfzehn Jahren, ein echter Hingucker: ein dunkeläugiger, gewiefter Rabauke mit dem Cajun im Blut, dem Schlamm des Sumpfs unter den Fingernägeln und ohne die geringste Zukunft, außer er stellte sich an einen Barbecue-Grill oder schleppte Ziegelsteine in Slidell. Träume hatte er eine Menge, aber die meiste Zeit nicht den geringsten Plan. Er gab sich alle Mühe, nicht auf die schiefe Bahn zu geraten, aber auf geradem Wege schienen sich einfach nicht alle Rechnungen bezahlen zu lassen, trotz seiner drei Jobs und der Tatsache, dass seine Momma in der Petit-Bateau-Klinik und dem Slidell-Memorial-Krankenhaus ständig Extraschichten schob.
Aber die Welt war im Wandel, denn Squid hatte sich eine Chance geboten. An diesem Sommerabend, begleitet von den blutschlürfenden Moskitowolken, die über den trüben Gewässern des Sumpfs schwebten, und den Zypressen, die an den Ufern von Honey Island Wache standen, hatte sich Squib auf einen Deal eingelassen, der ihm und seiner Mutter ein wenig Spielraum verschaffte, um den Avancen von Regence Hooke zu begegnen, der sein Balzverhalten gegenüber Elodie Moreau in letzter Zeit eskalieren ließ. Es schien kein Tag zu vergehen, an dem er nicht an der Anlegestelle der Moreaus vorbeischaute – ein Bulle, der bis ans Ende einer unbefestigten Straße fuhr, und das mit verschissenen Ausreden.
Ruhestörung.
Schulschwänzen.
Landfriedensbruch.
Verkehrswidrige Überquerung einer Straße, um Himmels willen – jeder Dreck, der ihm einfiel. Und er hatte immer eine Flasche Schaumwein dabei, in der Kühlbox seines Chevys in blaue Kühlakkus gepackt. Schamesröte. Mommas Lieblingsgetränk. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis Regence einen Fuß in der Tür hatte. Und dann war das Einzige, was ihm noch im Weg stand, eine Fliegengittertür. Eine Fliegengittertür war kein Hindernis, mit der sich ein brünftiger Hirsch wie Hooke aufhalten ließ. Squib wusste, dass sich seine Momma für den Constable nicht erwärmt hatte, so gar nicht, aber im Bayou waren die Nächte lang, und da Regence Hooke sein Revier mehr als deutlich markierte, ließen sich keine anderen Hunde mehr blicken.
»Regence könnte für uns sorgen, Junge«, sagte Elodie eines Nachts zu Squib, als ihre Augen nach einer langen Schicht in der Klinik fast von selbst zufielen. »Und er könnte dir mal den Kopf geraderücken. Der Herr weiß, dass ich es nicht kann.«
Squib wusste, dass seine Momma todmüde und verdammt deprimiert sein musste, wenn sie von Hooke auch nur als Möglichkeit redete. Vielleicht hatte sie einen ihrer Lieblingspatienten auf den letzten Stunden seiner Reise auf Gottes grüner Erde begleitet. Er wusste, dass der einzige Grund, aus dem Elodie Moreau ein solches Weltklassearschloch über ihre Türschwelle lassen würde, ihre Hoffnung war, dass er Squibs kriminelle Ader in den Griff bekam. Und dafür fühlte er sich verantwortlich. Manchmal träumte er davon, wie Constable Hooke und seine Momma sich in den Armen lagen, mit Küssen und so ’nem Zeug, und dann wachte er schweißgebadet auf. Was nichts mit der Hitze im Bayou zu tun hatte.
Also schwor Squib zum vielleicht hundertsten Mal, dass er sich in den Griff kriegen würde. Er schwor es ganz heiß und inniglich, und eins musste man ihm lassen: Für ihn war es jedes Mal ein heiliger Eid. Aber er war jung, und das bedeutete fehlbar. Kaum eine Woche später schwänzte Squib schon wieder die Schule.
So bin ich, das wurde ihm klar. Ich werde mich niemals ändern.
Als es wieder in die Schulferien ging, hatte er sich an Willard Carnahan von der Pearl Bar gewandt. Carnahan war vielleicht der einzige Mann in Louisiana, der sich im Sumpf besser auskannte als Squib, und daher bot der Junge seine starken Arme und seinen noch belastbareren Rücken dem Sumpfschmuggler an. Man einigte sich auf einen Probelauf. Heute Nacht sollte Squibs Lehrzeit beginnen.
Nur diesen Sommer, ermahnte sich Squib. Und nur Fusel oder Zigaretten. Maschinenteile vielleicht auch noch. Keine Drogen, keine Leute. Ich werde genug verdienen, um unsere Schuld abzubezahlen, und vielleicht können wir uns dann eine Wohnung in der Stadt leisten. Weit weg von Hooke und der Erinnerung an seinen miesen Möchtegern-Daddy.
Also schlich sich Squib hinaus in den Sumpf, ohne sich die Mühe zu machen, Elodie irgendwas davon zu erzählen. Die war wieder in der Klinik zur Nachtschicht und hätte ihn an die Wasserleitung gekettet, wenn sie gewusst hätte, mit wem er da gemeinsame Sache machte.
Er schob den Sperrholzkahn, den er mit einigen Tipps von Waxman selbst gebaut hatte, keine drei Meter von der Terrasse der Moreau’schen Flusshütte ins Wasser, entschied sich aber noch dagegen, den Außenbordmotor anzuschmeißen. Heute Nacht wird sich alles ändern, dachte er, während er seine kleine, flache Piroge gegen den Strom durch den Schlamm paddelte, der vom Damm ausgewaschen worden war, und nutzte die Rohrkolbenröhrichte als Deckung.
Ich habe ein schwarzes T-Shirt an und für den Notfall eine Packung Jerky dabei, dachte sich der neunfingrige Junge. Nix kann mehr schiefgehen.
Regence Hooke war ohne jeden Zweifel eine schillernde Persönlichkeit. Es gab praktisch kein Verbrechen, das er im Laufe seines Lebens nicht selbst begangen oder bei dem er nicht ein Auge zugedrückt hatte. Man kann mit Sicherheit sagen, dass er diesen Punkt seines Lebens nicht erreicht hatte, weil er ein braver Kirchengänger war oder Kekse für Afrika gebacken hatte. Hooke war über die Armee zur Polizei gekommen, und er war bei der Armee gelandet, weil sie ihm eine bessere Alternative schien als ein Bundesgefängnis. Andere Möglichkeiten hatte er damals nicht. Als der achtzehnjährige Regence vor einem Richter des Miami-Dade County gestanden hatte, musste der Gerichtsbeamte tief Luft holen, um alle Anklagepunkte vorlesen zu können. Dazu gehörten:
Verschwörung, Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses, Bedrohung, Bestechung eines Zeugen, schwerer Fahrzeugdiebstahl, Diebstahl (illegale Downloads), Besitz von Betäubungsmitteln mit Handelsabsicht, Körperverletzung und Behinderung der Justiz.
Der Richter reagierte auf diesen gefühlt endlosen Katalog mit dem Ausruf »Jesus, Maria und verfickter Josef, Junge«, was ihn im Grunde der Missachtung des eigenen Gerichts schuldig machte. Er bot dem jungen Regence zwei Möglichkeiten.
Die erste lautete: Armee.
Die zweite lautete: Baker Bundesgefängnis.
Regence entschied sich für A. Er verpflichtete sich bei der Armee, seine Unterlagen wurden versiegelt. Nach der Ausbildung schickte man ihn in die Ferne, wo er eine Menge Leute umbrachte und einige Jahrzehnte später mit einem Haufen Auszeichnungen zurückkehrte, um sich drei Bundestaaten westlicher in Petit Bateau, Louisiana, niederzulassen. Die kleine Gemeinde hieß den hochdekorierten Veteranen herzlich willkommen, da sie nicht die geringste Ahnung von den vielen und vielfältigen Sünden seiner Vergangenheit hatte.
Und mit gut vierzig Jahren war er nun der Constable seines kleinen Bezirks und fuhr in voller Straffreiheit in seinem eigenen Auto durch die Gegend. Regence konnte kaum fassen, wie rosig die Dinge für ihn aussahen. Sein Daddy hatte immer zu ihm gesagt: »Den Gerechten wird Gutes vergolten.« Daher betrachtete Regence jeden korrupten Dollar, den er sich in seine Brieftasche stopfte, als erhobenen Mittelfinger in Richtung seines toten Daddys, denn er war todsicher keiner der Gerechten.
Den Großteil seiner Einnahmen verdankte Regence Ivory Conti, der in New Orleans die Interessen des Los-Zetas-Kartells vertrat und ihn Besorgungen machen ließ. Auf Ivorys Lohnliste standen Dutzende Bullen, aber Regence kletterte die Erfolgsleiter verdammt schnell hoch. Das lag nicht nur an seiner unnachgiebigen Art, sondern auch an seiner Bereitschaft, alles über die Pontchartrain-Brücke zu transportieren, was in den Kofferraum seines Chevrolet Tahoe passte. Regence war es scheißegal, was Ivorys Leute bei ihm reinpackten, solange es nicht auslief oder tropfte oder als Beweismittel diente.
In der Nacht, in der unsere Erzählung beginnt, parkte Regence seinen Chevy an Bodi Irwins Bootshafen und fuhr mit seinem geliebten Kajütboot den Pearl River hinauf, um einen kleinen Plausch mit einem Typen zu halten, der in Ivorys Revier vor Kurzem richtig Mist gebaut hatte.
Es war bedauerlich, dass dieses Gespräch überhaupt stattfinden musste, weil der Kerl, mit dem er zu reden hatte, echt nützlich war – einzigartig sogar. Aber diese Angelegenheit für Ivory zu regeln, bedeutete für ihn auch, dass er eine Grenze überschritt. In diesem Fall würde er um einiges mehr als seine monatlichen zweitausendvierhundert Dollar verdienen.
Also, fick dich, Daddy, dachte Regence und raste in seinem Boot flussaufwärts. Der Aluminiumbug der Elodie schnitt sich eine Bahn durch die Algen.
Die Elodie.
Benannt nach dem Engel von einer Mutter, die diesen Kümmerling Squib ihren Sohn nannte.
Und so Christus sein Zeuge war, damit er würde sie bestimmt umstimmen.
Regence kannte seine Gepflogenheiten gut genug, um sich klarzumachen, dass er auf dem besten Weg war, von dieser Cajun-Kleinen besessen zu sein. Kleinen? Verdammt, sie war eine erwachsene Frau, die ihr Haltbarkeitsdatum schon längst überschritten und nichts anderes vorzuweisen hatte als diesen Idioten von Sohn. Und den hielt Hooke eher für eine Bürde als eine Bereicherung.
Sohnemann, das ist eine ganz dumme Idee, ermahnte er sich. Am Ende dieser Straße liegen nur Schmerzen und Leid.
Doch Regence hatte sein Verlangen nicht im Griff, und es ging ihm gar nicht so ums Handgreifliche. Hooke kannte eine Menge Hurenhäuser, die er regelmäßig mit seiner Anwesenheit beehrte. Sein Interesse an Elodie Moreau war nachhaltiger Natur.
Sie sollte sich glücklich schätzen, dass ich sie überhaupt eines Blickes würdige, dachte sich Constable Hooke mehrfach am Tag. Dieser Gedankengang änderte nichts daran, wie verärgert er darüber war, dass sein Balzverhalten keine erkennbaren Fortschritte einbrachte. Er war schlau genug, um die psychologischen Rahmenbedingungen der Situation zu ergreifen. Psychologie hieß in diesem Fall, dass er nicht befummeln durfte, was er befummeln wollte, aber auch ein Therapeut hätte ihm nicht helfen können, seine Bedürfnisse in den Griff zu bekommen.
Wenn sie mich nur nicht in aller Öffentlichkeit niedergemacht hätte. Als wäre ich eine Sumpfratte, die gerade an Land gerobbt wäre.
Regence war schon von anderen Frauen abgewiesen worden, hatte aber oft feststellen müssen, dass sie ihre Meinung änderten, wenn er ihnen eine andere Perspektive aufzeigte. Zum Beispiel morgens um vier in einer dunklen Gasse. Einmal hatte er gar nichts sagen müssen, sondern einfach nur den Kopf zur Seite geneigt und schief gepfiffen.
Aber Elodie. Sie war härter im Nehmen, so abschätzig wie sie ihn damals in der Pearl Bar gemustert hatte, kurz nachdem sie vor dem Revier zufällig aufeinandergetroffen waren. Sie hatte erschöpft vor einer Kaffeetasse gesessen und sogar noch den Krankenhauskittel ihrer letzten Nachtschicht getragen. Hooke hatte sie sich kurz angesehen und gedacht: Elodie ist völlig am Ende, vielleicht ist sie ja jetzt ein wenig zugänglicher. Also war er zu ihr geschlendert und mit den folgenden Worten rausgerückt: »Morgen, Schätzeken. Erinnern Sie sich an mich? Ich heiße Constable Hooke, und genau wie mein Namensvetter, der Captain, würde ich Sie gern mal an meinem Haken spielen lassen.«
Geschmackloser ging es kaum, aber Regence war nicht daran gewöhnt, mit Süßholzgeraspel Erfolge zu feiern. In der Regel reichte es schon, wenn er irgendwas sagte. Nur diesmal nicht. Elodie hob den Kopf, als ob die Last ihrer Sorgen die Tonnengrenze bei Weitem überschritten hätte. Sie starrte ihn mit diesen schokoladenbraunen Augen an und antwortete ihm, ein wenig lauter als notwendig, vor der gesamten Frühstückstruppe. Und ihre Worte lauteten: »Constable Hooke, ich habe die gesamte Nacht die Scheiße alter Männer aus Hygienebeuteln geschaufelt und würde mit hundertprozentiger Sicherheit lieber das für den Rest meines Lebens tun, als an ihrem Haken herumzuspielen.«
Eine ziemlich geistreiche Bemerkung, daran gab es keinen Zweifel. Die Leute in der Pearl lachten sich schlapp, und Regence ging mit einem roten Hals hinaus. Elodie hatte ihn seitdem freundlicher behandelt, aber die Scham brannte Regence immer noch unter dem Kragen.
2
Squib hatte oft das Gefühl, dass ihm das Glück nicht hold war. Alle hatten mal Glück, denn Mutter Natur warf jedem einen Knochen zu. Einen Segen gab es allerdings für ihn, denn wie bei vielen anderen Cajuns hatten die Stechmücken auch an ihm kein Interesse entwickelt. Vielleicht lag es an dem seit Generationen kursierenden französischen Blut, aber es schien wahrscheinlicher, dass der karibische Einschlag zu diesem positiven Nebeneffekt geführt hatte. Squib hatte nie verstanden, wie jemand nach Sonnenuntergang noch im Bayou überleben konnte, während die Moskitos einem das Fleisch von den Knochen rissen. Morgens sah man Touristen mit Quaddeln am ganzen Körper rumlaufen, als ob sie sich hätten foltern lassen. Nichts ließ eine Wadentätowierung uncooler wirken als ein halbes Dutzend Eiterbeulen. Squib hingegen bekam während des Sommers vielleicht eine Handvoll Bisse ab, und die lagen in der Regel an einem einsamen Vieh, das sein Lebensziel in einem selbstzerstörerischen Amoklauf sah.
In diesem Fall hatte er also Glück.
Makellose Haut.
Damit ließ sich dem eigenen Leben kaum eine neue Richtung geben, außer natürlich, man lungerte zum selben Zeitpunkt im Einkaufszentrum herum wie irgend so ein Modelscout. Und das war wohl kaum wahrscheinlich. Squib war ohnehin nicht der Typ, der herumlungerte. Für ihn hatte der Tag in der Regel nicht genügend Stunden. Er arbeitete ständig und versuchte, Kohle ranzuschaffen.
Immerhin sorgte seine Cajunhaut dafür, dass das Legen von Flusskrebsfallen nicht ganz so schmerzhaft war. Squib tuckerte den Bayou hinauf in Richtung Honey Island und ließ ein halbes Dutzend dieser Fallen neben den verräterischen Wasserlilienfeldern ab. Dann fischte er anderweitig ein paar Stunden mit dem Netz, bis die Fallen randvoll waren. In all den Jahren, die er mit Nachtfischen verbracht hatte, war Squib nur einmal gebissen worden. Und das war auch kein Moskito, sondern eine Mokassinschlange gewesen, die aus Versehen in der Falle gelandet war. Die Schlange musste aber schon ihr ganzes Gift verspritzt haben, denn Squib bekam nicht mehr als eine kleine Schwellung rund um die Bissstelle.
Heute bin ich hinter einem größeren Fisch her, dachte Squib melodramatisch. Einem Verbrecherleben.
Squib wusste, dass er heute eine Grenze überschritt und es danach kein Zurück mehr gab. Doch Regence Hooke war der Teufel in Schirmmütze, und er hatte ein Auge auf Elodie Moreau geworfen. Es lag an ihm, für ausreichend Sicherheitsabstand zu sorgen.
Wenn wir in einer Wohnsiedlung unterkommen könnten, mit reichlich Zeugen, dann würde sich Hooke vielleicht mal beruhigen und einen Gang runterschalten.
Squibs verkehrte Logik basierte auf dem Wissen eines Kinds über böse Menschen. Er konnte nicht wissen, dass Exemplare wie Regence Hooke nicht herunterschalteten, sondern sich im Gegenteil darüber ärgerten.
Die einzige Gelegenheit, bei der es Hooke ruhiger angehen ließ, war mit einer Blisterpackung Amphetamin, einem Liter Old Forester’s Bourbon und einer Nutte an der Haustür.
Folgendes musste man über Squibs möglichen Chef wissen: Willard Carnahan lieferte dir alles, legal oder illegal. Soweit Squib wusste, gab es nichts, was Carnahan für unter seiner Würde hielt. Eine Geschichte machte häufiger die Runde: Willard Carnahan hatte letztens im French Quarter einen Pusher ins Koma geprügelt, weil sich eine Line Koks als Babypuder erwiesen und ihm ganz schön die Nasenlöcher verätzt hatte. Carnahan würde also nie wieder die Doppelbrücke nach New Orleans überqueren, weil ihm sonst Vergeltung von denen drohte, die ein ganzes Stück über diesem Drecksdealer standen. Willard hatte den Sumpf im Blut: Er konnte den Pearl River befahren, ohne ein einziges Mal aufzusetzen. Tagsüber organisierte er Bootstouren, und nachts machte er seine anderen Geschäfte entlang der schmalen Seitenarme – wenn es sein musste, mit geschlossenen Augen. Carnahan besaß seine eigene Brennerei, was gesetzlich total zulässig war, außer man kam auf die beknackte Idee, damit LSD abzukochen. Nach außen hin ließ Carnahan verlautbaren, dass er Wasser destillierte, aber in Wirklichkeit widmete er sich der uralten Aufgabe, schwarzgebrannten Schnaps an die Penner im Bayou zu liefern, die sich mit dem Fusel blind soffen. Die Polizeiwache in Slidell erhielt die eine oder andere Kanne, sah nicht genauer hin, und auch sonst war es allen egal. Aber die Kannen waren ziemlich schwer, und Squib war der Ansicht, Carnahan könnte einen Handlanger gebrauchen, der den Sumpf fast genauso gut kannte wie er selbst.
Sie hatten sich zu einem Treffen am alten Honey-Island-Dock verabredet. Squib nahm an, dass er die Sachen auch von Carnahans eigener Anlegestelle abholen durfte, wenn er sich als verlässlich erwies, aber heute Abend war der Testlauf.
Nur für den Fall, dass ich eine Art jugendlicher Drogenfahnder bin, dachte Squib. Er hielt von seiner Piroge aus nach Willard Ausschau, mit der er es sich in den Rohrkolbenröhrichten am westlichen Ufer gemütlich gemacht hatte, direkt gegenüber der dunkelgrauen Gewässer rund um Honey Island.
Er hatte eine gute Aussicht. Das Mondlicht spiegelte sich auf den Zypressenblättern, und Squib entdeckte Carnahan, der in seiner Röhrenjeans und dem abgeschnittenen T-Shirt direkt am Uferrand stand. Aber Carnahan war nicht allein. Es waren zwei Leute auf dem Dock: Carnahan, dessen verlotterte Haare Twisted Sister alle Ehre gemacht hätten, und ein riesiger, kühlschrankförmiger Kerl. Der große Typ war Regence Hooke, daran gab es keinen Zweifel.
Was zum Teufel …?, dachte Squib. Warum gab sich Hooke mit einem Kriminellen wie Carnahan ab?
Er konnte aus der Entfernung nicht erkennen, was da los war – Hooke konnte schließlich einfach einen Verdächtigen befragen –, aber Squib bezweifelte es. Regence Hooke gehörte nicht zu den Leuten, die sich für ihren Job verausgabten, und schon gar nicht mitten in der Nacht.
Es lag zu viel des Bayou zwischen Squib und dem verdächtigen Duo am anderen Ufer, um ihre Worte zu verstehen, aber das musste dringend geändert werden. Und wenn später jemand den Finger auf den Augenblick legen musste, an dem die Scheiße richtig zu kochen anfing, dann war dieser Augenblick nicht mehr fern.
Ich muss näher an sie ran, dachte Squib. Vielleicht kann ich mir auch ein paar Infos zu Hooke besorgen, sollte ich jemals eine Du kommst aus dem Gefängnis frei-Karte brauchen.
Und da war er: Der Augenblick, der den Lebensweg des jungen Everett Moreau ein für alle Mal änderte. Squib war auf dem Weg, die wichtigsten Regeln aller Beobachter, Spione und Stalker zu missachten, die da lauteten: Bring dich nicht selbst ins Bild. Sorg dafür, dass du dich nicht in der Nähe dessen befindest, was ausspioniert werden soll, und trübe das Wasser nicht mit deiner eigenen Gestalt.
In Squibs Fall war das Gewässer ohnehin schon getrübt, aber der Junge ließ sich nicht aufhalten und machte es nur noch schlimmer. Er hob den Propeller aus dem Wasser und paddelte das Boot an das Ufer von Honey Island, ohne auf die unheilvollen, gequakten Warnungen der Ochsenfrösche zu achten. Sein Paddel glitt kurz über die verknöcherten Platten eines Alligators, aber Squib ignorierte weiterhin alle bösen Omen, denn er befand sich in dem Alter, in dem jede Idee, die er hatte, die absolut beste im Universum war. Also kämpfte sich der Junge mit gebeugtem Oberkörper voran und wünschte sich, irgend so eine Tarnschmiere ins Gesicht und auf seine Arme klatschen zu können. Nicht dass er im Besitz eines solchen außergewöhnlichen Stoffs wäre, aber Momma besaß nun mal jede Creme auf Erden, und Jesus war sein Zeuge, in einem ihrer Tiegel wäre was gewesen, mit dem er sich passend hätte einschmieren können. Tja, jetzt war es zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Es war ja nicht so, dass er in die Zukunft blicken und eine Wette auf dieses Treffen hätte abschließen können.
Er brauchte gerade mal ein halbes Dutzend Paddelschläge, um die Piroge über den Bayou zu bugsieren und den vor sich aufragenden Damm von Honey Island zu erreichen. Squib packte eine Faustvoll Rohrkolben und zog an ihnen, um sein Boot zwischen dem Schilf und den Wurzeln in Deckung zu bringen. Das gesamte Manöver lief flüsterleise ab, und Squib klopfte sich selbst für seine Heimlichtuerei auf die Schulter. Er dachte, dass er in einem anderen Leben vielleicht eine Chance bei den Sondereinsatzkräften gehabt hätte oder einer von diesen Ninja-Typen hätte werden können, die auf schwarze Latschen und Stirnbänder standen.
Hooke und Carnahan quatschten immer noch, und jetzt konnte Squib endlich das eine oder andere Wort aufschnappen. Er hörte Hooke sagen: »Ich habe nie eine Spur davon gesehen, außer dieser Biegung in der Mitte …«
Was mit so ziemlich allem hätte zu tun haben können, vom Weihnachtsmann bis zu einem Spitzel.
Und ein paar Sekunden später meinte Willard Carnahan: »Das war gar nichts im Vergleich zu diesem Typen, den ich in Slidell kennengelernt habe.«
Was noch vager klang, abgesehen von der Nennung der wichtigsten Stadt im Bezirk.
Die beiden plauderten eine Ewigkeit über Belanglosigkeiten, oder zumindest kam es Squib so vor. Er begann zu zweifeln, dass ihm diese Abhöraktion irgendetwas Nützliches einbrachte. Da das Schilf raschelte und das Kroppzeugs zu seinem üblichen, nächtlichen Konzert angesetzt hatte, konnte er keinen einzigen Gesprächsfaden von Anfang bis Ende verfolgen. Und was er zu hören bekam, war der übliche Scheiß, den es auch in der Bar zu hören gab.
Willard: »Jetzt mal ernst, Constable. Die Arschkrampe hat mich angeglotzt, bevor ich ihm sein …«
Und Regence Hooke: »Ich schwöre, mein Junge, Momma Hooke hatte diese Angewohnheit, wo sie zwei Regenwürmer …«
Alles nur sinnloses Gesabbel. Sein erstklassiger Plan erwies sich als mittelmäßige Riesenkacke. Und Squib kam zu dem Schluss, er könne den Plan auch aufgeben, und es sich gemütlich machen, bis Regence sich flussaufwärts verabschiedete.
Ich schieb mich mal noch ein bisschen näher, dachte er. Ich geb ihnen noch fünf Minuten, und dann scheiß drauf, bin ich weg.
Squib kletterte aus seiner Piroge ans Ufer, und da er wohl nicht mehr tiefer sinken konnte im Leben, schlängelte er sich durch das Röhricht. Er bewegte sich ganz vorsichtig im Rücken dieses fragwürdigen Mitternachtsduos und hoffte, dass er auf seinem Weg nicht von einem echten Schlangenmistvieh in den Arsch gebissen wurde.
Er erreichte die Rückseite eines Baumstumpfs, als sich eine Sumpfratte von der Größe einer Cantaloupe-Melone gemütlich ins Unterholz verabschiedete. Die Ratte warf ihm einen Hast du Glück, dass ich gerade kein Hunger habe-Blick zu, bevor ihr Hinterteil verschwand, und Squib war so außer Fassung geraten, dass er einen Augenblick brauchte, bis er die neue Stimmlage im Gespräch zwischen Hooke und Carnahan wahrnahm. Es war, als würde sich die Umgebungstemperatur rapide dem Gefrierpunkt nähern.
Ich sollte ein Foto machen, dachte Squib, und zog aus der wasserdichten Tasche seiner Arbeitsjeans, die irgendwie nach Tarnzeug aussah, sein Handy hervor. Und wie es so oft der Fall ist, wäre die Geschichte vielleicht viel besser verlaufen, wenn der Junge einfach mal alles in der Hose behalten hätte.
Hooke fragte sich, ob es eine Möglichkeit gab, Willard nicht unter den Hammer kommen zu lassen.
Ich könnte den Idioten einfach gehen lassen. Ihm befehlen, sich den Kopf zu rasieren und einen Anzug zuzulegen. Und er sollte den Namen Wilbert annehmen anstelle von Willard. Ivory würde den Unterschied niemals bemerken.
Aber Carnahan war einer von diesen Typen, die einfach zu dumm waren, die Tragweite ihres Handelns wirklich zu verstehen. Früher oder später würde er im French Quarter die Fresse aufreißen, wie er Ivory gerade nochmal entkommen war, und dann würde Hooke gemeinsam mit Willard vor die Hunde gehen.
Scheiße, dachte er. Ich hab keine Wahl.
Hooke hatte den Auftrag angenommen, weil er gehofft hatte, sich auf dem Weg ein wenig Spielraum verschaffen zu können. Aber jetzt, da er sozusagen das Ende dieses Wegs erreicht hatte, war ihm klar, dass er seine Aufgabe zu erledigen und sich irgendwie zu überlegen hatte, wie er die Carnahan-große Lücke in seinen Plänen stopfen sollte.
Denn Hooke hatte große Pläne. Pläne, die weiter reichten, als den Rest seines Daseins als Constable Hooke in diesem Drecksloch von einem Bezirk zu verbringen. Er hatte seine Knopfaugen auf Ivorys komplette Unternehmungen geworfen, die er konsolidieren und in Richtung Norden nach Kanada ausbauen wollte, um Südamerika loszuwerden.
Er hatte dem Schmuggler hier und da Informationen über seine Pläne mitgeteilt, denn der Schmuggler musste gegenchecken, ob diese umsetzbar waren. Willard sprach das Thema in diesem Augenblick an.
»Ich habe mit meinem Kollegen am Autohof gequatscht«, sagte er. »Gibt keine Obergrenze für Fernlastfahrer, die er uns schicken kann. Ivorys Jungs sind zu Tode gelangweilt. Die haben nur die Tankstellennutten als Ablenkung und transportieren alles, Amphetamine oder Waffen. Ist den Typen völlig egal, solange sie nur bezahlt werden.«
»Das ist gut«, sagte Hooke, »wirklich gut, Willard. Hast du dir die Namen aufgeschrieben?«
»Klar, natürlich, wie du gesagt hast.« Willard reichte Hooke einen zerknüllten Kassenbon, auf dessen Rückseite Namen gekritzelt waren.
»Muss schon sagen, Willard«, meinte Hocke und steckte die Namensliste ein, »du hast dich der Situation echt gewachsen gezeigt.«
Carnahan nahm das Kompliment wie ein Hundewelpe mit glänzenden Augen an. »Danke, Partner. Also, wie lange dauert’s noch, bis wir uns an Ivory ranmachen?«
»Nicht mehr lange«, sagte Regence. »Ich baue gerade noch meine Position aus. Habe mir G-Hop mal genauer angeschaut und noch einige meiner Kameraden ausfindig gemacht. Gibt zwei klare Optionen.«
»Und hast du dich für Waffen entschieden? Nicht doch Drogen? Drogen sind verdammt leicht, und Waffen sind verdammt schwer.«
Hooke hatte sich monatelang den Kopf darüber zerbrochen und freute sich über die Gelegenheit, seine Entscheidung jemandem erklären zu können, der es nicht später in der Bar ausplapperte.
»Hör mir mal gut zu, Willard«, sagte er. »Ich werde dir mal unsere Geschäftsphilosophie erläutern. Der Verkauf von Heroin ist im freien Fall, richtig? Kokain ist billig, und jedes Arschloch auf zwei Beinen handelt jetzt mit dem Scheiß. Alle Gangs. Bald werden uns die Mexikaner nicht mehr brauchen. Sie haben ihre eigenen Leute auf unserer Seite der Grenze. Die Albaner, die Russen, Puerto-Ricaner, die Iren – selbst die Kanadier haben jetzt Gangs. Die Bacon-Brüder – ist so ein Name zu fassen, Willard? Also wird schon ziemlich bald niemand mehr Ivorys Dienstleistungen in Anspruch nehmen müssen. Jeder Gangster mit einem Rucksack wird Drogenkurier. Der Zug ist abgefahren, auch wenn Ivory das noch nicht begriffen hat.«
»Was denn, sein Schleuserweg ist nutzlos?«, fluchte Willard. »Warum zur Hölle wollen wir ihn dann übernehmen?«
»Der Schleuserweg ist nicht nutzlos«, wies Hooke ihn zurecht. »Er ist immer nützlich. Auch das Produkt ist im Augenblick nützlich. Aber wir müssen diversifizieren.«
Willard spielte seine Rolle in diesem Frage-und-Antwort-Spiel, indem er fragte: »Ja, okay, aber in welche Richtung diversifizieren?«
»In die Richtung der berühmten zweiten Zusatzklausel«, sagte Hooke und salutierte. »Das Recht, Waffen zu tragen.«
»Das Recht haben wir doch schon.«
»In einigen Bundesstaaten mehr als in anderen«, sagte Hooke. »Kalifornien ist nicht so nachsichtig. In New York ist es nahezu unmöglich, einen Waffenschein zu bekommen. New Jersey, Connecticut, selbst Hawaii. All diese heißblütigen Amerikaner schreien förmlich nach Waffen. Und wenn es eine Sache gibt, die ich verstehe, Willard …«
Carnahan beendete den Satz. »Dann sind es Waffen«, sagte er.
»Genau. Du kaufst günstig in Louisiana und verkaufst teuer in Kalifornien. So funktioniert die Welt. Glaub mir, die NRA wird sich gegen die Liberalen nicht mehr lange halten können. Und das Beste ist, wir behalten das alles in unserer Heimat für uns. Dafür brauchen wir keine südamerikanischen Hitzköpfe.«
»Jetzt verstehe ich es«, sagte Carnahan. »Wir machen Inlandsgeschäfte.«
Hooke schnippte mit den Fingern. »Inlandsgeschäfte. Auf geht’s, Amerika.«
»Du hast dir das alles gut überlegt, Constable«, sagte Willard. »Da kann nichts mehr schiefgehen.«
Und dann griff Hooke in die Tasche seiner Windjacke, und es wurde schlagartig kühler.
Squib hatte es sich mittlerweile gemütlich gemacht und freute sich wie ein Schneekönig im Sumpfschlamm, die Kamera auf Hooke und Carnahan gerichtet. Sah so aus, als ob der Gute-Laune-Teil des Abends vorüber war. Vorbei mit den Schenkelklopfern und dem gutmütigen Gelächter.
»Nur haben wir jetzt ein Problem, Willard«, sagte Hooke. »Die Prügel, die du in New Orleans verteilt hast.«
Carnahan lachte, und Squib sah seine Zähne im Nachtaufnahmemodus seiner Kamera schwarz glänzen. »Scheiß auf den Burschen, Regence. Der geile Scheiß, den er mir verkauft hat, war kein geiler Scheiß. Jetzt mal ernsthaft. Gottverdammtes Babyarschpuder. Das hat mir eine Woche lang die Nebenhöhlen versaut. Verdammt, sie sind immer noch nicht in Ordnung. Jedes Mal, wenn ich morgens aufwache, fällt mir das Atmen schwer. So behandelt man doch keinen Kunden.«
Hooke schien ein wenig größer zu werden, als ob der echte Regence Hooke endlich Freigang hätte. »Das Problem ist nur, mein Junge, den Burschen, den du verprügelt hast … du hast ihm den Schädel so hart eingeschlagen, dass sie ihm den Stecker haben ziehen müssen. Seine Momma musste das unterschreiben. Kannst du dir das vorstellen?«
Carnahan nutzte beide Hände, um seine Haare in senkrechte Spitzen zu formen. »Das ist eine Schande, Regence. Eine echte Schande. Aber der Junge hat die ganze Zeit vom Zeug gelabert und mir gesagt, dass es der echte Scheiß wäre, das volle Programm. Du kannst deine Kunden nicht übers Ohr hauen und davon ausgehen, dass du ohne Strafe davonkommst.«
Hooke legte Carnahan einen Arm um die Schulter: ein Bär, der einen Hirsch umarmte. Normalerweise begriff der Hirsch, dass er auf der Speisekarte stand, aber Willard Carnahan musste der Überzeugung gewesen sein, dass er unersetzlich war.
»Ich sollte für das Koks überhaupt nicht bezahlen«, meinte Willard plötzlich, »bei all dem Scheiß, den ich dir flussaufwärts schmuggle. Aber ich hatte halt Bock auf Party, weißt du, also habe ich tief in die Tasche gegriffen und mein schwer verdientes Geld gezückt. Und was macht dieses Arschloch? Verkauft mir diesen Mist. Mir! Dem verschissenen Kokskurier.«
»Du hast nicht unrecht«, sagte Hooke und schürzte die Lippen, als ob er Carnahans Einwand tatsächlich überdachte. »Tja, es gibt da nur ein Problem. Der Bursche war Ivorys Neffe. Der sich beweisen wollte. Er sollte gar nicht an dieser Straßenecke stehen. Der junge Vincent hätte eigentlich seine Nase in Bücher stecken sollen.«
Das war eine Menge an Informationen, und alle waren ziemlich konkret. Als ob Hooke sie aus erster Hand erfahren hätte.
»Ich … Ivory. Fuck, Ivory?«, fragte Carnahan und verhaspelte sich beim Sprechen. »Das wusste ich doch im Voraus nicht, Constable. Woher sollte ich das wissen? Ivory? Soweit ich das sehen konnte, war er einfach nur ein italienischer Bastard, der auf der Straße Babypuder als Koks verkauft hat. Ich habe doch was gut bei Ivory, oder?«
Hookes Finger schlossen sich um Carnahans Schulter. »Verdammt, mein Junge. Alles, was du bei ihm gut hattest, hast du aufgebraucht. Und es hat mich außerdem die Hälfte meines guten Rufs gekostet.«
Squib war eigentlich immer noch ein Kind, aber selbst er wusste, was gleich passieren würde. Druckmittel hin oder her, das war einfach zu viel. Das war die Sorte Information, die man sich mittels einer freiwilligen Lobotomie aus dem Schädel schrauben ließ, damit man sicher sein konnte, nicht vor dem Gericht aussagen zu können.
»Ich bin der Lotse, Constable«, sagte Willard. »Es gibt niemanden, der sich so gut im Sumpf auskennt wie ich. Ich habe kein einziges Paket verloren, seit wir den Schleuserweg aufgemacht haben. Kein gottverdammtes Gramm.«
»Das ist wahr, mein Sohn«, bestätigte Hooke. Der Schmerz war ihm tatsächlich anzusehen. »Und jetzt hast du auch bei mir Unbehagen verursacht, denn ich bin nun gezwungen, einen Ersatz auszubilden.«
Willard hatte noch ein letztes Argument vorzubringen. »Aber wir haben doch Pläne, Regence. Wir sind Partner.«
Regence seufzte. »Waren wir auch, hast ja recht«, sagte er. »Bis du das mit Ivorys Neffen versaut hast. Ich bin noch nicht so weit, solchem Druck standzuhalten. Meine Pläne haben noch keinen Belastungstest durchlaufen.«
Die Realität holte Carnahan so langsam ein wie sanft aufsteigender Nebel im Sumpf, und alle Hoffnung verließ ihn. Er sackte in Hookes Umarmung zusammen wie eine von diesen tanzenden Ballonfiguren, fast so, als ob er auf der Stelle zusammenbrechen würde. Doch Constable Hooke hielt ihn fest.
»Na, komm schon, mein Junge«, sagte Regence. »Uns allen schlägt irgendwann die Stunde.« Und in diesem Moment pfiff Hooke einige Töne der Reveille. »Verstehst du, mein Sohn? In deinem besonderen Fall bin ich die Uhr, die deine Stunde schlägt.«
Squib hatte in diesem Augenblick sein ganz eigenes Damaskuserlebnis, während er auf dem Bauch im Schlamm lag und Flusskrebse und weiß Gott noch was an seinen Schnürsenkeln knabberten. Das hatte nichts mit Gott zu tun. Squib hatte wenig Zeit für Gott oder seine Leute. Nein, Squibs Offenbarung war körperlicher Natur, und zwar hinsichtlich seiner eigenen Sterblichkeit. Der Junge war kein Narr. Er wusste theoretisch, dass er irgendwann in ferner Zukunft mal sterben würde. Aber für Squib und die meisten Kinder war es das auch schon: eine Theorie. Außerdem hatte Squib die Vorstellung, dass bis zu dem Zeitpunkt, an dem sein Leben sein Ende finden sollte, die Wissenschaftler dieses ganze Todesding irgendwie in den Griff bekommen hatten.
Aber hier und jetzt an den Ufern der trägen Gewässer des Bayou, im strahlenden Mondenschein, der einen zu Tode Verurteilten in Szene setzte, begleitet von seinem Henker, spürte Squib, wie sich über ihm die gähnende Leere seiner eigenen Sterblichkeit zeigte. Er wusste mit hundertprozentiger Gewissheit, dass wenn er sich jetzt verriet, Regence Hooke ihn umbringen würde, ohne auch nur ins Schwitzen zu kommen.
»Mann, Constable«, sagte Carnahan, »wir sind doch Partner, oder? Es muss doch eine Möglichkeit geben, wie wir das lösen können.«
»Nee, keine Chance«, sagte Regence Hooke und legte den Finger zum Gruß an seine Schirmmütze, wie es sich gehörte. »Also, hör mal zu. Ich kenne da diese alleinstehende Mutter in Petit Bateau, die nur darauf wartet, von mir die Beine breitgemacht zu bekommen. Aber ich muss erst das hier erledigen. Das verstehst du doch, oder?«
Carnahan, dem immer noch nicht klar war, was das Schicksal heute für ihn bereithielt, seufzte. »Ja, schon irgendwie. Man muss den Frauen hinterher sein, was, Constable?«
»So ist es, mein Sohn«, sagte Hooke und nahm die Hand aus seiner Windjacke. Mit zwei Fingern hielt er den Griff eines Jagdmessers mit Ausweidehaken fest und ließ die Klinge mit dem Daumen aufspringen. Dann zog er sie direkt unterhalb von Carnahans Brustkorb quer über den Körper. Das Jagdmesser hatte die Haut so sauber durchtrennt, dass sie wie eine Klappe nach vorne fiel.
Willard zuckte ein wenig. »Ganz schön kalt, Constable. Hast du mich gerade umgebracht?«
Hooke wischte die Klinge an Carnahans T-Shirt ab. »Ja, mein Sohn. Habe ich. Mit größtem Bedauern.«
Dann warf er Carnahan in den Pearl, als ob er ihn aus einem Club werfen wollte.
Willard Carnahan fiel in den Bayou, und die seichte, schwammige Oberfläche nahm seine knapp siebzig Kilogramm mit kaum merklichem Klatschen auf. Die klaffende Wunde ließ Carnahans Innereien herausfallen, und binnen weniger Sekunden stürzte sich das widerliche Kroppzeug, das sich vom Bodensatz des Bayou ernährte, auf diese unverhoffte Mahlzeit aus Blut und Eingeweiden und holte ihn ein. Willard hatte kaum noch Kraft und schaffte es bloß, schräg ins Röhricht zu blicken, während sein offen stehender Mund zu gleichen Mengen Luft und Schlamm schluckte. Carnahans Leben hatte sich auf ein Drittel seiner üblichen Geschwindigkeit verlangsamt, und nichts, was er begehrte, war jetzt noch machbar. Das Einzige, was er noch zustandebrachte, war zuzusehen, wie sich sein Leben von ihm verabschiedete.
»He, mein Sohn«, rief Regence Hooke ihm hinterher, »der Sumpf schließt dich in seine Arme. Ein passendes Ende, findest du nicht auch?«
Hätte sich Regence doch nur vor dieser letzten spitzen Bemerkung abgewandt, dann hätte er diese Bewegung im Röhricht gar nicht mitbekommen. Und selbst wenn, dann wäre das kein großer Akt gewesen. Im Bayou huschten eine Menge Dinge durch das Schilf. Allerdings gab kein einziges dieser Dinge Sachen von sich wie Himmelherrgottmaria, und Hooke war sich ziemlich sicher, dass ihm genau diese Bemerkung aus der Flora entgegengeschallt war. Selbst wenn er nicht gerade einen Mann umgebracht hätte, war ein so neugieriger Mann wie Constable Regence Hooke dazu verpflichtet herauszufinden, wer mit dem zweiten Gebot so offensichtlich Schindluder trieb.
Folgendes war geschehen: Carnahan war auf dem Schmodder auf und ab getrieben, an der klapprigen Anlegestelle vorbei, bis er sich auf etwa derselben Höhe wie der junge Squib befand. Der hatte schon lange jeden Gedanken an Erpressung aufgegeben und wünschte sich nur noch ein Paar roter Schuhe, das er an den Hacken zusammenschlagen konnte. Die Miene des armen Willard befand sich irgendwo zwischen am Arsch und tot, und seine glatte blasse Gesichtshaut machte deutlich, dass er sich auf der kurzen Strecke zwischen diesen beiden Zuständen befand.
Squib konnte den Blick nicht von dem sterbenden Mann nehmen. Er fragte sich, welche Form der Tod im Wettkampf um Carnahans Leben annehmen würde – Blutverlust oder Ertrinken? Oder vielleicht ein Alligator? Wie es der Zufall so wollte, gab es noch eine weitere Kandidatin. Eine riesige Geierschildkröte hob sich wie ein fleckiges, kuppelförmiges U-Boot fast dreißig Zentimeter aus dem Wasser, den Raubtierschnabel gierig vorgestreckt, und fraß Carnahans Gesicht mit einem Bissen, was Squib zur Aussage Himmelherrgottmaria veranlasste.
Er hatte noch nie eine Schildkröte mit so einem Körperumfang gesehen. Sie war so groß wie ein Kleinwagen, und ihr langer, starrer Hals wirkte mit seinen knotigen Schwellungen wie der Schwanz seines guten Freunds Charles Junior, mit dem er gern herumwedelte, weil er so stolz auf ihn war.
Die Sumpfbewohner sprachen häufig von der blutrünstigen Ader dieser sonst so sanftmütigen Kreaturen, aber nur die wenigsten hatten so etwas aus nächster Nähe gesehen.
Das war das mehr als merkwürdige Ende Willard Carnahans und seines wilden Piratendaseins, aber der Junge sah ihn und seinen zerfetzten Schädel nicht im Sumpf versinken, denn Squibs blasphemische Aussage hatte ihn nicht nur als Zeugen verraten, sondern auch zum Ziel gemacht. Er brachte sich also zügig in die Senkrechte und wie ein Hase mit schnellen Sprüngen auf die eigentliche Insel in Sicherheit.
Hooke sah, wie eine Gestalt in Richtung Insel flitzte. Der grüne Schein eines Handys leuchtete in ihrer Hand, und er sah ihr mit verdrießlicher Laune hinterher.
»Heilige Maria, Mutter Gottes, dieser Tag ist wirklich der letzte Dreck.«
Regence Hookes Auffassung nach hatte man ihm in den letzten zwölf Stunden schwer zugesetzt.
Erst hatte ihm die Sache mit Elodie Moreau die Laune verhagelt, dann hatte Ivory ihn gezwungen, seinen Lotsen auszuweiden, und jetzt hatte eine schattenhafte Gestalt die gesamte Geschichte auch noch gefilmt?
Ein Druckmittel, dachte Hooke. Dieser verschissene Ivory wollte ihn offensichtlich härter an die Kandare nehmen. Es schien, dass er ihre Beziehung falsch auslegte und vergessen hatte, wer von ihnen die Dienstmarke trug. Wer sonst könnte dafür verantwortlich sein? Ivory hatte auf den Mord bestanden und dann irgend so einen Idioten aus der Stadt hierhergeschickt, um Verstehen Sie Spaß? zu spielen. Der Drogenboss würde wesentlich mehr Informationen erhalten als erhofft, wenn er sich das Video ansah.
»Nicht heute Nacht, Ivory«, sagte Regence Hooke und tätschelte seine Dienstwaffe in ihrem Holster, eine Glock. Das Geräusch von Schüssen pflanzte sich auf dem flachen Gewässer weit fort, aber daran konnte man nichts ändern. Schüsse in einem Sumpf ließen sich immer erklären. Das Video nicht.
Regence schoss nicht einfach wild ins Louisianamoos, sondern ging sehr vorsichtig über die halb zerfallene Anlegestelle zu seinem eigenen Kajütboot und legte ab. Er hatte zwei Gründe, sein Boot zu nehmen: erstens, der Idiot von einem Spion hatte sich selbst auf der Insel gefangengesetzt, und zweitens, er hatte aus seinem Waffenschrank ein paar Spielzeuge mitgebracht.
Ich werde dich mit meiner Pumpgun aus deinem Versteck treiben, dachte sich Regence, und dann aus nächster Nähe mit der Glock erledigen.
Als er das flache Boot von der Anlegestelle abstieß, kam Constable Hooke der Gedanke, dass dies erst das zweite Mal in seinem Leben sein würde, dass er in einer Nacht zwei Männer umbrachte.
Oh, nein, nein, warte mal, Regence. Du verkaufst dich unter Wert. Letztes Jahr hast du den Typen vom Zeugenschutzprogramm und seinen Betreuer abgeknallt.
Der Zeugenschutzprogrammtyp – keine einfache Aufgabe.
Also dreimal.
Definitiv dreimal.
In Friedenszeiten.
Squibs erster persönlicher Kontakt mit Schrotkugeln ergab sich, als er aus dem Dickicht der Mangroven am westlichen Ufer von Honey Island hervorpreschte. Er hatte ganz bestimmt nicht vorgehabt, diese Deckung zu verlassen, aber es lief wie in den Road-Runner- und Wile-E.-Coyote-Cartoons ab: Gerade noch stolperte er etwas entlang, das man mit reichlich Mühe einen Weg hätte nennen können, und plötzlich steckte seine Nase in der freien Luft, und auf dem Wasser war Hooke, der seine Pumpgun geladen hatte und nur darauf wartete, sie abzufeuern. Squib sah Regence Hookes Kinn im roten Glühen seiner Zigarre, und schon zuckte der Gewehrlauf des Bullen nach oben, und Squib hatte sich eine Schusswunde im Unterarm eingefangen. Sie war bei Weitem nicht tödlich, nicht aus einer Entfernung von über sechzig Metern, und der größte Teil des Schrots drang nicht mal in seine Haut ein, aber er würde die Folgen trotzdem wochenlang spüren.
Er wollte mich damit nicht töten, dachte Squib. Der Bastard treibt mich wie Vieh vor sich her.
Der Rückstoß ließ das Boot im Bayou nach hinten gleiten und zwang Regence Hooke dazu, ein wenig Gas zu geben, und das bot Squib die Chance, sich wieder außer Sichtweite zu bringen. Er huschte auf die Insel und atmete tief durch.
Er legte sich auf den Rücken und spürte das Brennen, das die Schrotmunition verursacht hatte, und wie der kalte Morast seinen Sack verkümmern ließ.
Wie zur Hölle komme ich von der Scheißinsel runter?, dachte er. Wenn Hooke mich nicht erwischt, dann die verdammten Alligatoren.
Der Gestank des ölverschmutzten Wassers gab ihm seine Antwort.
Soweit er die Lage beurteilen konnte, war Squibs einzige Möglichkeit, hier auszuharren. Bei Tageslicht würden die ersten Touren von Crawford Landing hierherkommen, mit Dutzenden Auswärtigen, die den legendären Sumpf-Bigfoot zu Gesicht bekommen wollten. Regence Hooke konnte dann auf keinen Fall auf ihn schießen, weil dann nämlich eine Menge Kameras in seine Richtung geschwenkt würden. Die sozialen Medien liebten Videos von einem Bullen, der wild um sich schoss.
Ich muss meinen Kopf einziehen und die Klappe halten, begriff Squib. So einfach ist das.
Aber tief in ihm schlummerte die Erkenntnis, dass diese Einschätzung reines Wunschdenken war. Regence Hooke war kein Anfänger im Blutsport, und er würde sich ganz bestimmt nicht tränenreich und verzweifelt verabschieden, bloß weil Squib auf einer Insel Schutz gesucht hatte.
Dies wurde nur wenige Sekunden später bestätigt, als die Hölle losbrach.
Squibs erster Gedanke war Vulkanausbruch, was ein wenig nach Vollidiot klang, aber man musste einem Jungen, der sich selbst als knallhart empfand, fairerweise zugestehen, dass er sich nie in der Nähe einer tatsächlichen Kampfzone befunden und daher keine Vergleichswerte für die Explosionen hatte, in deren Mitte er sich nun befand. Tausende Stunden an der Playstation waren nichts im Vergleich zur Realität.
Der Lärm war fürchterlich, ein donnerndes Buuuuummm, das aus der Erde zu kommen schien und als Wellen akustischen Terrors über ihm zusammenschlug. Schlick, Schalentiere, Mangrovenwurzeln und Ölschmiere wurden, in das Schmutzwasser des Sumpfs gehüllt, gen Himmel geschleudert und regneten als widerwärtige Scheiße auf den Jungen herab. Für Squib war es, als ob er kurzerhand beerdigt wurde, denn das schiere Gewicht des auf ihn herabregnenden Schlamms drohte seine schmächtige Gestalt zu erdrücken.
Momma wird niemals erfahren, was mit mir geschehen ist, wurde ihm klar, und der Gedanke jagte ihm eine Heidenangst ein. Er versuchte zu schreien, aber das erwies sich als großer Fehler, denn die herabregnende Scheiße füllte ihm bloß den Mund. Auch Squibs Augenhöhlen waren voller Schlamm, und sein T-Shirt war von dem Angriff zerfetzt worden.
Ich bin mit Sicherheit tot, dachte Squib. Ich kann nicht mal mehr klar denken.
Aber langsam schien sich das Beben zu legen, und das Pfeifen in Squibs Ohren wurde mit einem Mal von schallendem Gelächter übertönt. Es hörte sich an, als ob Regence Hooke einen Riesenspaß zu haben schien.
»Na, gefällt dir diese Offensivhandgranate, mein Freund?«, rief er. »War das genau dein Fall? Ich wette, dass du deine dumme Fresse aufgerissen hast, nicht wahr? Und hast ein Maul voll Sumpfscheiße und Krabbelzeugs geschluckt.«
Hooke lachte wieder, und es mochte der Granatenschock sein, aber Squib hätte schwören können, dass seine gute Laune etwas Triebhaftes an sich hatte.
»Jede Nacht, nach jedem Feuergefecht, lief irgend so ein dummer Grünschnabel mit weit aufgerissenem Maul rum, der sich einen Mundvoll Schrapnell einfing. Bei uns waren eher die Zähne zersplittert, nicht Arme oder Beine.«
Squib warf einen vorsichtigen Blick durch das Schilf. Er vermutete, dass er jetzt reichlich getarnt war. Regence Hooke saß auf der Kabine seines Boots und hatte eine plump wirkende Waffe auf dem Schoß. Er trat munter mit den Fersen seiner Stiefel gegen die Windschutzscheibe. Sein Granatenwerfer lag wie sein liebstes Haustier auf seinem Schoß. Squib kannte das Modell sogar von Call of Duty: der MM-1. Sieht ganz schön witzig aus, dieses klobige Miststück. Das Orgelgeschütz des Todes.
»Wunderschöne Nacht, nicht wahr, Junge? Ich wette, dass du dir jetzt wünschst, New Orleans niemals verlassen zu haben, was? Ich wette, du wünschst dir, dass der gute alte Ivory jemand anderen geschickt hätte, um mir nachzuspionieren.«
Ivory, dachte Squib. Hooke weiß nicht, wer ich bin.
Was bedeutete, wenn er Constable Hooke entwischte, dass er es nur noch zu seiner Piroge zurückschaffen musste.
Hooke wuchtete den Granatenwerfer auf seine Schulter. »Junge, ich wette, du denkst dir gerade, du musst nur zu deinem Boot zurückkriechen und wegpaddeln. Tja, ich habe da leider schlechte Nachrichten für dich. Dein Boot ist eben an mir in Richtung Meer vorbeigeschwommen. Hast es wohl nicht ordentlich genug festgemacht.«
Squib kniff die Augen zusammen, weil er befürchtete, dass das Weiße in ihnen ihn verraten konnte. Versuchte Hooke, ihn zu verarschen? Hatte er das Boot gesichert?
Wahrscheinlich nicht.
Er hatte den letzten Schritt in seiner Mission nicht gerade durchdacht. Also saß er jetzt auf dieser gottverlassenen Insel mit den Wildschweinen und den Pumas und einem Haufen Feuerameisen fest, die sich schon in einer Reihe aufstellten, um seinen Pimmel hinaufzumarschieren. Und wenn er zu fliehen versuchte, dann würde ihm Hooke eine Granate in den Arsch rammen wie einen raketengetriebenen Flutschfinger.
Diese Nacht hatte sich als richtig spitze erwiesen.
Everett Dumpfbacke Moreau, der geborene Stratege.
Wie dieser kleine französische Typ, der sich nur mit großen Frauen umgeben hatte, um sich was zu beweisen. Napoleon.
Aber im Grunde dann wieder doch nicht. Sie hatten nur eins gemeinsam: Am Ende waren sie beide am Arsch und auf einer Insel gestrandet, wenn er die Geschichte nicht falsch in Erinnerung hatte. Oder vielleicht war es auch Huckleberry Finn, der auf einer Insel am Arsch war.
Wie auch immer, er war der Vollhorst, der an diesem wunderschönen Abend auf einer vom Wasser umschlossenen Landmasse ordentlich durchgezogen wurde.
Tut mir leid, Miss Ingram. Er dachte an seine Sozialkundelehrerin, die einzige, die er in den zehn Jahren seiner Schulzeit jemals gemocht hatte.
»Hör mal, mein Sohn«, rief Regence Hooke. Seine Stimme dröhnte über die Wasserfläche. »Ich sag dir was. Warum wirfst du mir nicht einfach dein Handy raus? Wahrscheinlich sieht das Ding ohnehin ziemlich scheiße aus, nachdem es ins Wasser gefallen ist. Ernsthaft, ich unterschreibe sogar im Polizeibericht, dass du ein neues bekommst. Denn wir wissen doch beide, dass du auf diesem Teilstück des Pearl keinen Empfang hast.«
Es sieht überhaupt nicht scheiße aus, dachte Squib. Es ist heil und unversehrt in meiner Arbeitshosentasche.