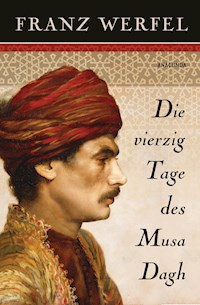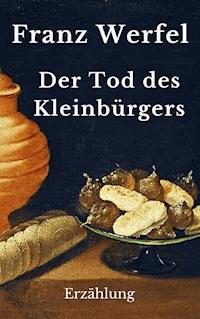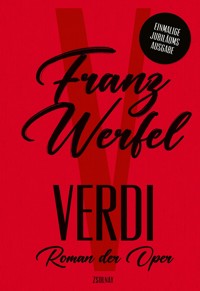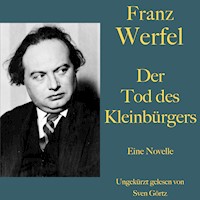Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franz Werfel ist bekannt für seine historischen Romane, zu denen Werke wie 'Die vierzig Tage des Musa Dagh' gehören. In diesen Romanen verbindet er geschickt historische Ereignisse mit fesselnden Geschichten und starken Charakteren. Sein literarischer Stil ist detailliert und einfühlsam, was es dem Leser ermöglicht, in die Welt seiner Romane einzutauchen und die dargestellten Ereignisse mitzuerleben. Werfels historische Romane sind nicht nur spannend zu lesen, sondern bieten auch einen tieferen Einblick in historische Ereignisse und soziale Themen. Werfels Werke sind ein wichtiger Beitrag zur deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts und haben einen festen Platz in der Literaturgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 4284
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Historische Romane
Inhaltsverzeichnis
Die vierzig Tage des Musa Dagh
Erstes Buch Das Nahende
»Wie lange noch, o Herr, Du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest Du nicht und rächest unser Blut an den Bewohnern der Erde?«
Erstes Kapitel Teskeré
»Wie komme ich hierher?«
Gabriel Bagradian spricht diese einsamen Worte wirklich vor sich hin, ohne es zu wissen. Sie bringen auch nicht eine Frage zum Ausdruck, sondern etwas Unbestimmtes, ein feierliches Erstaunen, das ihn ganz und gar erfüllt. Es mag in der durchglänzten Frühe des Märzsonntags seinen Grund haben, in dem syrischen Frühling, der von den Hängen des Musa Dagh herab die Herden roter Riesenanemonen bis in die ungeordnete Ebene von Antiochia vorwärtstreibt. Überall quillt das holde Blut aus den Weidenflächen und erstickt das zurückhaltende Weiß der großen Narzissen, deren Zeit ebenfalls gekommen ist. Ein unsichtbar goldenes Dröhnen scheint den Berg einzuhüllen. Sind es die ausgeschwärmten Immenvölker aus den Bienenstöcken von Kebussije oder wird in dieser durchsichtigsten und durchhörbarsten Stunde die Brandung des Mittelmeers vernehmlich, die den nackten Rücken des Musa Dagh weit dahinten benagt? Der holprige Weg läuft zwischen verfallenen Mauern aufwärts. Wo sie unvermittelt als unordentliche Steinhaufen enden, verengt er sich zu einem Hirtenpfad. Der Vorberg ist erstiegen. Gabriel Bagradian wendet sich um. Seine große Gestalt in dem Touristenanzug aus flockigem Homespun streckt sich lauschend. Er rückt den Fez ein wenig aus der feuchten Stirn. Seine Augen stehen auseinander. Sie sind etwas heller, aber um nichts kleiner als Armenieraugen im allgemeinen.
Nun sieht Gabriel, woher er kommt: Das Haus leuchtet mit seinen grellen Mauern und dem flachen Dach zwischen den Eukalyptusbäumen des Parks. Auch die Stallungen und das Wirtschaftsgebäude blinken in der sonntäglichen Morgensonne. Obgleich zwischen Bagradian und dem Anwesen schon mehr als eine halbe Wegstunde Entfernung liegt, scheint es immer noch so nahe, als sei es seinem Herrn auf dem Fuße gefolgt. Doch auch die Kirche von Yoghonoluk weiter unten im Tal grüßt ihn deutlich mit ihrer großen Kuppel und dem spitzhütigen Seitentürmchen. Diese massig ernste Kirche und die Villa Bagradian gehören zusammen. Gabriels Großvater, der sagenhafte Stifter und Wohltäter, hat beide vor fünfzig Jahren erbaut. Unter den armenischen Bauern und Handwerkern ist es wohl Sitte, nach den Wanderfahrten des Erwerbs aus der Fremde, ja selbst aus Amerika in die Heimatnester zurückzukehren; die reichgewordenen Großbürger aber halten es anders. Sie setzen ihre Prunkvillen an die Küste von Cannes, in die Gärten von Heliopolis oder zumindest auf die Hänge des Libanon in der Umgebung von Beirût. Von dergleichen Emporkömmlingen unterschied sich der alte Awetis Bagradian beträchtlich. Er, der Begründer jenes bekannten Stambuler Welthauses, das in Paris, London und New York Niederlassungen besaß, residierte, soweit es seine Zeit und seine Geschäfte zuließen, Jahr für Jahr in der Villa oberhalb der Ortschaft Yoghonoluk am Musa Dagh. Doch nicht nur Yoghonoluk, auch die übrigen sechs armenischen Dörfer des Bezirkes von Suedja hatten den reichen Segen seiner königlichen Gegenwart genossen. Wenn man von den Kirchen und Schulbauten, von der Berufung amerikanischer Missionslehrer absieht, so genügt es, auf das Geschenk hinzuweisen, das der Bevölkerung trotz aller Ereignisse bis auf den heutigen Tag im Gedächtnis geblieben ist: jene Schiffsladung von Singer-Nähmaschinen, die Awetis Bagradian nach einem besonders glücklichen Geschäftsjahr an fünfzig bedürftige Familien der Dörfer verteilen ließ.
Gabriel – er wendet den lauschenden Blick noch immer von der Villa nicht ab – hat den Großvater gekannt. Er wurde ja unten in dem Hause geboren und hat so manchen langen Kindheitsmonat dort verbracht. Bis zu seinem zwölften Jahr. Und doch, dieses frühere Leben, das einst das seinige war, berührt ihn unwirklich bis zur Schmerzhaftigkeit. Es gleicht einem vorgeburtlichen Dasein, dessen Erinnerungen mit unwillkommenen Schauern die Seele ritzen. Hat er den Großvater tatsächlich gekannt oder ihn nur in einem Knabenbuch gelesen oder abgebildet gesehen? Ein kleiner Mann mit weißem Spitzbart in einem langen, gelb-schwarz gestreiften Seidenrock. Der goldene Kneifer hängt an einer Kette auf die Brust herab. Mit roten Schuhen geht er durch das Gras des Gartens. Alle Menschen verbeugen sich tief. Zierliche Greisenfinger berühren die Wange des Kindes. War es so, oder ist es nur eine leere Träumerei? Mit dem Großvater ergeht es Gabriel Bagradian ähnlich wie mit dem Musa Dagh. Als er vor einigen Wochen den Kindheitsberg zum erstenmal wiedersah, die dunkelnde Kammlinie gegen den Abendhimmel, da durchflutete ihn eine unbeschreibliche Empfindung, schreckhaft und angenehm zugleich. Ihre Tiefe ließ sich nicht ergrübeln. Er gab es sofort auf. War es der erste Atemzug einer Ahnung? Waren es die dreiundzwanzig Jahre?
Dreiundzwanzig Jahre Europa, Paris! Dreiundzwanzig Jahre der völligen Assimilation! Sie gelten doppelt und dreifach. Sie löschen alles aus. Nach dem Tode des Alten flieht die Familie, vom Lokalpatriotismus des Oberhauptes erlöst, diesen orientalischen Winkel. Der Hauptsitz der Firma bleibt nach wie vor in Stambul. Doch Gabriels Eltern leben mit ihren beiden Söhnen jetzt in Paris. Der Bruder, auch er heißt Awetis, um fünfzehn Jahre älter als Gabriel, verschwindet aber rasch. Als Mitchef des Importhauses kehrt er in die Türkei zurück. Nicht zu Unrecht trägt er den Vornamen des Großvaters. Ihn zieht es nicht nach Europa. Er ist ein einsamkeitssüchtiger Sonderling. Die Villa in Yoghonoluk kommt nach mehrjähriger Verlassenheit durch ihn wieder zu Ehren. Seine einzige Liebhaberei ist die Jagd, und von Yoghonoluk aus unternimmt er seine Weidfahrten ins Taurusgebirge und in den Hauran. Gabriel, der von dem Bruder kaum etwas weiß, geht in Paris aufs Gymnasium und studiert an der Sorbonne. Niemand zwingt ihm den kaufmännischen Beruf auf, zu dem er, eine wunderliche Ausnahme seines Stammes, nicht im geringsten taugt. Er darf als Gelehrter und Schöngeist leben, als Archäologe, Kunsthistoriker, Philosoph, und empfängt im übrigen eine Jahresrente, die ihn zum freien, ja wohlhabenden Mann macht. Sehr jung noch heiratet er Juliette. Diese Ehe bringt eine tiefere Wandlung. Die Französin zieht ihn auf ihre Seite. Nun ist Gabriel Franzose mehr denn je. Armenier ist er nur mehr im akademischen Sinn gewissermaßen. Dennoch vergißt er sich nicht ganz und veröffentlicht einen oder den anderen seiner wissenschaftlichen Aufsätze in armenischen Zeitschriften. Auch bekommt sein Sohn Stephan mit zehn Jahren einen armenischen Studenten zum Hofmeister, damit ihn dieser in der Sprache seiner Väter ausbilde. Juliette hält das anfangs für höchst überflüssig, ja sogar schädlich. Da ihr aber das Wesen des jungen Samuel Awakian angenehm ist, gibt sie nach einigen Rückzugskämpfen ihren Widerstand auf. Die Zwistigkeiten der Gatten wurzeln immer in ein und demselben Gegensatz. Wie sehr sich aber Gabriel auch bemüht, im Fremden aufzugehen, er wird dennoch von Zeit zu Zeit in die Politik seines Volkes hineingezogen. Da er einen guten Namen trägt, suchen ihn etliche der armenischen Führer auf, wenn sie in Paris sind. Man bietet ihm sogar ein Mandat der Daschnakzagan-Partei an. Wenn er auch diese Zumutung mit Schreck von sich weist, so nimmt er doch an dem bekannten Kongreß teil, der im Jahre 1907 die Jungtürken mit der armenischen Nationalpartei vereinigt. Ein neues Reich soll geschaffen werden, in dem die Rassen friedlich und ohne Entehrung nebeneinander leben. Für ein solches Ziel begeistert sich auch der Entfremdete. Die Türken machen in diesen Tagen den Armeniern die schönsten Komplimente und Liebeserklärungen. Gabriel Bagradian nimmt nach seiner Art den Treueschwur ernster als andere. Dies ist der Grund, weshalb er sich bei Ausbruch des Balkankrieges freiwillig zu den Waffen meldet. Er wird an der Reserveoffiziersschule zu Stambul im Eilverfahren ausgebildet und kommt noch zurecht, um als Offizier einer Haubitzbatterie die Schlacht bei Bulaïr mitzukämpfen. Diese einzige große Trennung von den Seinigen währt länger als ein halbes Jahr. Er leidet tief unter ihr. Vielleicht fürchtet er, Juliette könnte ihm entgleiten. Irgend etwas in ihrer Beziehung zu ihm fühlt er gefährdet, obgleich er keinen wirklichen Anlaß zu diesem Gefühl hat. Nach Paris zurückgekehrt, schwört er allen Dingen ab, die nicht allein dem inneren Leben gelten. Er ist ein Denker, ein abstrakter Mensch, ein Mensch an sich. Was gehn ihn die Türken an, was die Armenier? Er denkt daran, die französische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Damit würde er vor allem Juliette glücklich machen. Zuletzt hält ihn immer wieder ein Mißgefühl davon ab. Er ist freiwillig in den Krieg gegangen. Wenn er auch in seinem Vaterland nicht lebt, so kann er es doch nicht widerrufen. Es ist sein Väter-Land. Die Väter haben Ungeheures dort erlitten und es dennoch nicht aufgegeben. Gabriel hat nichts erlitten. Er weiß von Mord und Metzelei nur durch Erzählungen und Bücher. Ist es nicht gleichgültig, wohin ein abstrakter Mensch zuständig ist, denkt er, und bleibt ottomanischer Untertan. Zwei glückliche Jahre in einer hübschen Wohnung der Avenue Kleber. Es sieht so aus, als seien alle Probleme gelöst und die endgültige Lebensform gefunden. Gabriel ist fünfunddreißig alt, Juliette vierunddreißig, Stephan dreizehn. Man hat ein sorgloses Dasein, keinen besonderen Ehrgeiz, geistige Arbeit und einen angenehmen Freundeskreis. Was letzteren anbetrifft, ist Juliette tonangebend. Dies zeigt sich hauptsächlich darin, daß der Verkehr mit Gabriels alten armenischen Bekannten – seine Eltern sind lang verstorben – immer mehr einschrumpft. Juliette setzt gleichsam ihr Blut unnachgiebig durch. Nur die Augen ihres Sohnes kann sie freilich nicht ändern. Gabriel aber scheint von alledem nichts zu merken. Ein Eilbrief Awetis Bagradians bringt den Umschwung des Schicksals. Der ältere Bruder fordert Gabriel auf, nach Stambul zu kommen. Er sei ein schwerkranker Mann und nicht mehr fähig, das Unternehmen zu leiten. Darum habe er seit Wochen schon alle Vorbereitungen getroffen, um die Firma in eine Aktiengesellschaft zu verwandeln. Gabriel möge erscheinen, um seine Interessen wahrzunehmen. Juliette, die auf ihren Weltsinn nicht wenig pocht, erklärt sogleich, sie wolle Gabriel begleiten und während der Verhandlungen unterstützen. Es gehe ja um sehr große Dinge. Er aber sei von harmloser Natur und den armenischen Kniffen der anderen keineswegs gewachsen. Juni 1914. Unheimliche Welt. Gabriel entschließt sich, nicht nur Juliette, sondern auch Stephan und Awakian mit auf die Reise zu nehmen. Das Schuljahr ist ja so gut wie zu Ende. Die Angelegenheit kann sich lange hinausziehen und der Lauf der Welt läßt sich nicht berechnen. In der zweiten Juliwoche kommt die Familie in Konstantinopel an. Awetis Bagradian jedoch hat sie nicht erwarten können. Er ist mit einem italienischen Schiff nach Beirût abgereist. Sein Lungenleiden hat sich in den letzten Tagen mit grausamer Schnelligkeit verschlechtert und er konnte die Luft von Stambul nicht länger ertragen. (Merkwürdig, der Bruder des Europäers Gabriel geht nicht in die Schweiz, sondern nach Syrien, um zu sterben.) Anstatt mit Awetis verhandelt Gabriel nun mit Direktoren, Rechtsanwälten und Notaren. Er muß aber erkennen, daß der unbekannte Bruder für ihn auf die zarteste und umsichtigste Art vorgesorgt hat. Da kommt es ihm das erstemal ganz stark zu Bewußtsein, daß es dieser kranke ältliche Awetis ist, der für ihn arbeitet, dem er sein Wohlergehen verdankt. Welch ein Widersinn, daß Brüder einander so fremd bleiben müssen. Gabriel erschrickt vor dem Hochmut, den er in sich gegen den »Geschäftsmann«, gegen den »Orientalen« nicht immer unterdrückt hat. Jetzt erfaßt ihn der Wunsch, ein Unrecht gutzumachen, ehe es zu spät ist, ja eine leichte Sehnsucht. Die Hitze in Stambul ist wirklich nicht auszuhalten. Nach dem Westen zurückzukehren scheint jetzt nicht ratsam. Lassen wir den Sturm vorübergehen. Hingegen ist schon der Gedanke an eine kleine Seefahrt eine Erquickung. Einer der neuesten Dampfer des Khedival Mail läuft auf dem Wege nach Alexandria Beirût an. Auf den westlichen Hängen des Libanon sind moderne Villen zu mieten, die den unbescheidensten Ansprüchen genügen. Die Kenner wissen, daß keine Landschaft der Erde schöner ist als diese. Gabriel aber hat es gar nicht nötig, mit solchen Überredungskünsten aufzuwarten, denn Juliette ist sogleich einverstanden. In ihr lebt schon seit langer Zeit eine dumpfe Ungeduld. Die Aussicht auf etwas Neues lockt sie an. Während sie auf hoher See sind, prasseln die Kriegserklärungen der Staaten aufeinander. Als sie den Landungsquai von Beirût betreten, haben in Belgien, auf dem Balkan und in Galizien schon die ersten Kämpfe begonnen. An eine Heimkehr nach Frankreich ist nicht mehr zu denken. Sie sitzen fest. Die Zeitungen berichten, daß die Hohe Pforte in den Bund der Mittelmächte treten werde. Paris ist Feindesland geworden. Der tiefere Zweck der Reise entpuppt sich als verfehlt. Awetis Bagradian ist dem jüngeren Bruder zum zweitenmal entronnen. Er hat Beirût vor ein paar Tagen verlassen und die beschwerliche Reise über Aleppo und Antiochia nach Yoghonoluk gewagt. Auch der Libanon genügt ihm nicht für den Tod. Der Musa Dagh muß es sein. Der Brief aber, in dem der Bruder diesen seinen Tod selbst ankündigt, trifft erst im Herbst ein. Die Bagradians haben sich inzwischen in einem hübschen Hause angesiedelt, das nur ein wenig oberhalb der Stadt liegt. Juliette findet das Leben in Beirût erträglich. Es gibt eine Menge Franzosen hier. Auch die verschiedenen Konsuln kommen zu ihr. Sie versteht es wie überall, Leute aufzutreiben. Gabriel ist glücklich darüber, daß sie die Verbannung nicht zu schwer empfindet. Man kann dagegen nichts machen. Sicherer als europäische Städte ist Beirût wenigstens. Gabriel aber muß immerzu an das Haus in Yoghonoluk denken. In seinem Briefe legt es ihm Awetis dringend ans Herz. Fünf Tage nach dem Brief kommt Doktor Altounis Telegramm mit der Todesnachricht. Jetzt denkt Gabriel nicht nur, sondern spricht immerwährend von dem Haus der Kindheit. Als aber Juliette plötzlich den Willen kundgibt, dieses Haus, von dem er seit ewigen Zeiten immer erzählte und das er nun geerbt hat, so schnell wie möglich zu beziehen, schrickt er zurück. Seinen Einwänden begegnet sie mit Eigensinn. Ländliche Einsamkeit? Nichts sei ihr willkommener. Weltverlassenheit, mangelnder Komfort? Sie werde sich alles Nötige selbst schaffen. Gerade diese Aufgabe reize sie besonders. Ihre Eltern hätten ein Landhaus besessen, in dem sie aufgewachsen sei. Wenn sie ein eigenes Haus einrichten, wenn sie darin nach ihrem Ermessen schalten und wirtschaften dürfe, gehe einer ihrer liebsten Träume in Erfüllung, wo und unter welchem Himmelsstrich, das sei gleichgültig. Trotz dieser freudigen Bereitwilligkeit wehrt sich Gabriel noch über die Regenzeit hinaus. Wäre es nicht weit klüger, wenn er alles daransetzte, um seine Familie in die Schweiz zu bringen? Juliette aber bleibt bei ihrem Begehren. Es klingt fast wie eine Herausforderung. Er kann ein sonderbares Unbehagen nicht unterdrücken, das mit sehnsüchtigen Gefühlen vermengt ist. Es ist bereits Dezember geworden, als sich die kleine Familie zu der Expedition in die Heimat des Vaters rüstet. Bis nach Aleppo geht die Bahnreise trotz der Truppenverschiebungen leidlich. In Aleppo mietet man zwei unbeschreibliche Autos. Im Schlamm der Bezirksstraße gelangen sie wie durch ein Wunder Gottes doch bis Antiochia. Dort wartet schon der Verwalter Kristaphor an der Orontesbrücke mit dem Jagdwagen des Hauses und zwei Ochsenkarren für das Gepäck. Keine zwei Stunden mehr bis Yoghonoluk. Sie vergehn recht heiter. Das Ganze war gar nicht so schlimm, meinte Juliette ...
Wie komme ich hierher? All die äußere Verquickung der Dinge beantwortet die Frage nur höchst unvollständig. Das feierliche Erstaunen seiner Seele aber weicht nicht. Eine leichte Unruhe schwingt mit. Die uralten Dinge, in dreiundzwanzig Pariser Jahren überwunden, sie müssen wieder eingebürgert werden. Jetzt erst wendet Gabriel den leeren Blick von seinem Haus. Juliette und Stephan schlafen gewiß noch. Auch die Kirchenglocken von Yoghonoluk haben den Sonntag noch nicht eingeläutet. Seine Augen verfolgen das Tal der armenischen Dörfer ein Stück nach Norden. Das Dorf der Seidenraupen, Azir, kann er von seinem Standpunkt aus noch erblicken, Kebussije, die letzte Ortschaft in dieser Richtung, nicht mehr. Azir schläft in einem dunkelgrünen Bett von Maulbeerbäumen. Auf dem kleinen Hügel dort, der sich an den Musa Dagh lehnt, erhebt sich eine Klosterruine. Der heilige Apostel Thomas in Person hat die Einsiedelei begründet. Die Steine des Trümmerfeldes tragen bemerkenswerte Inschriften. Manche darunter stammen aus der Seleuzidenzeit und bedeuten für einen Archäologen seltene Funde. Einst reichte Antiochia, die Königin der damaligen Welt, bis zum Meere. Allenthalben liegen hier die Altertümer auf der nackten Erde zur Schau oder springen dem Schatzgräber beim ersten Spatenstich entgegen. Gabriel hat in diesen Wochen schon eine Menge kostbarer Trophäen in seinem Hause geborgen. Diese Jagd bildet seine Hauptbeschäftigung hier. Dennoch hielt ihn eine Scheu bisher zurück, den Hügel der Thomasruine zu ersteigen. (Große Schlangen, kupferfarben und gekrönt, bewachen sie. Jenen Männern, welche die heiligen Steine zum Hausbau heimschleppten, wuchs die Last auf dem Rücken fest, und die Frevler mußten sie ins Grab mitnehmen.) Wer hat ihm diese Geschichte erzählt? Einst im Zimmer seiner Mutter, das nun Juliettens Zimmer ist, saßen alte Weiber mit sonderbar bemalten Gesichtern. Oder ist auch dies nur eine Einbildung? Ist es möglich: war die Mutter in Yoghonoluk und die Mutter in Paris ein und dieselbe Frau?
Gabriel hat längst den dunklen Laubwald betreten. In den Berghang ist eine steile breite Rinne eingeschnitten, die bis zur Höhe führt. Man nennt sie die Steineichenschlucht. Während Bagradian den Hirtenweg emporsteigt, der sich mühselig durch das dichte Unterholz drängt, weiß er plötzlich: Das Provisorium ist zu Ende. Die Entscheidung muß kommen.
Provisorium? Gabriel Bagradian ist ottomanischer Offizier in der Reserve eines Artillerieregimentes. Die türkischen Armeen stehen an vier Fronten im Kampf auf Leben und Tod. Im Kaukasus gegen die Russen. In der mesopotamischen Wüste gegen Engländer und Inder. Australische Divisionen sind auf der Halbinsel Gallipoli gelandet, um gemeinsam mit den verbündeten Flotten das Tor zum Bosporus einzurennen. Die vierte Armee in Syrien und Palästina bereitet einen neuen Stoß gegen den Suezkanal vor. Übermenschliche Anstrengung ist nötig, um an all diesen Fronten standzuhalten. Enver Pascha, der vergötterte Feldherr, hat bei seinem tollkühnen Feldzug im kaukasischen Winter zwei volle Armeekorps eingebüßt. Überall fehlt es an Offizieren. Das Kriegsmaterial ist unzulänglich. Für Bagradian sind die hoffnungsvollen Tage von 1908 und 1912 vorüber. Ittihad, das jungtürkische »Komitee für Einheit und Fortschritt«, hat sich des armenischen Volkes für seine Zwecke nur bedient, um sogleich all seine Schwüre zu brechen. Gabriel hat durchaus keinen Grund, sich zum Erweise seiner vaterländischen Tapferkeit besonders vorzudrängen. Die Dinge liegen diesmal ganz anders. Seine Frau ist Französin. Er könnte demnach gezwungen sein, gegen eine Nation im Felde zu stehen, die er liebt, der er zu höchstem Dank verpflichtet, der er durch die Ehe verbunden ist. Dennoch hat er sich in Aleppo bei dem Ersatzbezirk seines Regimentes gestellt. Es war seine Pflicht. Ansonsten hätte man ihn als Deserteur behandeln können. Merkwürdigerweise scheint aber der Oberst des Kaders keinen Bedarf an Offizieren zu haben. Er studiert Bagradians Papiere mit durchdringender Genauigkeit, dann schickt er ihn fort. Er möge seinen Wohnort angeben, sich dort bereit halten und die Einberufung abwarten. Das geschah im November. Jetzt geht der März zu Ende, und der Einrückungsbefehl ist noch immer nicht von Antiochia eingetroffen. Steckt dahinter eine undurchdringliche Absicht oder nur das undurchdringliche Betriebs-Chaos ottomanischer Militärkanzleien? In diesem Augenblick aber ist es Gabriel, als wisse er genau, daß noch heutigentags die Entscheidung herablangen werde. Am Sonntag kommt die Post aus Antiochia, nicht nur Briefe und Zeitungen, sondern auch die Regierungsbefehle des Kaimakamliks an Gemeinden und Untertanen.
Gabriel Bagradian denkt nur an seine Familie. Die Lage ist verzwickt. Was soll während seines Felddienstes mit Juliette und Stephan geschehen? Mancherlei spricht für das Verbleiben in Yoghonoluk. Juliette ist von Haus, Park, Wirtschaft, Obst- und Rosenzucht entzückt. In der Rolle einer Gutsherrin scheint sie sich sehr wohl zu fühlen. Verläßliche und schätzenswerte Menschen gibt es auch hier genug. Den alten Arzt Doktor Altouni und den wunderlich gelehrsamen Apotheker Krikor kennt Gabriel noch aus seiner Kindheit. Dazu kommt der Wartabed Ter Haigasun, Hauptpriester von Yoghonoluk und gregorianischer Vikar des ganzen Sprengels von Suedja. Ferner der protestantische Pastor Harutiun Nokhudian von Bitias, die Lehrer und etliche Notabeln mehr. Mit den Frauen muß man freilich ein wenig Nachsicht haben. Nach dem ersten Empfang dieser Honoratioren in der Villa Bagradian hatte Gabriel zu Juliette gemeint, daß man in einem Marktflecken der Provence bei solcher Gelegenheit auch keine besseren Leute finde als hier an der syrischen Küste. Juliette nahm diese Feststellung hin, ohne wie gewöhnlich ihren Spott gegen alles Armenische und Orientalische aufzubieten, mit dem sie ihren Gatten oft zu quälen weiß. Seither wiederholten sich diese Empfangsabende mehrfach. Auch an dem heutigen Märzsonntag findet ein solcher statt. Gabriel ist über Juliettes Milde glücklich. All diese Gunst jedoch ändert nichts an der Tatsache, daß Frau und Sohn hier, wenn sie allein zurückbleiben, von der Welt abgeschnitten sind.
Die Steineichenschlucht bleibt hinter Bagradian zurück, ohne daß er in dieser Frage zu größerer Klarheit gelangt wäre. Der ausgetretene Pfad läuft nordwärts und verliert sich zwischen Arbutus- und Rhododendrongesträuch auf dem Bergrücken. Dieser Teil des Musa Dagh wird von den Bergbewohnern Damlajik genannt. Gabriel kennt noch all diese Namen. Der Damlajik erreicht keine nennenswerten Höhen. Die beiden südlich gelegenen Kuppen wachsen bis zu achthundert Metern empor. Sie bilden die letzten Erhebungen des Gebirgsstockes, der dann unversehens und ohne rechte Ordnung mit riesigen Steinhalden in die Ebene des Orontes stürzt, wie abgebrochen. Hier im Norden, wo der Spaziergänger soeben seinen Weg sucht, ist der Damlajik niedriger. Er fällt dann in eine Sattelkerbe ab. Dies ist der schmalste Punkt des ganzen Küstengebirges, die Taille des Musa Dagh. Die Hochfläche verengt sich auf wenige hundert Meter, und das Felsgewirre der Steilseite dringt weit vor. Gabriel glaubt jeden Stein und jeden Busch zu kennen. Von allen Bildern der Kindheit hat sich dieser Ort am tiefsten in sein Gedächtnis eingestanzt. Es sind dieselben schirmspannenden Pinien, die hier einen Hain aufschlagen. Es ist derselbe kriechende Nadelwuchs, der sich über den steinigen Boden sträubt. Efeu und anderes Schlinggewächs umhalst eine Runde weißer Felsblöcke, die wie riesenhafte Persönlichkeiten eines Natursenats ihre Beratung unterbrechen, sobald der Schritt des Eindringlings erschallt. Eine reisefertige Schwalbennation durchzwitschert die Stille. Erregtes Spiel in dem grünlichen Binnensee der Luft. Wie von dunklen Forellen. Das jähe Entfalten und Einziehn der Flügel gleicht einem Lidschlag.
Gabriel legt sich, die Arme unter dem Kopf verschränkend, auf eine grasige Stelle. Zweimal hat er schon vorher den Musa Dagh erstiegen, um diese Pinien und Felsblöcke zu finden, ist aber immer aus der Richtung geraten. Die gibt es also gar nicht, dachte er schon. Jetzt schließt er müde die Augen. Kehrt der Mensch an einen alten Ort der Betrachtung und des inneren Lebens zurück, so stürzen sich die Geister, die der Heimkehrer dereinst dort zeugte und zurückließ, leidenschaftlich auf ihn. Auch auf Bagradian stürzen sich seine Knabengeister, als hätten sie hier unter Pinien und Felsen dieser reizenden Einöde dreiundzwanzig Jahre seiner treulich gewartet. Es sind sehr kriegerische Geister. Die wilden Phantome jedes Armenierjungen. (Konnten sie anders sein?) Der blutige Sultan Abdul Hamid hat einen Ferman wider die Christen erlassen. Die Hunde des Propheten, Türken, Kurden, Tscherkessen, sammeln sich um die grüne Fahne, um zu sengen, zu plündern und das Armeniervolk zu massakrieren. Die Feinde aber haben nicht mit Gabriel Bagradian gerechnet. Er vereinigt die Seinen. Er führt sie ins Gebirge. Mit unbeschreiblichem Heldenmut wehrt er die Übermacht ab und schlägt sie zurück.
Gabriel entzieht sich diesen kindischen Anwandlungen nicht. Er, der Pariser, Juliettens Gatte, der Gelehrte, der Offizier, der die Wirklichkeit des modernen Krieges kennt und neuerdings im Begriffe steht, seine Pflicht als türkischer Soldat zu erfüllen – er ist zugleich der Knabe, der sich mit uraltem Bluthaß auf den Erzfeind seiner Rasse wirft. Die Träume jedes Armenierjungen. Nur ein Augenblick zwar! Doch Gabriel wundert sich und lächelt ironisch, ehe er einschläft.
Gabriel Bagradian fährt auf, nicht ohne Schreck. Jemand hat ihn eindringlich beobachtet, während er schlief. Wahrscheinlich recht lange. Er sieht in die stillbrennenden Augen seines Sohnes Stephan. Eine unangenehme Empfindung, wenn auch nicht ganz deutlich, erfaßt ihn. Der Sohn hat seinen Vater während des Schlafes nicht zu überraschen. Irgendein tiefes Sittengesetz wird dadurch verletzt. Er legt eine leichte Strenge in seine Worte:
»Was tust du hier? Wo ist Monsieur Awakian?«
Jetzt scheint Stephan auch darüber bestürzt zu sein, daß er den Vater im Schlafe ertappt hat. Seine Hände wissen mit sich nichts anzufangen. Seine starken Lippen öffnen sich. Er trägt ein College-Gewand, Halbstrümpfe und einen breiten Umlegkragen. Während er spricht, zupft er an seinem Rock:
»Mama hat mir erlaubt, allein spazierenzugehen. Monsieur Awakian ist heute frei. Wir lernen ja am Sonntag nicht.«
»Wir sind hier nicht in Frankreich, Stephan, sondern in Syrien«, erklärt der Vater bedeutungsvoll. »Das nächste Mal darfst du nicht ohne Aufsicht in den Bergen herumklettern.«
Stephan sieht Papa gespannt an, als erwarte er außer dieser kleinen Rüge noch wichtigere Weisungen. Doch Gabriel sagt nichts mehr. Eine komische Verlegenheit bemächtigt sich seiner. Ihm ist es, als sei er jetzt zum erstenmal im Leben mit seinem Jungen allein. Seitdem sie in Yoghonoluk sind, hat er sich wenig um ihn gekümmert und sieht ihn zumeist nur bei Tisch. In Paris zwar und zur Ferienzeit in der Schweiz hat er mit Stephan manchmal einsame Spaziergänge unternommen. Aber ist man in Paris, Montreux oder in Chamonix allein? Die klare Luft des Musa Dagh jedoch ist ein lösendes Element, das eine Nähe zwischen den beiden erzeugt, die ihnen unbekannt ist. Gabriel geht voraus wie ein Führer, der alle wichtigen Punkte kennt. Stephan folgt ihm, noch immer stumm und erwartungsvoll.
Vater und Sohn im Morgenland! Das läßt sich kaum mit der oberflächlichen Beziehung zwischen Eltern und Kindern in Europa vergleichen. Wer seinen Vater sieht, sieht Gott. Denn dieser Vater ist das letzte Glied der ununterbrochenen Ahnenkette, die den Menschen mit Adam und dadurch mit dem Ursprung der Schöpfung verbindet. Doch auch, wer seinen Sohn sieht, sieht Gott. Denn dieser Sohn ist das nächste Glied, welches den Menschen mit dem Jüngsten Gericht, dem Ende aller Dinge und der Erlösung verbindet. Muß da in solch heiligem Verhältnis nicht Scheu und Wortkargheit herrschen?
Der Vater entschließt sich zu einer ernsthaften Unterhaltung, wie es sich gebührt:
»Welche Gegenstände lernst du jetzt mit Herrn Awakian?«
»Wir haben vor einiger Zeit Griechisch zu lesen begonnen, Papa. Dann lernen wir auch Physik, Geschichte, Geographie.«
Bagradian hebt den Kopf. Stephan spricht armenisch. Hat er ihm seine Frage auch armenisch gestellt? Für gewöhnlich reden sie französisch miteinander. Die armenischen Worte des Sohnes berühren den Vater seltsam. Er wird sich dessen bewußt, daß er in Stephan weit öfter einen französischen als einen armenischen Jungen gesehen hat.
»Geographie«, wiederholt er. »Und mit welchem Weltteil beschäftigt ihr euch gerade?«
»Die Geographie von Kleinasien und Syrien«, meldet Stephan diensteifrig. Gabriel nickt zustimmend, als habe er nichts Klügeres erwartet. Dann sucht er, schon nicht mehr ganz bei der Sache, dem Gespräch einen pädagogischen Abschluß zu geben:
»Wärst du imstande, vom Musa Dagh hier eine Karte zu zeichnen?«
Stephan ist durch soviel väterliches Zutrauen beglückt:
»O ja, Papa! In deinem Zimmer hängt noch eine Karte von Onkel Awetis, Antiochia und die Küste. Man muß nur den Maßstab vergrößern und alles, was fehlt, ergänzen.«
Das ist ganz richtig. Gabriel freut sich einen Augenblick über Stephan. Dann aber schweifen die Gedanken zu dem Einrückungsbefehl ab, der vielleicht schon unterwegs ist, vielleicht sich noch immer auf einem türkischen Schreibtisch in Aleppo oder gar in Stambul herumwälzt. Stumme Wanderung. Die gesammelte Seele Stephans wartet einer neuen Ansprache. Dies ist die Heimat Papas. Er sehnt sich danach, Geschichten aus des Vaters Kindheit zu hören, jene geheimnisvollen Dinge, von denen man ihm so selten erzählt hat. Der Vater aber scheint ein bestimmtes Ziel zu haben. Und schon öffnet sich die eigenartige Terrasse, der er entgegenstrebt. Sie reicht, weit aus dem Berg gebaut, ins Leere. Ein gewaltiger Felsenarm hält sie mit gespreizten Fingern hoch wie eine Schüssel. Es ist eine steinbesäte Felsplatte, sehr geräumig, zwei Häuser hätten Platz. Die Stürme des Meeres freilich, die hier leichtes Spiel haben, dulden kaum ein paar Sträucher und eine lederharte Agave. Die freischwebend überhängende Fläche springt so weit vor, daß ein Selbstmörder, der vom äußersten Rand sich in den vierhundert Meter tiefer gelegenen Meeresabgrund stürzt, im Wasser verschwinden kann, ohne von einer Klippe verletzt zu werden. Nach Knabenart will Stephan zum Rande vorlaufen. Doch der Vater reißt ihn heftig zurück und hält seine Hand krampfhaft umklammert. Mit der freien Rechten deutet er in die verschiedenen Weltrichtungen.
»Dort im Norden könnten wir die Bucht von Alexandrette sehen, wenn das Ras el Chansir, das Schweinekap, nicht wäre. Und im Süden die Orontesmündung; der Berg aber macht einen Bogen ...«
Stephan verfolgt aufmerksam den Zeigefinger des Vaters, der das Halbrund des erregten Meeres nachzeichnet. Doch was er fragt, hat mit der Ortsbeschreibung nichts zu tun:
»Wirst du wirklich in den Krieg gehn, Papa?«
Gabriel bemerkt gar nicht, daß er Stephans Hand noch immer ängstlich festhält:
»Ja! Ich erwarte jeden Tag den Befehl.«
»Und muß das sein?«
»Es geht nicht anders, Stephan. Alle türkischen Reserveoffiziere müssen einrücken.«
»Wir sind aber keine Türken. Und warum haben sie dich nicht gleich einberufen?«
»Es heißt, daß die Artillerie vorläufig nicht genügend Geschütze hat. Wenn die neuen Batterien aufgestellt sind, wird man dann alle Reserveoffiziere einberufen.«
»Und wohin werden sie dich schicken?«
»Ich gehöre zur vierten Armee in Syrien und Palästina.«
Es ist für Gabriel Bagradian eine beruhigende Vorstellung, daß er wohl für einige Zeit nach Aleppo, Damaskus oder Jerusalem kommandiert werden kann. Vielleicht gäbe es da eine Möglichkeit, Juliette und Stephan mitzunehmen. Stephan scheint die väterlichen Sorgen zu erraten:
»Und wir, Papa?«
»Das ist es eben ...«
Der Knabe fällt dem Vater inbrünstig ins Wort:
»Laß uns hier, Papa, bitte laß uns hier! Auch Mama gefällt es doch sehr gut in unserem Haus.«
Mit dieser Versicherung will Stephan den Vater über die Gefühle Mamas beruhigen, die ja hier in der Fremde ist. Er spürt mit wacher Feinheit das Hinüber und Herüber der beiden Welten in der Ehe seiner Eltern.
Bagradian aber überlegt:
»Es wäre am besten, wenn ich es versuchte, euch über Stambul nach der Schweiz zu bringen. Leider aber ist Stambul auch schon Kriegsschauplatz ...«
Stephan ballt die Fäuste über die Brust:
»Nein, nicht in die Schweiz! Laß uns hier, Papa!«
Gabriel sieht den Jungen, dessen Augen flehen, erstaunt an. Sonderbar! Dieses Kind, das die Väterheimat nie gekannt hat, ist also dennoch mit ihr tief verbunden. Was in ihm selbst lebt, die Anhänglichkeit an diesen Berg des Bagradian-Geschlechtes, das hat der in Paris geborene Stephan ohne eigene Gefühlserfahrung in seinem Blut geerbt. Er legt den Arm um die Schultern seines Knaben, sagt aber nur:
»Wir werden sehn.«
Als sie wieder die Hochfläche des Damlajik erstiegen haben, dringt das Morgengeläute von Yoghonoluk zu ihnen empor. Der Weg ins Tal dauert kaum eine Stunde. Sie müssen sich sehr beeilen, um wenigstens die zweite Hälfte der Messe noch zu hören.
In Azir, dem Raupendorf, begegnen die Bagradians nur wenigen Leuten, die ihnen den Morgengruß entbieten:
»Bari luis!« »Gutes Licht!« Die Bewohner von Azir pflegen in Yoghonoluk zur Kirche zu gehn. Sie haben ja nur fünfzehn Minuten bis in den Hauptort. Vor manchen Haustüren sind Tische aufgestellt, die große Bretter tragen. Über diese Bretter sind die Eier des Seidenwurmes ausgeschmiert, eine weißliche Masse, die in der Sonne brütet. Stephan erfährt von dem Vater, daß der Ahne Awetis der Sohn eines Seidenspinners gewesen ist und in frühester Jugend seine Laufbahn damit begann, daß er als Fünfzehnjähriger nach Bagdad fuhr, um Brot einzukaufen.
Mittwegs vor Yoghonoluk kommt der alte Gendarm Ali Nassif an ihnen vorüber. Der würdige Saptieh gehört zu jenen zehn Türken, die unter den Armeniern der Dörfer schon seit langen Jahren leben, und zwar in Frieden und Freundschaft. Außer ihm waren noch die fünf Untergendarmen zu nennen, die seinen Posten bilden, jedoch öfters ausgewechselt werden, während er an Ort und Stelle bleibt, unverrückbar wie der Musa Dagh. Sonst gibt es nur noch als Vertreter des Sultans einen verwachsenen Briefträger samt Familie, der am Mittwoch und am Sonntag die Post aus Antiochia bringt. Ali Nassif macht heute einen aufgestörten und besorgten Eindruck. Dieser struppige Funktionär der ottomanischen Obrigkeit scheint sich in großer amtlicher Eile zu befinden. Sein mit Pockennarben bedecktes Gesicht glänzt feucht unter der räudigen Pudelmütze. Der martialische Kavalleriesäbel schlägt ihm gegen die ausgedörrten O-Beine. Während er sonst angesichts Bagradian Effendis immer ehrfürchtig Front macht, salutiert er heute nur stramm, legt aber dabei ein betretenes Wesen an den Tag. Sein verwandeltes Benehmen ist für Gabriel so auffallend, daß er ihm eine ganze Weile lang nachblickt.
Über den Kirchplatz von Yoghonoluk laufen nur mehr einige Nachzügler, die von weit her kommen und sich deshalb verspätet haben. Frauen mit buntgestickten Kopftüchern und gebauschten Röcken. Männer, die den Schalwar, die Pumphose, und darüber den Entari, einen kaftanartigen Rock, tragen. Ihre Gesichter sind ernst und in sich gekehrt. Die Sonne hat schon sommerliche Kraft und macht das Rund der kalkweißen Häuser grell erstrahlen. Die meisten sind einstöckig und haben frischen Anstrich bekommen: das Pfarrhaus Ter Haigasuns, das Haus des Arztes, das Haus des Apothekers, das große Gemeindehaus, das dem steinreichen Muchtar, dem Ortsvorsteher von Yoghonoluk Thomas Kebussjan gehört. Die Kirche »Zu den wachsenden Engelmächten« ruht auf einem breiten Sockel. Eine Freitreppe führt zum Portal. Awetis Bagradian, der Stifter, hat sie im kleineren Maße einem berühmten nationalen Heiligtum nachbilden lassen, das sich im Kaukasus befindet. Aus dem offenen Tore strömt der Gesang des Chores, der die Messe begleitet. Man sieht über die dichte Menge hinweg den kerzenbleichen Altar im Dunkel. Das goldene Rückenkreuz auf dem roten Ornat Ter Haigasuns leuchtet.
Gabriel und Stephan Bagradian treten ins Portal. Samuel Awakian, der Hofmeister, hält beide auf. Er hat schon ungeduldig gewartet:
»Gehn Sie nur voraus, Stephan«, bedeutet er seinem Zögling. »Ihre Mutter erwartet Sie.«
Dann, als Stephan in der summenden Menge verschwunden ist, wendet er sich rasch an den Herrn:
»Ich will Ihnen nur mitteilen, daß man Ihre Pässe eingefordert hat. Reisepaß und Inlandpaß. Drei Beamte von Antiochia sind gekommen.«
Gabriel betrachtet aufmerksam das Gesicht des Studenten, der das Leben der Familie nun schon seit mehreren Jahren teilt. Armenisches Intellektuellen-Gesicht. Hohe, ein wenig zurückweichende Stirn. Wachsame, tief bekümmerte Augen hinter der Brille. Der Ausdruck ewiger Schicksalsergebenheit und zugleich ein scharfer Zug wehrhafter Bereitschaft, in jeder Sekunde den Hieb eines Gegners aufzufangen. Erst nach einer Weile dieser eingehenden Antlitz-Erforschung stellt Bagradian die Frage:
»Und was haben Sie getan?«
»Madame hat den Beamten alles ausgefolgt.«
»Auch den Inlandpaß?«
»Ja, Reisepaß und Teskeré.«
Gabriel Bagradian steigt die Kirchentreppe hinab, zündet eine Zigarette an und raucht tiefsinnig einige Züge. Der Inlandpaß ist eine Urkunde, welche ihrem Besitzer die Freizügigkeit innerhalb der ottomanischen Reichsprovinzen zusichert. Ohne dieses Stück Papier hat der Untertan des Sultans theoretisch nicht einmal das Recht, sich von einem Dorf in das andere zu begeben. Gabriel wirft die Zigarette fort und richtet sich mit einem Ruck auf:
»Es bedeutet nichts anderes, als daß ich heute oder morgen zu meinem Kader nach Aleppo einberufen werde.«
Awakian senkt seinen Blick auf eine tiefeingebackene Räderspur, die der letzte Regen im Lehmboden des Kirchplatzes zurückgelassen hat:
»Ich glaube nicht, daß es Ihre Einberufung nach Aleppo bedeutet, Effendi.«
»Es kann ja gar nichts anderes bedeuten.«
Awakians Stimme wird ganz leise:
»Auch ich habe meinen Paß abliefern müssen.«
Bagradian bricht ein beginnendes Lachen schnell ab:
»Das heißt, Sie werden zur Musterung nach Antiochia müssen, lieber Awakian. Diesmal ist es kein Spaß. Aber seien Sie nur ruhig. Wir werden die Militärsteuer für Sie halt noch einmal leisten. Ich brauche Sie für Stephan.«
Awakian hebt den Blick noch immer nicht von der Räderspur:
»Wenn ich auch noch jung bin – Doktor Altouni, Apotheker Krikor, Pastor Nokhudian sind gewiß nicht mehr kriegsdienstpflichtig. Und auch ihnen hat man den Teskeré abgefordert.«
»Wissen Sie das genau?« fährt ihn Gabriel an. »Wer hat abgefordert? Was sind das für behördliche Organe? Welche Gründe haben sie angegeben? Überhaupt, wo befinden sich die Herrschaften? Ich habe große Lust, mit ihnen ein Wort zu reden.«
Er bekommt die Antwort, daß diese Beamten, von einer Abteilung berittener Gendarmerie begleitet, schon vor anderthalb Stunden in der Richtung nach Suedja verschwunden sind. Bei ihrem Auftrag könne es sich ja nur um die Notabeln handeln, da der einfache Bauer und Handwerker ja keinen Teskeré besitzt, sondern höchstens einen Erlaubnisschein für den Markt in Antiochia.
Gabriel macht ein paar lange Schritte hin und her, ohne sich um den Hauslehrer zu kümmern. Dann erst mahnt er: »Gehn Sie nur voraus in die Kirche, Awakian, ich komme schon nach.«
Er denkt aber gar nicht daran, dem Rest der Messe beizuwohnen, deren dichtgeballter Chorgesang jetzt besonders stark hervorbricht. Langsam, den Kopf im Nachdenken zur Seite neigend, schlendert er über den Platz, geht ein Stück die Straße entlang und verläßt sie, wo der Weg zur Villa abzweigt. Ohne aber das Haus zu betreten, macht er bei den Ställen halt und läßt sich eines der Reitpferde satteln, die der Stolz seines Bruders Awetis waren. Leider ist Kristaphor nicht da, um ihn zu begleiten. So nimmt er den Stallburschen mit. Genau weiß er noch nicht, was er unternehmen wird.
Jedoch bei frischem Tempo kann er um die Mittagsstunde in Antiochia sein.
Zweites Kapitel Konak – Hamam – Selamlik
Der Hükümet von Antiochia, wie der Regierungskonak des Kaimakam auch genannt wird, liegt unterhalb des Zitadellenberges. Ein schmutziges, aber umfängliches Gebäude, denn die Kasah Antakje ist eine der volksreichsten Provinzen Syriens.
Gabriel Bagradian, der den Burschen mit den Pferden bei der Orontesbrücke zurückgelassen hatte, wartete schon längere Zeit in einem großen Kanzleiraum des Konaks. Er hoffte vom Kaimakam selbst, dem er seine Karte geschickt hatte, empfangen zu werden. Ein türkisches Amtslokal, wie es Gabriel genau kannte. An der feuchten Wand, von der die Tünche bröckelte, ein unbeholfener Öldruck des Sultans und ein paar gerahmte Koransprüche. Fast alle Fensterscheiben zerbrochen und mit Spannleiste verklebt. Die schmutzstarrende Holzdiele vollgespuckt und mit Zigarettenresten übersät. An einem leeren Schreibtisch saß irgendein Unterbeamter, der schmatzend vor sich hin stierte. Eine Legion dicker Fleischfliegen gab ungehindert ein wildes und ekelhaftes Konzert. Rings um die Wände liefen niedrige Bänke. Ein paar Leute warteten. Türkische und arabische Bauern. Einer von ihnen hatte sich, ungeachtet der Widerlichkeit, auf den Fußboden gehockt, sein langes Gewand um sich verbreitend, als könne er von dem Unflat nicht genug erfassen. Ein säuerlicher Juchtengeruch von Schweiß, kaltem Tabak, Trägheit und Elend erfüllte den Raum. Gabriel wußte, daß die obrigkeitlichen Kanzleien der verschiedenen Völker ihren eigenen Geruch haben. Allen aber war diese Ausdünstung von Angst und Ergebung gemeinsam, mit der die kleinen Leute das Walten der Staatsmacht hinnehmen wie die Unbilden der Natur.
Ein buntgescheckter Türhüter geleitete ihn endlich mit herablassender Miene in ein kleineres Zimmer, das sich durch unverletzte Fensterscheiben, Tapeten, einen aktenbeladenen Schreibtisch und einige Sauberkeit von den übrigen Räumen unterschied. An der Wand hing nicht das Bild des Sultans, sondern eine große Photographie Enver Paschas zu Pferde. Gabriel sah sich einem jüngeren Mann mit rötlichem Haar, Sommersprossen und kleinem englischem Schnurrbart gegenüber. Es war nicht der Kaimakam, sondern der Müdir, der die Geschäfte des Küstenbezirkes, der Nahijeh von Suedja verwaltete. Das Auffälligste an dem Müdir waren seine überaus langen, sorgfältig manikürten Fingernägel. Er trug einen grauen Anzug, der selbst für seine kleine, dürre Gestalt etwas zu eng schien, dazu eine rote Krawatte und kanariengelbe Schnürstiefel. Bagradian wußte sofort: Salonik! Er hatte dafür keinen anderen Anhaltspunkt als das Äußere dieses jungen Mannes. Salonik war die Geburtsstätte der jungtürkischen Nationalbewegung, des erbitterten Westlertums, der fassungslosen Verehrung für alle Formen des europäischen Fortschritts. Ohne Zweifel gehörte der Müdir zu den Anhängern, vielleicht sogar zu den Mitgliedern Ittihads, jenes geheimnisvollen »Comité pour union et progrès«, das heute unbeschränkt das Reich des Kalifen beherrschte. Er zeigte seinem Besuch außerordentliche Höflichkeit und rückte selbst einen Stuhl zum Schreibtisch. Mit den entzündeten wimperarmen Augen aller Rothaarigen sah er an Bagradian meist vorbei. Dieser nannte mit einem gewissen Nachdruck noch einmal seinen Namen. Der Müdir neigte leicht den Kopf.
»Die hochansehnliche Familie Bagradian ist uns bekannt.«
Es kann nicht geleugnet werden, daß Geste und Worte in Gabriel ein angenehmes Gefühl auslösten. Sein Tonfall gewann große Sicherheit.
»Einigen Bürgern meiner Heimat, darunter auch mir, wurden heute die Pässe abgenommen. Handelt es sich um eine Verfügung Ihrer Behörde? Wissen Sie von ihr?«
Der Müdir brachte durch längeres Nachdenken und In-den-Akten-Blättern zum Ausdruck, daß er bei der Fülle seiner Obliegenheiten nicht jede Kleinigkeit sofort gegenwärtig haben könne. Endlich ging ihm ein Licht auf:
»Ach ja! Gewiß! Die Inlandpässe! Es handelt sich hierbei nicht um eine selbständige Verfügung der Kasah, sondern um einen Erlaß Seiner Exzellenz des Herrn Ministers des Innern.«
Nun hatte er ein bedrucktes Blatt gefunden und legte es vor sich hin. Er schien bereit zu sein, den Erlaß des Ministers Taalat Bey, sollte es gewünscht werden, vollinhaltlich vorzulesen. Gabriel erkundigte sich, ob hier eine allgemeine Maßnahme vorliege. Die Antwort klang ein wenig ausweichend. Die breiten Volksmassen seien kaum betroffen, da sich zumeist nur die reicheren Kaufleute, Händler und ähnliche Persönlichkeiten im Besitze von Inlandpässen befänden. Bagradian starrte auf die langen Fingernägel des Müdirs:
»Ich habe mein Leben im Ausland, in Paris zugebracht.«
Der Beamte neigte wieder leicht den Kopf:
»Es ist uns bekannt, Effendi.«
»Ich bin daher an Freiheitsberaubungen nicht sehr gewöhnt ...«
Der Müdir lächelte mit Nachsicht:
»Sie überschätzen diese Sache, Effendi. Wir haben Krieg. Übrigens müssen sich heutzutage auch die deutschen, französischen, englischen Staatsbürger in mancherlei fügen, woran sie nicht gewöhnt waren. In ganz Europa ist es jetzt nicht anders als bei uns. Ich bitte ferner zu bedenken, daß wir uns hier im Etappengebiet der vierten Armee, also im Kriegsbereich, befinden. Eine gewisse Aufsicht über den Verkehr ist unbedingt geboten.«
Diese Gründe waren so einleuchtend, daß Gabriel Bagradian Erleichterung empfand. Das Ereignis des heutigen Morgens, das ihn nach Antiochia gejagt hatte, verlor auf einmal seine Schärfe. Der Staat mußte sich schützen. Immer wieder hörte man von Spionen, Verrätern, Deserteuren. Aus der Winkelperspektive von Yoghonoluk konnte man Maßregeln wie diese gar nicht beurteilen. Auch die weiteren Hinweise des Müdirs waren danach angetan, die mißtrauische Unruhe des Armeniers zu beschwichtigen. Der Minister habe zwar die Pässe eingezogen, das bedeutet aber nicht, daß in berücksichtigungswerten Fällen neue Dokumente nicht ausgestellt werden könnten. Die zuständige Behörde dafür sei das Vilajet in Aleppo. Bagradian Effendi wisse wohl selbst, daß Seine Exzellenz, der Wali Djelal Bey, der gütigste und gerechteste Gouverneur des ganzen Reiches sei. Eine diesbezügliche Eingabe würde, von hier aus wohlempfohlen, nach Aleppo weitergeleitet werden. Der Müdir unterbrach sich:
»Wenn ich nicht irre, Effendi, stehn Sie im Militärverhältnis ...«
Gabriel berichtete knapp über die Sachlage. Noch gestern vielleicht hätte er den Beamten gebeten, Nachforschungen darüber anzustellen, warum seine Einberufung nicht erfolge. Seit einigen Stunden aber war alles grundlegend verändert. Der Gedanke an den Krieg, an Juliette und Stephan bedrückte ihn tief. Sein Pflichtgefühl als türkischer Offizier schmolz zusammen. Jetzt hoffte er, daß man ihn beim Kader in Aleppo vergessen habe. Er dachte nicht daran, sich bemerkbar zu machen. Es fiel ihm aber auf, wie wohlunterrichtet die Behörde in Antiochia über alles war, was ihn betraf. Die entzündeten Augen des Müdirs sandten ihm einen befriedigten Blick zu:
»Nun also, Sie sind Militärperson, im Stande der Beurlaubung gewissermaßen. Ein Teskeré kommt somit für Sie gar nicht in Betracht.«
»Aber meine Frau und mein Sohn ...«
Bei diesen für den Müdir unklaren Worten hatte Gabriel zum erstenmal das würgende Gefühl: Wir sind in einer Falle. Im selben Augenblick öffnete sich die Doppeltür in das Nebenzimmer. Zwei Herren traten ein. Der eine, ein älterer Offizier, der andere zweifellos der Kaimakam. Der Provinz-Statthalter war ein großer, aufgeblähter Mann in einem grauen, knittrigen Gehrock. Schwere, schwarzbraune Augensäcke hingen in dem fahlen und schlaffen Gesicht eines Leberkranken. Bagradian und der Müdir erhoben sich. Der Kaimakam schenkte dem Armenier nicht die geringste Beachtung. Mit leiser Stimme gab er seinem Untergebenen irgendeinen Auftrag, hob die Hand nachlässig an den Fez und verließ, von dem Major gefolgt, die Kanzlei, denn sein Tagewerk schien beendet zu sein. Gabriel starrte auf die Ausgangstür:
»Wird ein Unterschied zwischen Offizier und Offizier gemacht?«
Der Müdir begann seinen Schreibtisch in Ordnung zu bringen.
»Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Effendi?«
»Ich meine, gibt es zweierlei Behandlung für Türken und Armenier?«
Der Müdir schien durch diese Frage auf das äußerste entsetzt zu sein:
»Vor dem Gesetz ist jeder ottomanische Staatsbürger gleich.«
Dies sei, so fuhr er fort, die wichtigste Errungenschaft der Revolution von 1908. Daß sich einige Gewohnheiten der Vorzeit erhalten hätten, darunter etwa die Bevorzugung des osmanischen Staatsvolkes im öffentlichen und militärischen Dienst, das gehöre zu jenen Erscheinungen, die man von Amts wegen nicht abschaffen könne. Völker verändern sich nicht so schnell wie Verfassungen, und Reformen werden auf dem Papier schneller durchgeführt als in Wirklichkeit. Und er schloß seine staatspolitischen Ausführungen:
»Der Krieg wird in allen Belangen Wandel schaffen.«
Gabriel faßte diese Worte als eine günstige Prophezeiung auf. Der Müdir aber warf plötzlich sein sommersprossenbraunes Gesicht zurück, das sich ohne jeden Grund gehässig verzerrte:
»Hoffentlich zwingen keine Vorkommnisse die Regierung dazu, gewissen Bevölkerungsteilen ihre unnachsichtige Strenge zu zeigen.«
Als Gabriel Bagradian in die Bazarstraße von Antiochia einbog, hatte er zwei Dinge beschlossen: Erstens, im Falte seiner Einberufung kein Opfer zu scheuen, um sich vom Militärdienst loszukaufen. Und zweitens, in der friedlichen Stille des Hauses von Yoghonoluk das Ende des Krieges abzuwarten, unbemerkt und ungestört. Da man doch schon im Frühjahr 1915 stand, konnte es sich ja nur mehr um ein paar Monate bis zum allgemeinen Waffenstillstand handeln. Er rechnete mit September oder Oktober. Einen neuen Winterfeldzug würde keine der Parteien mehr wagen. Bis dahin mußte man sich einrichten, so gut es ging, um dann so schnell wie möglich nach Paris heimzukehren.
Der Bazar riß ihn mit. Jener dichte Strom, der keine Hast, kein Zu- und Abnehmen kennt wie der Verkehr in europäischen Städten, sondern sich im unwiderstehlichen Gleichtakt dahinwälzt, so wie die Zeit in die Ewigkeit. Man hätte sich nicht in die gottverlassene Provinzstadt Antakje, sondern nach Aleppo oder Damaskus versetzt glauben können, so unerschöpflich fluteten die beiden Gegensätze des Bazars aneinander vorbei. Türken in europäischer Kleidung, mit Spazierstöcken und steifen Kragen, den Fez auf dem Kopf, Kaufleute und Beamte. Armenier, Griechen, Syrer, auch sie an der abendländischen Gewandung kenntlich, jedoch mit unterschiedlicher Kopfbedeckung. Dazwischen immer wieder Kurden und Tscherkessen in ihren Trachten. Die meisten von ihnen trugen Waffen zur Schau. Denn die Regierung, die bei den christlichen Völkern jedes Taschenmesser mißtrauisch betrachtete, duldete bei den unruhigen Bergstämmen moderne Infanteriegewehre, ja beschenkte sie sogar mit solchen. Arabische Bauern aus der Umgebung. Auch einige Beduinen aus dem Süden, im langen faltenreichen Mantel, wüstenfarben, mit prächtigem Tarbusch, von dem die seidenen Quasten über die Schultern hingen. Frauen im Tscharschaff, dem züchtigen Gewand der Moslemin. Dann aber auch Unverschleierte, Emanzipierte, mit fußfreien Röcken und Seidenstrümpfen. Von Zeit zu Zeit ein schwerbeladener Esel im Menschenzug, der hoffnungslose Prolet der Tierwelt, mit tiefgesenktem Kopf vorbeitappend. Gabriel glaubte, es sei immer derselbe Esel, der in Abständen einhernickte, und immer derselbe zerlumpte Kerl, der ihn am Halfter führte. Aber alle, diese ganze Welt, Männer, Frauen, Türken, Araber, Armenier, Kurden, die feldbraunen Soldaten im Gedränge, Esel und Ziegen, sie waren durch die gleiche Gangart zu einer unbeschreiblichen Einheit zusammengeschmolzen: ein langer Schritt, langsam und wiegend, der unaufhaltsam einem Ziele zustrebte, das sich nicht zu erkennen gab.
Und Gabriel erkannte die Gerüche seiner Kindheit. Den Geruch des siedenden Sesamöls, das aus den Löchern der Auskochereien über die Gasse peitscht. Den Geruch der knoblauchreichen Frikadellen von Lammfleisch, die auf Pfannen über offenen Feuern brutzeln. Den Geruch von faulendem Gemüse. Und den alles überlärmenden Geruch von Menschen, die nachts in denselben Kleidern schlafen, die sie tagsüber tragen.
Auch die leidenschaftlichen Gesänge der Straßenverkäufer erkannte er: »Jâ rezzah, jâ kerim, jâ fettah, jâ alim«, so schwärmte noch immer der Junge, der das ringförmige Weißbrot aus seinem Korbe feilbot: »O Allernährer, o Allgütiger, o Allerschließer, o Allwissender!« Noch immer pries der uralte Ruf die frischen Datteln an: »O Braune du, Braune der Wüste, o Mädchen!« Auch der Salathändler blieb bei seiner kehligen Feststellung: »Ed daim Allah, Allah ed daim!« Daß das Dauernde allein Gott, daß Gott allein das Dauernde sei, dies mochte den Käufer im Hinblick auf die Ware trösten. Gabriel kaufte einen Berazik, ein mit Traubensirup bestrichenes Brötchen. Auch an diese »Schwalbenspeise« besaß er eine Kindheitserinnerung. Beim ersten Bissen aber erfaßte ihn ein Ekel und er schenkte das Backwerk einem Jungen, der ihm begeistert auf den Mund sah. Er schloß für ein paar Sekunden die Augen, so elend war ihm zumute. Was hatte sich denn ereignet und die Welt ganz und gar verwandelt? Hier in diesem Lande war er geboren. Hier müßte er auch zu Hause sein. Aber wie? Der unaufhaltsam gleichmäßige Menschenstrom des Bazars machte ihm die Heimat streitig. Er spürte es, obgleich die in sich versunkenen Gesichter ihn gar nicht anblickten. Und der junge Müdir? Er hatte sich höchst korrekt und höflich benommen. »Die hochansehnliche Familie Bagradian.« Doch Gabriel glaubte jetzt mit einem Schlag zu erkennen, daß diese ganze Höflichkeit samt ihrer hochansehnlichen Familie eine einzige Impertinenz war. Ja mehr als das, Haß, in gebildete Formen verkleideter Haß. Und derselbe Haß umflutete ihn hier. Er brannte ihm auf der Haut, er verletzte seinen Rücken. Und wirklich, sein Rücken war voll plötzlicher Furcht wie der eines Verfolgten, ohne daß sich eine Menschenseele um ihn kümmerte. In Yoghonoluk, in dem großen Haus, bei sich selbst, da wußte er von alledem nichts. Und früher in Paris? Dort hatte er trotz alles Wohlbefindens in dem kühlen Zustand eines eingewanderten Fremden gelebt, der anderswo wurzelt. Wurzelte er hier? Jetzt erst, in diesem elenden Bazar seiner Heimat konnte er den absoluten Grad seiner Fremdheit auf Erden ganz ermessen. Armenier! Uraltes Blut, uraltes Volk war in ihm. Warum aber sprachen seine Gedanken öfter französisch als armenisch, wie zum Beispiel jetzt? (Und doch hatte er an diesem Morgen eine deutliche Freude empfunden, als sein Sohn ihm armenisch antwortete.) Blut und Volk! Ehrlich sein! Waren das nicht auch nur leere Begriffe? In jedem Zeitalter streuen sich die Menschen andre Ideen-Gewürze auf die bittere Lebensspeise, um sie noch ungenießbarer zu machen. Eine Seitengasse des Bazars öffnete sich vor seinen Blicken. Dort standen zumeist Armenier vor ihren Läden und Verkaufsständen: Geldwechsler, Teppichhändler, Juweliere. Dies also waren seine Brüder? Diese verschlagenen Gesichter, diese irisierenden Augen, die auf Kundschaft lauerten? Nein, für diese Bruderschaft dankte er, alles in ihm wehrte sich dagegen. War jedoch der alte Awetis Bagradian ehemals etwas andres und Besseres gewesen als solch ein Bazarhändler, wenn auch weitblickender, begabter, energischer? Und hatte er es nicht dem Großvater allein zu verdanken, daß er nicht so sein mußte wie dieser und wie jene hier? Er ging, von Widerwillen geschüttelt, weiter. Dabei wurde es ihm bewußt, daß eine große Schwierigkeit seines Lebens in dem Umstand lag; daß er manches schon mit den Augen Juliettens sah. Er war also nicht nur in der Welt, sondern auch in sich selbst ein Fremder, sobald er mit den Menschen in Berührung kam. Jesus Christus, konnte man denn nicht ein Mensch an sich sein? Frei von diesem schmutzigen, feindlichen Gewimmel, wie heute morgen auf dem Musa Dagh?
Nichts war entnervender als solch eine Probe auf die eigene Wirklichkeit! Gabriel floh den Usun Tscharschy, den langen Markt, wie der Bazar im Türkischen hieß. Den feindseligen Rhythmus konnte er nicht länger ertragen. Dann stand er auf einem kleinen, von neueren Bauten gebildeten Platz. Ein hübsches Gebäude trat hervor, Hamam, das Dampfbad, wie überall in der Türkei mit einiger Verschwendung errichtet. Es war noch zu früh für den Besuch beim alten Agha Rifaat Bereket. Da es ihn auch nicht gelüstete, in eines der zweifelhaften Speisehäuser einzukehren, trat er in das Badehaus.
Zwanzig Minuten verbrachte er in der großen allgemeinen Schwitzhalle, in dem langsam steigenden Gewölk, das nicht nur die Körper der anderen Badenden gespenstisch entfernte, sondern auch seinen eigenen Leib von ihm selbst fortzutragen schien. Es war wie ein kleiner Tod. Er fühlte die undurchsichtige Bedeutung dieses Tages. Die Tropfen rannen an seinem fernen Körper hinab und mit ihnen ein mühsamer Glaube, an dem er bisher festgehalten hatte.
Im kühlen Nebenraum legte er sich auf eine der leeren Pritschen, um sich der üblichen Behandlung anheimzugeben. Ihm war, als sei er jetzt nackter, wenn man das sagen darf, als vorhin im Dampf. Ein Badeknecht warf sich auf ihn und begann nach allen Regeln der Kunst, die wirklich eine war, sein Fleisch zu kneten. Mit trillernden Schlägen spielte er auf seinem Rumpf wie auf einem Zimbal. Zu dieser Begleitung summte er keuchend. Auf den Nachbarpritschen wurden einige türkische Beys in ähnlicher Weise bearbeitet. Sie schickten sich mit wohligen Wehlauten in den zornigen Eifer der Badeknechte. Zwischeninne – von jenen Schmerzlauten unterbrochen – führten die Stimmen in abgerissenen Sätzen eine Unterhaltung. Gabriel wollte zuerst gar nicht hinhorchen. Aber durch das Summen des Quälgeistes hindurch drängten sich die Stimmen seinen Ohren unabweisbar auf. Sie waren so überaus persönlich und so scharf voneinander unterschieden, daß Gabriel diese Stimmen zu sehn vermeinte.
Die erste, ein fetter Baß. Zweifellos ein selbstbewußter Charakter, der den größten Wert darauf legte, alles zu wissen, was vorging, womöglich noch vor den zuständigen Beamten. Dieser Mann der Informiertheit besaß seine heimlichen Quellen:
»Die Engländer haben ihn in einem Torpedoboot von Zypern an die Küste geschickt ... Bei Oschlaki war das ... Der Mann hat Geld und Gewehre gebracht und sieben Tage das Dorf aufgewiegelt ... Die Saptiehs haben natürlich von nichts gewußt ... Ich kenne sogar den Namen ... Köschkerian heißt das unreine Schwein ...«
Die zweite Stimme, hoch und ängstlich. Ein älteres, friedfertiges Männchen gewiß, das sich sträubt, an das Böse zu glauben. Die Stimme hatte gewissermaßen einen kleineren Wuchs als die anderen und sah zu ihnen auf. Für ihre lustvollen Schmerzlaute benützte sie den erhabenen Vers des Korans als unterlegten Text:
»La ilah ila 'llah ... Gott ist groß ... Das geht ja nicht ... Vielleicht aber ist es nicht wahr ... la ilah ila 'llah ... Man redet sehr viel ... Es wird auch nur ein Gerede sein ...«
Der fette Baß, verachtungsvoll:
»Ich besitze sehr ernste Briefe einer hohen Persönlichkeit ... eines treuen Freundes ...«
Dritte Stimme. Ein schnarrender Scharfmacher und politischer Kannegießer, dem es rechte Freude zu machen schien, wenn es auf der Welt drunter und drüber ging:
»Das kann man sich nicht länger gefallen lassen ... Es muß ein Ende gemacht werden ... Wo bleibt die Regierung? ... Wo bleibt Ittihad? ... Das Unglück ist die Wehrpflicht ... Man hat das Pack noch bewaffnet ... Jetzt sehet zu, wie ihr mit ihnen fertig werdet ... Der Krieg ... Ich rede mir schon seit Wochen die Lunge aus dem Leib ...«
Vierte Stimme, sorgenbeschwert:
»Und Zeitun?«
Das friedfertige Männchen:
»Zeitun? Wie das? ... Allmächtiger? ... Was gibt es denn in Zeitun?«
Der Scharfmacher, bedeutungsvoll:
»In Zeitun? ... Die Nachricht ist in der Lesehalle des Hükümet angeschlagen ... Jeder kann sich überzeugen ...«
Der informierte Baß:
»In diesen Lesehallen, welche die deutschen Konsuln überall eingeführt haben ...«
Von der entferntesten Pritsche her unterbrach eine fünfte Stimme:
»Die Lesehallen haben wir selbst eingeführt.«
Ein dunkler Rauch von unverständlichen Anspielungen: »Köschkerian ... Zeitun ... Es muß ein Ende gemacht werden.« Gabriel aber verstand, ohne die Einzelheiten zu verstehen. Während der Badeknecht die Fäuste in seine Schultern bohrte, drangen ihm die Türkenstimmen überlaut in die Ohren wie Wasser. Peinliche Scham! Er, der noch vor kurzer Zeit mit Blicken des Widerwillens an den armenischen Händlern des Bazars vorübergegangen war, fühlte sich nun verantwortlich und in das Schicksal dieses Volkes hineinverwickelt.
Der Herr auf der entferntesten Pritsche hatte sich indessen ächzend erhoben. Er raffte seinen Burnus, der als Bademantel diente, und machte auf Watschelfüßen ein paar Schritte in den Raum. Gabriel konnte nur sehn, daß er sehr groß und dick war. Seine Art, zusammenhängend zu reden, und die Art der anderen, ihn widerspruchslos anzuhören, ließ darauf schließen, daß man einen Hochmögenden vor sich hatte:
»Man tut der Regierung unrecht. Politik läßt sich nicht mit Ungeduld allein machen. Die Verhältnisse liegen ganz anders, als sich die Unwissenden im Volke einbilden. Verträge, Kapitulationen, Rücksichten, das Ausland! Ich kann aber den Beys vertraulich mitteilen, daß vom Kriegsministerium, von Seiner Exzellenz Enver Pascha selbst, Befehle an die Militärbehörden ergangen sind, melun ermeni millet (die verräterische Armeniernation) zu entwaffnen, das heißt die Eingerückten aus dem Liniendienst zurückzunehmen und nur zu niedriger Arbeit zu verwenden. Straßenbau oder Lasttragen. Dies ist die Wahrheit! Doch es soll von ihr nicht gesprochen werden.«
Das darf ich nicht hinnehmen, das kann ich nicht dulden, sagte sich Gabriel Bagradian. Leise mahnte die Gegenstimme: Du bist selbst der Verfolgte. Eine dunkle Kraft aber, die ihn von der Pritsche hob, entschied diesen Kampf. Er schüttelte den Badeknecht ab und sprang auf die Steinfliesen. Mit dem weißen Tuch verhüllte er sich um die Hüften. Das zornglühende Gesicht mit dem durch das Bad verwirrten Haar, der mächtige Oberkörper schienen dem Herrn im englischen Touristenanzug nicht mehr anzugehören. Er pflanzte sich vor dem Hochmögenden auf. An den schwarzbraunen Augensäcken und an der leberkranken Gesichtsfarbe erkannte er den Kaimakam. Dieser Anblick aber stachelte seine Erregung nur noch höher:
»Seine Exzellenz Enver Pascha wurde samt seinem Stab von einer armenischen Truppe im Kaukasus gerettet. Er war von den Russen schon so gut wie gefangen. Das wissen Sie ja ebenso wie ich, Effendi. Sie wissen ferner auch, daß Seine Exzellenz daraufhin in einem Schreiben an den Katholikos von Sis oder an den Bischof von Konia die Tapferkeit der sadika ermeni millet (der treuen Armeniernation) dankbar rühmte. Dieses Schreiben wurde auf Befehl der Regierung öffentlich angeschlagen. Das ist die Wahrheit! Wer diese Wahrheit vergiftet, wer Gerüchte verbreitet, der schwächt die Kriegführung, der zersprengt die Einheit, der ist ein Feind des Reiches, ein Hochverräter! Das sage ich Ihnen, Gabriel Bagradian, Offizier in der türkischen Armee ...«
Er brach ab und wartete auf eine Antwort. Die Beys aber, durch den wilden Ausbruch verdutzt, gaben keinen Laut von sich, auch der Kaimakam nicht, der nur den Burnus fester um seine Blöße zog. Gabriel durfte deshalb den Raum sogleich als Sieger verlassen, wenn auch bebend vor Erregung. Während er sich ankleidete, erkannte er bereits, daß er mit diesem Ausbruch eine der größten Dummheiten seines Lebens begangen hatte. Der Weg nach Antiochia war nun für ihn verschüttet. Und das war doch der einzige Aus- und Rückweg in die Welt. Er hätte, ehe er den Kaimakam beleidigte, an Juliette und Stephan denken müssen. Dennoch war er nicht ganz unzufrieden mit sich.
Sein Herz ging noch immer schnell, als ihn der Diener des Agha Rifaat Bereket in den Empfangssalon, den Selamlik des kühlen Türkenhauses führte. Auf dem schwebend weichen Riesenteppich des halbdunklen Zimmers schritt Gabriel auf und ab. Seine Uhr, die er unsinnigerweise doch immer nach westeuropäischer Zeit richtete, zeigte die zweite Nachmittagsstunde. Geheiligte Hauszeit also, Zeit des Kef, der unantastbaren Mittagsruhe, in der jeder Besuch einen schweren Verstoß gegen die Sitte bedeutete. Er war viel zu früh gekommen. Der Agha, ein unbestechlicher Hüter alttürkischer Förmlichkeit, ließ ihn auch warten. Bagradian durchmaß immer wieder den nahezu leeren Raum, in dem außer zwei langen, niedrigen Diwans nichts vorhanden war als ein Kohlenbecken und ein kleines Serviertischchen. Er rechtfertigte seine Unhöflichkeit vor sich selbst: Etwas geht vor, ich weiß nicht genau was, aber ich darf keine Minute verlieren, um mir Klarheit zu verschaffen.– Rifaat Bereket war ein Freund des Hauses Bagradian noch aus dessen Urzeit, aus den glorreichen Tagen des alten Awetis. Er bedeutete eine der klarsten und ehrfürchtigsten Erinnerungen Gabriels, der ihm seit seinem Aufenthalt in Yoghonoluk schon zwei Besuche abgestattet hatte. Der Agha erwies sich ihm nicht nur bei notwendigen Einkäufen behilflich, sondern sandte auch von Zeit zu Zeit Leute, die ihm für seine Antikensammlung kostbare Ausgrabungen anboten, und zwar zu lächerlich billigen Preisen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: