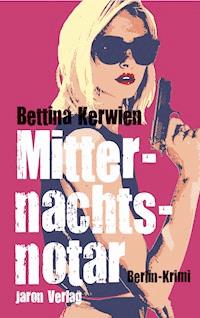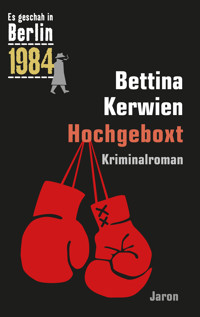
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron
- Kategorie: Krimi
- Serie: Es geschah in Berlin
- Sprache: Deutsch
Hans Jürgen „Kid“ Kilinek war einer der ganz Großen: Als jüngster deutscher Profiboxer kämpfte er sich hoch bis zum Europameister und war der Star der Boxwelt. Nun, im Ruhestand, verbringt er seine Zeit damit, rauschende Partys für die West-Berliner Künstlerszene zu schmeißen – bis seine Ehefrau Elfriede nach einem ausgelassenen Abend erschossen in der hauseigenen Kellerbar aufgefunden wird. Kommissar Kappe und sein Kollege Landsberger nehmen die Ermittlungen auf – und finden bald heraus, dass das Glamourpaar nicht nur für seine Feiern bekannt war …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Kerwien
Hochgeboxt
Ein Kappe-Krimi
Jaron Verlag
Bettina Kerwien lebt in Berlin. Sie studierte Amerikanistik und Publizistik. Als Geschäftsführerin eines Stahlbauunternehmens widmet sie sich in jeder freien Minute dem Schreiben. In der Reihe «Es geschah in Berlin» erschienen von ihr 2019 «Au revoir, Tegel», 2020 «Tot im Teufelssee», 2022 «Tiergarten Blues» und 2023 «Agentenfieber».
Originalausgabe
1. Auflage 2024
© 2024 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Satz: Prill Partners|producing, Barcelona
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
ISBN 978-3-95552-076-2
Watt braucht der Mensch außer Glotze gucken, een bisschen bumsen und een bisschen Anerkennung.
Graciano Rocchigiani
(1963–2018, Weltmeister im Supermittelgewicht)
Für Carola Wolff (1962–2024)
I do not care what comes after; I have seen the dragons on the wind of morning.
Ursula K. Le Guin, The Farthest Shore
Das Buch ist nicht nur staatsgefährdend, sondern stellt in der Hand seines Lesers staatsfeindliches, besonders gegen die UdSSR gerichtetes Hetzmaterial dar. Die Verbreitung und jeder Vertrieb sollten unter allen Umständen beobachtet und mit allen staatlichen Mitteln verhindert werden.
Aus einem Gutachten des Deutschen Instituts für Zeitgeschichte, Berlin-Ost, von 1958 über George Orwells 1984
Inhalt
Prolog Ein Sommertag Ende Juli 1984
Eins Montag, 23. Juli 1984
Zwei Dienstag, 24. Juli 1984
Drei Mittwoch, 25. Juli 1984
Vier Donnerstag, 26. Juli 1984
Fünf Freitag, 27. Juli 1984
Sechs Samstag, 28. Juli 1984
Sieben Sonntag, 29. Juli 1984
Acht Montag, 30. Juli 1984
Neun Dienstag, 31. Juli 1984
Zehn Mittwoch, 1. August 1984
Elf Donnerstag, 2. August 1984
Zwölf Samstag, 4. August 1984
Fakt und Fiktion
PROLOG Ein Sommertag Ende Juli 1984
AUF DIE BEIDEN ENGLÄNDER wirkt das milde, regnerische West-Berlin angenehm. Der hochgewachsene Alte im Tweedanzug führt seine sommersprossige Enkelin in ihrem karierten Kleidchen die wuchtigen Treppen hinter dem Reichstagsgebäude hinunter.
Keine zwanzig Meter hinter dem Reichstag steht die Grenzmauer nach Ost-Berlin.
Der Engländer reicht der Kleinen vorsichtig seinen hochmodernen Kodavision 2400 Camcorder. «Be a dear, poppet, and film me for your grandma.» Er zündet seine Pfeife an und wirft sich in Positur. Das Mädchen tritt ein paar Schritte zurück und beginnt, den Großvater und das Gebäude aufzunehmen. Er zeigt auf den Reichstag hinter sich.
«Siehst du die Einschusslöcher da in der Fassade? Das waren die Russen», sagt er in die Kamera. «Dein Opa war schon im August 1945 hier in Berlin, vier Monate nach Kriegsende. Da hat hier alles in Trümmern gelegen. Ich habe dir ja erzählt, dass ich als Journalist für das Nachrichtenblatt der Britischen Militärbehörde gearbeitet habe.»
Der Engländer schlendert los, an der Mauer entlang zum Spreeufer. «Ich erinnere mich noch an meinen allerersten Artikel. Es ging um eine Firma in Halensee, die aus Wehrmachts- und Luftschutzstahlhelmen tausende Kochtöpfe hergestellt hat. So ein Fritz ist oft erschreckend pragmatisch, poppet.»
Die Grenzmauer endet. Großvater und Enkelin treten direkt ans Ufer. Inmitten von Knallerbsensträuchern steht eine orange-neongelb gestreifte, viereckige Meldesäule für Wasserunfälle mit einer roten Rundumleuchte auf dem Dach. An der Seite kann man eine Scheibe einschlagen und direkt Alarm auslösen. Seitdem fünf Kinder in der Spree ertrunken sind, denen man wegen der Staatsgrenze nicht helfen konnte, gibt es diese Notrufsäulen. Damit auch die DDR-Grenzer Bescheid wissen, wenn es ein Wasserunfall ist und keine Republikflucht.
«Die Spree ist hier ungefähr fünfzig Meter breit», doziert der Engländer mit dampfender Pfeife und investigativ zusammengekniffenen Augen. «Sie gehört in voller Breite zu Ost-Berlin.»
Das Mädchen blickt durch den Sucher der Kamera. Sie filmt die Mauer, die am gegenüberliegenden Ufer verläuft. Rechts kann man den Fernsehturm sehen und gegenüber das Hochhaus der Charité. Möwen dümpeln in der Flussmitte.
Da kommt wie aus dem Nichts Bewegung ins Wasser. Ein Kopf taucht auf, mitten im Fluss. Zwei Arme stechen mit kräftigen Zugbewegungen ins graue Wasser. Unter dem Beinschlag des Flüchtenden schäumt es weiß auf. Er krault pfeilschnell auf das Westufer zu. Am Ostufer rennt ein Grenzpolizist hin und her, brüllt: «Stehenbleiben! Komm zurück!»
Das Mädchen hält atemlos mit der Kamera drauf. Hinter ihr laufen einige Touristen zusammen. Jemand ruft «Jawoll!» und «Schneller, schneller!». Ruhig und rhythmisch durchpflügen die Arme des Schwimmers das Wasser. Fast hat er die rettende Spundwand erreicht.
Aber da. Von links rauscht ein Schnellboot mit bewaffneten Grenzsoldaten heran. Beinahe klemmt das Boot den Flüchtenden am Ufer ein. Es ist ein sehr junger Mann, vielleicht 16 oder 17 Jahre alt. Er schafft es nicht, sich an der Wand hochzuziehen.
«Haut ab, Mensch!», schreit ein Tourist in Richtung Boot.
Ein Grenzer stürmt an Deck, reißt sein Maschinengewehr hoch, legt an.
«Halt!», schreit er. «Grenzposten! Aus dem Wasser!»
Es klickt, eine Salve von Warnschüssen fetzt in den grauen Himmel. Das Mädchen verreißt vor Schreck die Kamera.
«Kommen Sie aus dem Wasser!», schnarrt es aus den Lautsprechern des Patrouillenbootes. «Auf das Boot!»
Eine Strickleiter klatscht ins Wasser.
Das Mädchen filmt, wie die Touristen am Ufer empört die Arme in die Hüften stemmen. Pfiffe und Flüche gellen, Fäuste werden geballt und in Richtung Boot geschüttelt.
Aber niemand hilft dem Flüchtling. Das Wasser ist DDR-Gebiet. Der schwer atmende Junge verkrallt sich in die Uferwand. Sein nackter nasser Rücken bietet ein nicht zu verfehlendes Ziel für das Gewehr des Grenzers.
Da sieht das Mädchen durch die Kamera, wie ihr Großvater die Pfeife in seine Pfeifentasche steckt. Er zieht das Tweedjackett aus und schmeißt es in die Büsche. Entschlossen bückt er sich und reicht dem jungen Mann im Wasser die Hand. Der schlägt sofort ein.
«Jetzt können Sie ihn nicht mehr erschießen!», brüllt der Engländer den Uniformierten auf dem Boot in wackligem Deutsch zu. «Seine Hand ist schon im Westen!»
Die Umstehenden brechen in Jubelrufe und Applaus aus.
Der Großvater zieht den Jungen aus dem Wasser, schirmt ihn mit seinem Körper ab und schiebt ihn weg vom Ufer.
Mit wütender Heftigkeit jaulen die Motoren des Patrouillenbootes auf. Einmal fährt es noch drohend gegen die Spundwand an. Spreewasser schäumt auf, peitscht ans Ufer. Dann dreht das Boot ab, schießt davon.
«Well done!» Der Großvater klopft dem tropfnassen jungen Mann auf die Schulter.
Plötzlich sind Männer in Anzügen mit Sprechfunkgeräten da. Sie legen eine Decke um den durchnässten Republikflüchtling und führen ihn weg.
Das englische Mädchen richtet die noch immer laufende Kamera auf ihren Großvater. «Woher wusstest du, dass der Soldat nicht schießen würde, gramps?», fragt sie atemlos.
«Ich wusste es nicht, poppet», sagt der Großvater und zieht sein Jackett wieder an. «In solchen Momenten handle ich nach einem Ausspruch von Winston Churchill: ‹We are all worms but I do believe that I am a glowworm.›»
EINS Montag, 23. Juli 1984
KURZ NACH HALB FÜNF UHR MORGENS. Ein samtiger Sommermorgen, mediterrane Palmenkübel, die Havel funkelt heiter. Schwanenwerder. Es ist eine Traumgegend, nicht nur für West-Berliner Verhältnisse. Selbst um diese unchristliche Zeit.
Kriminaloberkommissar Peter Kappe fährt langsam. Er ist unterwegs zum Haus eines berühmten Mannes.
Ein dicker schwarzer Kater trottet träge von rechts nach links über die Brücke zur Insel. Seine halb offenen Augen glimmen gelb und böse. Kappe zuckt unter dem Katerblick zusammen. Das Gefühl, ein Störenfried, ein Eindringling, zumindest aber ein ertappter Verkehrssünder zu sein, lässt ihn den Dienstwagen anhalten. Das verärgerte Tier verschwindet mit verächtlichem Schwanzzucken in Richtung Yachtclub.
Kappe kurbelt das Fenster herunter. Es riecht nach Kiefern, Farnen und feuchtem Strandsand. Als Stadtindianer hat er keine Ahnung von den Vögeln, die sich hier die Seele aus dem Hals tirilieren. Jedenfalls hängt über der Havel ein magischer warmer Morgennebel, vom Sonnenaufgang rosa bedampft. Im glitzernden Wasser dümpeln hochglanzpolierte Segelboote. Nach links weitet sich die Bucht zum Strandbad Wannsee. Vor ihm rechts und links der Inselstraße stehen weiße Cabrios in den Villenauffahrten. Rote Kiefernstämme wippen im Havelwind. Die harzige, herbe Luft verspricht Wärme und Sonne. Schau dir mal den Himmel an, blau so weit man sehen kann, wie es in dem schönen Conny-Froboess-Klassiker Pack die Badehose ein heißt: Und dann nischt wie raus nach Wannsee.
Wie das wohl wäre, in so einer Villa zu wohnen?, denkt Kappe. Der Butler würde abends schon mit angewärmten Ravioli auf ihn warten. Und natürlich hätte er einen Hund.
Schade, dass Kappe auf dem Weg zu einem Tatort ist. Die geradezu südländische Gelassenheit gefällt ihm. Schade, dass ihn gleich eine ziemliche Aufregung erwartet. Andererseits: Wer tot ist, hat Zeit. Erst recht jetzt am frühen Morgen. Das romantische Zauberbild einer italienischen Sommernacht hat sich noch nicht ganz verzogen. Sogar die Gaslaternen brennen noch.
Kappe fährt langsam weiter. Rechts neben dem ruhigen Sträßchen steht auf einem kleinen Platz mit Aussicht über die Havel eine korinthische Säule. So etwas fällt Kappe als halbwegs kulturell interessiertem studiertem Psychologen auf. Das historische Fragment schimmert marmorweiß und selbstgerecht im Morgennebel, eine Schmuckruine wie aus dem Skizzenbuch von Caspar David Friedrich.
Kappe passiert weiße Gartenmauern mit wuchtigen schmiedeeisernen Zäunen vor herrschaftlichen Sommerhäusern. Die üppigen Lederblätter der Rhododendren glänzen im Morgenlicht wie Dschungelpflanzen, dazu dunkelgrüner Kirschlorbeer, efeuumrankte Eichen, akkurate Buchenhecken. Auf keinem der messingpolierten Klingelschilder steht ein Name.
Ein Funkwagen mit zuckendem Blaulicht klemmt schräg in der Einfahrt zu einer weißen Bauhaus-Villa wie ein Fremdkörper.
Kappe parkt am Straßenrand und steigt mit morgenmüden Gelenken aus.
Hans-Jürgen Kilinek hat sein Anwesen mit brachialem Naturstein einfassen lassen. Sogar die Baumscheiben sind hier efeubewachsen. Kappe muss an einen alten Friedhof denken.
Kilinek hat es weit gebracht. Bis zum Berliner Box-Idol. Aufgewachsen ist er als Sohn eines polnischen Eisenbiegers in Rostock. Er hat seinem Vater oft helfen müssen und dadurch früh viel Kraft entwickelt. In der Schule wurde er gehänselt, weil er wegen der Arbeit vor der Schule nach Schweiß roch. Da hat Kilinek eben zugeschlagen. Hat das Boxen auf dem Schulhof gelernt. Oft kommt er mit Beulen und zerrissenen Hosen nach Hause. Er fliegt von zwei, drei Schulen.
Der Vater, ein handfester Säufer, ist von seinen dauernden Prügeleien so angefressen, dass er ihn schließlich zu einem Boxtrainer bringt: «Wenn du dich schon schlagen musst, dann geh wenigstens in einen Verein!»
Seinen ersten Kampf hat Kilinek schon mit 13 Jahren. Als Siegprämie erhält er eine Tafel Schokolade. Sie nennen ihn «Kid», das Kind. Ungeheuer amerikanisch und knorke. Der Name ist ihm geblieben.
Nach Kriegsende ’45, Kilinek ist 14, haut er auf eigene Faust aus Rostock ab und geht nach West-Berlin. Er macht eine Lehre zum Gebäudereiniger und landet im Boxstall von Knolle Plötz, Kampfname «Die Pranke von der Panke».
Der einstmals erfolgreiche Schwergewichtsboxer, jetzt Trainer, ist wie ein Vater für ihn. 1947 wird Kid zum ersten Mal Berliner Meister, der Beginn einer steilen Karriere.
1948 wird Kilinek Deutscher Amateurmeister im Schwergewicht. Da ist er 17. Noch im selben Jahr wird er mit einer Ausnahmegenehmigung Profi, der jüngste deutsche Profi aller Zeiten. Das braucht Kappe nicht nachzulesen. So etwas weiß man als West-Berliner.
Kappe geht Kilineks weißen Kiesweg entlang. Der parkähnliche Garten ist gut in Schuss. Bestimmt hat der Boxer einen Gärtner. Schließlich ist Kilinek hauptberuflich Liebling der Massen. Mit seinem enormen Oberkörper und der schiefen Nase sieht er aus wie ein verwegener blonder Neandertaler. Ein verbeulter Engel, und die Filmkamera schmeichelt ihm noch dazu. Er ist Filmstar, Millionär und hat Erfolg als Schlagersänger. Kilinek ist wie West-Berlin: ein bisschen einfach gestrickt, aber charmant und unbesiegbar.
Der Bungalow ist für Kappes Geschmack zu modern, zu weiß, zu eckig. Mit seinem Flachdach und der ausladenden Terrasse sieht er aus wie aus Lego-Steinen gebaut. Davor parkt das übliche weiße Porsche Cabrio.
Ein uniformierter Polizist kommt Kappe entgegen, an der Leine einen widerstrebenden pechschwarzen Schäferhund. Das Tier schaut unglücklich, und dazu hat es allen Grund.
«Ist das Rocky?», fragt Kappe. Wie der Hund heißt, weiß er aus der Klatschpresse. Kilinek hat ihn nach dem Boxerdrama mit Sylvester Stallone benannt.
«Wahrscheinlich Rocky II», witzelt der Kollege. «Wir bringen den Hund ins Tierheim Lankwitz. Nutzt ja nischt.»
Der Swimmingpool ist öde und leer wie das Maifeld nach einem Poloturnier. Auf den blauen Kacheln stehen grüne Regenpfützen. In den Ecken hat sich letztjähriges Laub gefangen. An der Poolleiter wartet ein Polizist.
In der Mitte des Beckens steht ein Gartenstuhl, mit gelben Plastikschnüren bespannt. Auf dem Stuhl lümmelt der Champ. Kid Kilinek. Er trägt seinen berühmten weißen Frottee-Bademantel, hat die Augen geschlossen und sieht noch immer gut aus. In der Manteltasche steckt, unverkennbar, eine grüne Flasche Bols Prinzen Kirsch. Das Bild erinnert an Udo Jürgens bei der Zugabe.
«Eine Flasche Gin habe ich ihm schon weggenommen», sagt der Polizist leise.
Kappe macht sich gerade und hebt die Stimme. «Herr Hans-Jürgen Kilinek?»
Kilinek hebt die schweren Augenlider. Er lächelt dümmlich und tippt sich an die Stirn. «Kid. Nur Muhammad Ali darf mich Hans-Jürgen nennen.»
«Wunderbar. Also Kid. Wie geht’s Ihnen? Könnten Sie mal zu uns heraufkommen?»
Kilinek zieht die Flasche aus der Bademanteltasche und nimmt einen Schluck. «Ich hab Zoff mit meiner Frau, wissen Sie.»
Kappe nickt. «Ihre Haushälterin hat uns angerufen.»
Kilinek schaut ins Leere und trinkt. «Ja, klar», sagt er. «Das sieht ihr ähnlich.»
«Ziehen Sie sich mal einen Trainingsanzug über.» Kappes Amtsstubenstimme wackelt ein bisschen. «Wir müssen Sie mitnehmen. Nach Spandau, Direktion 2. Zur Blutprobe.»
«Nehmen Sie mal lieber eine Blutprobe von meiner Frau!», kichert Kilinek.
«Keine Sorge», murmelt Kappe. «Das macht die Rechtsmedizin immer.»
In Hans-Jürgen Kilineks dunkelbrauner Kellerbar riecht es so süß und klebrig wie bei einer Miss-Wahl im Big Eden. Harte Zigaretten, schales Bier, warmer Schnaps und beginnende Verwesung. Eine schwarzblaue Schmeißfliege sitzt auf dem Hals einer umgekippten Schnapsflasche und putzt sich die Vorderbeine.
Doktor Doreen Niedergesäß von der Rechtsmedizin steht im weißen Kittel vor der Gästetoilette. Als sie Kappe sieht, winkt sie mit ihren AIDS-Handschuhen. «Kappe! Morgen! Kommste ganz alleine?»
Neben dem Plattenspieler steht das Ray-Conniff-Album You are the Sunshine of my Life. Auf dem weißen Cover räkelt sich ein geisterhaft durchsichtiges Luxusgirl im goldenen Cocktailkleid. Zu viel Easy Listening für Jazz-Fan Kappe. Er nimmt das Album kurz in die Hand und zuckt mit den Schultern.
«Laut meinem Chef ist hier alles klar», sagt er. «Dafür brauchen wir keine Polizei. Die Haushälterin hat uns verständigt und den Fall auch gleich gelöst: Der Boxer war’s. Tötung der Intimpartnerin. Und wegen der Prominenz sollen wir natürlich so wenig Aufsehen machen wie möglich.»
«Die Schwarze Elfriede», seufzt Doreen und zeigt auf die Toilettentür. «Det wird een Schock für West-Berlin. Zu Lebzeiten hat se jerne Kalte Muschi getrunken …»
Kappe stellen sich die Nackenhaare auf. «Doreen! Pietät! Was soll das heißen: Kalte Muschi?»
«Eene Weinschorle. Rotwein mit Cola, Eis und Zitronenscheiben. War ihr Lieblingsgetränk. Hab ich im Blitz gelesen.» Doreen Niedergesäß klopft Kappe aufmunternd auf die Schulter. «Du musst nicht imma gleich untastellen, det ich mir allen Schweinkram selbst ausdenke. Aber jetzt, na ja, da hat die Elfriede selbst ’ne … also vastehste, Kappe? Die Schlagzeile liegt einfach uff der Hand.»
«Mann!» Kappe reißt ihr die Gummihandschuhe weg und zieht sie sich über. «Deine Sponti-Sprüche waren auch schon mal besser. Gott sei Dank bist du bei der Rechtsmedizin und nicht bei der Pressestelle!»
Vorsichtig öffnet er die Tür des Gäste-WCs. Sie ist zersplittert und voller Einschusslöcher. Der Raum selbst ist winzig, kaum größer als ein Meter im Quadrat. Waschbecken, Toilette, darüber hängt kopfüber Elfriede Kilinek. Sie ist noch immer schön. Wie eine Schaufensterpuppe, die jemand umgestoßen hat.
«Hast du auch schon was Belastbares?», fragt Kappe. Seine Stimme kratzt.
«Logo. Elfriede Kilinek, 48», sagt Doreen hinter ihm, um gestochenes Hochdeutsch bemüht. «Todeszeitpunkt unjefähr 3 Uhr heute Morgen. Wir haben auch die Tatwaffe sichergestellt. Ein Anschütz-Kleinkaliber-Gewehr. Kaliber 22. Ist schon auf dem Weg in die Kriminaltechnik. Das Gewehr hing hier hinter der Kellerbar. Offen für jedermann zugänglich. Hat Kilinek wohl bei ’ner Europameisterschaft jewonnen.»
«Wahrscheinlich hat er keinen Waffenschein. Unerlaubter Waffenbesitz. Selbst dafür wandert er schon ein.»
«Und det Gewehr wurde mehrfach abjefeuert. Wir ham hier in der Toilette vier Projektile jefunden. Aba fünf Hülsen. Todesursächlich war das fünfte Projektil. Det steckt noch hinter Elfriedes rechtem Ohr in ihrem Schädel, nehme ich an. Relativer Nahschuss durch die Tür und keine Austrittswunde. Elfriede Kilinek war sofort bewusstlos, aba nich sofort tot. Hat vielleicht noch ’ne halbe Stunde jelebt. Aber keen Krankenhaus der Welt hätte ihr mehr helfen können.»
Der Körper der Frau des Boxers liegt auf entwürdigende Weise verrenkt und eingeklemmt mit dem Kopf nach unten zwischen Toilettensockel und Wand. Ihr schönes, glänzendes, nachtschwarzes Haar, bekannt aus Funk und Fernsehen, ist hinter dem rechten Ohr blutverkrustet. Die Fliesen sind voller Blutspritzer.
Es ist kühl hier im Partykeller, trotz des Julimorgens. Souterrain eben. Kappe schaut hoch zum Toilettenfenster. Es steht offen. Man kann den Garten sehen. An der Fassade lehnt eine Leiter.
«Die Haushälterin, ein Frau Ilse Maybach, is üba det Fenster einjestiegen und wollte Erste Hilfe leisten», sagt Doreen Niedergesäß. «Sagt sie. Det war nich so superjut für die Spurenlage.»
«Hast du nicht was zum Abdecken der Leiche, Doreen?» Kappe fröstelt. Die Nerven.
Die Gerichtsmedizinerin zieht eine Plastikfolie aus ihrem Koffer. «Hoffentlich isset nich allet zu ville für dich als ehemaligen Seelenklempner.» Sie zwinkert ihm zu.
«Hoffen wir das Beste.» Kappe deckt die prominente Tote ab. Seine Finger sind klamm. Wie schnell der Spaß zu Ende sein kann. Selbst wenn man alles hat.
Die Tötung des Intimpartners ist nach Prof. Dr. Wilfried Rasch eine sich musterhaft wiederholende Tötungssituation überindividueller Vorprägung, in der der Täter nur noch als Funktionsgröße in einem über ihn selbst hinweggehenden Geschehen erscheint. Auf Deutsch: ein Klassiker. Es vergeht keine Woche, ohne dass so ein Fall vor deutschen Gerichten verhandelt wird. Und immer sagt der Täter aus, dass er die Tat nicht gewollt hat oder gar nicht weiß, warum er sie begangen hat: Er liebt das Opfer doch. Er kann ohne sie doch gar nicht leben. Was man halt so sagt.
«Wo ist denn diese Frau Maybach?», fragt Kappe.
«Wartet in der Küche uff dich. Na, denn tu ma deine Pflicht.» Doreen schiebt ihn zur Kellertreppe. «Ich ruf dich an, wenn ich mehr weiß.»
Als Kappe auf dem Weg in die Küche im Erdgeschoss aus dem Fenster schaut, sieht er, wie ein apathischer Hans-Jürgen Kilinek im Adidas-Jogginganzug über das Anwesen zum Funkwagen wankt, von einem Polizisten gestützt. Vor der Grundstücksmauer wartet ein Menschenauflauf. Auch die Presse ist schon da. Kameras glänzen in der Morgensonne. Ein paar Kinder machen Räuberleiter, spicken über der Gartenmauer. Kappe hört den bekannten Berliner Kinder-Abzählreim: «Kilinek schießt um’s Eck, in den Dreck, über’s Bett, ins Klosett».
Wie es aussieht, hat Kilinek jetzt wirklich geschossen. Kappe fragt sich, ob der Mann mitbekommt, wie sein Leben gerade den Bach runtergeht.
Das Gesicht des Box-Champions ist leer, seine Augen sehen eine andere, weit entfernte Welt.
«Erst dachte ick, da knalln schon wieda de Schampanjerkorken! Aber nee!»
Die Haushälterin Ilse Maybach sitzt mit verweintem Gesicht am Küchentisch. Die Küche ist braun mit weißen Türen, sogar einen orangen AEG-Mikrowellen-Ofen gibt es. Der letzte Schrei.
Frau Maybach ist eine drahtige Sechzigjährige mit einer resoluten Schürze und einer knallharten Dauerwelle Marke Schöneberger Königspudel. Sie hält sich an ihrem verknüllten Geschirrhandtuch fest.
«Wollen Se auch ’nen Tee?», schnieft sie.
Kappe spürt den frühen Morgen und die Kühle des Souterrains in den Knochen. Er ist ehrlich. «Instantkaffee wäre mir lieber.»
Sie schiebt zwei Becher mit Wasser in den Mikrowellen-Ofen. Das Gerät macht ein Geräusch wie ein kaputter Heizlüfter. Seit dem Atomunfall von Three Mile Island in Harrisburg, Pennsylvania vor fünf Jahren hat Kappe Respekt vor unsichtbarer Strahlung. Aber nach zwei Minuten macht es zuverlässig «Pling!», und das Wasser in beiden Bechern ist kochend heiß. Wunder der Technik. Ilse Maybach schiebt ihm ein Glas Nescafé und einen Löffel zu.
«Können Se ruhig trinken. Hier is atomwaffenfreie Zone.» Sie lächelt bitter. «Sagt Herr Kilinek immer.»
«Sie wohnen hier im Haus?», fragt Kappe, während er das Kaffeepulver in das bestrahlte Wasser schaufelt.
«Nee, im Gästehaus.» Sie zeigt aus dem Fenster. «Det ist dort drüben, neben de Garage. Von da kann ick die Vorderseite vom janzen Haus sehn. Jestern Abend war noch Party im Keller. Aber eha im kleenen Rahmen.»
«Kannten Sie die Gäste?»
«Die kennen Se ooch. Der Herr Lackheimer war da, und der Herr Jung.»
Das sind tatsächlich Namen, die Kappe sich nicht aufschreiben muss. Auch bekannt aus Film und Fernsehen, wie alles hier. «Georg Lackheimer, der Schauspieler, und Herbert Jung, der Entertainer?», fragt er sicherheitshalber.
«Die jehn hier ein und aus. Kann sinn, det noch mehr Herren jekommen sind. Ick hab den Tatort jesehn, mit Ihrem Kollegen Schimmi. Schimanski. Ick lieb den ja. Zweierlei Blut hieß det.»
Für den «Kollegen» Horst Schimanski ist die Maybach natürlich genau die Zielgruppe. Kappe mag es nicht, wenn Götz George in Duisburg-Ruhrort wie ein grunzender Parka-Primat im Knöchelgang durch’s Büro afft oder – wie in der Folge von gestern – nackt und besoffen im Fußballstadion herumstümpert. Zum Schluss löst er den Fall nur mit Gerechtigkeitssinn und Gewalt. Nichts davon wäre gerichtsfest, aber das ist Frauen wie der Maybach egal. Hauptsache Hemd auf bis zum Bauchnabel. Der Ruhrpott kocht – sind wir alle Mörder oder Trinker?, hat Kappe mal an einem Kiosk auf dem Titel der Bild gelesen. Schimmi ist nicht gut für das Polizisten-Image. Man traut sich ja schon gar nicht mehr, im Dienst einen Parka zu tragen. Da kommen gleich Sprüche. Ein Typ, der von Dispo und Currywurst mit Sozialsoße lebt, dürfte beim LKA Berlin jedenfalls nicht mal Fahrraddiebstähle bearbeiten.
«Wann sind die Herren Lackheimer und Jung denn wieder gegangen?», fragt Kappe.
«Heute morjen erst. So jejen einse, zweie vielleicht. Ick konnte nich schlafen, da war ick nochma mittem Hund pullern. Um zweie warn gloob ick die Autos schon weg. Ach Mensch, der arme Rocky.» Sie bricht erneut in Tränen aus. «Det Licht im Kella jing aba nich aus, und et lief ooch keene Musik mehr. Herr Kilinek hat ja imma Ray Conniff und seine Big Band jehört. Manchma so laut, det sich die Nachbarn von een paar Grundstücken weita noch beschwert ham. Also, det war ma zu ruhich – da hab ick denn durch’s Klofenster jespickt. Und da lag se. Die Frau Elfriede. So komisch unnatürlich. Det Fenster war anjekippt. Ick hab rinjegriffen und hab’s uffjemacht und bin runterjeklettert, mit de Jartenleiter.»
«Ist Ihnen etwas aufgefallen?»
«Die Frau Elfriede hatte keenen Puls mehr. Und det Blut. Det war een Schock.»
«War die Toilettentür von innen verriegelt?»
«Ja», schluchzt Ilse Maybach.
«Sicher?»
«Janz sicha.»
«Wussten Sie, dass Herr Kilinek ein geladenes Gewehr in der Kellerbar hatte?»
«Det wußte jeda. Wa alljemein bekannt. Ooch bei die Nachbarn. Die Besucha ham damit imma im Jarten rumjeballert. Uff Spatzen und Wildschweine jeschossen. Nur so zwecks Amüsemang. Jestern ooch.»
Über was man sich nicht alles amüsieren kann, wenn man sich langweilt. Warum richtet man sich bloß ein in dieser Dekadenz? Da kann man doch gar nichts mehr bewegen. Kappes Bild von Kid Kilinek ändert sich, und nicht zum Besseren. «Frau Maybach, wie ist denn Ihr Verhältnis zu Herrn Kilinek?», fragt er, in der Hoffnung auf ein paar warme Worte.
Aber die Maybach atmet erst mal tief durch und fährt sich dann durch das Haar. «Als Chef, meinen Se?»
Kappe nickt und stellt fest, dass die Haushälterin richtig nachdenken muss über die Frage.
«Nicht, dass Sie det falsch vastehen, Herr Oberkommissar», sagt sie. «Die Kilineks, det is ja hier ’n Glamour-Paar. Sacht man doch so? Und der Herr Kilinek is echt een Netter. Berlins Bester. Steht ja imma inna Zeitung. Aber Boxer oder nich – der hatte hier zu Hause nischt zu sagen. Die Frau Elfriede, die hatte hier die Hosen an. Für ihn war sie die Liebe seinet Lebens. Aba sie? Richtich abjekanzelt hat die ihn manchma. Die hatte ’ne spitze Zunge.»
«Worum ging’s da? Um Geld?»
«Nee. It jing darum, dass er angeblich ihr Leben vasaut hat. Und er hat dann jebrüllt, sie hat seins erst recht vasaut. Also, die warn sich einig, det ihr Leben een Nischt is. Wertlos, sagen wa ma so. Is det nich lächerlich? Schaun Se sich doch ma um! Die hatten doch allet. Und vakehren nur mitte Hautevolee. Selbst die Nachbarn sind erste Sahne. Hier uff Schwanenwerder wohnen ja ooch nur jroße Numman.»
Kappe nippt am mikrowellenbestrahlten Kaffee. Schmeckt auch nicht schlimmer als im Büro, denkt er. «Sind Sie schon lange bei den Kilineks?»
«Schon über zehn Jahre! Die haben mich einjestellt, als se herjezogen sind. Wo er mit det Boxen uffjehört hat.»
«Und hat sich in letzter Zeit etwas verändert, was würden Sie sagen?»
«Er hat doch mal in diesem Film mitjespielt, Hochjeboxt, über seine Lebenserinnerungen. Vor drei Jahren oder so, wo der Film rauskam, da war nach außen noch allet in Ordnung. Da konnta die Dekoration noch hochhalten. Aber dann hat allet seinen Jlanz valorn. Herr Kilinek war mit dem Streifen Hochjeboxt dann unzufrieden. Kama wohl nich jut jenuch weg drin. Er hat sich mit dem Drehbuchfritzen anjelecht und denn det kleene Kino im Kella einbauen lassen. Da hatta tagsüba jesessen und sich Mitschnitte von seine Kämpfe anjesehen. Jeschrieben hatta ooch, anjeblich seine wahren Lebenserinnerungen, also wie et wirklich war – natürlich anders wie in dem Film. Frau Elfriede musste ja tagsüber in ihre Schönheitssalons, wenigstens ma nach dem Rechten kieken als Chefin. Herr Kilinek hat, sacht man, für seinen letzten Kampf vor zwanzig Jahren 150.000 D-Mark Gage jekricht, obwohla noch nich ma jewonnen hat. Von der Börse hatta seiner Elfriede eenen Salon im Europa-Center und eenen am Hansaplatz jekauft. Frau Elfriede is ja jelernte Fußpflegerin. Also – det war se.»
«Und die Schönheitssalons laufen gut?»
«Det sind Joldgruben!» Ilse Maybach drückt sich die Pudelfrisur zurecht. «Vor Weihnachten, da wird det meiste Geld vadient mit Salben und Parfüms und Wässerchen und Jutscheine. Da kommt Frau Elfriede schonma mit janzen Koffern volla Bargeld nach Hause. Manchma hat se det Jeld dann hoch in de Luft jeworfen und sich jefreut wie een kleenet Kind, wenn die Scheine heruntajeflattat sind. Ick musste det denn zusammenklamüsern. Manchma warn det 100.000 D-Mark.»
«Alle Achtung.» Kappe muss an Dagobert Duck denken, sagt aber: «Wie war das noch mit der Hautevolee? Da machen Sie mir doch bitte mal eine Liste, wer hier noch so alles verkehrt. Freunde, auch Geschäftspartner oder Handwerker.»
Ilse Maybach verspricht es. «Wo bringen Se denn den Herrn Kilinek hin?», fragt sie.
Kappe zuckt die Schultern. «Ins Polizeigefängnis an der Gothaer Straße wahrscheinlich.»
«Ick weeß nich», sagt die Haushälterin wie zu sich selbst. «Ick hab irgendwie keen jutet Jefühl bei der Sache. Herr Kilinek is nich aggressiv, wissen Se. Der ist einfach nur traurich. Hat keene Aufgabe mehr im Leben, seita nich mehr boxen tut.»
«Sie halten sich bitte zu unserer Verfügung», sagt Kappe und steht auf. «Verlassen Sie bitte die Stadt nicht. Und sprechen Sie nicht mit der Presse. Das macht so viel Ärger, Frau Maybach, das ist es nicht wert.»
«Noch zwei Wochen bis zu den Sommerferien, Johanna!»
Es ist das erste, was Micki Grimm zu ihr sagt, noch vor dem Kuss. Sommerferien, das sind die besten acht Wochen des Jahres für Micki Grimm: endlich frei sein! Nichts als lesen und brettsegeln wird er. Und natürlich nach den kessen Ost-Berliner Sommerfrischlerinnen gucken, da macht sich Johanna nichts vor. Denn Micki Grimm hat einen Schlag bei allen Mädels an der Polytechnischen Oberschule Karol Swierczewski in Zinnowitz auf Usedom. Kein Wunder. Er ist einer, der hierher gehört wie ein Fischkutter in die Brandung. Ein sehniger Typ mit brauner Haut und langen blonden Locken, die er zu einem Piratenzopf bindet. Um den Hals trägt er an einem Lederriemen einen Haizahn. Kann auch ein Schweinezahn sein. Im Sommer schneidet Micki sich die Nietenhosen ab. So schau! Wie Johanna es in einer zerfledderten West-Bravo gesehen hat.
Für Johanna ist Micki der Sohn eines Strandpiraten und einer Elfenkönigin. Sie selbst kommt aus bürgerlichem, sogar konservativem Hause, der Vater arbeitet in der Verwaltung des katholischen Heimes St. Otto in Zinnowitz. Mit ihren Eltern wohnt sie in Lütow, auf dem letzten Gehöft vor dem Hünengrab im Wald. Das steinerne Ganggrab ist ihr heimlicher Treffpunkt. Micki kommt fast jeden Tag nach der Schule mit dem Fahrrad aus Zinnowitz. Sie treffen sich an den moosigen, harsch gespaltenen Steinen des alten Megalith-Grabes. Manchmal nur zum Knutschen, manchmal sind noch ein paar Freunde aus der Kirche dabei. Freie Jugendarbeit, das toleriert die Stasi. Wenn die wüssten, dass zwischen den uralten Steinen Bücher getauscht werden, sogar vermeintliche Schundlektüre aus dem Westen, dann wären die anders auf Zack.
Aber wie will man sonst an den richtigen Lesestoff kommen, fragt sich Johanna. In Artikel 9 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik von 1949 heißt es: Eine Pressezensur findet nicht statt. Aber selbst viele Klassiker wie Franz Kafka kann man nicht immer kaufen. Auf der Leipziger Messe werden den Westverlagen die Bücher aus den Regalen geklaut. Wer da zu spät kommt, hofft auf den Mut seiner Westfreunde oder liegt den Großeltern, die ja als Rentner in den Westen fahren können, in den Ohren, sie mögen sich doch das dünne Taschenbuch in den Rock- oder Hosenbund stecken und das heiß ersehnte Druckerzeugnis über die Grenze schmuggeln. Und so kommt das Buch dann in den Umlauf, und die Gedanken aus dem Westen haben sich eingeschmuggelt in die Ost-Welt.
Es ist kühl unter der großen Eiche, den Sommerregen spürt man nicht. Johanna hat sich mit Zitronenmelisse eingerieben gegen die Mücken. In den Brombeersträuchern ruft die Grasmücke. Johanna und Micki ritzen kichernd ihre Initialen in einen schmächtigen Ahorn links vom Ganggrab. Johanna findet, dass Micki zu viel kichert und zu wenig bedeutungsschwer schaut beim Ritzen. Vielleicht meint er es doch nicht so ernst wie sie.
Micki erzählt ihr, dass er mit Hajo eine Stalltür zu einem Wasserski umgebaut hat. Die Fischer von der Fischwirtschaftsgenossenschaft «Gold des Meeres» haben sie mit ihrem Kutter mit dem starken Motor gezogen, bis die Stalltür tatsächlich über das Wasser geflitzt ist. Ein Riesenspaß! Fast so schön wie Surfen, was in der DDR Brettsegeln heißt. Dabei ist Micki kein Sportfanatiker. Er hält nichts vom Gewinnen. Dass die DDR ihre Mannschaft in diesem Sommer nicht zu den Olympischen Spielen nach Los Angeles schickt, das interessiert ihn zum Beispiel nicht die Bohne. Micki geht es um seinen Spaß.
Johanna findet, er gehört eigentlich in den Westen. Er spricht nie darüber abzuhauen, und gesagt hat sie ihm das nie. Denn Micki ist immer obenauf. Im Hier und Jetzt. Er schwimmt immer auf der größten Welle des Lebens. Johanna genießt das. Micki ist einfach da, aber jegliche Fragen nach dem Warum oder dem Wie-lange-noch würden ins Leere laufen. Johanna hat keinen Zweifel, dass er ein glücklicher Mensch mit einem erfüllten Leben werden wird. Dabei ist Micki nicht unpolitisch. Er hat bloß dieses Erwachsene nicht, dieses Ernsthafte. Sie selbst sammelt noch schnell ein paar Holunderzweige für ihre Mutter, während Micki von seinen Abenteuern erzählt, und schon vor der Schule lieben sie sich auf dem großen Kopfstein – wild, frei, abseits von allem, und nur die Brennnesseln sind Zeugen.
Vor dem LKA in der Schöneberger Keithstraße will Kappe gerade die Tür des Dienstwagens öffnen, da schießt ein Sportwagen um die Ecke und hält mit Bremsspur genau neben ihm. Ist das Josef Bolps Jaguar? Der Mann ist wirklich die Pest auf Rädern. Kappe überlegt kurz, ob er sich unters Armaturenbrett werfen oder über den Beifahrersitz Richtung Gehweg wegkrabbeln soll.
Josef Bolp, Chefreporter vom Berliner Blitz, federt aus seinem Wagen und reißt Kappes Fahrertür auf. «Kappe! Guten Morgen! Kommen Sie mal raus, ich halte Ihnen hier sogar persönlich den Schlag auf, mein Lieber!», jubelt er los.
Kappe hat Bolp ein paar Monate nicht gesehen. Am Telefon hat er ihn andauernd. Bei jedem 08/15-Mord wittert der Journalist eine Titelseite. Und wenn man ehrlich ist – man liest doch schon fast lieber, wer wem die Birne eingeschlagen hat, als über SS-20-Stationierungen oder die Transporte von Pershing-2-Raketen zum US-Stützpunkt Mutlangen.
«Bolp», sagt Kappe gequält und kriecht aus dem Wagen.
«Sie freuen sich auch, mich zu sehen?» Bolp strahlt. Er ist mit der Zeit nicht schöner geworden.
«Comme ci, comme ça», sagt Kappe.
«Sie wissen ja, was unsere Leser interessiert!» Bolp wedelt mit dem Stenoblock.
«Klar: Mutter dreht Kinder durch den Fleischwolf – der Berliner Blitz sprach zuerst mit den Buletten.» Kappe schließt seinen Wagen ab.
«Sie haben das Prinzip verstanden», grinst Bolp. «Kappe, Sie wissen ja, die Kilineks – das sind Helden für die Nachkriegsgeneration in dieser Stadt!»
«Was wollen Sie von mir, Bolp? Nein, halt, sagen Sie’s nicht. Ich krieg jetzt schon schlechte Laune. Sie wollen mich bequatschen, Ihnen Details zu verraten.»
«War er’s?» Bolp greift nach Kappes Arm und fixiert ihn so intensiv, dass Kappe zurückweicht. «Hat Kid Kilinek im Suff seine Frau erschossen, Herr Inspektor?»
«Inspektor gibt’s keinen beim LKA.» Kappe macht sich los und hastet Richtung Hauseingang. «Wir sind hier nicht bei Kottan ermittelt.»
Aber Bolp lässt sich nicht abschütteln. «Wenn Sie vielleicht ein Foto vom Tatort haben?»
«Mensch, Bolp, nein! Lassen Sie mich in Ruhe!»
«Ich würde mich dafür auch erkenntlich zeigen!» Bolp reibt Daumen und Zeigefinger aneinander. «Ich meine es ernst. Sie können es doch bestimmt gebrauchen, wo Sie Ihre Tochter in den Staaten unterstützen müssen?»
«Jetzt auch noch Beamtenbestechung?» Kappe zeigt ihm ganz klassisch einen Vogel. «Warum gehen Sie nicht als Kriegsreporter nach Afghanistan und lassen sich erschießen, Sie Aasgeier?»
Kappe knallt Bolp die Eingangstür vor den Latz. Er hält sich am Tresen des Pförtners fest. Zu viel Aufregung so früh am Morgen. So was kann böse enden. Besonders für Raucher.
Der dritte Stock des LKA in der Keithstraße ist im Sommer eine heiße, staubige Angelegenheit. Als Kappe die Bürotür öffnet, riecht er sofort diesen speziellen Amtsgeruch, eine Mischung aus braunen Holzschränken, Wasserschaden und in der Tiefe von Schubläden vergessenen Stullen mit Harzer Käse. Von den Wänden grüßt Mahatma Gandhi auf Rosis Postern. Kappes bester Freund und Kollege Wolf Landsberger legt gerade eine Akte beiseite. Es ist kurz vor 10 Uhr. Zeit, durchzulüften und Zeit für ein kultiviertes Sahnebonbon Marke Quality Street.
«Ach, der Peter.» Lächelnd zwinkert Landsberger ihm zu. «Willkommen zu einer neuen Folge von Peter kommt später.»
«Ich war schon am Tatort, du Büroklammer», pariert Kappe.
Seit Landsbergers schwerer Schussverletzung bei einem Fall vor zwei Jahren hat der Kollege ein bisschen Narrenfreiheit. Weil alle so froh sind, dass er überhaupt noch unter ihnen weilt.
Auf Kappes Tisch liegt eine rosafarbene Ermittlungsakte, darauf ein Zettel. Eindeutig Selbstmord!, steht da in der Handschrift ihres Dezernatsleiters Harry Engländer. Fall abschließen. Unterlagen an die Staatsanwaltschaft.
Ach ja. Es ist immer gut, einen Fall abzuschließen. Kappe streicht lächelnd über die schmuddelige Pappe. Berliner schießt sich in die Brust – weil sein Wellensittich im Sektglas ertrunken ist, so hatte der unvermeidliche Josef Bolp gerade erst zu diesem Fall im Blitz getitelt. Bolp trägt doch auf seine Art zur Unterhaltung in der Stadt bei. Eigentlich nicht witzig, aber eigentlich eben doch. Wie Kappes ganzer Berufsalltag.
«Frühstück?» Landsberger hält Kappe die rosa Sahnebonbondose hin. «Tatort heißt, wir haben einen neuen Fall?»
Kappe nickt und greift geistesabwesend nach einem in glänzend grüne Folie eingewickelten Bonbon. «Ich wollte dich heute Nacht nicht rausklingeln», sagt er und schiebt Landsberger ein Foto von Kilinek über den Schreibtisch. «Arbeitshypothese: Kid Kilinek hat seine Frau erschossen. Durch die Toilettentür. Sagt jedenfalls die Haushälterin.»
«Ach herrje. So ein schöner Verlierer ist der immer gewesen», seufzt Landsberger mit sahnetoffeeglänzenden Lippen. «Da lege ich doch gleich mal eine neue Akte an.»
«Ein Verlierer mit einer sehr großen Schnauze.» Kappe mixt sich einen ganz besonders steifen Nescafé. «Ich mach erst mal kurz Pause. Wo ist denn meine Rosi?»
Von ihrem dritten Teammitglied, Rosi Habedank, ist nämlich nichts zu sehen. Und Kappe kann nur sehr schlecht ohne seine Rosi. Da fließt die Lebensenergie bei ihm nicht so richtig.
«Harry Engländer hat Rosi ins Besprechungszimmer gebeten», sagt Landsberger und wuschelt sich das Haar zurecht.
«Der Chef?» Alarmiert fährt Kappe herum. «Was will der denn schon wieder?»
«Bleib ruhig. Das macht sie schon selbst.»
Zugegeben. Rosi macht alles selbst. Spielt Bluesgitarre wie der Teufel und serviert einen Yogi-Tee, den es sogar im Café Kranzler nicht gibt. Trotzdem würde Kappe gerne Verantwortung für sie übernehmen. Mit ihr zusammenziehen. Sie zögert. Er zögert, weil sie zögert. Rosi ist schon 52. Ist das ein Argument? Immerhin ist Kappe auch schon 41. Quasi stabil stubenrein und aus dem Gröbsten raus. Eine Tochter hat er auch schon, die aber samt Mutter in Amerika lebt. Und so toll war das Vatersein jetzt im Großen und Ganzen auch nicht gewesen, dass er unbedingt noch ein weiteres Kind bräuchte. Vielleicht hat er auch gar nichts gegen das Vatersein, sondern nur keine Lust auf einen aussichtslosen Kampf um die Liebe eines viel zu weit entfernten Kindes.
Landsberger steht auf; noch bewegt er sich ziemlich steif. Ein Bauchschuss ist eben kein Spaziergang. Er hangelt sich rüber zum Papierkorb, wegen der Bonboneinwickelfolie. Bei ihm muss alles seine Ordnung haben. Auf dem Rückweg mustert Landsberger sich abwesend im Spiegel über ihrem Büro-Handwaschbecken, und Kappe mustert Landsberger. Die Haare des Kollegen sind blond, halblang und schwingen so schön wie in der Drei-Wetter-Taft-Reklame. Als er noch krankgeschrieben war, hatte Landsberger als Hobbykicker schwerstes Fußballfieber wegen der Europameisterschaft in Frankreich. Aber nach dem peinlichen Ausscheiden von Jupp Derwalls Jungs in der Vorrunde gegen Spanien gilt die Aufmerksamkeit des Kollegen jetzt wieder ganz der eigenen Schönheit.
«Soll ich schnell zu Drospa laufen und dir drei Dosen Haarspray holen?», bietet Kappe an.
«Nee, wäre schade wegen des Ozonlochs. Ich bin ja naturschön.» Landsberger grinst frech zurück.
Kappe greift sich ein Magazin vom Schreibtisch des Freundes, als Pausenlektüre. Es ist eine aktuelle Ausgabe der Jugendzeitschrift Bravo. «Bist du dafür nicht schon zu alt?»
«Das sagt der Richtige.» Landsberger wirft ihm eine Kusshand zu. Er ist drei Jahre jünger und genießt es.
Auf dem Cover sind Bilder sogenannter Stars, von denen Kappe kaum mehr als die Namen kennt. Auf einer Metaebene amüsiert sich Kappe über sich selbst. Dass er nach klassischer Alt-Herren-Art die künstlerische Leistung des aktuell Angesagten skeptisch sieht. Geht das jetzt mit über vierzig los? Aber halt – etwas anderes kennt Kappe noch vom Pausenhof der Schule. «Schauen wir mal, was es Neues gibt von Doktor Sommer.»
Er schlägt die entsprechende Seite auf: «Hier, hör mal: Stephan (15): Ich habe Angst, dass, wenn meine Freundin beim ersten Mal einen Scheidenkrampf bekommt, ich in ihrer Scheide feststecke.»
«Ach du Schreck. Eigentlich ein Fall für die Sitte», murmelt Landsberger abwesend. «Kappe, ich glaube wirklich, ich müsste mit meinen Haaren dringend was anders machen.» Er zuppelt daran herum.
Aber Kappe ist gedanklich mehr am körperlichen Südpol unterwegs. «Hier, nicht zu fassen: Markus (14): Lieber Dr. Sommer, ich möchte bald zum ersten Mal mit meiner Freundin schlafen. Meine Freundin hat mir gesagt, dass dabei das Jungfernhäutchen platzt. Nun habe ich Angst, dass meine Eltern durch den Knall wach werden und uns erwischen! Ganz schön, nicht mehr in der Pubertät zu sein, oder?»
«Wie findest du das?» Landsberger schiebt die Haare so lange hoch, bis sie stehen.