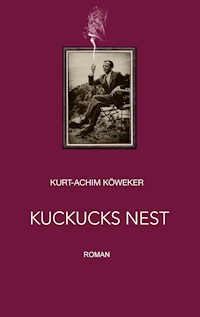Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gibt's das - ein falscher Sarg im Grab? Eine Ehefrau, der im Wald statt eines Hundes ein Mann zuläuft? Ein Liebhaber mit Hexenschuss und weiteren Problemen? Ein Politiker, der Angst hat, Toilettentüren zu schließen? Eine alte Dame, die mit einem Brief zwei junge Flegel flach legt? Ein Ehrenmann im Rentenalter, der Stehlen als Hobby für sich entdeckt hat? - Doch, das gibt es. Und noch einiges mehr. "Bei Selbstgesprächen versteht man sich in allen Sprachen" - Mit feinem Hintersinn beschreibt der Autor seine Figuren. Was sie erleben, ist komisch, traurig, witzig und berührend. Skurrile Geschichten von nebenan - liebevoll und mit Humor erzählt. Ein Buch, das gute Laune macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Anamnese
Blauer Engel
Auf Augenhöhe
Der Lenz war da
Auf dem Weg
Aktenzeichen X-Y gelöst
Im grünen Bereich
Höhenflug mit Bodenhaftung
Die andere Seite der Sonne
Hot Dog
Taxi nach Kalifornien
Der mit dem Wolf spielt
Mit freundlichem Gruß
Frühstückstheater
Nachbarschaftshilfe
Ende der Sitzung
Sicher ist sicher
Babylon
Deutsch für Inländer
Herzenssache
Ein Traum
Zufall, was sonst
Gipfeltreffen
Ende der Kampagne
Künstlerliebe
Paul
Sein und Schein
Laufzeit
Für Ursula
Anamnese
Ich rede gern. Und viel. Zu viel, wie meine Freundin sagt, wenn ich sie bei Freunden mal wieder nicht habe ausreichend zu Wort kommen lassen. „Überall musst du deinen Senf dazu geben,“ predigt sie mir. „Sei doch einfach mal still und hör zu. Üb das mal – einfach nur zuhören, so schwer kann das doch nicht sein, Himmelherrgott!“
Sie hat keine Ahnung, wie schwer mir das Zuhören fällt. Wahrscheinlich bin ich zu ungeduldig. Wenn sich jemand – und vornehmlich eine Frau – auf den Weg zu einer Meinung begibt und dabei viele Umwege und Kehrtwendungen macht, muss ich tief durchatmen. Bevor sie noch zu Ende gekommen ist, weiß ich schon, was sie eigentlich sagen wollte, und unterbreche sie: „Aber ...“
Ich bin natürlich anderer Meinung als sie. Schon aus Prinzip. Männer wie ich wissen alles besser und müssen zwangsläufig widersprechen. Oder wenigstens eine andere Meinung vertreten. Die Dinge auf sich beruhen lassen können sie nicht. Sie müssen das letzte Wort haben. Und das letzte Wort sollte, so wünsche ich es mir, zudem noch eine Pointe sein, damit ich die Lacher auf meiner Seite habe. Für eine gute Pointe zur rechten Zeit würde ich meine Großmutter verkaufen; leider habe ich keine mehr, so dass die Sache mit der Pointe Glücksache bleibt.
„Du laberst und laberst und laberst ohne Punkt und Komma“, behauptet meine Freundin immer wieder und stellt mir eine Diagnose, die mich ärgert: Ich litte, um es medizinisch auszudrücken, unter 'Wörter-Diarrhoe. Manchmal benutzt sie auch folgende Variante: „Du redest wirklich nur Scheiß. Und das mehrt sich in letzter Zeit.“ Das sind die seltenen Augenblicke, in denen mir nichts mehr einfällt außer:
„Du blökst wie eine frustrierte Ehefrau.“
„Und du nervst wie ein hirnrissiger Ehemann!“
„Aber ich bin nicht dein Ehemann!“
„Zum Glück nicht, sonst wäre ich schon längst in die Elbe gesprungen!“
Geschrei, Türknallen. Ich muss eine Prise frische Wendlandluft nehmen, es weht kalt von Osten. Im Schafstall blöken die Schafe. Pfützen auf dem Hof, ich mitten drin. Irgendwo hinterm grauen Himmel fließt angeblich die Elbe, in die sie springen würde, wenn ich ihr Mann wäre. Seit achtzehn Jahren lebe ich mit ihr auf diesem Resthof. Einmal habe ich versucht, sie zu heiraten. „Geht nicht“, bedauerte sie, „du kannst ja nie 'ja' sagen ohne eine Einschränkung! Und ein 'Ja, aber' gilt nicht unter der Kanzel.“ Dabei blieb es, streiten kann man sich auch ohne amtlichen Ehe-Segen.
Trotzdem. Alles war gut zwischen uns, also Manches. Im Bett war alles Kanone, im übrigen Bereich eher Kleinkaliber, um im Militärjargon zu bleiben. Der übrige Bereich begann im Laufe der Jahre eine immer größere Rolle zu spielen. Zu meinem Leidwesen. Wenn das so weitergeht, rasseln wir in eine Krise, die Elke und ich. Deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen. Aus eigenem Antrieb. Auch wenn die Elke mich etwas angeschoben hat. Die Elke, kann ich Ihnen sagen, ist ein Kapitel für sich, über das ich stundenlang reden …
Gut, gut, ich bleibe bei mir, dem Burkhard. Bei uns im Wendland kennt man meinen Familiennamen gar nicht, ich bin für alle einfach der Burkhard. Der Alleskönner. Tischlern, mauern, kochen, gärtnern, Schafe züchten, Kinder erziehen, reden und die Leute mit Liedern und flotten Sprüchen entertainen – überall bin ich ziemlich Spitze. Sogar im Gemeinderat bin ich gelandet. Ich habe ein gewinnendes Lachen im Gesicht, das wirkt garantiert ansteckend. Nur meine Frau, also die Elke, lacht nicht. Nicht mehr. „Nun lach doch mal“, lach ich sie manchmal an .„Ach Burki“, ruft sie dann, als riefe sie unseren Hund, dabei haben wir gar keinen. Fehlt nur noch, dass sie mich hinter den Ohren krault. Diese Verniedlichung von Burkhard verbitte ich mir. Meistens vergebens.
In der Laienspielgruppe, in der ich den Ton angebe, bin ich natürlich der Burkhard. Unangefochten. Ich spiele mit Lust und Hingabe und die Leute mögen mich. Ist bisher nie anders gewesen. Und dann diese seltsamen Dinge. Zuerst die Elke mit ihrem Laber-Vorwurf. Früher hat mein Reden sie begeistert, so sind wir überhaupt erst zusammengekommen. Seit wir zusammen sind, hat ihre Begeisterung Jahr für Jahr nachgelassen. Dann der Fall Schröderstraße in Lüneburg. Ich hatte da zu tun und da sitzt Rosi. Ich denk', ich seh' nicht recht. Da sitzt Rosi vorm Lokal, in eine blaue Decke gewickelt, und raucht. Vor zwanzig Jahren habe ich sie das letzte Mal gesehen, damals hatten wir ein kleines …, egal. Danach ging sie in die USA, wollte im Filmgeschäft Karriere machen, hat auch so einen Halbwegs-Star geheiratet, dann noch einen, dann war sie für die Presse vergessen. Die Rosi mit ihrer rosa Schleife im Haar, das blond gefärbt ist. Überhaupt ist sie ein bisschen fett geworden. Sitzt da und raucht, als wärs gestern. Gestern rauchte sie noch nicht. Und da steht wahrhaftig ihr Fahrrad an der Wand, auch rosa, mit Propeller am Lenker, als wär's gestern! Gibt's doch nicht, dachte ich, sagte „Hallo Rosi, Schatz, toll dich zu sehen“, drückte ihr einen Kuss auf die aufgespritzten Wangen und zog mir einen Stuhl an ihre Seite: „Wie geht’s denn, altes Haus?“ Und hab', ohne ihre Antwort abzuwarten, erzählt, wie ich das eben so mache, vielleicht etwas ausführlicher als sonst.
Sie schaute mich an als redete ich Suaheli, kniff die Augen zusammen wie eine Schwerhörige, wandte sich dann zur Seite. Ich drehte sie zu mir zurück, lachte sie an mit meinem ansteckenden Lachen. Sie lachte nicht mit, starrte mich an, stand plötzlich auf, haute mir eine herunter und setzte sich wieder. Ich war sprachlos, was selten vorkommt. Und benommen. Und ratlos. So saßen wir einen Moment stumm nebeneinander. Dann kam eine Frau, gestikulierte mit ihr, Rosi gestikulierte zurück, unverständliche Handbewegungen, dann gingen beide, das Fahrrad und ich blieben zurück. War wohl nicht ihr Fahrrad und ich wohl nicht ihr Ex. Hat mich etwas verunsichert, der Vorfall.
Dann Elke zuhause. Ich erzähl' ihr. Ihr Kommentar:
„Siehst du, Burki, das kommt davon. Wer nicht zuhören kann, versteht nichts.“
„Wie bitte? Was soll ich verstehen?“
Sie zuckt die Schultern und geht. Wochen später, beim Frühstück, sagt sie, sie habe von mir geträumt. Sie habe am Elbdeich gestanden, unten auf der Wiese hätten Kisten und Pakete gelegen, ein riesiger Haufen Wörter, fein verpackt, Burkhards gesammelter Wortschatz, portioniert in Tausende von Päckchen. Da sei sie ans Ufer getreten und habe begonnen, alles, Stück für Stück, in die Elbe zu schmeißen. Wie kleine Schiffchen seien sie davon gesegelt. Ihr sei beim Arbeiten richtig warm geworden, denn sie habe fertig werden wollen, bevor ich dazu käme. Und dann sei sie schweißnass aufgewacht. Das erzählte sie mit heiterem Gesicht und zwischen einem halben Dutzend Schlückchen Tee. Ich sagte nichts weiter dazu. Außer: „Dass du so unverschämt von mir träumst, das verbitte ich mir!“ Da lachte sie und ich lachte nicht mit. Der Hammer in der nächsten Nacht. Ich träumte, was ich sonst nie tue: Ich stehe am Elbdeich. Unten auf der Wiese mein gepackter Wortschatz. Und Elke, die ihn Stück für Stück ins Wasser schmeißt. Vor jedem Wurf schaut sie zu mir hinauf. 'Nicht!' will ich schreien, es geht nicht. Mir fällt 'nicht' nicht ein. Mir fällt gar nichts ein. Ich strenge mich an wie verrückt. Von meinem Schrei ist Elke aufgewacht. „Hast du denn?“, nuschelt sie schlaftrunken. Ich kann nur keuchen, bringe kein Wort heraus. Sie schläft weiter.
Von nun an jede Nacht dieser irre Traum, es ist zum Verrücktwerden. „Ach Burki“, sagt Elke und krault mich hinterm Ohr.
Mein Gott, ich bin doch ein Mann in den besten Jahren, keine fünfzig (also fast sechzig), und lasse mich nicht klein kriegen. Morgen hat ein Stück unserer Laienspielschar Premiere, ein Fastnachtsspiel von Hans Sachs, dann zeige ich's allen. Ich spiele den Ehemann einer heuchlerischen Ehefrau. Ich tue so, als stürbe ich, kaum bin ich tot, jauchzt die Witwe vor Vergnügen – und ich fahre vom Bett hoch und es gibt ein Donnerwetter.
Und nun Premiere. Alles gut. Ich liege mit geschlossenen Augen scheintot auf dem Bett, sie freut sich, fällt ihrem Galan um den Hals, ich fahre aufs Stichwort aus den Kissen hoch, öffne die Augen und sehe - Elke. Das kann nicht sein, sie sitzt im Zuschauerraum, das weiß ich. Trotzdem. Ich sehe Elke vor mir, die meine Wörter wegwirft – und mir fallen sie nicht ein. Nicht ein einziges. Die Souffleuse schreit, dass man sie in der letzten Ecke des Wirtshaussaales hören kann, mir nützt es nichts. Ich bin sprachlos. Sekunden dehnen sich wie Ewigkeiten. Nichts. Es wird nicht besser, wenn ich noch länger warte. Ich stehe auf und gehe ab. Ohne Donnerwetter.
Das könne jedem mal passieren, sagten meine Mitspieler. Als es mir bei der nächsten Vorstellung an haargenau derselben Stelle wieder passierte, sagten sie nichts mehr. Nach der dritten Vorstellung bin ich nicht mehr hingegangen. Stand in den Pfützen auf unserem Hof und habe geschrien, bis ich heiser war.
„Ach Burki“ sagte Elke.
„Fass mich nicht an!“, schrie ich. Ich hätte sie umbringen können. Vielleicht tu ich's ja noch. Vorläufig bin ich mal zu Ihnen gekommen. Und frage Sie: „Was jetzt?“
Blauer Engel
Er war der erste Patient, den sie allein besuchte. Er lag mit von den Medikamenten aufgedunsenem Kopf im Bett, sein Gesicht schien wie ein bleicher Mond aus dem Kissen. Er zwang er sich zu einem Lächeln und versuchte, sich aufzurichten, als Henrike Voss an sein Bett trat: „Was kann ich für Sie tun, schöne Frau?“ Damit war seine Kraft erschöpft, er sank zurück.
Sie sei eine ehrenamtliche Helferin, wie es hier in der Klink viele gäbe, sogenannte blaue Engel, wegen des hellblauen Kittels, den sie trügen.
„Blauer Engel mit roten Haaren“, unterbrach er sie schwach.
„Und mit viel Zeit für Sie, wenn Sie wollen,“ ergänzte sie. Selbst jetzt, wo seine Zeit zu Ende geht, kommen diesem Mann nur Plattheiten über die Lippen, dachte sie. 'Hirntumor, inoperabel', hatte die Stationsschwester sie eingewiesen, 'maximal zwei Wochen noch'. Der Kranke streckte ihr seine Hand entgegen:
„Herbert Wühne. Das Rot steht Ihnen übrigens gut.“ Für weitere Komplimente war er zu schwach. Sie nahm seine Hand und legte sie aufs Laken zurück.
„Ich bin Henrike Voss“, sagte sie und wusste nicht mehr, ob sie das sagen oder den Patienten gegenüber anonym bleiben sollte; erst vor kurzem hatte sie eine Ausbildung als Blauer Engel abgeschlossen.
„Helfen Sie auch?“, tönte es aus den Kissen.
„Ja, wenn ich kann“, antwortete sie.
„Sie können“, nickte er. Die Tür öffnete sich, eine zierliche Frau in den Fünfzigern trat ins Zimmer, zog ihren Mantel aus, legte ihn über das Fußende und wandte sich an die Frau im blauen Kittel:
„Ich bleibe jetzt ein paar Stunden.“
„Siehst du“, sagte Herbert Wühne zu seiner Frau, „jetzt habe ich neben dir auch noch einen blauen Engel, bis irgendwann der schwarze kommt.“ Die Frauen begrüßten einander, dann ging Frau Voss. Sie komme wieder, versprach sie, zweimal in der Woche helfe sie auf der Station.
Als sie ihn zum zweiten Mal besuchte, ließ er sich von ihr vorlesen. „Egal was, ich höre Ihre Stimme gern.“ Sie versuchte, das unbehagliche Gefühl zu verdrängen, das sie in seiner Gegenwart beschlich. Die Art, wie er mit ihr umging, erinnerte sie an einen Mann aus ihrem früheren Leben. Sie begann zu lesen. Er unterbrach: „Kann ich Ihnen vertrauen?“
„Ja sicher“, sagte sie, „ganz bestimmt. Natürlich.“
„Dann können Sie mir auch helfen, das ist gut zu wissen. Lesen Sie weiter.“
Er habe schon auf sie gewartet, sagte Herr Wühne, als Henrike Voss Tage später zum dritten Mal an seinem Bett stand. Wie sie ihm helfen könne, fragte sie. Er liebe seine Frau, sagte er; jetzt, wo es mit ihm zu Ende gehe, habe er erst begriffen, was sie ihm bedeute. Das Reden strengte ihn an.
„Wir haben viel Zeit“, sagte der blaue Engel.
„Sie ja, ich nicht. Würden Sie meiner Frau einen Blumenstrauß nach Hause bringen? Sie wohnt in der Innenstadt.“Er zog einen Umschlag unter der Decke hervor und gab ihn ihr. „Die Adresse ist drin. Und Geld für die Blumen, Fresien, sie liebt gelbe Fresien. Als Zeichen meiner Liebe.“
Sie hole ihm natürlich gern die Blumen, am besten jetzt gleich, damit er sie selber seiner Frau überreichen könne, wenn sie ihn gleich besuchen komme, sagte Frau Voss und und war gerührt von der Idee ihres Gegenübers. Wühne schüttelte mühsam den Kopf:
„Sie verstehen mich falsch! Sie müssen ihr die Blumen nach Hause bringen, so gegen neun. Von der Arbeit geht sie erst zu mir, dann zu sich nach Hause. Dann kommen Sie, bringen ihr die Blumen und können anschließend die Briefe mitnehmen.“ Er musste eine Atempause machen. Frau Voss verstand nicht:
„Briefe mitnehmen?“
„Die Liebesbriefe! Sie sollen nicht in ihre Hände fallen. Sie liegen oben in der weißen Kommode im Keller, ich habe eine Skizze gemacht!“ Er klopfte auf den Umschlag auf der Bettdecke. Wieder eine Pause der Erschöpfung, er atmete schwer. Auch der blaue Engel musste schlucken, als er begriff, was der todkranke Mann von ihm verlangte. „Und dann verbrennen“, keuchte er, „sie soll nichts davon erfahren, auch nicht, wenn ich tot bin.“ Henrike Voss starrte ihn sprachlos an.
„Ich soll hinter dem Rücken Ihrer Frau ...“
„Es ist ganz leicht. Neben der Gästetoilette ein paar Stufen hinunter, da steht die Kommode, oben, das kleine Fach ….“. Er hielt ihr den Umschlag hin: „Hier, nehmen Sie, bevor sie kommt! Bitte! Helfen Sie mir.“
Er sank schwer atmend ins Kissen zurück, der Umschlag entglitt seiner Hand und fiel auf den Boden. Henrike Voss stand lange sprachlos und wusste nicht, was tun. Sie sah seinen flehenden Blick. Langsam bückte sie sich, hob den Umschlag auf, steckte ihn ein.
„Ich weiß nicht, ob ich das kann“, sagte sie, strich ihm über die Hand und ging.
Sein flehender Blick verfolgte sie durch den Nachmittag und stritt sich mit ihrem strikten Vorsatz, aufrichtig durchs Leben zu gehen, ohne die Tricks und Täuschungsmanöver, mit denen sie es gute zwanzig Jahre lang als Bankkauffrau und Fondsberaterin zu Ansehen und Geld gebracht hatte. Nun hatte sie ihr Leben in neue Bahnen gelenkt und erfahren, dass man alles, was man man für andere tut, auch für sich selber tut und damit Zufriedenheit und Glück findet. Aber nun? Wenn sie dem Todkranken helfen wollte, musste sie das heimlich, hinter dem Rücken seiner Frau tun. Sie hasste solche Heimlichkeiten. Wenn sie jedoch die Hilfe verweigerte, würde sie vielleicht zwei Menschen unglücklich machen – ihn und sie, falls später die Briefe entdeckt würden. Was also tun?
Sie wusste es nicht, als sie an der Tür des kleinen Reihenhauses klingelte. Frau Wühne brauchte einen Augenblick, um sie wiederzuerkennen, bat sie dann ins Haus. Sie standen im Flur, Frau Voss übergab den Strauß: „Von Ihrem Mann. Er bat mich, ihn für sie zu kaufen“ – 'als Zeichen meiner Liebe' verschwieg sie.
„Fresien, meine Lieblingsblumen“, sagte Frau Wühne, sog den süßen Blumenduft ein, wandte sich dann jäh ab. Der blaue Engel sah durch die offene Küchentür, wie die schluchzende Frau die Blumen immer neu in der Vase arrangierte; er ging zu ihr und nahm sie in die Arme. Sie sei viel allein, sagte Frau Wühne und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Sie setzen sich an den Küchentisch; er war für zwei Personen gedeckt und noch nicht abgeräumt.
„Ich hoffe immer, er kommt wieder zur Tür herein, dann muss er essen, er war immer so hungrig, hungrig aufs Leben, und jetzt muss er sterben. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll ohne ihn. Lässt mir vom Krankenhausbett aus Blumen bringen, das ist doch … lieb.“
Ob es wirklich so lieb war, fragte sich still der Engel, der jetzt ohne blauen Kittel, aber mit leuchtend roten Haaren, unter der Küchenlampe saß.
Ob sie verheiratet sei und Kinder habe? Die roten Haare ständen ihr gut. „Nein“, antwortete sie. Der Mann, mit dem sie zwanzig Jahre gelebt habe, hatte eigene Kinder und eine eigene Frau, und war außerdem mit der Bank verheiratet, in der auch sie, Henrike Voss, gearbeitet habe. Er sei ihr Chef gewesen. Sie sind eine Spitzenkraft; sie können jeden um den Finger wickeln, sogar mich', habe sie ihr Chef gelobt, und sie dann behandelt wie sie ihre Kunden behandeln sollte: beschwatzt, gelockt, mit Versprechungen gefüttert und hingehalten, zwanzig Jahre lang. Dann habe sie radikal einen Schlussstrich gezogen. Schluss mit ihm. Schluss mit der Bank. Schluss mit der Bankkauffrau. Schluss mit halbherzigen Versprechungen, Schluss mit Handeln wider besseres Wissen, kein Zurück mehr; sie habe ihre langen brünetten Haare kurzgeschnitten und hennarot gefärbt und trage sie wie einen Stempel unter einem Kapitel abgeschlossener Lebensgeschichte.
Die zierliche Frau Wühne strich sich die Haare, die wie ein blonder Vorhang über den verweinten Augen hingen, aus der Stirn. „Und jetzt haben Sie ein neues Leben begonnen, das ist mutig. Ich wäre so froh, wenn ich mein altes noch lange so weiterleben könnte. Er fehlt mir so.“ Sie stand auf. „Kommen Sie, wir holen uns einen Wein aus dem Keller.“ Sie ging voran die kurze Treppe in den Keller hinunter. Neben dem Weinregal stand die verstaubte weiße Kommode. „Suchen Sie sich eine Flasche aus, mein Mann liebt gute Weine, er wird sie nur leider nicht mehr trinken können.“
Oben im Haus klingelte das Telefon; sie komme sofort zurück, sagte Frau Wühne und lief hinauf. War das ein Wink des Himmels? Mit einem Griff zog der blaue Engel die kleine Kommodenschublade auf, fand das in Packpapier gewickelte Päckchen, steckte es sich in den hinteren Hosenbund und schob das Jackett darüber. Sie tranken ein Glas Wein in der Küche; das Gespräch schleppte sich dahin. Es sei nicht immer leicht mit ihrem Mann gewesen, er habe beruflich viel unterwegs sein müssen, aber es sei eine schöne Zeit für sie beide gewesen; davon werde sie leben, auch wenn er gestorben sein sollte. „Ja“, sagte der blaue Engel, trank aus und verabschiedete sich. Frau Wühne brachte sie zur Tür. Ob man sich vielleicht wiedertreffen könne?
„Ja, vielleicht“, sagte der blaue Engel und ging. Zuhause zündete Henrike Voss ein Feuer im Ofen an, entkorkte eine Flasche Wein, schenkte sich ein, legte sich Mozarts Klarinettenkonzert auf, setze sich in einen Sessel vor der Feuerstelle, wickelte das Päckchen auf und warf Brief für Brief ungelesen in die Flammen.
Und wenn es nun nicht Liebesbriefe sondern andere Dokumente waren?, durchfuhr es sie heiß. Zu spät. Es gab kein Zurück.
Am nächsten Tag besuchte sie Herbert Wühne außerhalb ihres normalen Dienstes. Sie komme nur, um ihm den Umschlag zurück zu bringen, sagte sie, legte ihn aufs Bett, verabschiedete sich und verließ den Raum. Sprachlos hatte Herr Wühne zugesehen. Zitternd öffnete er jetzt das Couvert. Er fand eine Quittung des Blumengeschäftes, das Rückgeld und ein Häufchen Asche. Ein Lächeln glitt wie ein Sonnenstrahl über sein Gesicht.
Auf Augenhöhe
„Was machst du wieder für ein Gesicht!“, sagte sie, „schau dich mal im Spiegel an.“
Morgens um halb acht mag ich mich noch nicht anschauen, mein Rücken schmerzt, damit habe ich genug zu tun. Lächeln vor dem Frühstück ist ohnehin eine Aufgabe, die mich überfordert.
„Geh zum Arzt, anstatt hier herumzuhängen und zu klagen.“
Falls ich ein finsteres Gesicht habe, wird es nach solchen Ansprachen noch finsterer. Es hellte sich erst im Laufe des Vormittags auf, als ich mich entschlossen hatte, einen Orthopäden aufzusuchen. Sie wird schon sehen, was sie davon hat, mich zum Arzt geschickt zu haben: allein wird sie zu Hause sitzen, während ich tagelang in der Klinik von Abteilung zu Abteilung geschoben werde …
Schon auf dem Weg in die Praxis verlaufen sich meine Rückenbeschwerden ins Ungefähre. Fast habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich zum Arzt gehe. Der Orthopäde ist ein älterer Herr; wenn mich nicht alles täuscht, macht auch er ein finsteres Gesicht, als er mich sieht. Statt mich nach meinen Gebrechen zu fragen, will er wissen, was ich beruflich mache.
„Gemacht habe“, antworte ich und lasse nebenbei das Stichwort 'Theater' fallen. Er ist sehr interessiert.
„Erzählen Sie!“ Ich erzähle. Sein Gesicht hellt sich zunehmend auf. Mir ist, als führe ich im Fahrstuhl seiner Wertschätzung von Etage zu Etage aufwärts, bis wir beide auf Augenhöhe sind – der Arzt und der Patient. Von Beschwerden ist nicht mehr die Rede, sie sind der Rede nicht wert.
Wir reden über wichtige Dinge. Er spiele Geige in einem Laienorchester, strahlt der Arzt, wir seien sozusagen im weitesten Sinne Kollegen. So reden wir über Musik, Theater, Gott und die Welt. Zwischendurch blickt die Sprechstundenhilfe ins Zimmer und erinnert mit vielsagendem Blick an das überfüllte Wartezimmer. Dann geht sie wieder. Der Doktor folgt ihr, hält die Tür einen Spalt offen, winkt mich mit einer Kopfbewegung zu sich heran. „Sehen Sie?“
Wir sehen beide hinaus ins Wartezimmer: Menschen mit finsteren Gesichtern sitzen da, das Leiden Christi zu Fuß. Er schließt die Tür.
„Da sitzen sie und meinen, ich könne ihnen helfen. Aber ihnen ist nicht zu helfen. Man wird alt, so ist das. Man bekommt seine Problemchen und wird sie behalten, bis man in der Kiste liegt, so ist das. Aber das glauben die natürlich nicht. Also muss ich so tun, als ob es Abhilfe gäbe. Alles Theater!“ Er schüttelt freundschaftlich meine Hand.
„Und was haben Sie?“, scherzt er.
„Rücken“, lächle ich und versuche, das Gesagte durch eine wegwerfende Geste zu bagatellisieren.
„Jaja“, sagt der Doktor, „wenn man morgens aus dem Bett steigt. Ich kenne das. Schrecklich.“
„Und beim Schuhe-Zubinden!“
„Ja, ja, ja, ja“, lacht er, „das geht nur noch mit Tricks!“
Wir sind uns einig. Da helfe auf Dauer nur eines: Vorsicht, wenn man volle Bierkisten aus dem Auto hebe. Und Gewöhnung. Und vielleicht noch regelmäßige Rückengymnastik, aber dazu habe er als Arzt meistens entweder keine Zeit oder keine Lust.
„Da müssen wir durch“, sagt er herzlich und verabschiedet mich. Ich durchquere das Wartezimmer mit einem Lächeln im Gesicht; der Schmerz ist weg, die versammelten Patienten schauen mich an, als käme ich von einem Wunderheiler.
Ich erzählte meiner Frau von diesem Arzt-Besuch. „Siehst du!“, war ihre Antwort. Ich nickte, als hätte ich verstanden, was sie damit sagen wollte, und bemühte mich um ein freundliches Frühstücksgesicht.
„Wenn du dir nun vorstellst, ich sei dein Arzt, dann sparst du dir in Zukunft den Weg zum Doktor und das Resultat ist das gleiche“, erklärte sie. „Und ich habe einen Mann mit einem freundlichen Gesicht beim Frühstück.“ Ich war nicht überzeugt, aber guten Willens. „Sicher“, sagte ich.
Tage später spürte ich diesen feinen Schmerz im Kopf; er zog sich über die Scheitellinie und vergällte mir die Laune. Ich sah meine Frau lange an, der Kopfschmerz blieb. Um auf Augenhöhe über meinen Welt- und Kopfschmerz zu sprechen, brauche ich vielleicht doch einen richtigen Arzt und keine Ehefrau, fuhr es mir durch den schmerzenden Kopf.
„Geh' zum Arzt“ sagte sie, als habe sie meine Gedanken gelesen, „lass ein MRT machen; mit solchen Sachen scherzt man nicht.“ Als ob meine Rückenbeschwerden Scherze gewesen seien!, dachte ich und sagte: „Okay.“