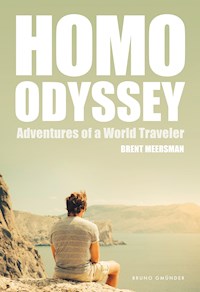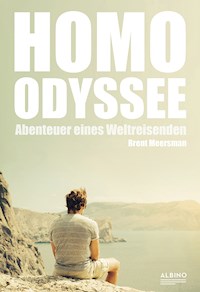
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albino Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Eine Sauna in Paris, ein Liebeshotel in Tokio oder ein Hamam in Damaskus: Brent Meersmans "Homo-Odyssee" führt durch 18 Länder auf sechs Kontinenten und ist so facettenreich wie das schwule Leben selbst. Muslimisch, christlich oder jüdisch. Legal oder illegal: Wie leben und lieben Schwule in anderen Teilen der Welt? Wie nehmen sie sich selbst wahr? Wie konnte ihre Kultur trotz Anfeindung und Ablehnung überleben? Meersman nimmt uns mit auf eine beeindruckende Entdeckungsreise, die dazu einlädt, die Welt und sich selbst aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Brent Meersman
HOMO-ODYSSEE
HOMOODYSSEE
Abenteuer eines Weltreisenden
BRENT MEERSMAN
Aus dem Englischenvon Dirk Schiller
1. Auflage© 2015 Albino Verlag, Berlinin der Bruno Gmünder GmbH Kleiststraße 23-26, D -10787 Berlin
Originaltitel: »80 Gays Around the World«© 2014 Brent MeersmanAus dem Englischen von Dirk Schiller Lektorat: Timm StafeUmschlaggestaltung & Satz: Robert Schulze Abbildung Umschlag: shutterstock.com / everst
eISBN 978-3-95985-056-8
ISBN 978-3-95985-039-1
Mehr über unsere Bücher und Autoren:www.albino-verlag.de
EINLEITUNG
Masree & Dahoud – BANANA ISLAND Luxor, Ägypten
William – HEIDNISCHE RITEN Damaskus, Syrien
Anonym – EIN ECHTER BERLINER JUNGE Berlin, Deutschland
Musa – ZWISCHEN ZWEI WELTEN Paris, Frankreich
Jussef – DER AUSSENSEITER Marrakesch, Marokko
Hakim, Asma & Julio – IM DUNKELN IST GUT … Rio de Janeiro, Brasilien
Abel / Isobel – GESCHLECHTERTAUSCH Toronto, Kanada
Chester – DAS UNSICHTBARE GHETTO New York, USA
Giovanni, José & Santos – SEXPLOITATION Havanna, Kuba
Sergio – MACHO Cancún, Mexiko
Diego, Rico, Gregg, Scott & Kate – BRAVE BÜRGER Mérida, Mexiko
Chavez & Pepe – FÜR EIN PAAR DOLLAR MEHR Mexiko-Stadt, Mexiko
Michael – ERZENGEL Los Angeles, USA
Adan & Xolelwa – SCHWARZ UND DÜSTER San Francisco, USA
Lee & Rex – DAS ENDE DER WELT Auckland, Neuseeland
Daniel – DIE KLONARMEE Sydney, Australien
Hiroshi, Hilton & Jiro – AVATARE IM BETT Tokio, Japan
Leo Ping Lee – DER ZERSCHNITTENE ÄRMEL Shanghai, China
Jason – DIE VERLORENE ADRESSE Bangkok, Thailand
Muhammad & Terrence – SINGABORE Singapur
EPILOG Indien
EINLEITUNG
Sex zwischen Männern sollte nicht jenen vorbehalten sein, die sich selbst als schwul betrachten.
Nachdem ich mich mit meiner eigenen Homosexualität abgefunden hatte, habe ich ein fast anthropologisches Interesse an der Frage entwickelt, was es bedeutet, sich auf unerklärliche, aber unabänderliche Weise zum eigenen Geschlecht hingezogen zu fühlen. Ich wollte das homosexuelle Leben in all seiner Vielfalt verstehen. Ich habe mich gefragt, wie Männer, die sich sexuell zu anderen Männern hingezogen fühlen, in den verschiedenen Teilen der Erde leben. Wie nehmen sie sich selbst wahr? Wie haben sie über Jahrhunderte hinweg an Orten überlebt, an denen ihnen mit Ablehnung und Hass begegnet wurde?
Ich bin aufgebrochen, um an so vielen Orten wie möglich Antworten auf diese Fragen zu finden. Auf meiner Reise durch sechzig Länder und sechs Kontinente hat sich nicht nur meine Selbstwahrnehmung gewandelt, sondern auch mein Blick auf die sogenannte schwule Identität.
Als Leser hat es mich immer geärgert, dass Sex, ein so wichtiger Bestandteil im Leben der meisten Menschen (was sich auch auf Reisen nicht plötzlich ändert), in den meisten Reiseberichten diskret verschwiegen wird, sodass auch aufregendste Abenteuer schrecklich keusch klingen. Das ist umso bedauerlicher, weil die Erfahrung der Fremde häufig geprägt ist von den intimen Kontakten zu Menschen, die dort leben, wo der Autor nur auf Durchreise ist. Eine unverhoffte Romanze mit einem schönen Fremden verwandelt noch das schäbigste Hotel in einen Paradiesgarten; ein mysteriöser Mann, der Fantasien wahr werden lässt, färbt die Erinnerung an eine Stadt genauso, wie dieser eine, betrügerische Callboy, den man am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen würde.
Die Geschichten in diesem Buch sind unzensiert meinen Reisetagebüchern entnommen. Sie handeln von Sex (einige mehr, andere weniger), von Erlebnissen, für die ich mich zum Teil inzwischen schäme, von Liebe und manchmal auch von Gewalt. Ich habe mich gegen eine chronologische Reihenfolge entschieden, doch ist die geografische Nähe, wie ich hoffe, nicht das Einzige, was die Kapitel miteinander verbindet.
Im Verlauf meines kurzen Lebens hat sich mein Land von Grund auf gewandelt, und das gilt auch im Hinblick auf den Umgang mit Homosexualität. Als ahnungsloser Teenager in Kapstadt glaubte ich noch, ich sei der einzige dieser Art auf der ganzen Welt. In Südafrika war Homosexualität illegal, ein Verstoß gegen die Gesetze konnte mit Gefängnis bestraft werden. Fast noch schlimmer war das soziale Stigma. Schwule kamen im Fernsehen einfach nicht vor – heute undenkbar. Selbst heterosexueller Geschlechtsverkehr galt den puritanischen Heuchlern, die mein Land regierten, als etwas Schmutziges, das in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hatte.
Vor den neunziger Jahren waren in den südafrikanischen Medien keine Geschlechtsorgane zu sehen, mit Ausnahme der Brüste schwarzer Frauen – denn Schwarze waren in den Augen der Behörden kaum mehr als wilde Tiere. Zeitungen und Zeitschriften versteckten die Genitalien meiner weißen Mitmenschen mit dicken schwarzen Balken, über Brustwarzen wurden Sterne geklebt. Sogar Kunstwerke wurden zensiert. Wenn die Kamera im Staatsfernsehen am Körper von Michelangelos David hinabglitt, wurde das Bild unterhalb des Bauchnabels weiß – erst ab den Knien konnte man wieder etwas erkennen. Der einzige nackte Mann, den ich außerhalb unseres Badezimmers jemals zu sehen bekam, war ein Stammesmitglied der Nuba, in einer Ausgabe von National Geographic. Kein Wunder, dass wir Sex für etwas zugleich Abstoßendes und Unaussprechliches hielten, für etwas, über das man allenfalls hinter vorgehaltener Hand sprach, um dann sofort in hysterisches Gekicher auszubrechen.
Für die Gesellschaft war ich ein Perverser, und Gott wollte mich tot sehen, so viel war mir immerhin klar. Während ich mich auf mein Studium zu konzentrieren versuchte, besetzte mein Land Namibia, führte Krieg gegen Angola und stand auch selbst kurz vor einem Bürgerkrieg. Fast alle meine Freunde verließen Südafrika, um einer Einberufung in die verhasste Armee zu entgehen.
Ich hatte nicht den Mut dazu. Stattdessen zog ich mit Rucksack und Eurail-Pass mehrere Monate lang kreuz und quer durch die zehn Länder, die damals zu Westeuropa gehörten. Ich hatte meine Jugend im rückwärtsgewandten und kulturell isolierten Südafrika der Apartheid verbringen müssen und hatte einen Heißhunger auf die Buchläden, die Architektur, die Galerien und Museen Europas. Staunend stand ich vor den riesigen Gemälden und all den anderen Kunstwerken, die ich bis dahin nur als blasse Abbildungen aus meiner Enzyklopädie kannte.
Meine sexuelle Identität war immer noch im Werden, und so formte sich beim Betrachten von Cellinis Perseus, von Moreaus unversehrtem Heiligen Sebastian, der Männer aus Picassos rosa Periode und der nackten Leiber von Géricault nach und nach eine Art sexuelles Ideal. Ich begann, mich nach männlichen Körpern zu sehnen, die diesen wundervollen Skulpturen und Gemälden gleichkamen. Meine Knie wurden weich, wenn ich ein Gesicht erblickte, das mich an einen von El Grecos Heiligen erinnerte, und mein Herz überschlug sich, wenn ein junger Mann aussah, als sei er soeben einem Gemälde von Botticelli entstiegen.
In Westeuropa schmeckte ich den bittersüßen Geschmack der Freiheit und träumte den Traum ungehinderter Selbstverwirklichung. Man konnte sich anziehen, wie es einem gefiel, und konnte äußern, was einem in den Sinn kam. Und nicht zuletzt konnte man lieben, wen man wollte, unabhängig von Geschlecht und Rasse.
Ähnlich wie südafrikanische Rucksacktouristen haben auch britische Aristokraten des achtzehnten Jahrhunderts versucht, den Zwängen ihrer Gesellschaft zu entfliehen. Diese Art des Reisens wurde als Grand Tour bekannt und hatte zum Ziel, den Horizont der jungen Männer zu erweitern. Das galt natürlich nicht nur für den Geist, sondern auch für den Körper, üblicherweise in Form von bezahltem Sex in Paris.
Der bekannteste Reisende zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts war vermutlich Lord Byron, der zu einer bisexuellen Erkundungstour über den Kontinent aufbrach. Weitere Homosexuelle folgten, die unterwegs ihre wahre Identität entdeckten, sich ihre im prüden England unterdrückten Neigungen eingestanden und dank der relativ offenen Sitten des Kontinents Gelegenheit hatten, fieberhaft ihren Leidenschaften zu frönen – was heute die Strichjungen in Pattaya sind, waren damals die derben italienischen Ragazzi mit ihrer dunklen Haut, den wilden Locken und Gazellenaugen.
Manche dieser schwulen Reisenden sind bis heute berühmt, wie zum Beispiel E.M. Forster, W.H. Auden und Christopher Isherwood.
Doch die meisten zeichneten ihre sexuellen Abenteuer nicht auf, und die Männer, deren Bekanntschaft sie machten, verschwanden genauso im Dunkel wie so manches Unausgesprochene in Bruce Chatwins Reiseerzählungen. Natürlich können wir uns denken, was in diesem Dunkel geschah. Doch ich meine, dass es heute möglich sein sollte, davon zu erzählen.
Mit Anfang zwanzig hatte ich mich endlich zu der Überzeugung durchgerungen, dass Homosexualität etwas völlig Natürliches war, auch wenn sie nicht der Norm entsprach. Ich hatte mit Mädchen geschlafen, aber noch nie mit einem Jungen, und diese Erfahrung wollte ich auf meiner ersten Reise nach Europa unbedingt nachholen.
Mein Reisebegleiter war Simon, ein heterosexueller Kumpel aus Schultagen, der in meinem Alter war und zu jener Zeit in London im Exil lebte.
In Paris begleitete er mich auf meine Pilgerreise zum Père-Lachaise, auf dem ich vor allem die Ruhestätte von Oscar Wilde besuchen wollte. Das Grabmal war mit Graffiti von Fans beschmiert, die auf diese Weise ihre unsterbliche Liebe zu Oscar verewigen wollten. Ich ließ das Mittagessen ausfallen, leistete mir stattdessen eine rote Rose und legte sie auf das Grab. Dann sagte ich zu Simon: »Ich glaube, ich bin schwul.« Und ich erzählte ihm, dass ich aus Neugier in eine Schwulenbar gehen wolle.
Als wir dann in Wien eintrafen, das zu dieser Zeit nicht unbedingt für seine lebendige Szene bekannt war, gelang es mir irgendwie, eine Schwulenbar ausfindig zu machen, die passenderweise ›The Why Not‹ hieß.
Simon mit seinem Engelsgesicht war einverstanden, mich am Abend als mein Beschützer zu begleiten.
Als wir ankamen, standen wir vor einer schweren, verschlossenen Holztür. Wir klingelten. In der oberen Hälfte der Tür öffnete sich ein Schlitz, und durch ein Eisengitter musterte uns ein zusammengekniffenes Augenpaar.
Simon fragte stammelnd, ob wir auf einen Drink hereinkommen könnten.
»Sorry«, sagte eine abweisende Stimme mit breitem österreichischen Akzent, »das ist eine Schwulenbar.« Der Schlitz schloss sich wieder.
Ich drückte nochmals auf die Klingel. Dieses Mal öffnete sich die Tür, jedoch nur einen Spaltbreit. »Das ist eine Schwulenbar«, zischte der Mann. »Nur für Männer, verstanden? Für homosexuelle Männer.«
»Ja«, sagte ich, »ich weiß. Deshalb wollen wir ja, dass Sie uns reinlassen.«
Der Mann im Türrahmen schaute uns prüfend an. Vor ihm standen typische Rucksacktouristen: Wir legten sichtbar nicht viel Wert auf unser Äußeres, trugen Wanderschuhe, Jeans mit aufgescheuerten Knien, Holzfällerhemden und Palästinensertücher, waren ungekämmt und unrasiert. Mit etwas gutem Willen konnte man Simon für einen hübschen Stricher halten – ich dagegen werde eher wie der typische Schwulenklatscher ausgesehen haben. Der Mann fletschte seine gelben Zähne und ließ uns widerstrebend hinein.
Im Innern, an der schwach beleuchteten Bar, saßen drei ältere Männer, tranken Alkohol und schauten mürrisch drein. Zwischen ihnen war jeweils ein Platz frei. Einladend. Mir rutschte das Herz in die Hose. Der einzige freie Platz für zwei war an der Ecke des Tresens, genau im Blickfeld der drei Männer.
Ich bestellte zwei Biere vom Fass, die in unglaublich großen Gläsern serviert wurden. Simon wirkte ein bisschen nervös. Die drei Männer starrten ihn an. Typisch, dachte ich, was war das bei Schwulen, dass der Heterokerl immer die meiste Aufmerksamkeit bekam? Weil er schwuler aussah als man selbst? Doch Simon brauchte sich keine Sorgen zu machen, niemand sprach uns an.
Als wir schließlich gingen, war meine Unschuld noch unbefleckt, Simon erleichtert und ich ziemlich niedergeschlagen. Diese Typen, die sich in einer dunklen Bar versteckten, auf irgendetwas warteten und nicht miteinander sprachen, sie ließen mich nicht los. Von den 1950ern bis in die späten Achtziger wurde uns von der Gesellschaft gesagt, dass wir im Großen und Ganzen genauso enden würden – tragisch, einsam und allein.
Doch dann wurde endlich die Apartheid abgeschafft, und Nelson Mandela legalisierte die Homosexualität. Wir drehten durch. Nach Jahren unter dem Stiefel erlebten wir unseren Prager Frühling, und die Menschen feierten. Schwule Bars und Clubs schossen wie Pilze aus dem Boden, waren vollgestopft mit Gästen, die kaum alle hineinpassten, und in den Hinterzimmern konnte man Sex haben. Ich erinnere mich daran, dass ein paar Übermütige vor den Augen der Polizei Gras rauchten. Aber wir hatten alle das Gefühl, dass es keine Rolle mehr spielte, was nun legal war und was nicht.
Nicht, dass alles glatt gelaufen wäre. Ich entging nur knapp einem Bombenanschlag auf eine schwule Bar in Green Point. Neun Menschen wurden schwer verletzt. Die Bar hat nie wieder aufgemacht.
Doch über die Jahre wurde Kapstadt zu einem schwulen Mekka, einem rosaroten Paradies, einem regenbogenbunten Dorf. Wir Schwulen aus der Mittelklasse hatten unsere Freiheit bekommen, ohne dass wir viel dafür gekämpft hätten.
Heute, im Südafrika des einundzwanzigsten Jahrhunderts, genießen Homosexuelle weitreichende Rechte, zu denen auch das Recht auf Eheschließung gehört. Am Clifton Third, dem schwulen Strand von Kapstadt, liegen Seite an Seite muskulöse Körper in allen Farben: schneeweiße und tiefschwarze, hell- und dunkelbraune, solariumgebräunte und sonnenbrandpinke. Im Hochsommer kann man zwischen all den schwulen Sonnenanbetern immer wieder Kleinfamilien unter einem Sonnenschirm sitzen sehen, denen die Zeichen der Zuneigung, die Berührungen, die gelegentlichen Küsse der Männer um sie herum offenbar gleichgültig sind. Ein schönes Werbemotiv für die in der Verfassung des Landes verankerten Menschenrechte. Schwarze und Weiße, Hetero- und Homosexuelle, Junge und Alte, Männer und Frauen, die alle friedlich in ihrer natürlichen Schönheit schwelgen. Inzwischen feiern wir, anstatt zu protestieren.
Allerdings gibt es auch eine andere Seite: Die Mehrheit der schwulen Männer in Südafrika ist schwarz und lebt unterhalb der Armutsgrenze. Ignoranz, kultureller Chauvinismus und religiöse Vorurteile, die kaum besser sind als der nackte Rassismus der Apartheid, machen es ihnen außerordentlich schwer, ihre in der Verfassung garantierten Rechte einzufordern. Sie sind immer wieder extremer homophober Gewalt ausgesetzt und daher ständig auf der Suche nach neuen Wegen, ihre Sexualität auszudrücken und auf diese Weise um Akzeptanz zu kämpfen – und sei’s durch einen extravaganten Kleidungsstil, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Manche stehen auch unter dem Schutz lokaler Kleinkrimineller, denn auch unter Kleinkriminellen gilt es inzwischen als cool, schwule Freunde zu haben.
Während meiner Reise um die Welt hat mich eine Frage nie losgelassen: Was ist es, das mich am Konzept der schwulen Identität stört?
Inzwischen greife ich, wie Gore Vidal, nach meinem Revolver, sobald ich die Worte schwule Subkultur höre. Früher war die schwule Szene eine politische, eine subversive Subkultur. Das machte einen Großteil ihrer Faszination aus. Doch in der westlichen Welt ist Homosexualität inzwischen so weit normalisiert, dass sie zum Mainstream gehört: die stereotypen schwulen Clowns in den Seifenopern, die schwulen Besserverdiener, auf die Autowerbungen und Marketingfachleute abzielen, durchtrainierte schwule Städtereisende, von denen Kapstadts boomende schwule Tourismusindustrie lebt, und die hübschen jungen Go-go-Boys, die auf den Umzugswagen der Gay-Pride-Paraden tanzen. Doch die Männer, die schwule Viertel und schwule Strände bevölkern, sind nur eine Spielart schwuler Identität, wenn auch eine sehr sichtbare. An den Orten schwulen Lebens dominiert ein bestimmtes Modell von Männlichkeit, das es schwulen Männern ermöglicht, sich ungezwungen in der Öffentlichkeit zu bewegen, solange sie selbstbewusst und jung, angepasst und karrierebewusst sind. Es handelt sich um ein konsumorientiertes Modell, das auf weltweite Verbreitung angelegt ist und dennoch enge Grenzen hat: Dicke und feminine, bi- und asexuelle sind ebenso ausgeschlossen wie ältere Männer, trotz des hinausposaunten Versprechens allgemeiner Glückseligkeit in einem pornografisch-kapitalistischen Nirwana, das aus nichts als Oberflächenreizen besteht.
Ist das wirklich der beste Weg, um die Rechte von Männern zu schützen, die Sex mit anderen Männern haben?
Im Zuge meiner Begegnungen mit Männern außerhalb der westlichen Welt bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass es ein Vorurteil ist, wenn man meint, ohne Coming-out sei ein authentisches Leben nicht möglich. Meine Erfahrungen haben mich gelehrt, dass die saubere Scheidung zwischen Hetero- und Homosexualität in vielen Teilen der Welt versagt – und dazu gehört nicht zuletzt auch jene Weltecke, aus der ich stamme.
Lange bevor die Idee der westlichen Welt geboren wurde, gab es Männer, die Sex mit Männern hatten – in fast jeder Gesellschaft, im alten China und Ägypten ebenso wie in den beiden Amerikas. Homosexuelles Verhalten war nicht nur in den antiken Hochkulturen eine allgemein akzeptierte Form der Sexualität, sondern auch in abgelegenen Gegenden wie Neuguinea oder dem Amazonas-Regenwald, lange bevor es zu ersten Kontakten mit dem weißen Mann kam.
Die Vorstellung, Homosexualität sei europäisch und damit unafrikanisch, ist ein bösartiger Irrglaube, der auf meinem Kontinent nicht nur von korrupten afrikanischen Politikern, sondern insbesondere auch von weißen nordamerikanischen Evangelikalen verbreitet wird, die für Afrika nichts als Verachtung übrig haben. Die Behauptung, Homosexualität sei unafrikanisch, ist schwarzen Homosexuellen gegenüber so paternalistisch wie rassistisch.
In vielen Ländern – Russland, Äthiopien, Ägypten und Indien, um nur einige zu nennen – habe ich Männer kennengelernt, die Sex mit Männern haben und deswegen zum Spielball politischer Machtkämpfe werden, bei denen die Kontrahenten sich gegenseitig in der Ächtung und Verfolgung von Homosexuellen zu überbieten suchen.
Und überall habe ich erlebt, dass die Ober- und Mittelschicht tun und lassen kann, was sie will, während die Armen auf Gnade und Ungnade einer intoleranten Gesellschaft ausgeliefert sind.
Meine Reisen haben mir gezeigt, dass wir auch das, was wir zu wissen glauben, erst dann richtig begreifen, wenn wir es am eigenen Leib erfahren. Wir wissen alle, dass unser Verstand uns täuschen kann. Doch unser Körper kann das mindestens genauso gut.
Ich hoffe, dass ich den Männern, die ich unterwegs getroffen habe, gerecht geworden bin. Hier folgt eine Handvoll ihrer Geschichten.
Masree & Dahoud
BANANA ISLAND
Luxor, Ägypten
Seit meiner Besichtigungstour zu den Pyramiden weiß ich, dass eine Pyramide zu betreten etwas vollkommen anderes ist, als ihre berühmten Formen von außen zu bewundern. Im Inneren der Pyramide war es stockdunkel, und in der Luft hing der Geruch von getrockneten Fäkalien. Ich war, wie es schien, vollkommen allein. Zögerlich tastete ich mich auf dem unebenen Boden voran und fragte mich, was ich hier drinnen eigentlich suchte, als ich ganz in der Nähe ein seltsames Geräusch hörte. Wie Stoff, der über Stein reibt. Ich konnte absolut nichts sehen. Dann berührte mich eine Hand an der Hüfte und fand schnell den Weg zu meiner Leiste, eine große raue Hand mit langen Fingernägeln. Ich machte einen Satz zurück, rannte blindlings in Richtung Ausgang und kam mir dabei vor wie Adela Quested in E.M. Forsters Reise nach Indien, auf ihrer Flucht aus den Marabar-Höhlen.
Ägypten kann auf eine reiche homosexuelle Geschichte zurückblicken – von den transvestitischen Tänzern unter Muhammad Ali Pascha (dem Gründer des heutigen Ägypten, der öffentliche Tanzdarbietungen von Frauen verboten hatte) bis zur berühmten Oase Siwa, wo noch in den 1930er Jahren Jungen miteinander verheiratet wurden (sehr zum Ärger der bigotten britischen Kolonialmacht, wie ich hinzufügen muss). Die englischen Reisenden, die im achtzehnten Jahrhundert nach Ägypten kamen, äußerten sich regelmäßig voller Abscheu über die homosexuellen Aktivitäten, die auf allen Ebenen der ägyptischen Gesellschaft verbreitet waren, vom Sultan bis zu den Fellachen.
Nach heutigem Kenntnisstand findet sich der weltweit älteste Nachweis für Homosexualität in Afrika, genauer gesagt: in Ägypten, in der Nähe von Gizeh. Es handelt sich um das 4390 Jahre alte Grab von Niankhkhnum und Khnumhotep, zweier Männer, die gemeinsam beerdigt wurden, um gemeinsam ihre Reise ins Jenseits antreten zu können. Die Fresken an den Wänden der Grabkammer zeigen die beiden in inniger Umarmung und beim Austausch von Nasenküssen (eine Form des Kusses, die zu dieser Zeit auch von heterosexuellen Partnern bevorzugt wurde).
Männer, die Sex mit Männern hatten, wurden Lotis genannt, ein Wort, das sich von dem Propheten Luth ableitet, eben jenem, der nach Sodom geschickt wurde und in der Bibel Lot heißt. Der Islam betrachtet homosexuelles Verlangen als angeboren, verbietet es jedoch, diesem Verlangen nachzugeben. Folgt man der Auslegung einflussreicher Korangelehrter, so betrachtete der Prophet Mohammed zwei Männer, die sich liebten, deren Liebe aber platonisch blieb, als Märtyrer, die für ihre aufopferungsvolle Enthaltsamkeit von Gott belohnt werden würden. Doch sind schon aus dem Mittelalter verschiedene Schriften bekannt, die einen offeneren Umgang mit Homosexualität anzeigen. Neben den flüchtigen Erwähnungen in Tausendundeiner Nacht sind hier vor allem die Gedichte der Sufis zu nennen, die vielfach Widmungen an ihre jungen christlichen Bediensteten enthalten (was heute gerne verschwiegen wird). Sufis scheinen sich überhaupt wenig um gesellschaftliche Zwänge geschert zu haben. Man darf annehmen, dass ihre idealisierte, poetisch überhöhte Liebe zu den jungen Männern oftmals die Grenze zur physisch-penetrativen überschritt. Mich jedenfalls erinnern ihre Lobgesänge an die Beschreibungen in Platons Symposium, das mir zum ersten Mal in der Universitätsbibliothek in meine zitternden Hände fiel – und mir endlich den philosophischen Beweis dafür lieferte, dass ich keine Anomalie war. Ich wünschte, solche Schriften wären auch den jungen Ägyptern zugänglich, die schier verzweifeln an jener Liebe, deren Namen man nicht nennen darf. Sie sollten nicht länger aus der Geschichtsschreibung ihres Landes getilgt werden.
Ein Jahrzehnt vor dem sogenannten Arabischen Frühling besuchte ich Luxor, wo ich an einem Spätnachmittag die Corniche, Luxors breite, aber eher langweilige Nilpromenade entlangschlenderte. Eigentlich galt sie als beliebtes Ausflugsziel, doch die Promenade war menschenleer, es war gespenstisch still. Vielleicht hatte man sich immer noch nicht von dem Massaker an achtundfünfzig Touristen erholt, das islamische Fundamentalisten am Westufer des Nils verübt hatten, im Schatten des Totentempels der Hatschepsut. Die Reisegruppe war mit automatischen Waffen niedergeschossen, die Leichen anschließend mit Macheten verstümmelt worden. In der ausgeweideten Bauchhöhle eines der Opfer hatten die Täter ein islamistisches Pamphlet hinterlassen.
Ein junger Mann auf einem Fahrrad fuhr ein paarmal an mir vorbei; wann immer er durch ein Schlagloch holperte, klirrte leise seine Fahrradklingel. Nach einer Weile hielt er in einiger Entfernung von mir an, stieg ab und warf mir einen prüfenden Blick zu, die Arme vor dem Körper verschränkt. Mit einer Mischung aus Interesse und Scheu ging ich auf ihn zu, wobei ich dachte: »Bitte, nicht noch ein verdammter Bettler!«
Als ich an ihm vorbeikam, begann er, sein Fahrrad neben mir herzuschieben.
»Hey Mister! Amerikaner?«
»Afrikaner«, antwortete ich.
Er lachte. Sein Gesicht war eingerahmt von vollen, unordentlichen Locken, seine Haut dunkelbraun. Er trug eine dünne, grauweiße Galabija aus Baumwolle, auf der die Fahrradkette ein paar Ölflecken hinterlassen hatte. Irgendwie schwarzafrikanisch, dachte ich, wie ein Nubier. Nordafrika war eben nicht gleich Nordafrika. Warum sahen diese ägyptischen Jungs (und, ehrlich gesagt, auch einige der Polizisten, in ihren makellos weißen Uniformen) nur so verdammt gut aus? Waren es die Augen, mit ihren perfekten Konturen, wie das Hieroglyphenauge des Ra – die Augäpfel schneeweiß, die Iris in tiefem Braun? Oder die perlweißen Zähne, die durch den dunklen Teint noch heller strahlten?
»Mein Name: Captain Masree.«
»Captain!«, sagte ich und versuchte, möglichst respektvoll zu klingen.
»Ich habe Boot. Willst du Bootsfahrt? Sehr billig!«
Der Pier war nicht weit, wir gingen direkt darauf zu.
»Es ist schon spät – «, antwortete ich.
»Heute guter Wind. Kein Anschieben.« Er grinste, ich lachte. Es war ein guter Witz. »Wir zurück … zwei Stunden. Spezialpreis für dich. Siehst du – kein Geschäft heute.« Er zeigte auf die leergefegte Promenade.
Ich war noch nie besonders gut im Feilschen, also wurden wir uns schnell einig. Ich hatte das Gefühl, dass der Preis, den er mir nannte, angemessen war – wenn man die schlechte Auftragslage einmal außer Acht ließ.
»Boot sehr sicher«, versprach er mir und zeigte auf eine Feluke, die Ähnlichkeit mit den Segelbooten hatte, die ich aus Madagaskar kannte. Nur dass hier der Ausleger fehlte. Im Boot saß ein zweiter, etwas jüngerer Mann mit nacktem Oberkörper. Er war damit beschäftigt, Seile zu flechten.
»Heißt Dahoud«, sagte Masree.
Dahoud schenkte mir ein unfassbar breites Grinsen. Das Grinsen verschwand auch nicht, als ich das Boot inspizierte. So strahlte ich meinen Zahnarzt auch immer an.
Nach kurzer Zeit legten wir ab, und das vom Wind geblähte, weiße Segel trug uns hinaus auf den breiten Fluss. Auf dem Wasser war es deutlich kühler, doch ich hatte mir am Morgen einen leichten Sonnenbrand geholt, auf den Armen und im Nacken, und der sanfte Wind verstärkte das Brennen. Als würde Terpentin auf der Haut verdampfen.
Dass Flussufer verschwamm zu einer dunklen Linie, obwohl wir noch nicht allzu weit hinausgefahren waren. Ich überlegte, ob ich wohl zurückschwimmen könnte, falls das Boot sank.
»Woher kommst du?«, fragte Dahoud, der am Ruder stand.
»Kapstadt, Südafrika.«
»PAGAD«, sagte er zu meiner Überraschung. PAGAD, das war eine umstrittene Bürgerwehr, die hauptsächlich aus Muslimen bestand: People Against Gangsterism and Drugs.
»Was arbeitest du?«, fragte er.
»Journalist«, sagte ich.
»Foto machen?«
Er bestand darauf. Also holte ich meine Kamera heraus. Sie juchzten vor Freude, ließen Ruder und Segel fahren und stellten sich in der Mitte des Bootes auf, die Arme umeinander. Es war ein bezaubernder Anblick.
Als wir noch weiter draußen waren, fragte Masree: »Bist du verheiratet?«
Er nickte wissend, als ob sich sein Verdacht bestätigt hätte, und leckte sich die Lippen, die jetzt hell in der Sonne glänzten. »Willst du Banana Island sehen?«
»Wo ist das?«
Er zeigte irgendwo in die Ferne.
»Vielleicht.« Ich hatte von der Insel gehört. Sie sollte sehr schön sein.
»Banana Island könnte dir gefallen – vielleicht.«
»Warum? Was gibt’s denn dort zu sehen?«
Die beiden jungen Männer kicherten.
»Vielleicht magst du ägyptische Bananen?« Er drehte sich gegen den Wind, sodass die Galabija gegen seinen Körper gedrückt wurde. Mit den Händen zog er den Stoff glatt – ich konnte deutlich die Umrisse seiner langen, baumelnden Frucht erkennen.
»Ägyptischer Mann gut. Einhundertfünfzig Pfund«, sagte Masree. Wahrscheinlich war es nicht allzu schwer gewesen, mir auf die Schliche zu kommen: Single, weiß, männlich, einer von denen, die seinem Blick nicht auswichen.
»Und ich? Gefällt dir?«, fragte Dahoud plötzlich.
»Er nur hundert Pfund«, lachte Masree. »Keine große Banane wie ich.«
Dahoud protestierte und schlug sich auf die Brust.
Masree quietschte vor Vergnügen. »Willst du blasen?«
Unerwartet sagte Dahoud etwas auf Arabisch, er klang besorgt, Masree drehte sich um. Eine andere Feluke steuerte auf uns zu.
Es war ein größeres Boot, mit zwei Lateinersegeln und in deutlichem besserem Zustand. Der Rumpf war frisch lackiert. An der Reling saßen zwei westliche Touristinnen, die ich auf Anfang fünfzig schätzte. Eine trug ihr Haar adrett unter einem pinken Kopftuch, die andere schützte ihr Gesicht mit einem Sonnenhut, den sie mit einer Hand festhielt, damit er nicht davonflatterte. Beide hatten sich in schlecht sitzende Bikinis gezwängt, die bestimmt ein paar Nummern zu klein waren. Auf ihrer weißen Haut lag ein dünner Film aus Schweiß und Sonnencreme, ihre Augen waren hinter großen Designersonnenbrillen verborgen.
Das Boot wurde von drei attraktiven, jungen Männern gesteuert, einer trug eine beeindruckende blassblaue Galabija. Auf dem Deck standen große Weidenkörbe, aus denen auffällig große (und schon leicht überreife Bananen) hervorlugten. Und Champagnerflaschen, die mit dem orangefarbenem Etikett. Kopfhaltung und baumelnde Arme der Frauen ließen vermuten, dass sie leicht angetrunken waren. Wir Westler ignorierten uns, doch die jungen Männer auf den beiden Booten wechselten lachend ein paar Worte auf Arabisch miteinander, während die Boote aneinander vorbeiglitten.
Sobald sie außer Hörweite waren, sagte Masree: »Jetzt zu Banana Island!«
»Mañana, no bananas today«, sagte ich betont teilnahmslos, blickte hinaus aufs Wasser und versuchte, mich an den Rest des Textes zu erinnern.
»Komm! Wird dir bestimmt gefallen! Zweihundert Pfund – Dahoud und ich, Spezialpreis. Zwei Ficks!« Er rieb über den sich wölbenden Stoff seiner Galabija, als ob er Metall polieren wollte.
Dahoud und Masree waren beide wunderschön. Doch es war mir peinlich, dass sie sich mir anboten.
»Nein, bitte – bringt mich einfach zurück zur Küste.«
»Schöner Fick. Schau, groß, sehr groß!« Masree presste beide Hände gegen den Penis unter dem Stoff. »Du kannst blasen!«
»Nein!«, rief ich. »Ich sagte: Nein!«
Ich schaute hilflos zum fernen Ufer hinüber. Sie starrten mich feindselig an. Wie albern – ich war gefangen auf einem Boot mit zwei gut aussehenden Strichern, die mich anflehten, ihnen einen zu blasen.
»Zurück zum Hafen, jetzt! Oder es gibt kein Geld für die Bootsfahrt – kein Geld für nichts!« Ich schrie fast, so wütend war ich.
Es folgte eine lange, peinliche Stille. Schließlich wendeten sie das Boot dann doch. Es kostete sie einige Kraft, gegen den Wind zu kreuzen.
Ich war dankbar, dass sie dadurch für eine Weile beschäftigt waren. Innerlich war ich immer noch wütend. Sex hat die Angewohnheit, sich ungewollt in alles Mögliche einzumischen.
Doch beim sanften Schaukeln des Bootes, dem Anblick des goldenen Sonnenlichts und des schlammig-blauen Wassers war mein Ärger dann bald verschwunden. Was blieb, war ein Gefühl der Bestürzung. Ich dachte an die Jungs, die ich auf anderen Reisen getroffen hatte. Aber diese Begegnungen waren anders abgelaufen. Sie hatten zumindest versucht, den Schein zu wahren, dass wir uns auf Augenhöhe begegneten. Die Bezahlung war dann eher ein Geschenk gewesen. Sie waren schwul und gefangen in ihren Kulturen, und ich half ihnen gewissermaßen bei der Entdeckung ihrer sexuellen Identität. Doch diese zwei Kerle mit ihrer Feluke waren nicht schwul. Sie verkauften ihre Körper.
Wer weiß, vielleicht gefiel es ihnen. Vielleicht waren sie einfach nur geil und liebten es, einen geblasen zu bekommen und auch noch Geld damit zu verdienen. Und in dieser Gegend galt sowieso, dass nur der passive Partner wirklich homosexuell war. Der Arsch eines westlichen Touristen war einfach ein Geldautomat, ein hässliches Loch, in den man einen Schwanz statt einer Bankkarte schieben musste, damit das Geld heraussprudelte.
Es fehlte nicht an Touristen, die scharf darauf waren, ihre Köpfe unter Galabijas zu stecken. Und auch nicht an Jungs, die die weißen Affen nur zu gerne mit ihren Bananen fütterten. Wie lange würde es noch dauern, bis Ägypten ein zweites Pattaya wurde? Hatten diese Jungs Kondome auf ihren Feluken? Ich bezweifelte es. Nicht mehr lange, und die Seuche würde auch hier um sich greifen, wie im Rest der Welt.
Interessierten sich die Freier für die Männer, die sich ihnen anboten? Oder waren sie nichts weiter als eine exotische Ware – ein Abenteuer aus tausendundeiner orientalistischen Fantasie, ein Ausstellungsstück in einer erotischen Galerie, das man anfassen, ausprobieren und danach wegwerfen konnte?
Am Ende verabschiedeten wir uns freundlich. Dahoud und Masree gaben mir ihre Namen und Adressen und ich versprach, ihnen Abzüge der Fotos zu schicken. Ich konnte nicht sagen, ob sie meine Entscheidung respektierten oder mich im Gegenteil dafür hassten, dass ich ihr Angebot abgelehnt und ihren Nachmittag verschwendet hatte. Ich bezahlte sie für den Bootsausflug. Und ich gab ihnen die zweihundert Pfund.
Zurück in meinem feinen Touristenhotel, ging ich in den Speisesaal, auf der Suche nach einem stillen Plätzchen, an dem es hell genug war, um meinen Kavafis zu lesen. Zwischen den anderen Gästen entdeckte ich die beiden britischen Frauen, die ich auf der großen Feluke gesehen hatte. Sie waren inzwischen vollkommen betrunken, offensichtlich hatten sie nach ihrer Rückkehr einfach weitergemacht. Ich hörte, wie die eine von Banana Island sprach und dabei laut auflachte. »So bin ich schon seit Jahren nicht mehr gefickt worden«, sagte sie kichernd. Dann brachen sie beide in Gelächter aus.
Doch ich wusste ja schon, dass es nicht nur die alten, fetten, weißen schwulen Männer waren, die auf dem Nil ihren Hobbies nachgingen.
William
HEIDNISCHE RITEN
Damaskus, Syrien
Die syrischen Grenzbeamten wollten mir nicht erklären, warum ich festgehalten wurde. Der Polizist zeigte auf eine Bank: »Hinsetzen.«
Natürlich war es ihnen egal, ob William es inzwischen aufgegeben hatte, auf mich zu warten. Falls ja, war ich verloren. Mein letzter Kontakt zu ihm war eine Mail gewesen, vor über einem Monat. Seither hatte es keine Möglichkeit gegeben, ihn in der Wüste zu erreichen. Er war in der Nähe von Maalula mit archäologischen Ausgrabungen beschäftigt.
Wir waren hier in Damaskus verabredet – in Williams Worten: »wie unter Beduinen«. Man macht Monate im Voraus eine Zeit und einen Treffpunkt aus und erscheint dann, verabredungsgemäß. Keine Handys, keine E-Mails, keine Terminbestätigung. Während ich wartete, amüsierte ich mich im Stillen damit, Worte zu erfinden: Wartelange, Grenzdummizei.
Plötzlich stand ein kleines Mädchen vor mir, die Haare zu einem Zopf geflochten. Sie glotzte mich an, ziemlich unverschämt, richtete ihre Kamera auf mich und machte – Blitz – ein Foto von mir. Sofort sprang der Polizeichef auf und schrie etwas auf Arabisch. Offenbar wollte er wissen, wer da fotografiert hatte. Wir schauten alle zu Boden. Heimlich streckte ich dem Mädchen, das sich schnell wieder zwischen ihre Eltern geflüchtet hatte, die Zunge heraus. Ihr Gesicht war vor Scham rot angelaufen. Der Beamte schnaubte wütend und machte sich wieder an den Papierkram, nicht ohne uns vorher mit einem hasserfüllten Blick zu bedenken.
Ein Polizist, vielleicht derselbe wie zuvor – sie trugen alle den gleichen Schnurrbart – kam zu mir herüber, um mir mit militärischer Gründlichkeit Fragen ins Gesicht zu bellen.
Wie lange wollen Sie in Syrien bleiben? Wie viel Geld haben Sie bei sich? Wo werden Sie wohnen?
Nach jeder Frage verschwand er in einem unheilvoll aussehenden Flur, von dessen Wänden die Ölfarbe blätterte. Eine Zeit lang konnte man noch seine hallenden Schritte hören, dann das kalte Scheppern einer zufallenden Metalltür.
Was ist Ihr Beruf?
Nach jeder meiner Antworten zog man sich bis zu zehn Minuten zur Beratung zurück. Und jedes Mal sah ich, wie mein Reisepass anschließend zurück zum Schalter des Zollbeamten gebracht wurde. Diskussionen auf Arabisch folgten. Vielleicht unterhielten sie sich auch über Sport oder ihre Schwiegereltern. Wieder und wieder machte mein Pass die Runde vom Zoll zur Polizei und zurück.
Wo ist Ihre Frau? Sind sie hier im Urlaub?
Ich hatte inzwischen genug Erfahrung mit Bürokratie, von den mürrischen Zollbeamten Ihrer Majestät in Heathrow bis zu der barfüßigen, kaugummikauenden Grenzbeamtin, die in Simbabwe meinen Pass gestempelt hatte (und währenddessen übers Handy fröhlich mit einer Freundin tratschte), um zu wissen, dass es in solchen Situationen darauf ankam, geduldig und nach außen hin ruhig zu bleiben.
Dann bemerkte ich, dass mein Pass bei seiner letzten Runde auf dem Schreibtisch des Zollbeamten liegen geblieben war. Mein Polizist hatte ihn nicht wieder an sich genommen. Anstatt mir weitere Fragen zu stellen, lief er wortlos an mir vorbei, ließ sich in seinen Stuhl fallen und fing an, Formulare auszufüllen.
Das Gepäckband stoppte. Die letzten Passagiere standen ungläubig in der plötzlichen Stille und hofften, dass es wieder anspringen würde – was es natürlich nicht tat. Sie tauschten besorgte Blicke aus, seufzten resigniert und gingen zögernd hinüber zum Schalter ihrer Fluggesellschaft, um das verlorene Gepäck zu melden. Er war natürlich geschlossen. Es gab keine weiteren Flüge an diesem Tag. Nach und nach erloschen die Lichter, und von irgendwoher war das Rasseln eines großen Schlüsselbundes zu hören.
Ich wartete demütig. Nach ein paar Minuten riskierte ich einen Blick auf meinen Polizisten, der noch immer mit gesenktem Kopf über seinen Formularen saß. Mehr als eine Stunde war vergangen, seit ich meinen Pass zum ersten Mal vorgezeigt hatte. Inzwischen war es kurz vor elf Uhr abends – der letzte Bus nach Damaskus würde, wenn William mich richtig informiert hatte, bald abgefahren sein. Ich konnte wirklich nicht länger warten. Ich lief zum Tresen der Zollbeamten und verlangte meinen Ausweis.
Der Beamte lächelte und sagte ohne das geringste Zögern: »Gut, gut – Südafrika.« Er händigte mir meinen Pass aus, der bereits gestempelt war.
Verblüfft, doch dankbar rannte ich in Richtung Ausgang. Auf dem Weg durch die Absperrungen war ich ziemlich beunruhigt. Zwei Minuten vor elf.
War William noch da? War er überhaupt gekommen?
Wir hatten uns in Kapstadt kennengelernt und waren seither per Mail in Kontakt geblieben, doch eigentlich kannten wir uns kaum. Viele E-Mails, aber nur zwei kurze Begegnungen – die erste in einer Lederbar, und eine Woche später hatte er mich dann in meinem Apartment besucht, für eine schnelle Nummer. Das war die bisherige Ausbeute unserer Romanze.
Hektisch suchte ich die Hinweisschilder nach Piktogrammen von Bussen ab, als ich Williams amerikanischen Akzent hörte: »Hey, Dude!«
Wie versprochen stand er da und strahlte mich an. Ich umarmte ihn wie einen verloren geglaubten Seelenverwandten.
»Ich dachte schon, du hättest aufgegeben und wärst ohne mich gefahren. Wusstest du, dass der Flug Verspätung hatte? Und dann hat mich die Polizei aufgehalten, dem Zoll war ich egal. Haben wir den Bus verpasst?«
»Ich weiß, es ist immer das Gleiche.« William sprach ein wenig gedehnt. »Willkommen in Damaskus. Das ist normal hier, mach dir keine Gedanken.« Ich war erleichtert und freute mich, dass er auf mich vertraut und mich nicht im Stich gelassen hatte.
»Aber warum haben die sich ausgerechnet mich ausgeguckt? Ich hab da mindestens eine Stunde gesessen!«
»Schieb es einfach auf die syrische Inkompetenz. Das lernst du noch. Als das Team ankam, sind wir auch festgehalten worden, weil der Beamte die Passbilder an die Visa getackert hatte, ohne darauf zu achten, welche davon eigentlich zusammengehörten – zehn Fotos, zehn Formulare, fertig. Das Schlimme ist, dass unsere Namen deutlich lesbar auf den Rückseiten der Passbilder standen. Mit kulturellen Unterschieden kann man eben nicht alles erklären – manche Leute sind einfach nur dämlich«, lachte er. »Du bist also gekommen! Ich war mir nicht sicher, ob du mich erkennen würdest, ich habe ein echt schlimmes Auge. Siehst du?« Er zeigte auf sein rechtes Auge. Es war gerötet und sah ziemlich geschwollen aus. »Ich muss dir so viel erzählen, aber schnell, wir müssen den Bus erwischen. Der kostet nur fünfzehn Lira, anders als das Taxi, das ist fünfzehnmal so teuer.«
William nahm sich eine meiner Taschen, und wir rannten zur Haltestelle.
Der Bus war noch da. Es gab nur wenige Sitzplätze im vorderen Teil des Busses, die alle schon besetzt waren. William sprach mit dem Fahrer, auf Arabisch.
»Als ich eben hergefahren bin, waren es nur fünfzehn Lira, jetzt sind es plötzlich zwanzig. Was soll’s, es sind ja nur fünfzig Cent.«
»Ich hab kein syrisches … «, begann ich zu sagen, doch William schob mich nach hinten, ans Ende des Busses und küsste dabei meinen Nacken, dann meine Wangen und dann meinen Mund. Er biss mich, ganz sanft. Ich war überrascht und auch ein wenig erschrocken. Schließlich waren wir hier mitten im Nahen Osten.
»Keine Sorge. Wir sind Brüder. Wir sind Fremde.« Er schob sich näher an mich heran, drückte seinen Schoß gegen meinen Schenkel. »Wir haben uns seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wir sind alte Freunde, wir dachten, wir würden uns nie wiedersehen … «
Ich musste lachen. Keiner der wenigen Fahrgäste im Bus beachtete uns. Mir fiel auf, dass die Frauen unverschleiert waren.
»Entspann dich.« Er küsste mich noch einmal und umarmte mich. Ich fühlte mich leicht, gerettet und gut aufgehoben. Genau wie die anderen Passagiere war ich bereit zu glauben, dass wir alte Freunde waren, die sich lange nicht gesehen hatten, Kindergartenkumpel, entfernte Verwandte. Es fühlte sich an, als gäbe es unsere vollkommen fiktive gemeinsame Vergangenheit tatsächlich.
»Hier ist das nichts Ungewöhnliches, dass sich Männer in der Öffentlichkeit küssen. Man sieht das ständig.« William grinste schelmisch. »Und ich glaube, dass die Kerle sich auch gegenseitig ficken. Für eine Ehefrau müssen sie eine Brautgabe zahlen und viele können sich das nicht leisten, bevor sie Ende dreißig sind. Irgendwie und irgendwo müssen sie sich ihre Hörner abstoßen. Sex mit Frauen kommt nicht infrage, es sei denn, man geht ins Bordell.«
Die Libido ist wie jedes andere Verlangen: Es wird umso stärker, je mehr Sex man hat, und wenn man es nicht ausleben kann, wird es irgendwann unangenehm. Aber was, wenn man sich gar nicht erst damit abgab? Würde das sexuelle Verlangen dann einfach verschwinden? Vielleicht war Sex für muslimische Männer, nach einem Leben voller Enthaltsamkeit, gar kein Thema mehr. Ich dachte an die Fernsehbilder von arabischen Milizen, die ihre Kalaschnikows in den Himmel reckten und mit religiöser Inbrunst ihre sexuelle Energie in den Himmel schossen.
»Und wie stoßen sich denn Archäologen die Hörner ab?« Ich grinste ihn an.
»Beim Graben!«, lachte William. Dann fügte er schelmisch hinzu: »Das zeig ich dir später.«
William war Amerikaner jüdischer Abstammung. In Syrien war er im Auftrag einer polnischen Universität, und seinem Visum zufolge war er Angehöriger der anglikanischen Kirche. Atheist wäre die einzig richtige Angabe gewesen, aber das wurde in Syrien nicht besonders gern gesehen – noch weniger gern als eine jüdische Abstammung. Glücklicherweise hatte er einen relativ dunklen Teint und dichtes schwarzes Haar, sodass er oft auf Arabisch angesprochen wurde.
Auf der Straße war kaum Verkehr. Aus Sicherheitsgründen, wie William mich aufklärte, lag der Flughafen mehr als dreißig Kilometer außerhalb der Stadt. Doch der Bus kam erstaunlich gut voran – obwohl es ruckelte, als führe er auf quadratischen Reifen.
An der Innenstadt von Damaskus war vor allem eins auffällig: überall Neon. Am Platz der Märtyrer war man besonders großzügig gewesen, wenn auch nicht besonders einfallsreich: Überall leuchteten arabische Buchstaben in grellem Orange und Rot. Auf den Straßen waren extrem viele Polizisten zu sehen. Und die Landesflagge, mit ihren zwei Sternen und den drei Streifen, sah aus wie ein Orden auf einer Uniform.
Es war das Jahr 2001, zehn Jahre bevor der Bürgerkrieg das Land und seine Bürger in Stücke reißen sollte. In diesem Konflikt werden Homosexuelle als Ziele betrachtet, die es zu töten gilt. So geschah es auch im Irak nach der amerikanischen Invasion, wo ungestraft Dutzende zu Tode gefoltert wurden – auf eine Art und Weise, die ich mich hier nicht zu beschreiben traue.
Das Hotel in Damaskus war eine erbärmliche Absteige: ein riesiges, dreistöckiges Haus, das zwar vor Kurzem renoviert worden war, aber immer noch vor sich hin bröckelte und über sagenhaft schlechte Betten verfügte. Es war, als ob sich alles gefährlich in Richtung Treppenhaus neigte, das sich wie ein großer Strudel im Zentrum des Gebäudes emporschraubte. Auf gute Umgangsformen schien man keinen großen Wert zu legen – um ins Gebäude zu gelangen, mussten wir über Horden ungewaschener Rucksacktouristen steigen. Sie waren offenbar nicht bereit gewesen, für ihre Übernachtung viel Geld auszugeben, und belegten mit ihren Schlafsäcken jeden Quadratzentimeter der Veranda. Nicht der beste Ort für William und mich, um miteinander intim zu werden. Das europäische Fünfsternehotel auf der gegenüberliegenden Straßenseite berechnete zweihundert Dollar für ein Zimmer und hatte trotzdem nur Hockklosetts.
»Das ganze Grabungsteam ist krank. Keine Ahnung, warum. Das Wasser, Keime, was weiß ich.« Williams Auge sah gar nicht gut aus. »Ich hoffe, es ist keine Bindehautentzündung oder sonst etwas Ansteckendes. Hoffentlich verdirbt es uns nicht den Spaß.«
Ich bestand darauf, dass jeder ausschließlich auf seinem eigenen Kissen schlief und schärfte William ein, dass er sich nicht ans Auge fassen und dann mich berühren sollte.
Das war das allererste Mal, dass ich mit einem fremden Begleiter reiste. Doch William verfügte über all die wichtigen Eigenschaften, die einen guten Reisebegleiter ausmachen: Er war rücksichtsvoll, gewissenhaft, wortgewandt, humorvoll und, am wichtigsten, neugierig, sogar kühn. Im Lauf der nächsten Woche lernten wir uns immer besser kennen und waren uns bald vertraut wie ein altes Ehepaar.
Gleich am allerersten Tag legte ich mein Schicksal in seine Hände. Es gibt auf der ganzen Welt nichts, inklusive Kairo, das sich mit der schrecklichen Hölle des syrischen Verkehrs vergleichen lässt. Es scheint keine Regeln zu geben, und die Fahrer sind genauso wenig verkehrstüchtig wie ihre Vehikel. Man wählt sein Ziel und überlässt alles Weitere Allah.
Den Großteil des ersten Tages verbrachten wir eingezwängt in unseren kleinen Peugeot, mit dem wir über das flache Land fuhren. Es war eine lange Fahrt nach Aleppo, das ungefähr neunzig Kilometer vom antiken Antiochia und vierzig Kilometer von der türkischen Grenze im Norden des Landes liegt. Wir mussten einige Umwege machen, weil wir nie mit Sicherheit sagen konnten, auf welcher Straße wir uns gerade befanden. Offenbar hatten sich ein paar Stalinisten aus Sicherheitsgründen Syriens Straßenkarten vorgenommen und dabei ihrer Fantasie freien Lauf gelassen, um den kapitalistischen Feind in die Irre zu führen. Vergeblich suchten wir nach verzeichneten Autobahnen – und fanden dafür eine Menge Straßen, von denen unsere Karte nichts wissen wollte. Das Navigieren war meine Aufgabe, und ich hatte keine Anhaltspunkte außer die offensichtlich fiktive Karte. Auf der nicht verzeichneten Autobahn, auf der wir dann irgendwann landeten, kam uns in regelmäßigen Abständen Gegenverkehr entgegen, den man erst sehen konnte, wenn man schon fast mit ihm zusammengestoßen war. Manchmal verschwand die ganze Straße auch plötzlich im Nichts. Wenn man Glück hatte, ging es kurz darauf auf frischem, klebrigem Teer weiter. Ein Straßenschild, das am Ortseingang jeden Dorfes aufgestellt war, warnte: LANGSAM FAHREN! AUF ANWOHNER ACHTEN! Allerdings schienen wir die Einzigen zu sein, die sich daran hielten.
William nahm das alles gelassen. Er war froh, am Steuer zu sitzen. »Wir haben Zeit«, sagte er. »Und immerhin, diese Straße gibt es. Das sieht etwas weiter draußen schon ganz anders aus.«
Während wir mit Sonnenbrillen im Gesicht und dem Spiegelbild unserer stalinistischen Landkarte in der Windschutzscheibe durch die Wüste fuhren, entspannte ich mich ein bisschen – bis mir einfiel, dass wir keinen Ersatzreifen dabei hatten und bei einem Unfall in dieser Einöde stranden würden.
Irgendwann erreichten wir dann Aleppo und bezogen ein Zimmer im ›Al Gedeideh‹, dem angeblich saubersten Budget-Hotel in ganz Syrien. Alles war pastellgrün gestrichen: Die Wände, die Decke, der Ventilator, das Bett, die Stühle, sogar das Papierknäuel, das in einem der Lüftungsrohre steckte. Die Zimmer waren sorgfältig gereinigt worden. Es gab reichlich heißes Wasser und eine richtige Toilette. Leider ließ das Dekor beim besten Willen keine romantische Stimmung aufkommen – Vorhänge, Lampenschirme, Kissen und Bettdecken waren mit dem gleichen kitschigen Muster geschmückt, das sicherlich von einem Designer mit Rot-Grün-Blindheit entworfen worden war. Außerdem hatten wir erfahren, dass der Eigentümer unangekündigte Zimmerkontrollen machte, bei denen er ohne zu klopfen ins Zimmer gestürmt kam. Wer schlampte und seine Zahnpastatube unverschlossen herumliegen ließ, wurde kurzerhand zwangsgeräumt; alle zurückgelassenen Gegenstände, ob Socken, ein Rasierer oder eine Zahnbürste, wurden vernichtet.
Aleppo liegt genau zwischen Mittelmeer und Euphrat und hat eine buntgemischte Bevölkerung – hauptsächlich sunnitische Moslems, aber auch Kurden, russisch-orthodoxe Kaufleute, christliche Armenier, die aus Anatolien geflohen waren, und sogar ein paar jüdische Familien. Wenn man durch die Straßen lief, war die Vielfalt offensichtlich. Man konnte rothaarige Syrer und blonde Ukrainer sehen, unverhüllte Christinnen neben muslimischen Frauen mit Gesichtsschleier. Aber was man am häufigsten sah, waren Männer: Männer, die sich entspannten, Männer, die auf dem Weg irgendwohin waren, Männer bei der Arbeit. In einer westlichen Schwulenkneipe trifft man mehr Frauen als in einem gewöhnlichen syrischen Straßencafé. Die Männer saßen beieinander, um Shishas zu rauchen und um Backgammon oder Domino zu spielen. Manchmal saßen sie auch einfach nur da und hielten sich an den Händen – ein verführerischer Anblick vor der alten Stadtkulisse. Diese heterosexuellen Männer gingen erstaunlich ungezwungen miteinander um und fanden es anscheinend ganz selbstverständlich, dass Freundschaft auch körperliche Nähe mit einschloss. Ältere Männer berührten sich liebevoll, ohne Anzeichen von Scham, Furcht oder Sorge.
Ich vermutete, dass Männer in dieser Kultur ihre engsten emotionalen Bande zu anderen Männern knüpften. In ihren Beziehungen zu Frauen ging es vor allem um Ehre, Fortpflanzung und Familie.
Obwohl sich, während wir durch die Stadt streiften, überall um uns herum arabische Männer an den Händen hielten, trauten William und ich uns nicht, es ihnen gleichzutun.
Es war später Nachmittag, und William stand der Sinn nach einem Schwamm und Aleppos berühmter handgeschöpfter Seife aus Oliven und Lorbeer. Wir gingen in ein Hamam.
»Das ist die einzige Möglichkeit, in Syrien sauber zu werden«, sagte William, mit einem schelmischen Unterton. Er hob vielsagend eine Augenbraue.
Das Hamam war eine berühmte Touristenattraktion gewesen, doch in diesem schicksalshaften Jahr, in dem die USA Beweise für Massenvernichtungswaffen gefunden haben wollten und daraufhin ihre Bomben auf den Nahen Osten regnen ließen, waren wir ganz unter uns, und die Angestellten achteten merklich auf Abstand.
Männer haben sich schon immer gemeinsam im Hamam erholt. Im Gegensatz zu Budapest oder Finnland verlangt die Etikette in syrischen Thermalbädern jedoch, dass die Genitalien durchgehend bedeckt bleiben.
Nach der brütenden Hitze in der Sauna zogen wir uns in eine der kleinen Nischen zurück, die um das achteckige Zentrum angeordnet waren und die alle über ihren eigenen Brunnen verfügten.
Wir seiften uns gegenseitig mit Olivenseife ein, bis wir dicht mit Schaum bedeckt waren. Ich drehte mich auf den Bauch und legte mich auf den glatten, harten, uralten Marmorboden, während William mit der Luffa jeden Nerv auf meinen Fußsohlen, zwischen den Arschbacken und meinen Fingern kitzelte. Ich fühlte mich auf verletzliche Weise sauber, wie die Haut eines Albinos, die vom Sonnenlicht geküsst wird. Meine Kontaktlinsen benutzten die Gelegenheit, um davonzuschwimmen, aber das kümmerte mich jetzt nicht, so angenehm erschöpft fühlte ich mich durch die Hitze und das gegenseitige Massieren.
Als wir schließlich fertig waren, zog mir der Aufseher plötzlich und ohne Vorwarnung das Handtuch weg. Ich war peinlich berührt, aber auch ein bisschen stolz auf meinen abschwellenden Schwanz. Der Aufseher verzog keine Miene (als ob er es nicht gesehen hätte) und bedeckte meine Blöße mit einem leichten, gestärkten Tuch aus Perkal; ein zweites wickelte er mir um den Kopf. Ich dachte, ich sähe aus wie Lawrence von Arabien, aber William meinte, ich gliche eher Gloria Swanson.
Mit immer noch klopfenden Herzen setzten wir uns wieder auf unsere Bänke, thronten wie die Könige auf mit Quasten verzierten Kissen und tranken Minztee. Wir waren wieder allein.
William, den Vollblutarchäologen, interessierte natürlich die Geschichte dieses Hamams. Seine flackernden, langen Wimpern flimmerten durch die Luft wie eine archäologische Bürste, während er seinen Blick über die beschrifteten Metallschüsseln und die hölzernen arabischen Kommoden gleiten ließ. Leider konnte ich ohne meine Kontaktlinsen kaum etwas erkennen.
Als wir gerade gehen wollten, betraten drei Frauen vorsichtig den Raum, um dieses Heiligtum der Männlichkeit zu besichtigen. Sie machten zögernd ein paar Schritte vorwärts, zeigten auf verschiedene Details der Architektur und unterhielten sich mit gedämpfter Stimme, während es mir, einem Fremden aus einem fernen Land, erlaubt war, mich hier nackt wie zu Hause zu fühlen. William erklärte mir, dass Frauen den Hamam für besondere Anlässe mieten konnten. Dann allerdings hatten ausschließlich Frauen Zutritt.
Wir hatten jedes Zeitgefühl verloren. Der Suq würde schon um zwanzig Uhr zumachen, also beschlossen wir, den Besuch auf den nächsten Tag zu verschieben.
Der Al-Madina Suq ist einer der schönsten, den ich kenne – und mit einer Länge von über dreizehn Kilometern sicherlich der größte, ein imposantes Bauwerk und eindrucksvoller Beleg der historischen Bedeutung von Aleppo als Handelsstadt. Überwölbt von spektakulären, hohen Steinbögen, die aus dem vierzehnten Jahrhundert stammen, haben sich die Markthallen bis heute viel von ihrer Ursprünglichkeit bewahrt.
Bewaffnet mit ausreichend Kleingeld, waren wir bereit, uns einen Weg durch die gepflasterten Gänge zu bahnen – was nicht immer leicht war, denn es wimmelte im Suq nicht nur von Menschen, sondern auch von Eseln, Schubkarren und ganzen Wagenladungen stinkenden Schlachtguts, die viel zu dicht an uns vorbeigeschoben wurden (alle Treppen hatten in der Mitte schmale Steinrampen, um den Warentransport zu erleichtern). Man musste schon gut aufpassen, wenn man nicht unter einem der Lastkarren begraben werden wollte, die in wildem Zickzack durch die Gänge kreuzten. Völlig überladen mit vorstehenden Holzplanken und Eisenstangen schienen sie es geradezu darauf abgesehen zu haben, unsere wehrlosen Körper zu durchbohren.
Auf die Qualität oder zumindest die Echtheit der angebotenen Waren war indes Verlass. Die Preise boten zwar viel Spielraum für Verhandlungen, doch im Vergleich zu den Suqs in Marrakesch oder Fès waren die Händler sehr zurückhaltend.
»Huldigung!« Die Stimme des Mannes war für sein Alter entschieden zu hoch. Ich schätzte ihn auf Mitte zwanzig, aber von William wusste ich, dass man in Syrien immer fünf bis sieben Jahre abziehen musste, wegen der harten Lebensumstände. Doch auch mit achtzehn sollte man eigentlich aus dem Stimmbruch raus sein. Ich war verwirrt.
»Huldigung!«, wiederholte er – und klang immer noch wie ein Kastrat.
»Soll das heißen: Entschuldigung?«
Sofort gab er zurück: »Und wo ist da der Unterschied?«
»Naja, Entschuldigung, das bedeutet Entschuldigung. Und eine Huldigung« – ich deutete eine Verbeugung an – »ist das hier.«
Er sah mich mit großen Augen an, als wäre sein lang gehegter Traum, diesen wichtigen Unterschied zu verstehen, nun endlich in Erfüllung gegangen. Doch dann sagte er, und seine Stimme klang plötzlich heiser und rau: »Ich wette, Oscar Wilde hat sich nie entschuldigt.«
Er hatte mich auf dem vollkommen falschen Fuß erwischt. Nichts gegen literarische Anspielungen, aber ich hatte mich noch nie so bloßgestellt gefühlt. William, der unterdessen weitergeschlendert war, hatte von dem kleinen Intermezzo nichts mitbekommen. Ich beeilte mich, ihn einzuholen.
Etwas tiefer im Inneren des Suqs zeigte sich dann, dass ich mir umsonst Sorgen gemacht hatte. Oscar Wilde war eben einfach ein viel gelesener Autor und half auch Jahrhunderte nach seinem Tod noch dabei, die Menschen einander näherzubringen. Ein blonder Mann, der gravierte Silberschalen verkaufte, rief uns mit einschmeichelnder Stimme zu: »Wie schon Oscar Wilde gesagt hat – man soll sich nie verleugnen!«
»Das hat er in der Tat gesagt. Aber das war in Paris«, antwortete ich und wollte mich schon über meine Schlagfertigkeit freuen.
»Interessante Entdeckungen kann man auch hier bei mir machen!«, sagte der Mann und zwinkerte uns zu. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er von seinen Silberschalen sprach.
»Vielen Dank, wir kommen zurecht«, antwortete ich und versuchte, möglichst unverbindlich zu klingen.
»Schaut euch nur alles in Ruhe an. Aber ihr werdet schon sehen, irgendwann klopft ihr wieder an meine Tür. Ich werde geduldig warten.« Dafür, dass er nicht besonders einladend aussah, bewies der Mann einiges Selbstbewusstsein. Seine Nase war mit Pickeln übersät, die aussahen, als könnten sie jederzeit platzen.
»Ich habe eine Warteliste!«, rief er uns hinterher, als wir unsere Schritte beschleunigten.
Da waren wir nun in einem Land, in dem die Hälfte der Bevölkerung der Meinung war, dass man Homosexuelle steinigen musste, und trotzdem konnten wir uns vor ungebetenen Avancen kaum retten.
»Wir werden von einem Haufen Tucken verfolgt«, sagte ich zu William.
Er kicherte und blieb stehen, um sich ein paar Holztafeldrucke anzusehen. Offenbar betrieben die beiden jungen Männer, die uns aufmerksam betrachteten, den Stand gemeinsam.
»Wie lange werden du und dein zukünftiger Ex-Freund denn in der Stadt bleiben?«, fragte der eine.
»Bevor du antwortest – wir sollten unbedingt über unsere gemeinsame Zukunft reden«, fügte der zweite hinzu.
»Ich glaube nicht, dass unsere gemeinsame Zukunft besonders lange währen wird«, antwortete ich.
»Falsch – denn ich sehe Jahre des Glücks voraus, für dich und deinen syrischen Mann – oh Verzeihung, ich meine natürlich, deine syrische Frau.«
Wollte er uns aushorchen? Was sollten denn die plumpen Versprecher?
»Mann und Frau, Frau und Mann«, fing er von Neuem an, in einem merkwürdigen Singsang, während der andere sich meinen Arm griff.
»Nun zier dich nicht so – du bist doch kein kleines Mädchen mehr. Also, woher kommst du denn eigentlich? Australien?«
»Nein, Südafrika«, sagte ich triumphierend.
»Ah! Viele Schwule in Kapstadt, nicht?«
»Moment mal, wie war das eben? Hast du mich eben Mädchen genannt?«
Diesmal wandte er sich an seinen Freund: »Ich will den Dunklen. Der gefällt mir. Du kannst haben, was übrig ist.«
William und ich suchten so schnell wir konnten das Weite und schüttelten uns dabei vor Lachen.
»Kommt schon! Freunde! Freunde, lasst uns das Eis brechen. Wir lernen uns kennen und begraben das Kriegsbeil!«, rief er uns nach.
Kurz bevor wir um die nächste Ecke bogen, drehte ich mich noch einmal um. Sie hatten uns nachgeblickt und winkten, als sie meinen suchenden Blick sahen. Ich winkte zurück.
Wenn ich allein gewesen wäre, wäre die Geschichte an dieser Stelle bestimmt noch nicht zu Ende gewesen. Ich versuchte herauszufinden, wo sie lebten, wie sie lebten und wie sie es unter einem Regime aushielten, das mächtiger und unverwundbarer schien als Gott selbst. Überall an den Häuserwänden prangten überlebensgroße Porträts der Angehörigen des herrschenden Assad-Clans. Angetan mit Uniformen oder Pilotenjacken (der letzte Schrei in Syrien), blickten die Machthaber drohend auf ihre Untertanen herab. Doch die Jungs im Suq ließ man offenbar unbehelligt, zumindest solange sie sich darauf beschränkten, mit ein paar Ausländern Oscar Wilde-Zitate auszutauschen. Englisch schien hier sowieso niemand zu verstehen, zumindest gab man sich alle Mühe, so zu tun. Und galt dasselbe nicht auch für ihre Sexualität?
Als wir zurück im Hotel waren, lachten wir immer noch. Doch je länger ich darüber nachdachte, desto zynischer und arroganter kam mir unser Verhalten vor. Wer waren wir denn, dass wir uns über sie lustig machten? Wir hatten Geld im Überfluss, konnten uns frei im Land bewegen, und wenn es uns zu viel wurde, reisten wir einfach ab.
Ich schaltete den Fernseher ein – doch anstelle der erwarteten lief eine Propagandasendung, wie ich sie nicht erwartet hatte: eine Vorschau für eine Dokumentation über das Christentum. In schneller Folge wurden unterschiedliche Formen religiöser Ekstase gezeigt: spanische Flagellanten, die Kreuze einen Hügel hinaufschleppten, Gläubige auf den Philippinen, die sich Nägel durch die Handflächen schlagen ließen, hysterisch weinende Massen in Brasilien, die vor dem Papst auf die Knie fielen, Priester, die Ringe und Reliquien küssten, Goyas düstere Gemälde der Inquisition, evangelikale Gläubige in den USA, die Dollarnoten in Sammelbüchsen steckten, Besessene, die sich auf dem Boden krümmten, Weihwasser, Stigmata und blutende Kruzifixe. Wenn man, wie ich, den arabischen Kommentar nicht verstand, konnte man glauben, ein Musikvideo irgendwelcher Satansanbeter zu sehen. Als muslimischer Jugendlicher, der vom Christentum nur wusste, was in solchen Filmen gezeigt wurde, wäre ich wahrscheinlich nur allzu gern bereit gewesen, als Märtyrer für den Islam zu sterben – wenn es nur gelang, die Welt vor den Armeen der christlichen Fanatiker zu retten.
Als wir am selben Abend auf der Dachterrasse unseres Lieblingsrestaurants saßen, einer kleinen Oase voller saftigen Grüns, überkam mich tiefe Dankbarkeit für die Freiheiten westlicher Großstädte. Die Queens von Aleppo erinnerten mich an die jungen Männer, denen ich in abgelegenen Kleinstädten in den Vereinigten Staaten und Südafrika begegnet war, wo junge Schwule dem einzigen ästhetischen Vorbild nacheifern, das sie kennen – Frauen. Viele sind der festen Überzeugung, dass sie nur dann anziehend auf Männer wirken, wenn sie sich möglichst feminin geben. Dabei werden sie gerade dadurch, durch eine Parodie von Weiblichkeit, die aufgrund fehlender Mittel und mangelhafter Kenntnisse einfach nur camp wirkt, zum Gespött der Leute. Es ist die öffentliche Zurschaustellung einer Persona, die sich vollständig aus ziemlich bedenklichen Klischees zusammensetzt – und doch ist diese zusammengestoppelte Kunstfigur der einzige geschützte Raum, den diese Jungs haben, eine zwar verachtete, aber zugleich akzeptierte Identität, die weltweit verbreitet ist: der amerikanische Sissy, Fairy oder Flamer, der südafrikanische Moffie, der australische Pooftah, der schottische Bufftie, der kubanische Maricone, der mexikanische Chulo, der brasilianische Bicha, der thailändische Kathoey, der ägytische und syrische Khawal.
Ich ließ meinen Blick über die Gäste des Restaurants schweifen, ausnahmslos Männer, und fragte mich, wie viele von ihnen wohl schwul waren. Sie konnten Hand in Hand durch die Straßen laufen und genossen damit eine Freiheit, die ihnen in bestimmten Städten des Mittleren Westens verwehrt worden wäre. Doch andererseits gab es hier keinerlei Hoffnung auf ein Zusammenleben als Paar.
Ich habe vergessen, welcher genau es war und was er im Suq gesagt hatte. Doch irgendwann fiel mir auf, dass einer der Jungs aus dem Suq hier im Restaurant saß, an einem Tisch am anderen Ende der Terrasse. Als er bemerkte, dass ich ihn entdeckt hatte, stand er auf und kam zu uns. Wir begrüßten ihn mit dem informellen Marhaba. Gut gekleidet und im schmeichelnden Abendlicht, machte er einen deutlich attraktiveren Eindruck als vorhin auf dem Markt.
»Seid ihr beide allein hier?«, fragte er höflich.
»Ich fürchte, wir reisen morgen weiter.«
»Ah, zu schade«, seufzte er.
Dann spürte ich, wie er mit der Schuhspitze sanft, aber vielsagend auf meinen Fuß tippte.
»Ich habe in Rom gelebt, wisst ihr? Ich hatte jahrelang einen italienischen Liebhaber.«
»Rom ist wunderschön, eine meiner Lieblingsstädte«, sagte ich.
Er spielte weiter heimlich mit meinem Fuß, während er ein bisschen Small Talk mit William machte, der Syrien so viel besser kannte als ich. Als unser Essen serviert wurde, entschuldigte er sich und ging zurück zu seinen Freunden, die bereits ohne ihn angefangen hatten. Sobald er sich gesetzt hatte, steckten sie die Köpfe zusammen, und immer mal ließ einer seinen Blick zu der Ecke wandern, in der wir saßen.
Man hatte mir einen Aleppo Kebab gebracht. Offenbar war ganz egal, was ich bestellte – ich bekam nie etwas anderes als Aleppo Kebab. Dieses Mal hatte ich das einzige Gericht bestellt, von dem ich annahm, dass man es unmöglich mit Kebab verwechselt konnte – Couscous. Ich hatte sogar an der Theke darauf gezeigt. Aber ich bekam wieder das gleiche vertrocknete Dörrfleisch wie an den Abenden zuvor.
Ich schaute hoch und lächelte den syrischen Jungs an ihrem Tisch höflich zu. Sie strahlten zurück. Wie überall auf der Welt (übrigens: auch im Iran), gab es in Syrien eine Subkultur voller Freundschaften, Intrigen und Liebeleien. Die menschliche Natur kann man vielleicht verfolgen, aber nicht unterdrücken.
Eine Woche später konnten William und ich in einem Park in Damaskus syrischen Männern beim Cruisen zusehen. Jeder saß auf seiner Bank und beäugte die anderen, wie streunende Katzen. Ein rundgesichtiger, ewig lächelnder Junge mit einem lahmen Bein und riesigen, umherflackernden Augen verkaufte Tee. Er machte den Eindruck, als sei er geistig nicht ganz auf der Höhe. Ständig vergaß er, wo er seine Flaschen und die Tabletts mit dem Tee abgestellt hatte. Sein Arbeitgeber, von dem ich hoffte, dass es nicht sein Vater war, tauchte immer mal wieder auf, um ihm ungeduldig Beine zu machen – wie einem störrischen Esel, der sich weigerte, das Feld zu pflügen. Der Junge hatte offensichtlich keine Ahnung, was die Männer um ihn herum im Sinn hatten. Auf der Suche nach leeren Tassen und Flaschen eilte er die Wege entlang, wobei er sein lahmes Bein nachzog, und servierte Tee mit zerstoßenen Minzblättern, den er in einem Kessel auf einem kleinen Gasherd aufkochte. Mit einem Glas Tee in der Hand hatten die Männer eine Entschuldigung, warum sie hier herumsaßen, sich zuweilen zueinandersetzten und leise ein paar Worte miteinander wechselten.