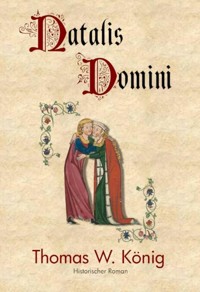Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Anno 1800. Vieles im Dorf Morle hat sich verändert. Feuersbrünste und blutige Kriege haben seine Einwohner geprägt, und selbst der Name des Dorfes durchlief in den 650 Jahren, die seit den Tagen des jungen Konrad aus der Erzählung Natalis Domini vergangen sind, eine Metamorphose. Aus Morle wurde Mörlen. Der Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert konfrontiert nicht nur Familie Mathes aus Ober-Mörlen mit drama-tischen Umbrüchen. Nach der Annexion der linksrheinischen Gebiete durch Frankreich und der Auflösung von Kurmainz, wird das Dorf dem Machtbereich des hessischen Landgrafen Ludwig X. zugeschlagen. Was sich zunächst nicht wie eine große Veränderung anfühlt, wird bald zu einem Problem. Zum einen macht sich ein Unteroffizier des Landgrafen in der Dorfbevölkerung unbeliebt und schikaniert die Menschen. Doch dann muss Hessen auch noch dem Rheinbund beitreten und die jährlichen Abgaben werden immer erdrückender. Napoleons Kriegsmaschinerie braucht das Geld zur Finanzierung der Kriege. Die Machtgier des französischen Kaisers verändert nicht nur Europa, sondern wirkt bis hinein in das Dorf an der Usa. Franz Johann Mathes, seine Frau Katharina und die gesamte Familie werden vor ungeahnte Schwierigkeiten gestellt. Bald wachsen sich diese zu Herausforderungen aus, die sich nicht ohne persönliche Opfer bewältigen lassen. Dieses Schicksal zu ertragen, bringt Franz und Katharina an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Was erwartet wohl die Familie in dieser Franzosenzeit und wie geht es für sie weiter hinter dem Horizont Der Zeiten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas W. König
Horizont der Zeiten
Taschenbuch Erstausgabe
13. Oktober 2024
KV04
Impressum
Texte: © 2024 Copyright by Thomas W. König
Umschlag: Umschlag: Ausschnitt aus dem gemeinfreien Gemälde »Schlacht von Valmy« (Horace Vernett, † 1863)
Seite 5: Napoleon Bonaparte (KI-generitertes Porträt von Thomas W. König)
Verantwortlich
für den Inhalt: Thomas W. König
Am Heiligenstock 5
61231 Bad Nauheim
Druck: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Thomas W. König
Horizont
Der
Zeiten
Historischer Roman
Band I
Franzosenzeit
1799 - 1813
Napoleon Bonaparte
»Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse,
aber nicht für jedermanns Gier«
Mahatma Gandhi
Vorwort
Haben Sie schon den Roman Natalis Domini gelesen? Dann kennen Sie zumindest bereits den Ort der Handlung. Das Dorf Morle, in dem der Küfersohn Konrad im 12. Jahrhundert lebte, hat sich im Laufe von rund 650 Jahren gewandelt. Selbst sein Name ist ein anderer geworden. Aus Morle wurde bis zum 19. Jahrhundert Mörlen.
Doch ist dieser Roman keine Fortsetzung der Natalis Domini Erzählung, auch wenn der aufmerksame Leser einige Schauplätze wiedererkennen wird. Zwei vernichtende Feuersbrünste und einige Kriege später haben sich die meisten Aufzeichnungen über das Ortsgeschehen des real existierenden Dorfes in der Wetterau in Asche und Rauch aufgelöst. Erst nach dem letzten großen Brand am 27. Juli 1716 begann ein völlig neuer historiografischer Abschnitt für Ober-Mörlen. So könnte man, selbst wenn man wollte, die Tage zwischen Konrad und der Familie Mathes, den Protagonisten des vorliegenden Romans, nur mit viel Fantasie und einer Menge Spekulationen rekonstruieren.
Die Handlung der Erzählung Horizont der Zeiten ist nun in einer Epoche angesiedelt, aus der gesicherte Berichte und verbriefte Namensregister vorliegen. Auch wenn der Inhalt komplett erfunden ist, so fußt der Roman dennoch auf geschichtlichen Ereignissen und verifizierbaren Tatsachen aus dem Ober-Mörlen des 19. Jahrhunderts. Sie sind in Kirchenbüchern oder amtlichen Gemeindedokumenten nachzulesen. Rund um ein stabiles Grundgerüst konnte ich so meine Geschichte ersinnen.
Dabei sind auch Personennamen wie bspw. die des Schultheißen, des Pfarrers oder des Schulvikars dem Namensregister der zugehörigen Zeit entnommen, ihre beschriebenen Charaktere und Handlungsweisen hingegen vollständig meiner Fantasie zuzuschreiben. Die Hauptpersonen tragen dagegen fiktive Namen. Dennoch orientieren diese sich an orts- und zeitüblichen Vor- und Familiennamen des Dorfes, sodass es durchaus sein kann, dass Personen gleichen Namens zur besagten Zeit in Ober-Mörlen gelebt haben. Das jedoch ist dann aber reiner Zufall.
Zu diesem Roman wurde ich durch das Paperback Valét – Adé von Hobby-Historiker Kurt Rupp inspiriert, der in dieser außerordentlich interessanten Dokumentation viele Fakten und berührende Briefe von Menschen sammelte, die ihrer Heimat im 19. Jahrhundert den Rücken kehrten und auswanderten.
Welche Ereignisse mussten sie bewegt haben, ihr Dorf zu verlassen, das bisher Heimat und einziger Lebensraum für sie war? Waren es Notlagen, unredliche Versprechungen, persönliche Schicksale oder pure Abenteuerlust? Vielleicht eine Kombination von alledem?
Die Gedanken darüber entwickelten ein Eigenleben, das ich nur durch eine neue Erzählung wieder einfangen konnte. Wenn ich bei der Recherche und dem Schreiben dieses Buches eines gelernt habe, dann ist es die Tatsache, dass sich zum Anfang des 19. Jahrhunderts die Welt in einem dramatischen Wandel befand. Das, was wir heute als typisches Zeichen unserer schnelllebigen Zeit deuten, haben Menschen in ähnlicher Form auch damals schon erfahren müssen.
Gestatten Sie mir eine letzte Anmerkung. In diesem Roman treten Menschen verschiedenster Nationalitäten auf. Sie in ihrer jeweiligen Muttersprache reden zu lassen, war mir ein wichtiges Anliegen. Leider spreche ich nicht all diese Fremdsprachen und habe mich deshalb eines KI-gestützten Übersetzers bedient. Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, der jeweiligen Sprache mächtig sein und schwerwiegende Fehler in den übersetzten Passagen finden, zögern Sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Meine E-Mail-Adresse ist ja im Impressum vermerkt.
Vielleicht werden einige auch die fremdsprachlichen Abschnitte für einen flüssigen Leseablauf hinderlich finden; diesbezügliche Rückmeldungen habe ich bereits erhalten. Dennoch möchte ich gerne an dem gewählten Stil festhalten, denn es gibt auch Stimmen, die sich an der Fremdsprache erfreuen und die Passagen spannend finden. Sollten Sie zur ersten Gruppe gehören, springen Sie bitte einfach zum deutschen Text weiter ...
Letztendlich stand für mich wieder einmal der Spaß am Schreiben im Vordergrund. Wenn Sie dasselbe nach dem Lesen des Buches auch über Ihren Lesespaß behaupten können, dann würde mich das sehr freuen ...
Bad Nauheim, im Oktober 2024
Ober-Mörlen um das Jahr 1800
Legende
Dorfanger/Kirchplatz
Hof der Familie Mathes
Kolonialwarenladen Koch
Mühle der Familie Morschel
Pfarrhaus
Röhrenbrunnen
Rathaus
Schloss
Schule
St. Remigius Kirche
Stockborn Quelle
Usafurt
Rosenbachsches Gut
Ein neues Jahrhundert
1799 - 1800
Die Ziffern Eins und Sieben hatten endlich ausgedient. Mit diesem 1. Januar brach nicht nur ein neues Jahr an, diesmal war es gleich der Beginn eines völlig ungebrauchten Jahrhunderts. Franz Johann Mathes und seine Frau Katharina Theresia begingen den Jahreswechsel in aller Stille. Sah man einmal von der Geburt ihrer beiden Söhne Karl Heinrich und Johann Remigius in den Jahren 1797 und 1799 ab, so hatte das alte Jahrhundert nichts dazu beigetragen, etwas zu schaffen, woran sie mit ihren Herzen hingen. Infolgedessen kamen in dieser Silvesternacht auch keine wehmütigen Sentimentalitäten auf, derentwegen sie dem vergangenen Jahrhundert nachtrauerten.
Selbst ihre Eheschließung vor fünf Jahren war nicht unbedingt die Liebesheirat, von der ein junges Paar träumte. Ihre Väter hatten die Ehe ausgehandelt und die beiden Kinder hatten dieser Entscheidung Folge zu leisten, basta!
Der Handel, den Josef Mathes mit seinem Dorfgenossen Heinrich Scheibel im Jahr 1794 eingefädelt hatte, war nicht zu ihrem materiellen Nachteil gewesen. Neben den üblichen Brautgaben wie einem Bettgestell, einem Strohsack und Bettzeug, bestehend aus zwei Daunendecken und drei Kopfkissen, die der Bräutigam in die Ehe mit einzubringen hatte, sowie einer Mitgift der Braut von Bettwäsche, Handtüchern, Tischdecken, Koch- und Essgeschirr, waren dabei auch achtzehn Morgen Land von guter Qualität in den Besitz der Hochzeiter übergegangen. Jede Familie hatte neun Morgen Ackerboden beigesteuert. Dazu kam die leerstehende Hofreite in der Hintergasse, wo bereits Katharinas verstorbene Großeltern gelebt hatten. Zwei Kühe, eine Muttersau mit fünf Ferkeln, drei Schafe und eine kleine Schar Gänse vervollständigten den neuen Besitz der Brautleute. Alles in allem eine grundsolide Basis für die Gründung einer Familie.
Dass Katharina eigentlich mit dem Sohn eines Handwerkers aus Ziegenberg kokettiert hatte, war für keinen der Väter ein Hinderungsgrund gewesen. »Man heiratet nicht weg vom Dorf!«, war seinerzeit Heinrichs wichtigstes Argument gegen das Techtelmechtel seiner Tochter mit dem jungen Mann aus dem Nachbardorf gewesen. Es hatte zweifelsfrei seine Vorteile, jemand aus dem Ort zu heiraten. Die Familien kannten sich seit Generationen, die Äcker des jungen Paares lagen alle in der gleichen Gemarkung und vor allem waren beide katholisch getauft; ganz im Gegensatz zu Katharinas ursprünglicher Schwärmerei. Ziegenberg war nun einmal protestantisches Gebiet und man kannte ja die Schwierigkeiten, die solch eine Mischehe mit sich brachte. Nein, Franz war die bessere Partie und so waren sich Heinrich Scheibel und Josef Mathes denn auch rasch einig geworden.
Zur Überraschung der beiden jungen Leute hatte die Zeit den Vätern sogar recht gegeben. Katharina wurde Franz eine gute Ehefrau und Franz sorgte für das Wohlergehen der Familie. Aus der ursprünglichen Zweckehe war mit den Jahren so etwas wie der Beginn einer Liebe gewachsen. Je besser sich die Brautleute kennenlernten, desto mehr wandelte sich die anfängliche Wertschätzung in Sympathie und daraus erwuchs eine gegenseitige Zuneigung. Spätestens mit der Geburt der beiden Söhne hatten sich auch ihre Herzen gefunden. Heute konnte sich keiner der beiden mehr vorstellen, einen anderen Partner zu lieben.
»Hoffen wir mal, dass sich nicht nur die Zahlen, sondern auch die Zeiten ändern werden«, meinte Franz, als er sich zur späten Stunde ins Bett begab. Auch seine Frau hatte bereits das Nachtgewand übergestreift und war dabei, sich für die Nacht vorzubereiten. Sie saß auf der Bettkante und kämmte ihr langes Haar aus. Bevor sie es zu einem Nachtzopf flechten konnte, meldete sich ihr Sohn Johann lautstark aus der Wiege zu Wort.
»So schnell ändert sich nichts, Franz!«, seufzte sie müde und nahm den Jungen aus seinem Bettchen. »Auch wenn jetzt eine achtzehn vor der Jahreszahl steht, der Hans besteht noch immer auf seiner Nachtmahlzeit.«
Als sie ihn hochhob, schlug ihr ein bestens bekannter Geruch entgegen. Die junge Frau drehte den Hintern des Säuglings zu ihrer Nase. Sie verzog sich ihr Gesicht: »Und die Windeln hat er auch schon wieder voll!«
Franz gähnte: »Sieh zu, dass der Bub rasch wieder einschläft«, und drehte sich zur Seite. Der gerade einmal sechseinhalb Wochen alte Hans war schließlich nicht seine Aufgabe.
Katharina legte eine Decke auf ihr Bett und wickelte ihren Sohn aus dem Paket von Lein- und Wolltüchern.
»Ach Bub, was haste dich wieder verschissen.«
Mit spitzen Fingern befreite sie ihn von seiner Notdurft und warf die verschmutzte Wäsche in einen blechernen Eimer. Zur Geruchseindämmung schob sie rasch einen Deckel darüber. Gleich morgen früh würde sie die Windel auswaschen.
Anschließend säuberte sie das Kind mit einem weichen Tuch, wusch es und puderte Genitalbereich und Po mit reichlich Kartoffelstärke ein. Dann legte sie dem Jungen eine neue Windel an, schlang ihn wieder in eine Wolldecke und schob ihr Nachthemd über die schweren, mit Milch gefüllten Brüste.
Hastig sog Hans die ersten Tropfen aus ihrer Brust. Doch schon nach wenigen Zügen fielen ihm wieder die Augen zu. Katharina strich ihm aufmunternd mit ihrem Finger über die Wange. Sie war sich bewusst, dass er mehr trinken musste, wenn er nicht gleich wieder von neuem zu quengeln beginnen sollte. Auch sie war schließlich müde und wollte wenigstens einige Stunden ihre Ruhe haben.
Ein Blick auf Franz zeigte, dass ihr Mann schon eingeschlafen war. Mann müsste man sein, dachte sie und motivierte Johann zu ein paar weiteren Schlückchen Milch. Ihre liebevollen Streicheleinheiten weckten den Kleinen. Mit großen Augen strahlte er seine Mutter an. Sein Lachen entschädigte Katharina für den aufgeschobenen Schlaf.
Nachdem Hans fertig getrunken hatte, legte sie ihn über ihre Schulter und wartete, bis er mit einem geräuschvollen Bäuerchen seine überschüssige Luft ausgestoßen hatte. Dann bettete sie ihn zurück in die Wiege und löschte die Kerze.
Die Frau lag noch lange wach und fand keinen Schlaf. Ein neues Jahrhundert. Was es wohl bringen wird? Das Alte hatte viel Elend und Not in seinem Gepäck. Bei der letzten Jahrhundertwende dauerte es nur wenige Jahre, bis ein verheerender Brand fast das gesamte Dorf ausgelöscht hätte. Zündelnde Kinder hatten im Sommer 1716 gar nicht weit von ihrem heutigen Wohnhaus entfernt eine Feuersbrunst entfacht. Die meisten Gebäude im Ort waren ihr damals zum Opfer gefallen. Selbst die große steinerne Kirche hatte es erwischt und sie war bis auf wenige Reste des Hauptschiffes und des unteren Teils des Turmes völlig zerstört worden. Von ihrem Großvater wusste sie, dass man vierzehn lange Jahre gebraucht hatte, um die Kirche wieder an gleicher Stelle aufzubauen. Seitdem besaß die Remigiuskirche eine andere Turmhaube. Früher stieg die KIirchturmspitze in einer vierseitigen Pyramide in die Höhe. Heute fand man dagegen eine achteckige, sich in drei Abschnitten verjüngende Haube auf dem Turm. Ganz oben zierte nun ein vergoldeter Wetterhahn die Spitze und war von überall im Dorf gut zu sehen.
Der weitere Verlauf des alten Jahrhunderts hatte ebenfalls nicht mit Nackenschlägen gegeizt. Auch im siebenjährigen Krieg wurde die Wetterau heimgesucht und ihr Dorf dabei nicht verschont. Vom Mai 1756 bis nach dem Winter 1762/63 stritten sich die Großmächte Europas, wer welche Gebiete in Übersee als Kolonie beanspruchen dürfe. Massive Handelsinteressen hatten den Krieg zu Lande und zu Wasser bis nach Amerika und Indien getragen.
Katharina verstand nicht viel von der großen Politik. Aber es interessierte sie, was um ihre Heimat herum passierte. Als der Krieg 1762 die Wetterau erreichte und eine erbitterte Schlacht am Johannisberg ausgetragen worden war, musste es ihr Dorf schlimm getroffen haben. Sie war damals noch nicht geboren und das war gut so. Es schauderte ihr bei dem Gedanken. Hoffentlich würde ihrer Familie und ihr ein solches Schicksal erspart bleiben.
Bei dem Gedanken, dass einer ihrer Söhne Karl oder Johann in eine Schlacht ziehen müsse, zog sich ihr das Herz zusammen.
»Lieber Gott, beschütze meine Kinder, meinen Mann und mein Dorf«, murmelte sie und machte ein Kreuzzeichen. Doch dann wurde ihr bewusst, wie nahe sie auch heute wieder vor einer furchtbaren Auseinandersetzung standen. Die Franzosen – wer auch sonst – bedrohten zum wiederholten Male Europa. Schon vor über zehn Jahren hatten sie sich gegen ihren König Ludwig XVI. gestellt und ihn 1793 sogar hingerichtet. Eine blutige Revolution war ausgebrochen und seitdem war das Franzosenland in Aufruhr.
Sie war damals schon eine junge Frau und hatte mitbekommen, wie sich ihr Vater mit anderen Männern über die Zustände im fernen Frankreich unterhielt. War dieses Land für sie auch weit entfernt, so wusste Katharina doch, dass französische Truppen Mainz besetzt hielten – und das schon seit 1792. Ober-Mörlen, ihr Dorf, gehörte noch immer offiziell – genau wie die Nachbardörfer Nieder-Mörlen, Oppershofen und Rockenberg – zu den kurfürstlichen Enklaven in der Wetterau. Damit lagen sie also durchaus in Reichweite und vor allem im Interessensgebiet der Franzosen.
Immer wieder fielen die westlichen Nachbarn auch bis in heimatliche Gebiete ein. Im Oktober 1792 hatten sie die Saline in Nauheim überfallen, Salz im Wert von fünfzigtausend Talern geraubt und an Frankfurt verkauft. Hundertfünfzig tapfere Männer standen damals eintausendfünfhundert Franzosen gegenüber. Die Brandschatzung Nauheims konnten die Soldaten um Hauptmann Mondorf zwar verhindern, den Salzraub jedoch nicht.
Und jetzt drängte ein neuer Führer nach vorn. Ein Mann namens Napoleon Bonaparte griff nach der Macht. Ihr wurde angst und bange, wenn sie daran dachte, was ein Größenwahnsinniger alles anstellen könne, würde er das Sagen in diesem kriegerischen Land bekommen.
Neben ihr schnarchte Franz tief und fest. Er hatte seine Ruhe gefunden. Was machst du dir für Gedanken, Frau? Nur weil ein neues Jahrhundert beginnt, muss nicht gleich die ganze Welt untergehen, würde er sicher sagen, wüsste er, was in ihrem Kopf gerade alles vor sich ging.
Er hatte ja recht. Es war nur ein Jahreswechsel, nur eine ganz gewöhnliche Nacht. Man konnte schließlich an jedem neuen Tag ins Unglück stürzen – oder auch einen Moment der Freude genießen. Ihr Blick fiel noch einmal auf Johann in seiner Wiege. Friedlich schlummerte er und hatte die beiden Hände zu Fäustchen geformt, links und rechts neben seinem Kopf liegen. Sie lächelte – und endlich fand auch sie ihre Ruhe.
Landgraf Ludwig
1802
In diesem Jahr fiel der 15. August, Mariä Himmelfahrt, auf einen Sonntag. Nach dem Kirchgang, an dem die ganze Familie teilgenommen hatte, kehrte Katharina mit den Kindern nach Hause zurück; schließlich wollte die ganze Bande ein anständiges Mittagsessen auf dem Tisch haben. Franz hatte hingegen wie üblich die andere Richtung eingeschlagen. Bei Wilhelm, dem Schwanenwirt, traf er sich jeden Sonntag nach der Messe mit den Männern des Dorfes zum Stammtisch.
Der Frühschoppen war für die Bauern nicht nur eine traditionelle Einrichtung, um ihren Durst zu stillen, sondern vielmehr die wichtigste Quelle, um Neuigkeiten aus dem Dorf und der ganzen Region zu erfahren. An- und Verkäufe von Vieh, Preisfestlegung von Landprodukten, Abstimmung von Arbeitseinsätzen, aber auch die Weltpolitik wurde hier genauso bei einigen süffigen Humpen Bier oder ein paar Bembel Apfelwein besprochen, wie der übliche Dorftratsch. Was Franz heute im Wirtshaus aufschnappte, barg jedoch eine beunruhigende Brisanz in sich.
Gerüchte, dass die kurmainzer Enklaven einem neuen Landesfürsten zufallen sollten, gab es schon lange. Seit die Franzosen am Rhein standen und das Land westlich des Stroms ihrem eigenen Staatsgebiet einverleibt hatten, herrschten für die erzbischöflichen Besitzungen in der Wetterau ungewisse Eigentumsverhältnisse. Kurfürst und Erzbischof Friedrich Karl Joseph von Erthal war nach dem französischen Einmarsch Hals über Kopf mitsamt seinem Domkapitel nach Aschaffenburg geflohen und hatte vor den Besatzern mutlos das Feld geräumt.
Im Dorf hatte man für die überhastete Flucht des Kurfürsten mehr Spott als Sorge übrig. Ober-Mörlen und seine Bewohner betraf diese Hasenfüßerei nur am Rande. Trotz der Zugehörigkeit zu Kurmainz war das Dorf nicht dem Erzbischof, sondern dem einst mächtigen Deutschen Orden zehntpflichtig. Schon im dreizehnten Jahrhundert hatte Ludwig von Isenburg in einer Schenkungsurkunde bestätigt, dass seine Großeltern um 1230 das Zehntrecht an den Deutschen Orden abgetreten hatten. Die bei Frankfurt gelegene Kommende Sachsenhausen war seit Vätergedenken die maßgebliche Stelle, wenn es um die alljährlichen Abgaben für Ober-Mörlen ging.
Nun aber schien auch diese Jahrhunderte währende Zuständigkeit infrage gestellt.
»Die Franzosen wollen uns offensichtlich den Hessen zuschlagen – behauptet man wenigstens im Schwanen«, warf Franz beim Mittagstisch brummend in die Runde. »Im kommenden Jahr sollen die Grenzen verändert werden und man will uns dem Landgrafen Ludwig zuschustern.«
Katharina hielt mitten im Essen inne und blickte ihn entgeistert an. »Wer sollte daran interessiert sein?«
»Du kannst Fragen stellen; Ludwig natürlich! Ich möchte den Landesherrn sehen, der nicht darauf aus ist, seinen Einfluss auszudehnen und gleichzeitig seinen Geldbeutel zu bereichern. Die Franzosen machen es sich leicht. Erst stehlen sie uns das Land und dann verschenken sie es mitsamt den zugehörigen Einnahmen. So schleimen sie sich bei den deutschen Fürsten ein, ohne dass es sie etwas kostet. Überdies verschleiern sie damit ihren Landraub auf der anderen Rheinseite. Die rechtsrheinischen Gebiete der kurmainzer Hosenscheißer sind nette Morgengaben für den Landgrafen, nachdem sich der Erzbischof so klammheimlich aus dem Staub gemacht hat.«
Katharina schaute besorgt. »Glaubst du, da ist was dran? Der Orden wird sich doch nicht einfach so etwas wegnehmen lassen, was ihm seit Ewigkeiten gehört.«
»Das sollte man meinen. Aber wie man hört, wollen die Franzosen sogar die Kirche enteignen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Landgraf Ludwig etwas dagegen einzuwenden hätte, schließlich ist er Protestant und die katholischen Besitztümer der Kurmainzer kämen ihm gerade recht.«
»Hm«, machte Katharina nachdenklich. »Was würde das für uns bedeuten?«
Franz zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Eigentlich ist es egal, wem wir den Zehnt leisten, solange es nicht die Franzosen sind.«
»Aber wenn mit ihrer Zustimmung die Besitzverhältnisse neu geregelt werden, dann geschieht dies sicherlich nicht aus reiner Großzügigkeit. Der Landgraf muss ihnen doch sicher dafür etwas geben.«
Franz nickte. »Selbstredend, Käthchen! Wahrscheinlich wollen sie, dass Ludwig ihnen Gefolgschaft leistet. Schließlich haben die Franzosen schon genug Feinde in Europa. Was sie brauchen, sind Verbündete … und eine neue Geldquelle für ihre Kriegskasse.«
Der fünfjährige Karl hatte mit gespitzten Ohren der Unterhaltung seiner Eltern gelauscht. Seine Miene wurde immer ängstlicher. Schließlich fragte er: »Mama, kommen jetzt die Franzosen und hauen uns tot?«
»Nein, mein Schatz!« Katharina lächelte ihrem Ältesten aufmunternd zu und streichelte über seinen blonden Haarschopf. »Iss deinen Kartoffelbrei und denk nicht so schlimme Sachen. Willst du noch ein wenig Butter?«
»Lieber noch ein Stück Fleisch!«, entgegnete Karl und verdrängte sofort seine Angst.
Mutter lächelte. Sie schnitt ein kleines Stück von Festtagsbraten ab, zerteilte es und legte es ihm auf den Teller. Auch einen Zuschlag Butter mischte sie unter seinen Stampf. Mit Begeisterung schob sich Karl einen Bissen Fleisch in den Mund und stopfte eine Portion fetten Kartoffelbrei nach.
»Ich auch!«, meldete sich Johann energisch zu Wort. Was seinem großen Bruder recht war, sollte ihm billig sein. Katharina versorgte auch ihn. Ihr Blick ging hinüber zu der Wiege, wo mit Josef ihr dritter Sohn friedlich schlummerte. Der Jüngste stellte noch keine Ansprüche.
Die Frau wendete sich wieder ihrem Essen zu. Nachdenklich nippte sie an ihrem Wasserglas und wollte zu einer neuen Bemerkung ansetzen. Doch überlegte sie es sich noch einmal und schwieg. Nach einer Weile räusperte sie sich dann aber doch und schaute ihren Mann an: »Du, Franz. Ich muss dir nach dem Essen auch noch was erzählen.«
»Hm, was gibt’s? Raus damit!«, erkundigte sich Franz, ohne von seinem Teller aufzuschauen. Heute war Sonntag, der einzige Tag der Woche, an dem er sich ausruhen konnte. Da wollte er in Ruhe sein Essen genießen. Er liebte es nicht sonderlich, bei den Mahlzeiten gestört zu werden.
»Nicht jetzt. Nach dem Essen«, wich Katharina ihm aus. »Wenn die Kinder ihren Mittagsschlaf machen.«
Franz legte den Löffel beiseite. »Jetzt sag schon, Käthchen. Was gibt’s so Wichtiges? Ich will mich nachher auch ein wenig aufs Ohr legen.«
Die Frau druckste herum. »Nicht vor den Kindern, Franz.«
»Seit wann haben wir Geheimnisse vor ihnen? Mach’s nicht so spannend. Sag schon.«
Katharina atmete tief durch. Es fiel ihr offensichtlich schwer, mit der Sprache herauszurücken. »Mir ist der Fluss ausgeblieben«, umschrieb sie ihr Problem.
»Welcher Fluss?«, brummte Franz.
»Na, du weißt schon …«
Nein, ihr Mann wusste nicht! Sein Gesicht zeugte von völliger Ahnungslosigkeit. Katharina seufzte.
»Franz! Ich … ich bin wieder gesegnet …«,
In ihren Augen glänzte etwas, was bei Franz nur sehr zögerlich eine Ahnung aufsteigen ließ. Als das Gesagte in seinem Kopf zu einem Sinn reifte, veränderte sich schlagartig seine Miene. Das Kinn klappte entgeistert herunter.
»Du meinst …?«
Sie nickte lächelnd.
»Aber wir haben doch schon drei? Noch eins?«
Ein Argument, was stach. Karl Heinrich war jetzt fünf und Johann Remigius gute zweieinhalb. Erst vor zehn Monaten hatte sie Josef Wilhelm entbunden. Eine Pause hätte ihr sehr gutgetan.
Wieder lächelte Katharina nur. Franz hingegen war das Lachen vergangen; sein Gesicht wurde lang und länger. Es dauerte eine Weile, bis er sich wieder entspannen konnte. Schließlich lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück und stöhnte resigniert:
»Na ja, das werden wir auch noch durchfüttern!«
Er stand auf, ging zum Küchenschrank und holte sich ein Schnapsglas. Im Fach nebenan stand die Flasche mit dem starken Korn; es war der, den er immer trank, wenn eine Kuh erfolgreich gekalbt hatte. Er goss sich seinen Stamper randvoll und kippte ihn mit einem kräftigen Nicken in seinen Schlund.
Hans hatte sich nicht von seinem Essen ablenken lassen, aber Karl schaute verwirrt von Mutter zu Vater und zurück. »Was habt ihr beiden denn?«
»Nichts, mein Junge. Iss schön weiter.« Katharina hatte nicht vor, den Kindern schon so früh von einem neuen Geschwisterchen zu berichten. Das hatte Zeit, bis man es auch ihrem Bauch ansehen konnte. Noch stand sie ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft.
Karl fügte sich. Aber seine Neugier war ihm anzusehen. Der Junge war ein aufgewecktes Kerlchen und keiner konnte ihm etwas vormachen. Mutters Aussage hatte Vater beunruhigt. Er nahm sich vor, wachsam zu sein, um herauszufinden, welches Geheimnis die Eltern ihm vorenthielten.
»Bin satt!« Johann schob seinen Teller von sich. »Darf ich rausgehen und spielen?«
Mutter nickte. Der Junge kletterte vom Stuhl und zog an Karls Hand. »Tarl mittommen.«
»Dein Bruder heißt Karl, Hans! K … Sag bitte, Karl!« Katharina versuchte schon seit Wochen, ihm das K richtig zu entlocken. Doch jedes Mal brachte Johann nur ein T über seine Lippen.
Hans schaute Mutter an, als wisse er nicht, was sie wolle.
»T … Tarl!«, wiederholte er.
»Na, geht schon«, lachte Katharina. »Aber macht euch nicht so schmutzig. Heute ist Feiertag und ihr habt die guten Sachen an. Da tollt man nicht so wild herum.«
»Wir passen schon auf«, rief Karl. Lärmend stoben die beiden hinaus auf den Hof.
Katharina ging zu Franz und umschlang ihn mit beiden Händen. »Jetzt schau nicht so. Wir werden bald zu sechst sein. Freust du dich denn gar nicht?«
»Ach, Käthchen. Es wird immer schwieriger, die Familie sattzubekommen. Noch so ein Wildfang wie die zwei dort draußen ist schon eine Herausforderung.«
»Vielleicht wird es ja auch ein Mädchen. Es müssen nicht immer Jungs sein«, spekulierte seine Frau.
Jetzt endlich legte sich auch ein kleiner Schimmer von Freude auf Franz’ Gesicht. »Ich hätte nichts dagegen. Weißt du denn schon, wann es so weit sein soll?«
»Das hat noch Zeit. Irgendwann im kommenden Frühling. Vielleicht wird’s ein Osterkind?«
Franz schaute seine Katharina ernst an. »Wir sind jetzt sieben Jahre verheiratet – und du bekommst schon das vierte Kind. Mutest du dir nicht ein bisschen zu viel zu?«
»Ich denke mal, daran bist du auch nicht ganz schuldlos.« Verschmitzt schaute sie ihn an.
Franz schmunzelte. »Aber du solltest dich etwas schonen.«
»Oh, gerne, wenn du den Haushalt machst.«
Wie zur Bestätigung erwachte Josef in seiner Wiege und fing an zu schreien. »Du kannst gleich anfangen, Franz. Wickel mal deinen Jüngsten.«
Franz hob abwehrend seine Hände. »Oh, ich glaube, das kannst du dann doch besser. Ich hau’ mich mal aufs Ohr ...«
Ohne ihre Antwort abzuwarten, verließ er schleunigst den Tisch, um in die gute Stube zu gehen. Katharina stemmte ihre Arme in die Hüften und schüttelte den Kopf.
»Franz, Franz, Franz«, empörte sie sich. Dann aber huschte ihr doch wieder ein Lächeln über das Gesicht. Voller Glücksgefühle hob das kleine Menschenbündel aus der Wiege. »Na dann komm mal her, du kleiner Racker.«
*
Der Herbst war ins Land gezogen und hatte Gewissheit gebracht, dass sich im Dorf etwas ändern würde. Fünf fremde Reiter in Uniformen ritten im Oktober ins Dorf. An ihrer Bekleidung konnte man unschwer erkennen, dass es sich um Soldaten des Landgrafen Ludwig von Hessen-Darmstadt handelte; ein Unteroffizier und vier Gefreite.
Sie bezogen in Ober-Mörlen Quartier – dauerhaft, wie man hörte. Das konnte nur eines heißen, die Gerüchte um die Eigentumsverhältnisse sollten sich wohl bewahrheiten. Wenn der Landgraf schon eine Vorhut seines Militärs im Dorf einquartierte, war wohl damit zu rechnen, dass sich die kurmainzer Zeit für Mörlen seinem Ende entgegen neigte.
Ein merkwürdiges Gefühl beschlich die Dörfler. Keiner konnte sich daran erinnern, jemand anderem als dem Deutschen Orden zehntpflichtig gewesen zu sein. Seit jeher war das Dorf lediglich zur Zahlung des Fruchtzehnts verpflichtet, also nur für die Erträge, die sie auf den Getreidefeldern erwirtschafteten. Wein-, Kraut- und Obstzehnt war ihnen schon immer erlassen worden. Der Deutsche Orden hatte sich seine Großzügigkeit durchaus leisten können, denn die Äcker des Mörler Grundes waren sehr fruchtbar und warfen Jahr für Jahr einen guten Ertrag ab. Was der Landgraf, sollte auch das Zehntrecht zu ihm wechseln, ihnen zukünftig abverlangen würde, musste man abwarten. Es stand zu befürchten, dass es für die Bauern teurer werden würde.
Doch zunächst änderte sich nichts; auch wenn die fünf Militärs ab sofort zum Dorfbild dazugehörten. Man sah sie immer wieder durch die Gassen patrouillieren. Erfreulicherweise spielten sie sich aber nicht als die Herren des Dorfes auf. Bald hatte man sich an sie gewöhnt und das Leben nahm weiter seinen Lauf.
*
Es war Dezember geworden. In der Luft trieben pappig dicke Schneeflocken und fielen auf den Boden, ohne eine Schneedecke zu bilden. Die Gassen und Wege weichten derart auf, dass sie schlammig, rutschig und für Fußgänger fast unpassierbar wurden.
Dennoch hatte Katharina den Entschluss gefasst, sich aus dem Haus zu wagen. Angesichts des Schneetreibens zog sie den dicken Mantel eng um ihren Körper. Ihre Schwangerschaft konnte sie nicht mehr verheimlichen. Sie war im fünften Monat und zeigte bereits einen gerundeten Leib. Selbst in dem Wintergewand war es zu sehen. Auf dem Arm trug sie ihren Jüngsten, Josef Wilhelm, den alle nur liebevoll Seppel nannten. Mittlerweile hatte auch er schon das erste Lebensjahr vollendet.
Der kleine Mann konnte sogar bereits laufen. Doch war es für die Mutter nicht nur wegen des schlechten Wetters mühsam, ihn neben sich hertrotten zu lassen. Überall fand der Junge etwas Interessantes. Jede Toreinfahrt untersuchte er und man kam einfach nicht voran. So hatte es Katharina vorgezogen, den Jungen zu tragen.
Sie war auf dem Weg zum Kolonialwarenladen auf der Großen Landstraße, um ihren Hausstand durch einen neuen Topf zu ergänzen. Seppel fest an ihren Körper gedrückt, überquerte sie den Kirchplatz und passierte das Rathaus. Fast wäre sie achtlos am Anschlagsbrett vorbeigelaufen; doch sie stutzte, denn an ihm prangte heute ein neuer Aushang.
Neugierig trat sie an die Bekanntmachung heran und betrachtete das Papier. Oben links war das Wappen des Landgrafen von Hessen-Darmstadt zu sehen. Das kannte sie. Doch war sie leider des Lesens nicht mächtig. Ihr Vater hatte es nicht für nötig gehalten, sie mit Lesen, Schreiben und Rechnen zu belästigen. Jedes Mädchen würde einmal heiraten und sich dann um Haus und Kinder sorgen. Es hätte nur unnötig Schulgeld gekostet, jemanden wie Katharina auf die Schule zu schicken.
Sie hatte es sehr bedauert, denn schon im Kindesalter war Katharina von wissbegieriger Natur. So blickte die Frau nun auf die Zeichen, ohne entziffern zu können, was dort auf dem Anschlag geschrieben stand.
Vielen im Dorf würde es ähnlich gehen. Zwar gab es schon seit über hundert Jahren eine kleine Schule hinter der Remigiuskirche, und oben in der Mansarde wohnte mit Josef Groß auch ein Schulvikar. Der Dorflehrer kam gebürtig aus Oppershofen, hatte in Bensheim an der Bergstraße das katholische Lehrerseminar besucht und war seitdem im Dorf für die Bildung wissbegieriger Knaben zuständig. Dienstherr von Schulvikar Groß war Bonifatius Lanzinger, der Dorfpfarrer, den der Deutsche Orden für Ober-Mörlen abgestellt hatte. Neben seiner Lehrtätigkeit oblag dem Schulvikar stets auch das Amt des Glöckners und des Organisten. Die Schule samt der Lehrerwohnung war nicht von ungefähr unmittelbar an der Remigiuskirche angesiedelt.
Katharina bemühte sich redlich, wenigstens den ungefähren Sinn der Schriftzeichen zu verstehen. Sie hatte sich selbst einige Buchstaben beigebracht und ließ ihre Augen langsam und angestrengt über das Papier wandern.
»Morsche Käth’che! Na, wie isses? Krieschte raus, was da stehje dud?«
Die Schwangere zuckte zusammen. Sie hatte gar nicht bemerkt, wie der Schwanenwirt neben sie getreten war.
»Huch, hast du mir en Schrecke ingejacht«, fuhr sie herum. »Isch versuch’s, Willem, aber ob isch’s schaff’, weiß isch noch neijt. Is schon schwierisch …«
Unversehens verfiel sie in den Dialekt, den auch der Schwanenwirt immer bemühte. »Kannst du mir d’bei helfe?«
Wilhelm lachte. »Naaa, ganz bestimmt neijt. Leäse is neijt moins. Awer ich waaß, was do stieht.«
Katharina sah ihn auffordernd an. »Un was? Jetzt sach schon!«
»Ei des mer demnächst dem Landgraf Ludwisch unser Geld in der Hinnern schiewe müsse. Unser Leut uff der Gemoah müsse sich jetz schon uff der Ludwisch verpflischde.«
Sie hatte es geahnt! Jetzt also wurde es ernst. Die Gemeindebeamten waren die ersten, die auf den neuen Landesherrn einen Eid abzulegen hatten.
»Danke, Willem!«, sagte Katharina und nickte dem Schwanenwirt zu. Sie wollte schnell ihren Einkauf hinter sich bringen und dann zu Franz zurück. Es brannte ihr unter den Nägeln, ihm die Neuigkeit mitzuteilen.
»Gern geschehe, Käth’che. Bass uff dich oacht und rutsch neijt in dem Schlampes aus!«, hörte sie Wilhelms Stimme ihr noch nachrufen. Doch sie war schon halbwegs um die Ecke und auf dem Weg zum Kolonialwarenladen.
Bei Peter Koch erstand sie einen gusseisernen Topf. Das schwere Teil machte ihr den Rückweg nicht leichter. Jetzt hatte sie gleich zwei Dinge zu tragen. Als sie wieder am Rathaus vorbeikam, ärgerte sie sich erneut darüber, dass sie weder lesen noch schreiben konnte. Das Leben könnte so viel einfacher sein. Sie nahm sich vor mit ihrem Mann zu reden, ob sie nicht Karl demnächst zur Schule schicken sollten. Wenigstens der Bub sollte es einmal besser haben als sie. Im nächsten Frühling würde er sechs werden. Das war das übliche Alter, in dem die meisten Kinder, wenn denn ihre Eltern es wollten und konnten, zum Schulvikar geschickt wurden.
Zu Hause angekommen, traf sie Franz in der Küche an. Er saß am Küchentisch und zerschnitt alte Lappen zu handlichen Stücken. Sie sollten ihre letzte Verwendung im Häuschen mit dem Herzen in der Tür, draußen im Hof, finden. Im Winter, wenn die Feldarbeit getan war, hatte er Zeit für solche Arbeiten.
»Franz, am Rathaus hängen Neuigkeiten!«, sagte sie ohne einen Gruß.
Ihr Mann blickte auf. »Und die wären?«
»Die Ortsbeamten werden auf den Landgrafen vereidigt.«
Franz legte das Messer beiseite. »Ist es also so weit? Haben die Kurmainzer die Sache verkackt.«
»Wie es aussieht, ja! Aber es stand noch nichts davon, dass wir jetzt auch unsere Abgaben an Ludwig zahlen müssen.«
»Das kommt noch, Käthchen – so sicher wie das Amen beim Lanzinger in der Mess’. Und ich befürchte, es wird nicht billiger werden als beim Deutschorden. Das haben wir alles den Franzosen zu verdanken. Wenn die sich nicht in Mainz breit gemacht hätten, wäre alles beim Alten geblieben.«
Katharina kam nicht umhin ihm recht zu geben. »Wohl wahr!« Sie wartete einen kurzen Augenblick, bis sich der erste Ärger bei Franz wieder gelegt hatte.
»Du, ich hätte da noch was mit dir zu besprechen.«
»Was denn? Gibt’s noch was Unangenehmes?«
»Nein. Aber etwas, was unseren Karl betrifft.«
Franz stöhnte. »Hat er wieder etwas ausgefressen? Ich zieh’ dem Kerl die Hammelbeine lang.«
»Ach was. Der Karl ist doch ein guter Bub. Der macht nichts Schlimmes.«
»Ja, was ist es denn dann?«
»Ich habe mir überlegt, dass wir ihn nach Ostern zu Groß in die Schule schicken sollten. Er soll Lesen und Schreiben lernen!«
Franz sah sie mit großen Augen an. »Warum denn das? Kannst du lesen?«
»Nein – aber genau deswegen!«
»Des sinn doch Firz mit Kralle, Käth’che! Der Bub soll lernen, wie man einen Acker bestellt, Schweine mästet und Hühner schlachtet. Sowas muss man hier wissen.«
»Da bin ich mir nicht so sicher, Franz. Ich hab’ gerade wie der Ochs vorm Scheunentor gestanden, als ich den Aushang gesehen hab’. Wenn der Wilhelm mir nicht gesagt hätte, was da steht, wüsste ich es bis jetzt noch nicht.«
»Der Willem? Der Schwanenwirt kann doch auch nicht lesen. Woher soll der denn wissen, was auf dem Anschlag stand?«
»Er wusste es aber. Wahrscheinlich hat es sich im Wirtshaus schon rumgesprochen. Auch Herr Groß und der Pfarrer Lanzinger verkehren bei ihm. Und die können lesen und schreiben.«
»Hm«, brummte Franz und nickte. »Das könnt’ natürlich sein. Aber unser Karl muss das nicht können, Käthchen. Überleg doch mal, was das kosten würde. Schulgeld können sich nur bessere Leute leisten.«
»Ach was! Wir können den Vikar ja auch mit Eiern und Speck bezahlen. Das nimmt der bestimmt gerne.«
»Ich weiß nicht. Ich bin nicht dafür.«
»Ich schon, Franz. Guck mal, dann könnte Karl uns immer die Neuigkeiten aus erster Hand berichten, die am Rathaus stehen. Vielleicht könnte er später gar mal Ortsdiener werden. Dafür muss man auch lesen können.«
Franz lachte. »Und dann soll der Bub wohl wie der Alois mit der Schelle durch das Dorf rennen und Bekanntmachungen ausrufen. Das ist doch nichts! Dann lieber ehrliche Feldarbeit.«
»Ach Franz!« Katharina schlang beide Arme um ihren Mann. »Überleg es dir doch noch mal. Ich fände es gut, wenn wenigstens einer in der Familie etwas Bildung hätte.«
»Jetzt aber mal langsam!«, prustete Franz in gespielter Empörung. »Ich bin dir wohl nur noch dafür gut genug?« Mit seiner Hand tätschelte er ihren dicken Bauch. »Sieh erst mal zu, dass das da gut geht. Und denk daran, wir wollten diesmal ein Mädchen. Nicht, dass du wieder ein Bub in die Welt setzt. Der soll dann womöglich auch noch zur Schule.«
Katharina streichelte sanft über ihren Bauch. »Diesmal wird’s ein Mädchen, Franz. Ich spür’ das. Und ich hab’ auch schon einen Namen ausgesucht.«
»Ach so – das machst du jetzt auch schon alleine, was?«
»Was hältst du von Mechthild? So hieß doch deine Großmutter.«
»Oma Hilde? Oh, ja, das war eine ganz Liebe … Na, warten wir mal, was da kommt.«
Katharina gab ihm einen Kuss. »Du wirst sehen. An Ostern haben wir ein Mädchen und wenn es wieder warm wird, geht Karl Heinrich zur Schule.«
Franz lachte und schüttelte den Kopf über seine Frau. Sie hatte doch tatsächlich ihren ganz eigenen Willen. Aber gerade das hatte er an ihr schätzen gelernt.
Umbruchszeit
1803
Der Schnee hatte sich noch nicht vollständig verzogen, aber an vielen Stellen zeigten sich schon grüne Inseln. Strahlend weiße Schneeglöckchen reckten ihre Köpfe in die noch frische Luft und ließen ihre Blüten im Wind schaukeln. Es war Ende Februar und das neue Jahr schickte sich an, in den Frühling überzugehen.
Katharinas Bauch hatte noch einmal mächtig zugelegt. Die Kindsfrau hatte ihr für Ende des kommenden Monats die Geburt vorausgesagt. Wenn es so käme, dann würde ihr Kind sogar noch vor Ostern das Licht der Welt erblicken. Franz hatte im Winter die Wiege aufgearbeitet, in der bereits die drei Jungs gelegen hatten. Sie stand nun im Schlafzimmer am Fußende des Ehebetts und wartete darauf, dass die kleine Mechthild die Mathes’ um ein weiteres Familienmitglied bereichern würde.
Jedenfalls hoffte Katharina inständig, dass das Kind ein Mädchen werde. Sie hatte es ihrem Franz versprochen und er hatte für den Fall, dass es tatsächlich so käme, zugesagt, Karl nach Ostern in der Schule anzumelden. Der Gedanke daran machte sie glücklich. Im Stillen hatte sie sich vorgenommen, mit ihrem Sohn gemeinsam zu üben und ebenfalls die Kunst des Lesens zu erlernen. Schreiben war ihr nicht so wichtig. Doch lesen wollte sie unbedingt können. Aber das verriet sie ihrem Mann nicht. Er hätte wahrscheinlich den Kopf darüber geschüttelt.
Anfang März erklang im Dorf die Glocke des Ortsdieners. Alois Dey schritt durch alle Gassen und verkündete eine wichtige Nachricht. In seiner dunkelblauen Uniform, mit der schwarzen Schirmmütze und dem roten Gürtel, sah er ungemein wichtig aus, als er würdevoll die Hintergasse heraufschritt und die Schelle schwang. Alle hundert Klafter blieb er stehen, klemmte sich die Bimmel unter den linken Arm, faltete ein Blatt auseinander und verlas mit lauter Stimme seine Meldung:
»Beeeee-kannt-mach-hung, Beeeee-kannt-mach-hung!« Überall wurden die Fenster geöffnet, einige traten auch auf die Straße, um genau zu hören, was der Ortsdiener zu verkünden habe. Als Alois sich der Aufmerksamkeit seiner Mitbürger sicher wahr, verkündete er: »Beschluss zu Regensburg, am 25. Februar 1803! Mit sofordischer Wirgung untersteht Oowe-Mirle dem Landgraf Ludwisch. Die Ufflösung des Kurfürstentum Mainz is beschlossene Sach’. Ewe’so beschlosse’ is die Entscheidung, des de’ Deutsche’ Orde’, dem unser Dorf zum Zehnt verpflicht’ war, nix mehr krischt. Ab sofort sinn alle Abgabe de Landgrafschaft Hesse’-Da’mstadt zu entrischde.«
Er faltete sein Dokument wieder sorgsam zusammen, nahm die Glocke zur Hand und setzte mit gemessenem Schritt und nervtötenden Gebimmel seinen Weg fort.
Franz Johann Mathes stand mit anderen Neugierigen vor seinem Hoftor.
»Des war ja abzusehje.« Nachbar Hermann Geck schüttelte missbilligend den Kopf.
»Und neijt wirklich woas Neues«, stimmte ihm Max Schweitzer zu. »Awwer wenn’s jetz aach de Ridderorden neijt mi gibt, greje me da aach en neue Parrer? De Lanzinger is doch aaner von dene.«
Das war eine gute Frage, wie Franz fand. Pfarrer Lanzinger war in der Tat noch vom Deutschorden eingesetzt worden. Es würde ihn nicht wundern, wenn sich auch hier etwas ändern würde.
»Da sachste was, Max. Die Hesse soin doch all üwwerwischend evangelisch. Müsse mir jetzt aach prodesdandisch wern?«
Die drei Männer beschlich ein ungutes Gefühl. Die Konfessionszugehörigkeit wurde schon des Öfteren gewechselt, wenn der Landesfürst einer anderen Glaubenslehre anhing. Nach der Reformationsbewegung von Martin Luther hatte Ober-Mörlen zwischen 1546 und 1606 mehrfach die Konfession ändern müssen. Doch seit nunmehr zweihundert Jahren war das Dorf immer katholisch gewesen. Nur in den dreißig Jahren der Wirren des Großen Krieges hatte es noch einmal für kurze Zeit unter der Betreuung eines protestantischen Priesters gestanden.
»Mir wern’s sischer am Sonndaach in de Kirsch vom Lanzinger erfah’n«, meinte Hermann. Die beiden anderen nickten. Wohl war ihnen nicht bei dem Gedanken.
*
Am folgenden Sonntag platzt die Remigiuskirche aus allen Nähten. Die Sorge um die Zukunft hatte die Bewohner ins Gotteshaus getrieben. Sie alle hofften von Pfarrer Lanzinger etwas mehr zu erfahren, als die knappe Mitteilung des Ortsdieners bekannt gegeben hatte. Und sie wurden nicht enttäuscht.
Bonifatius Lanzinger hatte seine Predigt ganz dem Thema gewidmet, das seine Gemeinde in diesen Tagen umtrieb. Er hatte sie unter den Vers 13,7 des Römerbriefes gestellt, wo es hieß: Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, sei es Steuer oder Zoll, sei es Furcht oder Ehre.
Um diese Worte begreifbar zu machen, erklärte er der Gemeinde, was in Regensburg von der Obrigkeit beschlossen worden war. So erfuhren die Dörfler, dass die rechtsrheinischen Besitztümer des ehemaligen Kurfürstentums Mainz von Frankreich freigegeben und unter den Fürstentümern Nassau-Usingen, Aschaffenburg sowie der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt aufgeteilt worden waren. Unter der Leitung von Reichserzkanzler Karl Theodor Anton Maria Reichsfreiherr von und zu Dalberg hatten im Rathaus der Donaustadt Vertreter der alten Fürstentümer und Landgrafschaften die weltliche Herrschaft über die rechtsrheinischen Territorien neu geregelt. So war auch ihr Dorf endgültig in den Besitz von Landgraf Ludwig X. von Hessen-Darmstadt übergegangen.
Es waren unruhige Zeiten, da mit Kurmainz auch das Erzbistum Mainz von Papst Pius VII. zu einem einfachen Bistum zurückgestuft worden war. Das neue Oberhaupt, Joseph Ludwig Colmar, durfte sich nur noch Bischof und nicht mehr Erzbischof nennen. Doch Ober-Mörlen verblieb auch unter den neu geregelten Besitzverhältnissen im Mainzer Bistum und Pfarrer Bonifatius Lanzinger wurde weiterhin als Dorfpfarrer bestätigt.
Ein Aufatmen ging durch das Dorf. Wenigstens etwas Vertrautes war ihnen geblieben. Es würde sich zeigen, was die neuen Zeiten noch alles mit sich bringen würden.
Franz und Katharina gingen nach diesem Gottesdienst etwas beruhigter nach Hause. Jetzt stand erst einmal die Geburt ihres vierten Kindes an. Noch einmal bat die Frau inständig den lieben Gott, dass er ihnen doch ein Mädchen schenken wolle – schon damit Franz zu seinem Versprechen stehen musste und Karl Heinrich die Schule besuchen konnte.
*
Ostern 1803 war kein gewöhnliches Osterfest, jedenfalls nicht für die Familie von Franz Johann Mathes. Die Kindsfrau hatte sich geirrt und Katharina hatte nicht wie vorausgesagt Ende März, sondern erst am 1. April 1803 entbunden. Es war der Karfreitag, als in den Nachmittagsstunden die kleine Mechthild Maria ihren ersten Schrei ausstieß. Karl hatte so gehofft, dass sein Geschwisterchen wie er am 4. April zur Welt käme, doch hatte das Mädchen wohl nicht so lange warten wollen; sehr zur Freude der Mutter. Die letzten Tage waren ihr mehr als schwer geworden und es verlangte sie unbändig danach, endlich ihr Kind in den Armen halten zu dürfen.
Die Geburt war erfreulich glatt verlaufen und Franz hatte voller Freude über seine erste Tochter noch am Tag der Geburt sein Versprechen erneuert. Gleich nach dem Besuch im Pfarrhaus, um die Taufe von Mechthild anzumelden, war er auch bei Josef Groß vorstellig geworden. Für Montag, den 18. April 1803, hatten die beiden Männer den ersten Schultag für den Jungen vereinbart. Auch über das Schulgeld waren sie sich rasch einig geworden, denn Schulvikar Groß war hocherfreut über das Angebot, ihm die Gebühr in Naturalien zu zahlen. Es hatte etwas für sich, sicher zu wissen, dass man jede Woche mit sechs Eiern und einmal im Monat auch mit einer Wurst versorgt wurde.
Jetzt musste Franz nur noch eine Schiefertafel und einen Griffel für seinen Sohn auftreiben. Doch das sollte in Kochs Kolonialwarenladen kein Problem sein. Als er sogar mit einem ledernen Tornister nach Hause kam, konnte Katharina die Freudentränen nicht zurückhalten. Sie war stolz auf ihren Franz.
*
Im Dorf nahm das Leben seinen gewohnten Gang; viel merkte man nicht davon, dass man jetzt kein Kurmainzer mehr, sondern Oberhesse war. Der Sommer ging ins Land und die Abgaben an Landgraf Ludwig wurden erstmals fällig. In der Tat verlangte der Darmstädter etwas mehr als der Deutschorden und nicht jeder in Ober-Mörlen war problemlos in der Lage, die neue Zehntsteuer zu begleichen. Doch gab es Dörfer, die es wesentlich heftiger getroffen hatte. Man hörte, dass einige Adelshäuser, denen zuvor der Zehnt geleistet werden musste, sich nicht stillschweigend in die neue Situation fügten. Sie verlangten zusätzlich zu den Abgaben an den Landgrafen weiter einen Teil für ihre eigene Schatulle. Das Bauernvolk murrte heftig; gerade im Raum Nidda und Oberhessen. Da hatten es die Mörler besser getroffen. Der neue Zins war höher, aber leistbar.
So neigte sich das Jahr seinem Ende entgegen und nicht nur Karl Heinrich fand sich gut in sein Schülerdasein ein. Auch seine Mutter Katharina fand großen Gefallen am Lernen. Abends, wenn die Kinder im Bett lagen, machte sie sich voller Eifer über alles her, was ihr Sohn tagsüber von Josef Groß gelernt hatte. Sie hatte sich nun doch entschlossen, auch das Schreiben nicht zu vernachlässigen und übte fleißig die Auf- und Abschwünge der Buchstaben.
Als Franz sie eines späten Abends in der Küche beim Schreiben überraschte und fragte, was sie da tue, zeigte sie ihm stolz ihre Übungen. Einige Buchstaben hatte sie ja schon zuvor gekannt, und so war sie schneller in der Lage als ihr Sohn, die ersten Worte aufzuschreiben. Sie war mächtig stolz auf sich.
»Ach Käthchen!«, schüttelte Franz den Kopf. »Mit sowas verplemperst du deine Zeit. Wozu soll das nützlich sein? Bei dem Jungen seh’ ich es ja noch ein. Aber bei dir?«
»Warte nur ab. Irgendwann wird es uns Vorteile bringen«, ließ Katharina sich nicht verunsichern.
»Mir wäre es lieber, du kämst wiedermal beizeiten ins Bett, anstatt dir die Nacht mit dem Gekrakel um die Ohren zu schlagen. Mir fehlt etwas, wenn ich alleine einschlafen muss.«
Katharina war gerührt. »Das ist lieb von dir, Franz. Aber ich kann mich erinnern, dass du es warst, der mir sagte, ich solle eine Pause beim Kinderkriegen einlegen.«
»Wir können ja aufpassen.«
Sie lachte. »Das haben wir auch früher schon getan … und dennoch ist Hildchen jetzt schon ein dreiviertel Jahr alt.«
»Ja, und genauso lange fehlst du mir schon.«
Sie legte den Griffel beiseite und lächelte Franz an. »Ich glaube, heute mache ich etwas früher Schluss – dir zuliebe.«
Franz zog Katharina von ihrem Stuhl hoch und drückte sie an sich. Er küsste sie – leidenschaftlich.
»Lass mich noch rasch aufräumen. Ich komme dann sofort zu dir.«
Franz schüttelte den Kopf. Er nahm die Hand seiner Frau und führte sie zwischen seine Schenkel. »Das geht nicht. Fühlst du, wie fest mein Griffel schon ist?«
»Franz!«, empörte sich Katharina. Aber im nächsten Augenblick kicherte sie wie ein kleines Mädchen. Sie verloren keine Sekunde. Noch in der Küche liebten sie sich das erste Mal nach Mechthilds Geburt. Dann zog Franz sie mit sich ins Schlafzimmer …
Dreiklang
1805
Die Leute drängten sich dicht an dicht auf dem Dorfanger. Der Platz vor der Remigiuskirche war geschmückt mit Girlanden aus Buchsbaum sowie gelben und weißen Fähnchen. Vor dem großen Portal am Turmeingang standen junge, frisch geschlagene Birkenbäumchen und links daneben intonierte die Blaskapelle des Dorfes den Choral »Großer Gott, wir loben dich«. Niemand im Dorf war dem Ereignis ferngeblieben. Alle wollten miterleben, wie die neue Glocke geweiht und später in den Turm hinaufgezogen wurde, um dort ihren Dienst zu versehen.
Doch bevor das schwere, aus Zinn und Kupfer gegossene Monstrum an einem Flaschenzug in die Höhe gehievt wurde, standen die Reden der Honoratioren an. Und es gab viele, die an dem heutigen Tag etwas zu sagen hatten.
Kaum war der letzte Ton des Kirchenliedes verklungen, da trat Bonifatius Lanzinger als Erster an das Rednerpult. Der Gemeindepfarrer war der Hausherr des Gotteshauses und hatte das Vorrecht, die ersten Worte an die Dorfgemeinschaft zu richten. Seine Würdigungen galten den selbstlosen Anstrengungen der Mörler, diese Glocke als Dritte des Geläuts in den Dienst des Herrn stellen zu können. Fast einhundert Jahre nach dem großen Brand vom 27. Juli 1716 würde die neue Remigiusglocke den Lobpreis Gottes mehren und den Wohlklang der großen Dreifaltigkeitsglocke mit dem der etwas kleineren Jungfrau-Maria-Glocke wunderbar ergänzen.
Es folgte die Einsegnung. Pfarrer Lanzinger schritt um das massive Holzgerüst, auf welchem die goldglänzende Glocke stand. Er besprengte sie mit Weihwasser, räucherte sie mit reichlich Weihrauch ein und schlug mehrfach das Kreuzzeichen über dem zehn Zentner schweren Glockengigant. Lateinische Gebete begleiteten seine Handlungen, bis er das Gestell dreimal umrundet hatte.
»Mama!« Der vierjährige Josef zupfte seine Mutter Katharina am Ärmel.
»Psst, Seppel, jetzt nicht! Der Pfarrer weiht gerade die Glocke. Da haben Kinder zu schweigen!« Seine Mutter legte den Zeigefinger an die Lippen. Auf ihrem Arm hielt sie ihre Tochter Mechthild. Josef schwieg – aber nur kurz. Wieder zog er seine Mutter am Arm.
»Mama, ich muss Pipi.«
»Ach Bub. Kannst du es nicht mal einhalten?«
Seppel schüttelte den Kopf. Katharina seufzte. Sie nahm Mechthild auf ihren anderen Arm und wendete sich an ihren zweiten Sohn. Johann Remigius stand an ihrer linken Seite und hatte seinen Blick fest auf die Glocke gerichtet. Er fand es faszinierend, dass diese Glocke den gleichen Namen trug wie er.
»Hans, geh du bitte mit Seppel. Ich kann hier jetzt nicht weg.«
Johann nickte überraschend schnell. Eine Unterbrechung schien ihm nichts auszumachen. Sich der steifen Zeremonie für einige Augenblicke entziehen zu können, machte ihm nichts aus. Hauptsache, er war wieder an seinem Platz, wenn man die Glocke auf den Turm hochzog. Er griff seinen Bruder bei der Hand und schlüpfte zwischen den Umstehenden hindurch aus der Menge. Gemeinsam gingen sie hinter das Rathaus, bis sie sich dem Blickfeld der Feiernden entzogen hatten. Seppel stellte sich an die hinterste Ecke des Gebäudes und strullerte erleichtert gegen die Wand, während der Bruder geduldig auf ihn wartete.
»Was macht der Junge da?« Eine forsche Stimme herrschte Hans an.
Erschrocken schaute Johann auf. Hinter ihnen stand ein Unteroffizier des Landgrafen. Aber es war nicht das bekannte Gesicht, das Johann schon seit einigen Jahren kannte. Dieser Mann blickte viel strenger drein, als es Unteroffizier Brehm je getan hatte. Mit energischer Miene hatte er seinen Bruder im Genick geschnappt. Das Gesicht des Unteroffiziers war rot angelaufen und die Augen funkelten den Jungen erbost an.
»Seppel musste mal«, verteidigte Johann seinen Bruder.
»Und da muss er genau auf das Wappen des Landgrafen pissen? Das ist eine schwere Beleidigung, die ich nicht dulden darf. Wer ist dein Vater?«
Jetzt erst sah Johann, dass tatsächlich am Sockel des Gebäudes eine gusseiserne Plakette mit einer Prägung angebracht war. Es war weder ihm noch seinem jüngeren Bruder bewusst gewesen, dass es sich dabei um das landgräfliche Wappen handelte.
Seppel begann zu weinen. Der Griff des Mannes war brutal fest.
»Sie tun ihm weh! Lassen Sie meinen Bruder los!«
»Ich werde einen Teufel tun, du Lümmel. Sag mir sofort, wer euer Vater ist. Na wird’s bald!«
»Franz Johann Mathes, aus der Hintergasse!«, gab Johann kleinlaut von sich. »Aber wir haben gar nicht bemerkt, dass da ein Wappen ist. Seppel musste einfach nur mal.«
»Du machst jetzt das Schild wieder sauber. Aber bisschen plötzlich!«
»Wie denn? Ich habe keinen Lappen?«
»Dann nimm den Ärmel deines Hemdes. Jedenfalls muss die Platte wieder blitzblank werden.«
Johann schaute den Mann ungläubig an. Verlangte er wirklich, dass er mit seinem Sonntagshemd die Pisse seines Bruders wegwischen sollte?
»Worauf wartest du? Jetzt mach schon!« Der Unteroffizier blitzte ihn mit grimmiger Miene an. Eingeschüchtert tat Johann, wie ihm befohlen wurde. Er zog das Hemd über seinen Handballen und wischte angewidert die Eisenplatte trocken. Da sie weit unten am Sockel saß, hatte sich nicht wenig Deck von der viel befahrenen Landstraße auf ihr angesammelt. Als der Junge fertig war, strotzte sein Ärmel nur so vor Schmutz. Mutter würde ihn ganz bestimmt schimpfen.
Der Soldat hatte ihm ungerührt zugeschaut und dabei das Genick seines Bruders fest im Griff gehalten. Endlich nickte er zufrieden.
»Das wird noch ein Nachspiel haben.«
Mit einem heftigen Stoß gab der Mann Josef wieder frei. Der Schwung war wohl heftiger dosiert, als er beabsichtigt hatte, denn Seppel knallte mit der Nase gegen die Wand des Rathauses. Er schrie auf und sofort lief ihm Blut aus beiden Nasenlöchern.
»Ups!«, entfuhr es dem Unteroffizier. Doch anstatt sich zu entschuldigen, schnauzte er: »Jetzt zier dich nicht so – Rotzbengel!« Leicht verlegen drehte er sich um und schritt wie ein aufgeblasener Gockel davon.
Johann nahm den anderen, noch sauberen Ärmel seines Hemdes und drückte ihn seinem heulenden Bruder auf die Nase. Jetzt war es auch egal, ob ein oder zwei Ärmel schmutzig wurden. »Komm, wir gehen zurück zu Mama.«
Josef dachte gar nicht daran. Er blieb trotzig stehen und plärrte los, dass ihm sofort Tränen über die Wangen kullerten. So herzzerreißend wie Seppel plötzlich zu schreien begann und sich bei jedem Schrei steigerte, war Hans sich sicher, dass der Kleine weniger vor Schmerz als vielmehr aus Trotz Krokodilstränen vergoss. Blut, Rotz und Augenwasser vermischen sich zu einem Rinnsal, das auch noch sein eigenes weißes Hemd rot einfärbte. Johann war nicht in der Lage, das Geschrei seines kleinen Bruders zu stoppen. Hemmungslos weinte Seppel und wurde immer lauter dabei.
»Hör auf! Du schreist das ganze Dorf zusammen!« maßregelte ihn Johann. Er wollte den Bruder zum nahen Dorfbrunnen ziehen, um ihn mit sauberem Wasser zu reinigen. Doch noch bevor er seinen Bruder an der Hand nehmen konnte, kam Katharina mit Mechthild um die Ecke.
»Was macht ihr denn für ein Geschrei? Man hört euch ja bis zum Kirchplatz!« Ihr ärgerlicher Blick wandelte sich abrupt in Sorge, als sie das blutverschmierte Gesicht ihres Sohnes sah.
»Um Gottes willen, was ist denn passiert? Wie siehst du denn aus?« Katharina stürzte auf ihren Jüngsten, ging auf die Knie und legte ihren freien Arm um ihn. Endlich ließen seine Schreie etwas nach. Er schlang beide Ärmchen um ihren Hals und schluchzte nur noch anrührend.
»Der Soldat hat mir weh getan!«, weinte er.
Mutter schaute verständnislos die beiden Jungs an. »Welcher Soldat? Ich sehe niemanden!«
Kurz berichtet Johann, was geschehen war. Katharina war so erbost, dass sie selbst hätte heulen können. Sind wir schon so weit, dass unser Militär Kinder blutig schlägt? Wütend schaute sie sich um, doch der Übeltäter war nirgends mehr zu entdecken.
»Kommt, wir gehen nach Hause. So schmutzig wie ihr beide seid.«
»Aber ich will sehen, wie sie die Glocke hochziehen«, wehrte sich Johann.
»Nichts da. Wir gehen sofort nach Hause; alle zusammen. So kann ich nicht mit euch unter die Leute, schau doch nur mal wie ihr ausseht.«
»Aber Mama … die Remigiusglocke … sie wird gleich hochgezogen. Ich werde so etwas nie mehr sehen können. Lass mich doch alleine zurückgehen.« Johann versuchte verzweifelt, seine Mutter zu überzeugen.
»Sei still. Du kommst mit. Oder glaubst du, ich will noch einen Zwischenfall riskieren. Wir gehen nach Hause, basta!«
Ob er wollte oder nicht, Mutter hatte entschieden. Johann stampfte mit dem Fuß auf und erntete prompt dafür einen Klaps auf die Wange.
»Du bist ungerecht!«, heulte nun auch der Sechsjährige und rieb sich die Backe. Katharina bereute sofort, dass ihr die Hand spontan ausgerutscht war. Sie wusste, dass sie überreagiert hatte. Sich aber bei Johann dafür zu entschuldigen, kam ihr dann doch nicht über die Lippen. Tief sog sie die Luft ein, schnappte Josef an der Hand und schubste Johann in Richtung Hintergasse. Auf dem Kirchplatz hatte Schultheiß Kaspar Lung das Wort ergriffen. Katharina hörte gerade noch, wie er die Freigiebigkeit der Mörler für die Beschaffung der Glocke pries und die hervorragende Arbeit des Gießener Glockengießers Friedrich Richard Wilhelm Otto lobte. Dann war sie außer Hörweite …
*
»Was macht der Bub auch für Sachen? Das kann uns teuer zu stehen kommen.« Franz war ungehalten, als Katharina ihm den Vorfall vom Rathaus schilderte. Er und ihr Ältester, Karl Heinrich, waren spät von der Glockenweihe nach Hause zurückgekehrt. Die Feierlichkeiten hatten länger gedauert als angenommen. Nach dem Schultheiß hatten noch der Schulvikar, einer der Ortsbeamten und zu guter Letzt der Glockengießer eine Rede gehalten. Dann endlich hatte Zimmermann Heil das Zeichen gegeben, die Glocke himmelwärts zu hieven. Mit zwei festlich geschmückten Kaltblütern wurde das Teil über den Flaschenzug in die Höhe gezogen. Die beiden Zimmerleute auf dem Turm mussten präzise Arbeit verrichten, damit das Metallmonstrum an seinem neuen Platz im Glockenstuhl eingehängt und befestigt werden konnte. Heute Abend um sechs würde die neue Glocke zum ersten Mal im Dreiklang mit der Dreifaltigkeits- und der Jungfrau-Maria-Glocke erklingen.
Johann hatte wieder zu schluchzen begonnen, als Vater vom Moment der Glockenaufhängung in höchsten Tönen schwärmte. Dass er dieses einmalige Spektakel verpassen musste, würde er seiner Mutter nie verzeihen.
»Was kann der neue Unteroffizier schon gegen einen Vierjährigen veranlassen? Der Junge wusste doch gar nicht, was er da tat. Bisher gab es noch nie Beschwerden gegen die Landgräflichen. Vielleicht hatte er nur einen schlechten Moment«, sprach sich Katharina selbst Mut zu.
»Wenn der Brehm noch da wäre, würde ich dir zustimmen, Käthchen. Der Neue kann ganz anders sein! Aber hoffen wir mal, dass du recht behältst. Ich will mir nicht vorstellen, was aus einer Anklage wegen Beleidigung des Landgrafen erwachsen könnte. Ich denke, ich gehe morgen früh gleich ins Rathaus und spreche mit dem Mann. Drück mir die Daumen, dass er sich dann wieder beruhigt hat und den Vorfall in einem anderen Licht sieht.«
»Mach das, Franz. Obwohl ich es als eine Unverschämtheit empfinde, dass der Kerl unseren Seppel so gegen die Mauer gestoßen hat, dass ihm die Nase blutete.«
Franz nickte. »Wer weiß, was den in diesem Moment geritten hat. Besser, ich reibe ihm das nicht unter die Nase. Wie geht es denn dem Seppel jetzt?«
»Wieder besser. Seine Schreie waren wohl eher dem Schreck als den Schmerzen zuzuschreiben. Seppel hatte einfach Angst vor dem Mann.«
»Verständlich!«, nickte Franz, »Und Hans? Der arme Kerl hatte sich so darauf gefreut, beim Aufhängen der Glocke zuzuschauen. Du hättest ihn doch ruhig zu mir schicken können.«
»Bei den vielen Leuten hätte er dich doch gar nicht gefunden.« Katharina zögerte. »Es tut mir ja selbst leid, dass ich es ihm verboten habe. Aber ich war so aufgebracht und der Kleine war so voller Blut.«
»Schon gut. Ich mach’ dir gar keinen Vorwurf. Der Junge wird’s verkraften. Wir müssen alle mal auf etwas verzichten. Vielleicht können wir es ihm irgendwann mit etwas anderem vergelten.«
»Wir sollten bei Gelegenheit daran denken«, nickte Katharina. Sie dachte einen kurzen Augenblick nach und fragte dann: »Was hältst du davon, wenn wir Josef Groß fragen, ob Hans heute Abend mit ihm als erster die neue Glocke läuten darf.«
Franz schaute seine Frau an. Sein Gesicht hellte sich schlagartig auf: »Deine Einfälle sind einfach umwerfend, Käthchen. Lass uns essen und dann geh’ ich rüber zum Schulhaus.«
»Am besten, du nimmst noch eine von den Dauerwürsten aus der Räucherkammer mit.«
Der Bauer lachte: »Der Vikar wird hocherfreut sein!«
*
Um sechs Uhr am Abend schlug die Jungfrau-Maria-Glocke der Kirchturmuhr viermal vor, dann antwortete die tiefe Stimme der Dreifaltigkeitsglocke mit sechs dumpfen Stundenschlägen.
Überall im Dorf blieben die Leute stehen und lauschten erwartungsvoll dem neuen Dreiklang. Sekunden später ertönte die Remigiusglocke zum ersten Mal. Zunächst nur alleine, doch schon nach wenigen Schlägen stimmten die beiden alten Glocken mit ins Abendgeläut ein. Auf dem Knoten am Seilende der neuen Glocke ritt ein stolzer Johann Remigius Mathes. So sehr er sich auch zusammennahm, er konnte nicht verhindern, dass ihm eine dicke Träne über die Wange kullerte. Diesmal war es eine Freudenträne. Er konnte es nicht fassen, dass der Glöckner Josef Groß ausgerechnet ihm angeboten hatte, die neue Glocke anzustimmen.
Sowohl er als auch sie trug den Namen des Kirchenpatrons. Gott sorgte doch noch für Gerechtigkeit auf dieser Welt!
*
Franz betrat das Rathaus mit einem flauen Gefühl im Magen. Er wusste, dass die fünf Soldaten des Landgrafen sich hier aufhielten, wenn sie nicht gerade auf Patrouille durchs Dorf flanierten. In Ermangelung eines Dorfpolizisten hatten sie sich in den letzten Jahren als Ordnungshüter nützlich gemacht.
Bisher hatte er noch nie etwas mit den Landgräflichen zu tun gehabt. Er war als unbescholtener Einwohner des Dorfes davon ausgegangen, dass er auch nie mit ihnen zu tun haben werde. Ihr bisheriger Vorgesetzter, Unteroffizier Fridolin Brehm, war ein sehr umgänglicher Mensch gewesen. Im Schwanen hatte er sogar ab und an bei ihnen am Tisch gesessen. Warum man ihn nun gegen den Neuen ausgetauscht hatte, entzog sich dem Wissen des Bauern. Doch schien der Neue von anderem Schrot und Korn zu sein, das hatte der gestrige Vorfall mit seinen beiden Söhnen unterstrichen. Franz hatte sich vorgenommen, schlichtend auf den Mann einzuwirken. Eine Eskalation wollte er unter allen Umständen vermeiden.
Er straffte seinen Körper und klopfte an die Tür des Ordnungsamtes.
»Ja?«, ertönte eine Stimme von innen.
Franz drückte die Türklinke herab und trat in einen Raum, in dem zwei Tische standen. Um einen davon saßen drei Personen in Uniform; Gefreite, wie Franz sofort an ihren Rangabzeichen ablesen konnte. Offensichtlich hatte er sie beim Frühstück gestört, denn auf dem Tisch lagen ein Laib Brot, Käse und Wurst. Daneben stand ein Butterfässchen und in einem Korb lagen Eier.
»Guten Morgen. Ich möchte den Unteroffizier sprechen.«
»Wer möchte das?«, fragte einer der Drei mit vollem Munde. Er blickte Franz ob der unpassenden Störung missbilligend an.
»Mein Name ist Franz Johann Mathes. Ich wohne in der Hintergasse und der Unteroffizier hat gestern …«
»Ach, Sie sind der Vater von dem Tunichtgut, der unseren Landgrafen angepinkelt hat!«, fiel ihm der Mann ins Wort. Er schluckte den Bissen hinab, der sich noch in seinem Mund befand.