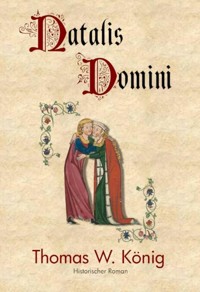
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Morle, ein Dorf in der Wetterau zur Zeit des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa. Der junge Morler Konrad hat den größten Teil seines bisherigen Lebens in der Fremde verbringen müssen. Nach Jahren in der Benediktinerabtei Lorsch und einer aufregenden Zeit in der aufstrebenden Stadt Frankfurt am Main, kehrt er zurück in sein Dorf im Usbachtal. Hier hofft der junge Mann wieder mit offenen Armen aufgenommen zu werden. Sein Wunsch ist es, die alte Küferwerkstatt seines Vaters zu neuem Leben erwecken zu können. Die Dorfgemeinschaft empfängt den Rückkehrer mit Wohlwollen; doch muss Konrad rasch erkennen, dass sich die Zeiten geändert haben. Ein neuer Dorfpfaffe ist ihm gegenüber unerklärlich reserviert und spinnt urplötzlich abstruse Intrigen. Als Konrads Bruder Wilhelm sich in zwielichtige Geschäfte verwickelt und durch den Friedberger Burggrafen Roderich mit dem Galgen bedroht wird, zwingen die Umstände den Heimkehrer das Dorf umgehend wieder zu verlassen. Er will versuchen, Fürsprache beim Lehnsherren der Mörler Mark, Graf Siegfried, im österreichischen Peilstein einzulegen. Ein Abschied, der umso schmerzlicher fällt, als da just in diesen Tagen ein Mädchen namens Juliane seine Wege kreuzt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 966
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas W. König
Natalis Domini
Überarbeitete Ausgabe der
Urfassung von 1998
17. Februar 2023
KV05
Impressum
Texte: © 2023 Copyright by Thomas W. König
Umschlag & mit Motiven aus dem gemeinfreien Codex
Abbildungen: Manesse Universitätsbibliothek Heidelberg
© 2023 Copyright by Thomas W. König
Verantwortlich
für den Inhalt: Thomas W. König
Am Heiligenstock 5
61231 Bad Nauheim
Druck: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Thomas W. König
Historischer Roman
Für Lisa, Judy und Danny
Danksagung
Dieser Roman erzählt nicht nur eine Geschichte, er hat auch eine. Die Urform der Erzählung entstand bereits 1994. Eine Woche Strohwitwerdasein brachten die ersten Zeilen aufs Papier. Sie entwickelten eine Eigendynamik und überraschten mich nach vier Jahren mit einem über tausend Seiten starken Manuskript – mein erster Roman war geboren.
Damals entschloss ich mich aus Kostengründen, den Roman nicht in Druck zu geben, sondern in Heimarbeit als handgebundenes Buch unter dem Pseudonym Tim Goonshake – einem Anagramm meines Namens – Freunden und Bekannten zur Lektüre anzubieten.
Trotz eines erfreulich positiven Feedbacks versackte das Manuskript auf der Festplatte meines Computers, bis mich gut zwanzig Jahre später ein Zufallsleser mit Bitten überhäufte, den Roman verlegefähig zu machen.
Ein Vierteljahrhundert nach Entstehen der ersten Zeilen von Natalis Domini hatten sich die Möglichkeiten einer Buchveröffentlichung deutlich verbessert. Heute findet man viele Internetanbieter, die Kleinstauflagen bis hin zu einem einzigen Exemplar unterstützen.
Bei Arbeiten an einer Eishockey-Chronik für meinen Herzensclub EC Bad Nauheim hatte ich Gabriele Kern, eine freie Lektorin und Autorin, kennengelernt. Durch ihre ausgezeichnete Arbeit hatte sie mich schnell begeistert und so bat ich sie um das Lektorat meines Debütromans. Erfreulicherweise sagte sie zu und ließ das Werk aufblühen wie eine verkümmerte Pflanze, der man endlich etwas Dünger verabreichte. Gabys Lektorat deckte historische und inhaltliche Mängel auf, beseitigte misslungene Ausdrucksformen und half meine Unzulänglichkeiten in Orthografie und Interpunktion in erträglichem Rahmen zu halten. Die Story schrumpfte sich von 1069 auf 784 Seiten gesund und präsentiert sich nun sehr viel geschmeidiger. Kein Wunder, denn Gaby hat ein überaus empfehlenswertes Paperback »Die literarische Diät« verfasst, welches jedem Autoren-Rookie einen wunderbaren Leitfaden zur Stiloptimierung an die Hand gibt.
So gilt mein herzlicher Dank vor allem Gabriele für ihr überaus hilfreiches Lektorat. Ohne ihre Hilfe hätte ich den Schritt zur Veröffentlichung sicher nicht gewagt. Dank sage ich aber auch meiner Schwester für die Weitergabe der Urfassung an ihren Bekannten Franz, denn nur durch dessen Plädoyer für eine Veröffentlichung fand Natalis Domini wieder den Weg aus dem Backup-Ordner.
Nicht zu vergessen sei bei diesem Dank auch meine Familie, die mir in den 1990er Jahren die Muse ließ, eine Geschichte zu ersinnen und zu Papier zu bringen.
So halten Sie jetzt den überarbeiteten Roman in der Hand und ich hoffe, er bringt Ihnen ein paar kurzweilige Stunden.
Bad Nauheim, im Februar 2023
Thomas W. König
Prolog
Der Anfang
Anno Domini 1117
»Es ist ein Junge! Herr, Ihr habt einen zweiten Stammhalter!«
Die Stimme der Kammerzofe überschlug sich vor freudiger Erregung, als sie in den Herrensaal der Burg eilte. In ihrer ungestümen Euphorie vergaß sie beinahe die Wahrung der gebotenen Ehrerbietung ihrem Dienstherrn gegenüber. Nachträglich beugte sie ergeben die Knie vor dem Mann, der abrupt in seinem nervösen Auf- und Abschreiten innegehalten hatte.
»Ein Junge?«
Heftig nickte die Bedienstete zu seinen Füßen und ihre Augen strahlten in neugieriger Erwartung.
»Ist die Herrin wohlauf?«
Wiederum beantwortete die Magd die Frage durch ein Kopfnicken.
Der Mann ballte seine Rechte zur Faust und stieß sie in die Handfläche der Linken. Erleichtert verschaffte er seiner Anspannung Luft und ließ den Atem durch die zusammengebissenen Zähne entweichen.
»Hol meinen Erstgeborenen. Er soll seinen Bruder zusammen mit mir begrüßen!«
»Ja, Herr!«
Die Zofe enteilte durch den Rundbogen der Tür. Sein zufriedener Blick folgte ihr. Bis sie mit dem Zweijährigen zurückkommen würde, war Zeit genug, sich auf den Neuankömmling einen guten Schluck zu gönnen. Gottfried griff zu dem silbernen Pokal, der auf dem Tisch in der Mitte des Raumes stand und füllte ihn aus der tönernen Amphore bis zum Rand. Er hob den Kelch wie ein Priester über seinen Kopf und – als befände sich ein ganzer Heerbann im Saal – stimmte er feierlich einen Trinkspruch an:
»Ich heiße dich willkommen, mein Sohn. Möge dein Leben zu Ruhm und Ehre führen, auf dass du dem Lande und deinem Vater zum Stolze gereichst!«
Dann setzte er das dünnwandige Gefäß an die Lippen und leerte es in einem einzigen Zug.
Er hatte allen Grund, zufrieden zu sein, denn die Frau an seiner Seite hatte ihm innerhalb zweier Jahre bereits den zweiten Sohn geschenkt. Eine gute Frau, dachte Gottfried. Sie gibt sich erst gar nicht mit unnützen Töchtern ab. Söhne, das, was für einen Mann wirklich zählt, setzt sie in die Welt! Gleichzeitig traf sein Stolz auch ein wenig seine eigene Person. War es doch sein Samen, der bei ihr so prächtig gedieh.
Gottfrieds Ländereien erstreckten sich weit über die ausgedehnten Wälder und Hügel des Schwabenlandes. Herzog Friedrich war ihm stets gewogen gewesen und hatte sein Einflussgebiet für die geleisteten Treuedienste immer wieder um ein ansehnliches Lehen erweitert. Männliche Nachkommen konnten Gottfried nur recht sein, um dieses Land auch auf Dauer zusammenzuhalten. Sicher, es würde sich eines Tages die Frage der Nachfolge stellen; nur einer konnte Herr über die Ländereien werden. Doch warum sich heute schon den Kopf über Dinge zerbrechen, die noch in so weiter Ferne lagen. Gottfried hatte keineswegs die Absicht, schon in wenigen Jahren das Zeitliche zu segnen. Er war ein Mann in den besten Jahren, gute dreißig. Fünfundzwanzig, dreißig Jahre – ja wenn es Gott genauso gut mit ihm meinte wie Friedrich, vielleicht sogar vierzig und mehr – gedachte er das Leben noch auszukosten. Söhne waren da genau das Richtige, um die Sicherheit des Landes zu garantieren.
Die Zofe trat mit dem zweijährigen Erstgeborenen an der Hand in den Herrensaal.
»Der junge Herr, Eure Erlaucht!«, knickste die Zofe.
»Schön! Lass uns in die Kemenate gehen. Ich will endlich meinen neuen Sohn sehen.«
Mit stolzgeschwellter Brust schritt er die steinerne Treppe hinauf, die die einzelnen Etagen des Wohnturmes miteinander verband. Hier in der Burg war es immer kühl und düster. Nur wenn die Treppe in eine der drei Plattformen mündete, gab es nach allen vier Himmelsrichtungen hin kleine Sehschlitze. An hellen Sommertagen wie heute reichte dieses Licht, um die Treppe zu beleuchten. Man konnte die einzelnen Stufen im Dämmerlicht noch gut genug erkennen, um gefahrlos auf- und abzusteigen. Kam jedoch der Herbst mit seinen trüben und tristen Tagen über das Land, mussten die Tücken des Wendelganges unbedingt durch Fackellicht entschärft werden.
Der Herrensaal lag in der untersten Etage. So ließen sich Besucher einfacher empfangen. Die zweite Plattform beherbergte die Tagesräume, in denen sich der Graf in der Regel aufzuhalten pflegte. Erst ganz oben befanden sich die Schlafgemächer. Viele hatten ihn ob dieser Aufteilung schon verlacht.
»Wie unpraktisch, wenn du nach einem zünftigen Gelage die vielen Stufen hinaufgetragen werden musst«, spotteten sie. Aber Gottfried war keineswegs ein Saufkumpan, der es sich zur Gewohnheit hätte werden lassen, eine Orgie nach der anderen zu veranstalten. Es hatte einen nicht zu unterschätzenden Vorteil, die Nächte in der obersten Etage des Wohnturmes zu verbringen. Ungebetene Besucher waren von dem umlaufenden Söller schneller auszumachen als aus ebenerdiger Sicht. Und waren sie doch einmal in die Burg eingedrungen, so konnte er durch einen ausgeklügelten Mechanismus von seinem Schlafgemach aus Fallgitter für jede Etage herunterlassen, sodass in einer bedrohlichen Situation seine Familie fürs Erste in Sicherheit war.
Heute allerdings kam er ob seiner Eile leicht ins Schnaufen, bis er endlich oben angelangt war. Die Zofe öffnete ihm die Tür und er trat leise in den Raum der Wöchnerin. Sein Weib lag in frische weiße Linnen gebettet und schien zu schlafen. Doch als er und der Kleine eintraten, drehte sie den Kopf zur Seite und streckte ihm die Hand entgegen.
»Gottfried! Wie schön, dich zu sehen«, lächelte sie ihn an. Kraftlos sah sie aus; kraftlos und matt. Doch glücklich, die Geburt gut überstanden zu haben.
Sie versuchte sich etwas aufzurichten, aber das rosige Etwas an ihrer linken entblößten Brust hinderte sie daran. Ein schwarzer Pelz bedeckte das Köpfchen, dessen Mund die ersten Tropfen Milch aus dem mütterlichen Busen zu saugen versuchte.
Rasch trat Gottfried an ihre Seite. Sie sollte sich nicht seinetwegen anstrengen müssen. Er beugte sich über sie und das Kind und küsste ihre Stirn. Behutsam nahm er den kleinen Körper von ihrer Brust und hob ihn mit seinen knorrigen Händen hoch.
Sofort erfüllte ein markdurchdringender Schrei die Schlafkammer, als das Kind nicht mehr die Brustwarze der Mutter zwischen seinen Lippen fühlte. Gottfried lachte. Eine gesunde Stimme und einen starken Willen hat er, dachte er.
»Willst du deinen Bruder sehen?«
Der Graf wendete sich dem Älteren zu. Nur zaghaft wagte sich der Zweijährige an das schreiende Neugeborene. Seine kleine Hand reckte sich schüchtern und berührte die Wange des Schreihalses. Das Köpfchen drehte sich und augenblicklich packte der zahnlose Kiefer den entgegengestreckten Finger.
Erschrocken zog der Knabe seine Hand zurück.
»Au! Er hat mich gebissen!«, schrie er bestürzt. Eingeschüchtert wandte er sich von dem neuen Bruder ab.
Die Muhme
Anno Domini 1124
Der Sturm zauste an den Bäumen und nur einzelne Blätter hielten sich noch an den Ästen. In diesem Jahr stob der Herbst so wild und ungestüm, wie er es selten tat.
Zwei Jungen im zarten Knabenalter von sieben und neun Jahren lagen im Unterholz des Waldes auf der Lauer und fieberten der erwarteten Jagdgesellschaft entgegen. Graf Gottfried hatte zur Jagd geladen und seinen Söhnen erlaubt, sich an diesem sicheren Ort zu verstecken, um die wilden Reiter mit ihren hetzenden Hunden zu beobachten.
»Sie müssen jeden Augenblick da sein!«, machte der Ältere sich und seinem Bruder Mut, die Wartezeit bald überstanden zu haben.
»Ich werde sie vor dir sehen«, neckte der Jüngere.
»Wirst du nicht!«
»Werd’ ich doch!«
Der Ältere zeigte sich ungerührt ob des rechthaberischen Gebarens des Jüngeren, denn so war es eigentlich immer. Sein Bruder Tholo hatte sich, seit er reden konnte, stets und allerorten vorzudrängen und ins rechte Licht zu rücken versucht. Gut, dass er in seinem älteren Bruder einen Menschen hatte, der sich genauso mit der zweiten Reihe abfinden konnte; wenn auch nicht immer leichten Herzens.
So hielt er auch heute seinen Mund und dachte: Es ist schließlich egal, wer die Reiter als Erster sieht. Hauptsache, sie kommen bald.
Es war kühl und feucht. Die letzten Tage waren verregnet gewesen und überall hing die Nässe noch klamm in dem moosigen Waldboden.
Der Kopf des jüngeren Knaben schoss unvermittelt nach vorn: »Sie kommen!«, rief er triumphierend aus und deutete mit der kleinen Hand in die Richtung, von wo sie die Jäger erwarteten.
Die Augen des Bruders flogen in die angedeutete Richtung. Kein Gebell, kein Hufschlag kündigte die Erwarteten an.
»Wo?«, wollte er wissen und reckte seinen Kopf ein Stück höher.
»Ha! Du siehst sie noch nicht? Bin ich also doch der Erste!«
Nirgends war ein Reiter oder ein Hund zu sehen, sosehr der Große auch die Augen anstrengte. Da – endlich vernahm er das Rascheln eilig fliehender Tiere. Kaum zehn Klafter von ihnen entfernt brachen grunzend zwei Wildschweine durch das Unterholz. Doch kamen sie aus einer gänzlich anderen Richtung, als Tholo gedeutet hatte. Unbestimmte Zweifel überkamen den Erstgeborenen. Hatte der Bruder tatsächlich die Tiere bereits vor ihm wahrgenommen oder war er lediglich einer Provokation aufgesessen, die das Glück nun nachträglich geradezurücken versuchte?
»Sie kommen, sie kommen!«
Vor Erregung klatschte der Siebenjährige in die Hände und vergaß alle gebotene Vorsicht. Um ein Haar wäre er aufgesprungen, hätte sein Begleiter ihn nicht zu Boden gezogen.
»Pssst! Du vertreibst ja das Wild!«
Schon hörten sie das Gebell der Hunde, und nur kurz darauf kamen Reiter, dicht an die Rücken ihrer Tiere geschmiegt, durch das Buschwerk geprescht. Der Boden erzitterte unter den stampfenden Hufen der Pferde, und den Kindern stieg der beißende Geruch schwitzender Rösser in die Nase.
Das ganze Geschehen währte nur wenige Augenblicke. So schnell die Jäger aufgetaucht waren, so schnell waren sie auch verschwunden.
»Ihnen nach! Ich will sehen, wie sie die Schweine stechen.«
Wieder war es der Jüngere, der aufgesprungen war und der verschwindenden Schar nachzusetzen trachtete.
»Nein, hiergeblieben!« Die brüderliche Hand hielt ihn erneut zurück. »Vater erlaubte uns nur, die Passage zu beobachten. Danach sollen wir unverzüglich zur Burg zurück!«
»Du hast Angst vor den Wildschweinen!«, grinste Tholo herausfordernd.
»Blödsinn! Aber wir müssen Vaters Anordnung befolgen.«
»Ach was. Vater hat uns erlaubt, die Jagd zu beobachten. Was haben wir denn bis jetzt schon gesehen?«
Das Jagdfieber hatte den kleinen Heißsporn übermannt. Für einen Wimpernschlag standen sich die beiden Jungen als Rivalen gegenüber. Der eine wild entschlossen, der davon stürmenden Meute zu folgen, der andere mit sich kämpfend, ob er dem Vater gehorchen oder sich dem Willen des Jüngeren beugen sollte.
»Komm schon, sei nicht feige! Wenn wir nicht gleich folgen, sind sie weg. Keiner wird uns erwischen und Vater wird es nie erfahren.«
Er wartete gar nicht auf eine Antwort, sondern rannte los.
»Halt! Bleib hier!«, schrie ihm der Bruder nach. Er war sich schmerzhaft bewusst, dass ihm der Vater den Jüngeren anvertraut hatte. Gottfried hatte ihm eindringlich aufgetragen, den Bruder ja im Auge zu behalten. Nur diesem Versprechen vertrauend, hatte der Graf überhaupt dem Bitten der Kinder stattgegeben und ihnen das alljährlich wiederkehrende Spektakel gestattet.
Die Vernunft des Neunjährigen war ausgereift genug, um zu erkennen, dass er sich in einem kaum lösbaren Zwiespalt befand. Folgte er dem Bruder, so missachtete er die Anordnung des Vaters; folgte er ihm nicht, verletzte er seine brüderliche Aufsichtspflicht. Egal, was er tat, es war das Falsche.
Mit einem verärgerten Schnauben tat er seinen Unmut kund; entschloss sich aber dann, dem Bruder hinterherzulaufen. Es erschien ihm angemessener, dem Jüngeren Beistand zu gewähren, als ein ohnehin schon teilweise gebrochenes Versprechen einzulösen.
Mit großen Sprüngen versuchte er, Tholo einzuholen. Die Jäger waren inzwischen verschwunden. War es nicht Irrsinn zu glauben, den Berittenen zu Fuß folgen zu können? Eigentlich war auch sein Bruder alt genug, dies einzusehen.
»He! Bleib stehen! Die sind doch über alle Berge!«
Seine Worte verhallten unbeachtet. Starrköpfig rannte der Siebenjährige weiter. Er war flink, das musste sein Bruder eingestehen. Behände sprang er über Wurzeln, schlüpfte unter Sträuchern hinweg und wich geschickt Hindernissen aus. Sicherlich hätte er eine ganze Weile den Vorsprung aufrechterhalten, wäre er nicht unverhofft in ein durch Laub verdecktes Loch im Boden gestolpert.
Einen spitzen Schrei ausstoßend, knickte er um und sank ins feuchte Herbstlaub. Mit Entsetzen sah der Ältere, wie sein Bruder zur Seite kippte und sich an den linken Fuß fasste.
Er erreichte den Verunglückten nur wenige Atemzüge später; der Fuß indes war bereits dick angeschwollen. Wimmernd und weinend befühlte der Kleine vorsichtig den klumpigen Knöchel. Noch völlig außer Puste kniete der Erstgeborene besorgt neben ihm nieder:
»Tut’s weh? Zeig mal her. – Oh, ist das schon dick!«
Seine Finger tasteten behutsam nach der Schwellung.
»Au! Verdammt, willst du mir noch mehr wehtun?«, fauchte ihn der Knabe an.
»Was rennst du auch so blindlings davon! Wir hätten die Reiter nie und nimmer eingeholt.«
»Spar dir deine Belehrung und hilf mir lieber hoch!«, giftete Tholo. Doch als die hilfreiche Hand des Bruders ihn aufzurichten versuchte, heulte er sogleich auf:
»Mein Fuß! So pass doch auf! Oh, mein Fuß!«
Der Neunjährige war kräftig gebaut. Beherzt griff er dem lädierten Bruder unter die Arme und versuchte ihn zu schultern. Doch trotz Tholos schmächtiger Gestalt war die Last für einen Knaben nicht zu bewältigen.
So blieb dem älteren Grafensohn nichts anderes übrig, als unter Aufwendung all seiner Kräfte den kleinen Körper über den lehmigen Waldboden zu schleifen. Was hatte er für eine andere Wahl, wollte er den Verletzten nicht hier allein zurücklassen? Das Wehklagen missachtend, gab er sein Bestes, den Bruder nach Hause zu bringen.
»Tze, tze, tze! Was ist denn mit dem Herzliebchen passiert?«
Eine talgige Stimme hinter seinem Rücken erschreckte den Neunjährigen zu Tode. Ruckartig schwenkte er herum und ließ seinen Bruder unsanft zu Boden fallen. Hinter ihnen stand eine Frau, das zerschlissene Schultertuch zum Schutz gegen den Wind über die langen, struppigen Haare gezogen. Die Kinder blickten in ein maskenhaft altersloses Gesicht. Die Augen standen eine Idee zu weit auseinander, und zwischen ihnen entsprang eine dünne, breitflügelige Nase, die sich fast bis hinab auf die schmalen Lippen erstreckte. Aus dem leicht geöffneten Mund blinkten zwei helle, makellose Zahnreihen.
Die beiden Jungen waren zu beschäftigt gewesen, als dass sie das plötzliche Erscheinen des seltsamen Weibes bemerkt hätten. Unvermittelt stand sie hinter ihnen. Auf dem Rücken trug sie eine kleine, aus Weidenruten geflochtene Kiepe, in der sie allerlei Pflanzen wie Blutweiderich, Baldrian, Tausendgüldenkraut und verschiedene Wurzeln gesammelt hatte; ein Kräuterweib auf der Suche nach Heilpflanzen, wie es den Brüdern schien.
Der Schreck hatte das Jammern des Jüngeren verstummen lassen. Erst als sich das Kräuterweib zu ihm hinunterbeugte und mit kundiger Hand den dick geschwollenen Fuß betastete, stöhnte er wieder auf.
»Ei, ei, ei! Herzliebchen! Böse Sache. Hast wohl nicht aufgepasst? Gebrochen ist aber nichts!«, beruhigte sie ihn.
Noch immer stand der ältere Bruder verschreckt neben der Erscheinung und versuchte, das Zittern seiner Glieder unter Kontrolle zu bekommen. Argwöhnisch betrachtete er die Gestalt.
»Was glotzt du wie ein Hornochse? Hast du das kleine Herzliebchen so übel zugerichtet?«
Ihr Atem roch streng nach Minze. Die Heftigkeit ihrer ungerechtfertigten Attacke brachte dem Angesprochenen die Sprache zurück.
»Er ist in ein Loch getreten und umgeknickt!«, verteidigte sich der Junge.
»Tze, tze, tze!«, fauchte das Kräuterweib. Sie schubste den Älteren beiseite und schlüpfte aus den Tragriemen ihrer Kiepe. Den Korb neben sich ins Laub setzend, stöberte sie in dem Sammelsurium aus Blättern, Wurzeln und Knollen, bis sie schließlich eine großblättrige Pflanze und eine Wurzel hervorzog. Vom Waldboden nahm sie eine Handvoll feuchte Erde auf, versetzte sie mit ihrem Speichel und knetete daraus einen Teig. Dann zauberte sie aus der Tasche ihrer Schürze einen kleinen Tiegel samt Stößel hervor, zerstieß die Wurzel zu einem milchigen Brei und strich alles zusammen auf das Blatt. Mit diesem Pflaster umwickelte sie sorgfältig die geschwollene Stelle. Zum besseren Halt verknotete die Alte das Blatt mit einer dünnen Hanfschnur.
»Ihr seid von der Burg, nicht wahr?«
Der Blick ihrer katzenhaften Augen traf den Neunjährigen und veranlasste ihn, dieses Gesicht nicht zu mögen. Er nickte trotzdem.
»Wir müssen heim! Sofort!«
Seinen Versuch, erneut Tholos Arme zu packen und ihn weiterzuschleppen, unterband die Frau mit giftigem Zischen:
»Weg da! Du reißt dem Herzliebchen ja noch die Arme aus.«
Mit einer Leichtigkeit, die der Neunjährige ihr nicht zugetraut hätte, hob sie den Verletzten auf und drückte den Jungen an ihre Brust.
»Los jetzt! Ich bringe euch zum Waldrand! Du nimmst den Korb!«
Ohne eine Widerrede zu dulden, stampfte sie mit dem verletzten Kind auf dem Arm voraus. Wortlos schnappte der Bruder die Trage und folgte ihnen.
Unterwegs begann der Siebenjährige wieder zu weinen.
»Ah, ah, ah!«, krächzte die Frau und streichelte dem Jungen, das nackte Bein. Es wirkte, denn der Knabe beruhigte sich rasch.
Am Waldrain angelangt, setzte sie ihre Last behutsam ab.
»Na, Herzliebchen! Jetzt ist es nicht mehr weit bis nach Hause. Das letzte Stück wird dich dein ungeschickter Bruder wohl noch allein tragen können.«
»Bringst du mich nicht nach Hause?«, winselte der Kleine bei dem Gedanken, erneut von seinem älteren Bruder über den Weg gezerrt zu werden. Die Frau aber schüttelte den Kopf.
»Von denen da halte ich mich fern!«
Der Kleine verlegte sich aufs Betteln: »Bitte. Mein Vater wird dir die Hilfe auch lohnen!« Seine Blicke hingen an ihrem Gesicht und schenkten ihr ein scheues Lächeln.
»Aber Herzliebchen! Ich will doch keinen Lohn. Es war mir eine süße Freude, dich zu tragen«, gab sie kichernd zurück. »Macht nun, dass ihr nach Hause kommt!«
Der Erstgeborene war froh, das Weib wieder loszuwerden. Rasch packte er den Bruder und wollte ihn davonschleppen, doch das Kräuterweib gebot ihm nochmals Einhalt.
Sie griff in die Tasche ihres Umhangs und zauberte zwei getrocknete Früchte hervor. Diese hielt sie den beiden hin.
»Hier! Zum Abschied! Lecker und zuckrig; kostet!«
Nein, dem Älteren widerstrebte es, von dieser Frau etwas anzunehmen. Etwas in ihrem Wesen behagte ihm nicht. Er schüttelte den Kopf und murmelte einen ablehnenden Dank.
Sein Bruder teilte diese Bedenken in keiner Weise. Beherzt griff er nach den Leckereien und schob sich sogleich eine Frucht in den Mund.
»Wo wohnst du?«, meinte er schmatzend.
Ein diebisch glucksendes Lachen kam über ihre schmalen Lippen.
»Mal hier, mal dort ...«
»Darf ich dich besuchen kommen?«, hakte Tholo nach.
»Wann immer du willst, Herzliebchen. Komm einfach hierher an den Waldrand. Ich werde dich finden und abholen.«
Mit diesen Worten schnappte sie ihre Kiepe, drehte sich um und stelzte zwischen den Bäumen davon.
*
Graf Gottfried hatte mit der Jagdgesellschaft die Festung längst wieder erreicht, als auch die beiden Knaben endlich zu Hause eintrafen. Selbst die kurze Strecke war den Brüdern zur Tortur geworden. Am Ziel angekommen waren sie beide mit ihren Kräften am Ende.
Unterwegs hatte der Kleine unentwegt lamentiert. Sicher, es war anzunehmen, dass die Art und Weise seiner Beförderung nicht die bequemste war. Doch fand der Ältere, dass sein Bruder auch kein bisschen die Zähne zusammenbiss. Einzig um den Bruder zu tadeln und zu beschimpfen, unterbrach er sein ständiges Gequengel.
Aber Tholo hatte die Zeit auch genutzt, um sich Gedanken zu machen, wie er die Schelte des Grafen umgehen könne. Denn, dass der Vater eine Strafpredigt über ihn ergießen würde, wenn er den ursächlichen Auslöser des Unfalls erführe, war selbst dem Siebenjährigen klar.
Das Ergebnis dieser Überlegungen blieb nicht lange sein Geheimnis. Der Vater stellte die Jungen unmittelbar nach ihrem Eintreffen zur Rede. So überraschte Tholo seinen Bruder mit einer dreisten Variante, als er dem Vater den Hergang des Missgeschicks schilderte:
»Stephan wollte unbedingt die Reiter verfolgen. So hetzten wir durch den Wald, und ich übersah wohl eines der vielen Kaninchenlöcher. Mein Fuß tut mir so schrecklich weh.«
Der Groll des Grafen entlud sich in einer schallenden Ohrfeige für den sprachlosen Bruder. Die Unverfrorenheit des Jüngeren und die Betroffenheit über die Gutgläubigkeit des Vaters raubten ihm jeden Willen zur Rechtfertigung.
Aber mehr als die körperliche Züchtigung schmerzte ihn in seinem kleinen Herzen der Zusammenbruch einer Welt des Vertrauens. Er fühlte sich in seinem Selbstwertgefühl zutiefst verletzt. Warum nur glaubte der Vater dem Bruder solch heimtückische Lügen? Er sollte ihn doch gut genug kennen, um zu wissen, dass er niemals so verwerflich handeln würde.
Das verbitterte Schweigen des Bruders ließ Tholo innerlich triumphieren. Zum ersten Mal hatte er die Erfahrung gemacht, dass man nicht im Recht sein musste, um einen Menschen auf seine Seite zu ziehen. Verschlagenheit, Dreistigkeit und ein bisschen Mut zum Risiko öffneten so manch unüberwindlich geglaubtes Tor.
Vater hatte sich für ihn entschieden, nicht für den Erstgeborenen. So, schwor sich Tholo, sollte er es auch möglichst weiterhin halten.
Schwarze Kunst
Anno Domini 1140
Der junge Tholo saß wie so oft in den letzten Jahren in der abgelegenen Hütte der Kräutermuhme. Wieder einmal hatte er sich heimlich zu ihr geschlichen, um sich ihres Beistands zu bedienen. In den langen Jahren ihrer Bekanntschaft war die Alte für ihn zu einer Vertrauten geworden. Schon als Knabe hatte er Trost bei ihr gesucht, wenn er sich mit Spielgefährten überworfen oder einen Konflikt mit seinem Bruder durchzustehen hatte. Sie besaß Scharfsinn und Witz, und er konnte sicher sein, dass sie auf alle Lebensfragen eine passende Antwort wusste.
Graf Gottfried, sein Vater, hatte ihm bereits mehrfach ohne Erfolg den Umgang mit dieser Frau verboten, denn sie hatte verwerfliche Referenzen. Die Kräutermuhme war in der ganzen Gegend als Gifthure verschrien. Ein Schimpfname, der sie kurz, aber treffend, charakterisierte. Zum einen verfügte sie über das Wissen, aus Wurzeln, Kräutern und Mineralien Elixiere und Wundermittel herzustellen, die Gebrechen heilen, aber auch auslösen konnten, derweil sie andererseits gegen klingende Münze dem lüsternen Mannsvolk bereitwillig ihren Rock lüftete.
Es ging gar das Gerücht, dass sie das eine mit dem anderen zu verbinden verstand, indem sie sich durch schwarze Magie in eine begehrenswerte Jungfrau verwandeln konnte.
Der jüngste Sohn des Grafen sah dies allerdings mit anderen Augen. Das Weib hatte ihm dereinst seine Schmerzen zu lindern gewusst, als er mit seinem Bruder unerlaubter Weise einer Jagdgesellschaft gefolgt war. Er hatte ihre Kunst schätzen gelernt. Die Gifthure selbst verlachte jene Menschen, die sie mit diesem Namen bedachten. Sie wusste nur zu genau, dass sowohl die Zauberpülverchen als auch ihre Liebesdienste immer wieder gerne in Anspruch genommen wurden.
Der junge Herr suchte sie weder des einen noch des anderen Geschäftes wegen auf, sondern, weil er ihr freundschaftlich verbunden war. Die Kräutermuhme, wie sie sich selbst am liebsten nannte, hatte ihn vom ersten Augenblick eng in ihr Herz geschlossen. Es war ihr ein Festtag, wenn Herzliebchen sie zur Kurzweil besuchen kam. Sie ließ dann auf der Stelle ihr Tagewerk fallen und widmete sich ausschließlich ihm und seinen Anliegen.
Wahrscheinlich, so sagte sich Tholo, war dies auch der Grund, warum er sie mochte. Kein anderer Mensch, weder Vater noch Bruder, weder Freund noch Bekannter – seine Mutter hatte diese Welt bereits verlassen – gab ihm, was die Muhme ihm gab.
Diesmal aber war sein Besuch in ernsthafter Sorge begründet. Er saß missmutig auf dem niedrigen Schemel und ereiferte sich heftig:
»Stephan hat es endgültig geschafft! Mein Vater hat mir heute unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass ich niemals Graf werden würde. Mein Bruder wird die Nachfolge antreten.«
Er seufzte aus tiefstem Herzeleid und ergänzte kopfschüttelnd: »Mir dagegen hat er einen Werdegang in der Kirche zugedacht! Man stelle sich das vor: Während mein lieber Bruder die Freuden der Herrschaft genießt, soll ich mir die Knie auf steinernen Altarstufen blank scheuern!«
»Du, ein Pfaffe? Am Ende ein Würdenträger gar?«
Sie kicherte amüsiert. Ihr Herzliebchen konnte sie sich beim besten Willen nicht im Schoße von Mutter Kirche vorstellen.
»Lach mich nicht aus!«, erboste sich der junge Mann. »Es ist ohnehin schon schlimm genug für mich.«
»Bist du nicht Manns genug, den Erstgeborenen auszubooten? Herzliebchen, Herzliebchen, ich dachte, du seist aus anderem Holze.«
»Du weißt genau, dass ich alles versucht habe. Manchmal glaubte ich gar, mein Ziel erreichen zu können, doch Vater besteht auf der Geburtsfolge.«
»Tze, tze, tze! Und nun suchst du meinen Rat?« Die Gifthure wiegte den Kopf. »Ad astra per aspera; es ist schwierig, die Sterne zu erringen!«, meinte sie, die zehn Finger vor ihrem Gesicht spreizend. »Aber ich bin nichts als ein machtloses Weib!«
»Machtlos?«
Da war der Besucher ganz anderer Meinung. »Nein, du bist nichts weniger als machtlos. Du verfügst über Kräfte, die, richtig eingesetzt, Berge versetzen können.«
Die Muhme fühlte sich geschmeichelt. Trotzdem fragte sie scheinheilig:
»Wie meinst du das?«
»Stell dich nicht dumm. Du bist pfiffig genug, um mich ganz genau zu verstehen. Ich wäre heute nicht zu dir gekommen, hätte ich nicht einen Plan mit dir zu bereden.«
Er schwieg kurz, um die Wirkung seiner Worte auf die Muhme zu taxieren. Sie schien interessiert an seinen Ausführungen. So fuhr er fort:
»Seit langem schon suche ich nach einer Möglichkeit, um meinem Bruder die Übernahme der Grafschaft unmöglich zu machen. Nun, ich kam zu einem Entschluss. Doch dazu benötige ich deine Hilfe. Wirst du mir beistehen?«
»Du weißt, für dich würde ich fast alles tun! Was verlangst du von mir?«
Er nickte zufrieden; er hatte sich also nicht in ihr getäuscht.
»Mein Bruder muss bei Vater in Ungnade fallen. Er muss etwas tun, was ihm der Alte niemals verzeiht.«
Die Muhme nickte zustimmend.
»Gut gesagt, doch was ist dabei meine Rolle?«
Tholos Augen leuchteten im festen Glauben, ein äußerst gewitzter Fuchs zu sein.
»Es ist ganz einfach. Du nimmst ihn zwischen deine Schenkel und ich sorge dafür, dass Vater und alle Welt es erfährt!«
Die Muhme stockte kurz, schlug sich dann aber wie ein Mannsbild auf die Knie und brach in lautstarkes Gelächter aus.
»Danke! Danke für die Blumen, Herzliebchen!«
Sie wischte sich mit dem Handrücken ein paar Tränen aus den Augen. »Aber dafür dürfte ich garantiert nicht die richtige Person sein.«
»Warum nicht?«
Verärgert über ihr Gelächter, warf Tholo ein: »Hast du es nicht schon vielen Männer besorgt?«
»Wenn’s nur das wäre. Aber dein Bruder ist doch ein Heiliger. Hat er denn jemals schon seine Finger unter einen Rock gebracht? Glaubst du im Ernst, es gelänge einem alten Weib wie mir, diesen Stockfisch zu verführen!«
Erneut amüsierte sie der Vorschlag ihres Besuchers zu Tränen.
»Hör auf zu lachen!«, fuhr sie der Bursche an. »Du kannst Stephan mit einem deiner Zaubertränke gefügig machen. Ich weiß, dass du das kannst! Man erzählt sich weit schwierigere Dinge von dir.«
Mit einem Schlag verstummte das Lachen der Muhme.
»Jetzt reicht’s aber! Ich bin keine Hexe; was immer man auch behaupten mag. Die Kräuterkunst hat mit schwarzer Magie nichts zu tun!«
Im Schein des flackernden Herdfeuers betrachtete der junge Herr das Kräuterweib. Sie hatte noch immer die glatte Haut, die ihm schon bei der ersten Begegnung aufgefallen war. Ihr Gesicht wirkte so alterslos wie damals.
Es fiel ihm außerordentlich schwer, ihre Lebensjahre zu schätzen. Das alte Weib, als das sie sich selbst bezeichnet hatte, war sie gewiss nicht. Vielleicht mochte sie dreißig sein – oder wenig darüber?
Wenn er es aber recht bedachte – nein – sie musste wesentlich mehr Lenze zählen, war sie doch vor fünfzehn Jahren, als er sie kennenlernte, schon erwachsen.
Verdammt, dachte Tholo, und wenn sie tausendmal behauptet, keine Hexe zu sein, sie muss die Zauberei beherrschen. Wie wäre es ihr sonst möglich, die Anzeichen des Alters von sich fernzuhalten? Keine ihre Mägde, die jenseits der fünfunddreißig standen, hatten die straffe und jugendliche Haut der Muhme. Ihre Haare waren grau oder zeigten zumindest Ansätze dazu. Nicht so das Haar seiner Vertrauten. Es glänzte pechschwarz wie bei einem jungen Ding.
Aber einerlei, ob sie sich nun auf Hexerei verstand oder nicht: Sie sollte ihm helfen und nicht über seine Pläne spotten. Niemals würde er akzeptieren, dass der Bruder ihm die angestrebte Herrschaft wegschnappte. Er verlegte sich aufs Flehen:
»Hilf mir! Bitte, Muhme, hilf mir!«
Ihr Gesicht entspannte sich. Nur kurz hatte sie der Gedanke verärgert, ihr Herzliebchen halte sie für eine Gespielin des Teufels. Sie strich ihm über das Haar wie einem kleinen Kind.
»Wir werden einen anderen Weg finden. Lass mich nur machen.«
Sie lächelte voller Zuneigung. Ihre warmen Hände liebkosten seine Wangen. Im Grunde war es ein schmeichelndes Kompliment, dass der junge Mann ihr diese Verführungskünste zutraute. Er schien sie für ein Weib zu halten, an der die Männerwelt noch Gefallen fand.
»Du bist also der Meinung, ich könne deinem Bruder gefallen! Ach Herzliebchen; sag, findest du mich hübsch?«
Eine Frage, die sich Tholo noch nie gestellt hatte. Die Muhme war für ihn immer mütterliche Ratgeberin gewesen, weiter nichts. Doch da die Frage nun einmal ausgesprochen war, versuchte er, sie für sich zu klären. Sein Blick strich mit den Augen eines Mannes über die Hausherrin. Das Halbdunkel der Hütte schmeichelte ihr und die zuckenden Schatten des Feuers legten einen geheimnisvollen Ausdruck in ihre Züge.
Es wollte dem Besucher scheinen, als vollzöge sich eine Wandlung bei seiner Gastgeberin. Ihre Haare glänzten verführerisch und umrahmten verlockend ihr Gesicht. Die grünen Augen funkelten wie Edelsteine. Selbst die schmalen Lippen, die für ihn niemals die Wollust einer Dirne verkörpert hatten, wirkten mit einem Mal außerordentlich einnehmend.
Schlagartig wurde dem jungen Herrn bewusst, dass sie mit ihrer Frage etwas in ihm aufgebrochen hatte, was zuvor fest verschlossen in seinem Inneren verborgen gewesen war. Er spürte die Körperwärme, die über ihre Hände in seine Wangen floss und das Blut in Wallung brachte.
Noch immer stand ihre Frage unbeantwortet im Raum. Er konnte nicht umhin, sie mit einem zaghaften Nicken zu bejahen. Die Muhme lächelte zufrieden, beugte sich zu ihm hinüber und drückte dankbar ihre Lippen auf seinen Mund. Sie hatte ihn schon öfters geküsst, aber es waren mütterliche Küsse gewesen. Dieser aber ließ Tholo einen Schauer der Lust über den Rücken gleiten.
»Hast du denn schon einmal?«, hauchte sie ihm ins Ohr.
Er fühlte die Schamröte in seinem Gesicht aufsteigen. Der Muhme hätte er seine Unschuld frank und frei eingestanden, doch dieser Frau? Nein, niemals könnte er das Geständnis über seine Lippen bringen. Andere Männer in seinem Alter hatten ihre ersten Erfahrungen schon lange gesammelt. Es kam ihm selbst seltsam vor, dass er mit seinen dreiundzwanzig Jahren noch nie einem Weib beigewohnt hatte. Obwohl, und gerade das brannte ihm nun wie glühendes Eisen auf dem Herzen, fast allabendlich die Lust in ihm heraufkroch, wenn er auf seinem Lager lag. Bisher hatte er sich immer auf andere Weise Erleichterung verschafft. Bei der Vorstellung, welche Gelegenheit sich ihm hier auftat, versteinerte sein Geschlecht fast augenblicklich.
»Komm!«, flüsterte ihm die Frau zu und zog ihn vom Schemel hoch. Willenlos gab er ihrer Aufforderung nach. Sie drückte ihren Körper fest gegen seinen Leib. Sanft begann sie sich an ihm zu reiben. Der junge Herr stöhnte vor Begierde auf. Ermuntert durch ihren Erfolg, schubste sie ihn auf die Strohschütte und raffte ihr Gewand hoch.
Tholos Blick gierte fiebernd auf die schlanken Beine. Von den straffen Fesseln glitten seine Augen hinauf über zwei wohlgerundete weiße Schenkel bis zu der Stelle, wo sie sich in einem dichten, kohlrabenschwarz gelockten Dreieck vereinten. Der Anblick raubte ihm schier den Verstand.
Sie muss eine Hexe sein!, durchfuhr es ihn. Anders konnte er sich die Kräfte, die ihn so fest in ihren Bann zogen, nicht erklären. Wie konnte dieser aufreizende Körper seinen Augen bisher verborgen geblieben sein? Unter dem formlosen Gewand aus Lumpen hätte er niemals dergleichen vermutet. Doch nun, da er ihn sah, stand nicht die Kräutermuhme vor ihm, sondern die Frau, die er schon so lange in seinen nächtlichen Träumen herbeigesehnt hatte.
Keuchend bemühte sich der junge Herr, die hinderlichen Beinkleider abzustreifen. Seine vor dem Bersten stehende Männlichkeit aber ließ den enganliegenden, rauen Wollstoff nicht über die Lenden rutschen. Vorzeitig entlud sich kraftvoll die Woge der Begierde. Feuchte Wärme ergoss sich in die wollenen Beinlinge, noch bevor sich die Frau ihm anvertrauen konnte.
Gott, war es ihm peinlich. So dicht hatte er davorgestanden, endlich ein richtiger Mann zu sein, und nun passierte ihm dieses Missgeschick. Er schloss voller Scham die Augen.
Die Verführerin blickte entgeistert auf den sich langsam verfärbenden nassen Fleck und ließ enttäuscht ihr Gewand sinken.
»Herzliebchen, Herzliebchen! Tze, tze, tze!«, seufzte sie und strich über die feuchte Stelle seines Beinkleides. »Das ging aber gründlich in die Hose«, fügte sie kichernd hinzu.
Der Spott ernüchterte den Mann augenblicklich. Das begehrenswerte Weib vor seinen Augen verschwand ebenso schnell, wie das Trugbild gekommen war. Vor ihm stand die alte Giftmischerin; keine Spur mehr von der verführerischen Jungfrau, die ihn soeben noch verlangend herausgefordert hatte.
Das war der Beweis! Nun schwor er jeden Eid darauf: Sie ist eine Hexe! Weiß der Teufel, wie sie es anstellt, diese zwei Gesichter in einem Körper zu vereinen. Ihn überlief eiskalter Schauer der Ernüchterung bei dem Gedanken, sich beinahe mit einer Hexe eingelassen zu haben.
Sein Atem ging stoßweise. Sollte er mit ihr brechen? Durfte er die nun schon viele Jahre andauernde unschuldige Beziehung zu ihr aufrechterhalten, oder lag sein Vater richtig, als er ihn ermahnte, dieses Weib zu meiden?
Seine Gedanken flogen in wilden Sprüngen hin und her. Sie hatte ihn lächerlich gemacht, vielleicht sogar in voller Absicht. Mit Abscheu wandte er sich von der Muhme ab. Er wollte mit diesem Weib nichts mehr zu schaffen haben. Aber dann fragte er sich, ob es nicht besser sei, eine solche Macht auf seiner Seite zu wissen! Um wieviel gefährlicher wäre es, sie zur Gegnerin zu haben? Sein Entschluss reifte in wenigen Augenblicken: Er würde an ihr festhalten! Dieses Debakel jedoch sollte ihm eine eindringliche Lehre sein: Nie wieder durfte er es ihr gestatten, sich ihm in dieser Weise zu nähern. Tholo wollte sich zukünftig besser vor ihren Kräften hüten.
Die Nachfolge
Anno Domini 1142
Der Graf lief mit bleiernen Schritten in der großen Halle auf und ab. In Erwartung seines Jüngsten, den er zu sich hatte rufen lassen, suchte er nach den rechten Worten. Der Ernst der Stunde gebot ihm, endlich ein klärendes Wort mit Tholo zu sprechen. Die Entscheidung dazu hatte er sich keineswegs leicht gemacht, doch hielt er es unter den gegebenen Umständen für die beste aller Möglichkeiten.
Das dumpfe Schlurfen lederner Stiefel verriet das Nahen des Sohnes.
»Ihr wünscht mich zu sprechen, Vater?«
Gottfried fuhr herum. Trotz der geräuschvollen Ankündigung wurde er aus seinen Gedanken gerissen.
»Ah – gut, dass du da bist! Ich muss mit dir reden.«
Er wies dem Sohn einen Platz zu.
»Komm, setzen wir uns. Reden wir offen, wie es sich für Männer geziemt!«
Was will der Alte von mir? Tholo wurde vorsichtig. Selten war es ein gutes Zeichen, wenn sein Vater unverhofft eine offene Rede ankündigte. Trotz der Unsicherheit tat er, wie ihm geheißen und setzte sich dem Vater gegenüber an die große Tafel.
»Schenk uns Wein ein!«, forderte Gottfried seinen Sohn auf. »Mit trockener Kehle redet es sich schlecht.«
Der Gerufene atmete etwas leichter. Dies wiederum ist ein gutes Zeichen, dachte er. Man bietet seinem Gast keinen Wein, wenn man ihn schelten will. Er goss die beiden bereitstehenden Pokale voll, reichte einen dem Vater und hob den anderen an den Mund.
Der Wein war gut. Kalt und süß. Er würde die restlichen Ängste schon vertreiben. Erneut füllte der Sohn sein Gefäß. Der Vater winkte dankend ab.
»Ich mache mir große Sorgen«, begann Graf Gottfried. »Große Sorgen um die Zukunft unseres Landes.«
»Aber Vater! Weshalb? Das Land bringt gute Erträge, uns fehlt es an nichts.«
»Dieser Zustand ist nicht gottgegeben, sondern Lohn harter Arbeit und vorausblickender Führung – meiner Führung.«
»Natürlich, so sehe ich das auch«, schmeichelte der junge Mann. Wenn er nicht gänzlich falsch vermutete, war es die Einleitung zu einem Gespräch über die Zeit nach Vaters Herrschaft. Ein äußerst interessantes Thema, wie er fand.
»Aber Ihr habt zwei Söhne, die das Werk dereinst in Eurem Sinne weiterführen werden. Auch hier sehe ich keinen Grund zur Besorgnis!«
Der Graf blickte ihm lange in die Augen. Es war ein unangenehmer Blick, der die Tiefen seiner Seele zu erkunden suchte.
»Einer von euch, nur einer, wird die Grafschaft übernehmen können. Wer, glaubst du, wird der geeignete dafür sein?«
Eine Frage, die der Jüngere niemals erwartet hätte. Vater hatte immer seinen Bruder als designierten Nachfolger angesehen. Sollte seine Saat erfolgreich aufgegangen sein? Er musste vorsichtig und diplomatisch zu diesem Thema Stellung beziehen. Vater würde ihm nie verzeihen, wenn er ihm auf den Kopf zusagte, dass er den Bruder auszustechen trachtete.
»Nun, das Recht des Erstgeborenen kann ich nicht geltend machen, doch halte ich mich nicht für ungeeignet«, gestand er deshalb dem Vater.
Der Graf nickte, aber seine Antwort klang alles andere als zustimmend:
»Dein Bruder hat die besseren Anlagen. Er ist besonnen und für sein Alter sehr erfahren, was man von dir nicht immer behaupten kann. Doch lassen wir zunächst diesen Punkt noch offen. Ich habe mich nämlich entschlossen, deinen Bruder in ein Kloster zu geben.«
Fast wäre Tholo vor Freude von seinem Platz aufgesprungen. Hieß das nicht, dass er freie Bahn hatte? Aber er zügelte seine Erregung und zwang sich, ruhig den weiteren väterlichen Ausführungen zu lauschen.
»Es ist wegen seiner Krankheit! Sie ist es, die mir die meisten Sorgen bereitet!«
Ah, also doch! Zwei Jahre war es nun her, da er der Kräutermuhme seinen Kummer um das verloren geglaubte Erbe der Grafschaft anvertraut hatte. Die Pläne, den Bruder durch unziemliches Handeln bloßzustellen, hatte die Muhme verlacht, und es war zu jener Schmach gekommen, an die er ungern zurückdachte. Doch hatte sich sein Festhalten an der Vertrauten gelohnt. Ihr erfinderischer Geist hatte eine Alternative gefunden, die nun endlich Erfolge zu zeigen schien.
Seit zwei Jahren verabreichte er dem Bruder heimlich das Elixier, welches ihm das Kräuterweib zugesteckt hatte. Es sollte den Erbfolger schwächen und langsam ins Siechtum treiben. Lange hatte Tholo vergeblich auf die beabsichtigte Wirkung warten müssen. Doch nach einem halben Jahr wurde der Bruder kränklich, lag öfters auf seinem Lager und verlor zusehends die Fähigkeit, dem Vater zur Hand zu gehen. Für den Jüngeren war die Zeit gekommen, seiner Chance auf die Nachfolge den Boden zu bereiten.
Die Muhme hatte ihrem Herzliebchen zu verstehen gegeben, dass man notfalls mit einem etwas stärkeren Mittel die Lebensflamme des Älteren vollends ausblasen könne, sollte der Graf auf Biegen und Brechen an dem Erstgeborenen festhalten. Niemandem würde es auffallen, wenn ein kränklicher Mann plötzlich seinem Siechtum erläge. Die risikolose und völlig unverfängliche Vorgehensweise hatte Tholo auf Anhieb fasziniert.
Nun also war es so weit! Vater hatte endlich die von ihm angestrebten Konsequenzen aus der heimtückischen Tat gezogen. Doch nun galt es, Nägel mit Köpfen zu machen. Es war nicht genug, den Bruder in einem Kloster zu wissen. Wer garantierte, dass er sich dort nicht rasch wieder erholen würde, wenn nur die entsprechende Droge seinem Körper entzogen wurde? In einem Kloster war Stephan für Tholo außer Reichweite. Alles wäre vergeblich gewesen, käme der Ältere rasch wieder zu Kräften. Nach Graf Gottfrieds Worten stand zu befürchten, dass seine Chancen auf die Grafschaft damit unwiederbringlich verwirkt seien.
Also kam es darauf an, dem Vater das Versprechen hier und jetzt zu entlocken. Ein für alle Mal musste geklärt sein, dass er, Tholo, der zukünftige Graf sein würde. Er musste es geschickt anstellen.
»Ihr habt Recht, Vater. Der Arme ist in einem bedauernswerten Zustand. Doch ihn zum jetzigen Zeitpunkt in die Obhut einer Abtei zu geben, halte ich nicht für geraten.«
Der Graf war erstaunt.
»Warum? Die Mönche verstehen sich auf die Krankenpflege. Ihre Gebete werden zusätzlich zu seiner Genesung beitragen.«
»Das tun wir doch auch jeden Tag. Sicherlich schließt Ihr ihn nicht minder stark in Eure Andacht ein als es ein Mönch tun kann.«
»Gewiss, gewiss. Aber ...«
»Kein Aber! Muss ich Euch daran erinnern, dass Ihr dem Bruder einen schlechten Dienst erweisen würdet? Hier auf der Burg ist Stephan in Eurer Nähe. Trotz seiner Krankheit ist er in der Lage, Eure Regierungsgeschäfte zu verfolgen. Wenn er dereinst Graf sein wird, braucht er dieses Wissen. Ihr sagtet gerade, dass Ihr Euch auch um das Land sorgt. Also behaltet ihn hier unter unserer Pflege und Eurer Anleitung.«
Wieder blickte der Vater lange Zeit stumm vor sich nieder, als kämpfe er gegen eine innere Macht. Doch dann erhob er den Kopf, griff in sein Wams und zog ein zusammengerolltes Pergament hervor.
»Du hast mich überzeugt!«
Dem Jüngeren stockte der Atem. War er doch zu weit gegangen und hatte gerade Vater zu einem Entschluss ermuntert, den er vermeiden wollte? Natürlich sollte der Bruder abgeschoben werden, und zwar so endgültig, dass ihm, Tholo, die Grafschaft sicher war. Seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt.
»Dein Herz ist besser als die Leichtlebigkeit deiner Jugend vermuten lässt!«, meinte der Vater. »Ich habe das Erbe geregelt. Allein, mir fehlte der Beweis, dass du dieser Entscheidung würdig bist. Die Fürsorge um deinen Bruder zeigt mir dein gutes Herz. Du wirst die Grafschaft übernehmen, da dein Bruder gesundheitlich nicht dazu in der Lage sein wird. Hier ist die schriftliche Beglaubigung. Ich hoffe, du erweist dich meines Vertrauens würdig!«
Er reichte ihm die Rolle. Der Sohn öffnete sie zitternd. Was er dort sah, hätte er in seinen kühnsten Träumen nicht mehr zu hoffen gewagt. Gottfried dokumentierte schriftlich seinen Willen, ihn zum Nachfolger zu ernennen. Eine bessere Sicherheit als das geschriebene Wort konnte er nicht bekommen. Damit war seine Zukunft gesichert.
»Vater!«, stammelte er aufrichtig bewegt. Doch währte die Rührung nur einen Herzschlag lang. Er presste das Dokument an seine Brust und heuchelte:
»Mir ist, als würde ich meinen eigenen Bruder bestehlen. Er rechnete sicherlich fest mit der Herrschaft.«
Der Edelmann ergriff die Hand seines Sohnes und drückte sie fest:
»Deine Handlungsweise ehrt dich. Doch glaube mir, es ist so für ihn das Beste. Du bist ein willensstarker Mensch; noch fehlende Eigenschaften wirst du mit der Zeit erwerben. Ich aber kann ab heute wieder ruhig schlafen und weiß die Geschicke des Landes in gesunden Händen.«
Es gab Tholo einen Stich, dass Vater ihm fehlende Eigenschaften attestierte. Aber das Wichtigste hatte sich am heutigen Tag geklärt.
»Ihr werdet diesen Schritt nicht bereuen, Vater«, versicherte er dem Alten.
Er stand auf und wollte sich rasch entfernen. Oh, wie brannte er doch darauf, seinen Erfolg der Kräutermuhme mitzuteilen. Zum Gelingen hatte sie ein gerüttelt Maß beigetragen. Doch der Vater schien noch nicht am Ende seiner Aussprache zu sein.
»Es gibt da noch einen weiteren Punkt, den ich mit dir besprechen muss.«
Der junge Herr horchte auf. Was sollte es nun noch zu besprechen geben? Es war alles gesagt – zumindest alles, was er hören wollte.
»Bedenke! Es ändert sich mit dieser Entscheidung einiges in deinem Leben. Als zukünftiger Herr über dieses Land übernimmst du Verantwortung. Mehr Verantwortung, als dein bisheriges Pflichtbewusstsein gezeigt hat.«
Verdammt, Alter, haltet endlich Euer Maul mit diesen Herabwürdigungen, dachte Tholo. Doch sprach er die Gedanken nicht aus.
»Vater, ich ...«
»Höre mir zu!«, unterband der Graf jeden Einwand. »Ich will dich nicht tadeln, denn du hast mir heute gezeigt, dass du mein Vertrauen verdienst. Aber es gibt etwas, was sich nun, da du der zukünftige Herr dieser Grafschaft bist, ändern muss. Du hast in all den Jahren, da du zu einem Mann herangewachsen bist, nie von Heirat gesprochen. Ständig bist du nur mit deinen Kumpanen zusammen. Fast will mir scheinen, du hältst dich von Weiberröcken mit Absicht fern.« Gottfrieds Gesicht verfinsterte sich. »Ich weiß aber um deine heimlichen Treffen mit dieser Gifthure. Gott verzeihe mir die Sünde, zu hoffen, dass sie es ist, die dir deine Begierde stillt. Es wäre mir zuwider; doch allemal lieber, als dich mit einem Mann im Bett ...«
Er konnte nicht weitersprechen. Ein dicker Pfropf drohte ihn zu ersticken.
»Vater, Ihr glaubt doch nicht ...?«
Der Sohn zeigte sich ob dieser Vermutung entrüstet. Wie konnte Vater ihn für einen gottverdammten Sodomisten halten? Natürlich fand er Gefallen am weiblichen Geschlecht! Doch, seit jener Demütigung in der Hütte der Muhme fehlte es ihm an Mut, sich nochmals mit einer Frau einzulassen. Er befürchtete, ein zweites Versagen triebe ihn in den Wahnsinn. Jedes Mal, wenn er in der Gegenwart einer hübschen Maid fleischliches Verlangen verspürte, stand ihm das hämische Grinsen der Muhme vor Augen. So hatte er zur Befriedigung seiner Lust stets den Weg pubertierender Knaben gewählt. Er hasste jeden Finger seiner Hand dafür.
»Ich glaube gar nichts«, wiegelte Gottfried ab. »Aber ich weiß, dass der Herr einer Grafschaft Nachkommen braucht. Und ohne ein Weib wirst du nie legitime Söhne zeugen. Deshalb fordere ich dich eindringlich auf, dir eine Frau zu suchen. Versprich es mir!«
Der kummervolle Blick Gottfrieds löste sich erst, als sein Sohn ihm zunickte.
»Ja, Vater! Ich verspreche es Euch!«
Graf Morgen
Anno Domini 1145
Unter den einstmals zufriedenen Bewohnern der Grafschaft wuchs die Furcht vor einer ungewissen Zukunft. Es brauchte nicht viel Weitblick, um den Niedergang der lebenswerten Verhältnisse abzusehen. Graf Gottfried war in die Jahre gekommen und es war nur eine Frage der Zeit, bis der junge Herr seinen Platz einnehmen würde.
Was dies für die Bevölkerung bedeutete, konnte sie an den zahllosen kleineren und größeren Übergriffen erkennen, die sich immer dann ereigneten, wenn Tholo in Gottfrieds Auftrag, aber unter eigener Regie, unterwegs war, den Zehnt einzutreiben. Der Graf hatte ihn beizeiten dazu bevollmächtigt, an seiner Statt die Abgaben einzusammeln, um den Sohn an zukünftige Aufgaben heranzuführen. Er beabsichtigte dadurch die Verbundenheit der Menschen mit dem zukünftigen Herrn zu stärken.
Doch der junge Herr sprang rücksichtslos mit den Bauern um. Er schikanierte die Leute, die nicht uneingeschränkt und ohne Aufforderung ihre Ernteeinkünfte zur Bestimmung des Abgabeanteils offenlegten. Nicht selten verlangte er zusätzlich zum Zehnt einen Extraanteil für seine private Schatulle. Widersetzte sich jemand, so konnte es passieren, dass in der darauffolgenden Nacht eine Kuh, ein Schwein oder ein anderes lebenswichtiges Gut abhandenkam.
Man munkelte, der Grafensohn schrecke auch nicht davor zurück, den Hof Abgabeunwilliger mit dem Roten Hahn zu schmücken. Schon öfters waren Ställe oder Scheunen in Flammen aufgegangen. Natürlich konnte niemand diese Verfehlungen dem Grafensohn offen in die Schuhe schieben, denn nie gab er sich die Blöße, eine Verbindung zu dem tragischen Ereignis nachweisen zu lassen.
Alle Beschwerden, sofern sich die Leute überhaupt dazu durchringen konnten, stießen bei Graf Gottfried auf taube Ohren. Er wollte nichts davon hören, dass sein Sohn die Grafschaft tyrannisiere. Tholo legte sich denn auch bei seinem Vater mächtig ins Zeug, um Anschuldigungen jener Art als Verleumdungen zu dementieren und zu bestrafen. So wurde von der Bevölkerung schon aus Angst vor Konsequenzen meist der Mantel des Schweigens über die Vorfälle gebreitet.
Solange Gottfried selbst die Herrschaft über das Land hatte, sorgte er dafür, dass Geschädigten, bei denen er dennoch zu dem Schluss kam, sein Sohn könne Unrecht haben walten lassen, ein angemessener Ausgleich zuteilwurde. Dies zehrte zunehmend an den Rücklagen der Grafschaft, sodass der junge Herr mit entsprechenden Gegenmaßnahmen die Verluste wieder einzutreiben versuchte. Ein Teufelskreis, der auf dem Rücken der Bauern ausgetragen wurde und nach Ansicht des jungen Herrn nur durch die Machtübertragung auf seine Person gestoppt werden konnte.
»Vater, wann werdet Ihr endlich Euer Versprechen einlösen und mir die Grafschaft übergeben?«
Seit nunmehr drei Jahren hatte er die Zusage Gottfrieds; sein Vater stand nicht nur im Wort, sondern hatte dies auch auf Pergament dokumentiert, welches Tholo aus Furcht, er könne es verlieren, immer in seinem Wams am Leibe trug. Doch der alte Graf machte keine Anstalten, seine Ankündigung umzusetzen.
»Ich kann mich nicht erinnern, dir ein solches Versprechen gegeben zu haben. Alles, was ich zusagte, war, dass du mich dereinst in der Nachfolge beerben wirst. Noch erfreue ich mich bester Gesundheit.«
Der Landesherr war erbost über die Ungeduld seines Sohnes. Im Stillen hatte er angesichts der sich mehrenden Vorfälle schon des Öfteren seinen Entschluss bereut. Aber für einen Widerruf war es ohne Gesichtsverlust zu spät. Selbst den Herzog hatte er seinerzeit übereilt von der Änderung der Erbfolge in Kenntnis gesetzt. Einen Weg zurück gab es nicht.
»Aber Vater, könnt Ihr nicht einsehen, dass ich endlich eine Lebensaufgabe brauche?«
»Habe ich dir nicht schon reichlich Verantwortung übertragen? Du bist in alle Entscheidungen eingebunden, bist eigenständig bei der Berechnung des Zehnten und hast die Vollmacht, die Abgaben bei der Bevölkerung einzutreiben. Was willst du mehr?«
»Die Unabhängigkeit, Vater! Heute muss ich für alles, was ich tue, Eure Zustimmung einholen. Wer kann ein Land regieren, solange er selbst noch Knecht ist?«
»Du vergisst, dass wir alle noch einen Herrn über uns haben. Mein Herr ist der Herzog. Über ihm steht der König, und dieser hat sich immer noch vor dem Allmächtigen zu rechtfertigen. Keiner von uns ist unabhängig!«
Der Sohn knirschte mit den Zähnen.
»So wollt Ihr mich zwingen, Euch den Tod an den Hals zu wünschen, nur damit ich endlich etwas gelte?«, fragte er ergrimmt.
Gottfried fuhr herum. Er blickte dem Sohn strafend in die Augen. Ihm wurde kalt, als er in das entschlossene Gesicht sah. Es war Tholo zuzutrauen; ja – dieser Wunsch war ihm zuzutrauen.
Hätte er sich doch damals nie zu diesem Versprechen durchgerungen. Sein Ältester, seit drei Jahren Mitglied der Bruderschaft des Heiligen Benedikt, wäre der bessere Mann für diese Aufgabe gewesen. Nun, da er sich dank der guten Fürsorge der Mönche von seiner Krankheit erholt hatte, hätte er ihm gerne und aus vollem Herzen die Geschäfte anvertraut. Doch, selbst wenn er sein Wort gegenüber dem Jüngeren gebrochen hätte, selbst dann wäre es zu spät für die Rücknahme dieser Entscheidung gewesen. Der Erstgeborene hatte sich für Gott entschieden. Die Bruderschaft hatte ihn ob seines selbstlosen und friedfertigen Charakters gerne aufgenommen. Das Studium der Theologie hatte ihm den Weg zur Priesterweihe geebnet und er stand kurz davor, das Sakrament zu empfangen.
Der Alte schüttelte seine schwermütigen Gedanken ab und machte sich bewusst, dass er selbst die Schuld für diese Entwicklung trug. Doch machten ihn die Worte Tholos bange.
Gottfried seufzte zutiefst berührt.
»Bewahre dich Gott vor einem solchen Frevel! – Nun gut, ich mache dir einen Vorschlag.«
Überrascht schaute der Sohn den Vater an. Hatte er ihn soweit?
»Ich höre gespannt!«
»Du wirst die Grafschaft übernehmen, sobald du ein Weib gefunden hast und sie vor Gott zur Frau nimmst. Mein Geschenk für diese Ehe wird die Herrschaft sein.«
Du bist ein gewiefter Hund, dachte der junge Herr. Vater hatte ihm schon vor langem ans Herz gelegt, sich zu vermählen. Aber der Graf kannte auch das Problem, das Tholo mit Frauen hatte. Dieses zu überwinden würde ihm nicht leicht fallen.
Es gibt schließlich der Weiber so viel wie Flöhe im Fell eines Straßenköters, sagte sich der Sohn. Irgendeine wird sich schon finden lassen.
»So sei es! Ich willige ein!«
Von diesem Tag an galt sein Streben der Suche nach einem Weib. Es war für ihn die erwartet schwierige Aufgabe, denn sein Charme war der eines rostigen Ambosses und sein Zartgefühl entsprach einem Nagelbrett. Keine gute Voraussetzung, das Herz seiner Zukünftigen zu erobern.
Tholo gab es bald auf, Jungfrauen den Hof zu machen. Sein Leumund hatte in der Grafschaft bereits so sehr gelitten, dass kein angesehener Vater die Tochter freiwillig in eine Ehe mit dem Grafensohn gegeben hätte. Erbost über die Kälte, die man ihm entgegenbrachte, änderte der Freier seine Strategie. Er dingte eine Handvoll zwielichtiger Gestalten und ließ sich Bewerberinnen zu einer abgelegenen Jagdhütte bringen, um sie auf ihre Tauglichkeit zu prüfen. Große Sorgfalt ließen seine Schergen bei der Auswahl ihrer Opfer nicht walten. Sie griffen jede unachtsame Jungfer auf und führten sie der Brautschau des Grafensohnes zu.
Tholo wusste selbst, wie gering die Aussichten auf Erfolg bei dieser Art von Brautwerbung waren, doch fand er bald Gefallen an der Prozedur, zumal sie ihm mehr und mehr die Scheu vor dem weiblichen Geschlecht nahm. Keines der bedauernswerten Geschöpfe verließ die Hütte so unschuldig wie es sie betreten hatte. Weinend und durch Entehrung beschmutzt, überließ Tholo seine Bräute nach vollbrachter Begutachtung den Gedungenen. Nicht selten fanden die Gedemütigten bei seinen Kumpanen eine Wiederholung dessen, was Tholo ihnen bereits angetan hatte, bevor sie, krank vor Scham, irgendwo sich selbst überlassen wurden.
Die Erkenntnis, dass die Angst seiner Opfer vor ihm weitaus größer war als seine Furcht vor dem Versagen beim Geschlechtsakt, befreite ihn. Das Winseln und Flehen der Misshandelten zeigte ihm eindrucksvoll, zu welcher Machtfülle er sich aufschwingen konnte. Je verängstigter sich ein Opfer zeigte, desto intensiver war sein Lustgefühl. Er hatte in den Jahren zuvor so viel versäumt; nun versuchte er die entgangenen Freuden durch Unersättlichkeit und Perversion auszugleichen.
»Wer kauft schon ein Ross, ohne es vorher geritten zu haben?«, prahlte Tholo bei seinen Häschern. »Bringt mir mehr Weiber. Eine gute Entscheidung verlangt eine breite Auswahl!«
Trotz dieser menschenverachtenden Behandlung wagte fast keines seiner Opfer, sich der Öffentlichkeit anzuvertrauen. So wurde Tholos Ruf in der Grafschaft zwar immer weiter ruiniert, doch eine offizielle Anklage kam nie zustande. Gottfried war in seiner Burg wohl der einzige Mensch im gesamten Machtbereich, der nicht um das abartige Treiben seines Sohnes wusste.
Im Spätsommer des Jahres 1145 erhielt der junge Herr, wie so oft, die Benachrichtigung, er solle sich in der Jagdhütte einfinden; ein sicheres Zeichen, dass ihn wieder lustvolle Stunden erwarteten. Er machte sich unverzüglich auf. Wie immer achtete er auch heute peinlichst darauf, dass ihm niemand folgte.
Es war ein milder Septembertag und die Sonne schickte ihre letzten wärmenden Strahlen von einem strahlend blauen Himmel. Als der Grafensohn die abgelegene Hütte erreichte, schlug ihm die Ausdünstung warmer Pferdeleiber entgegen.
Sie sind bereits da! Prickelnde Lust durchflutete ihn. Im Innern der Hütte warteten vier verwahrloste Gestalten und vertrieben sich die Zeit beim Würfelspiel. In ihren Händen kreiste ein Fässchen Wein, von dem sie schon einiges in sich hineingeschüttet hatten.
»Wer hat euch erlaubt, meinen Wein zu trinken?«, herrschte der Ankömmling sie an.
Beim Eintreten Tholos verstummte ihr Schwatzen und einer der Vier, ein grobschlächtiger, hünenhafter Kerl, erhob sich. Breitbeinig stellte er sich dem Erbfolger entgegen und verschränkte die Arme vor seinem Brustkasten.
»Wir grüßen Euch, Graf Morgen!«, grinste er anzüglich.
Es war die Anrede, die die Männer stets dann gebrauchten, wenn sie den Grafensohn daran erinnern wollten, welch ausständige Ziele er noch immer nicht erreicht hatte. Gewöhnlich brachte ihn dieser Titel in Rage.
»Wo ist die Braut?«, überging der junge Herr die zynischen Worte.
»Langsam, langsam! Alles der Reihe nach! Wir haben zunächst etwas Geschäftliches mit Euch zu bereden.«
»Geschäftliches?« Tholo zog die Augenbrauen hoch.
»Uns ist übel aufgestoßen, dass wir für die bisherigen Dienste noch keinen Lohn gesehen haben!«, antwortete der Hüne.
»Ich verstehe nicht recht!«, zischte ihn der Grafensohn an. »Unsere Absprache sah von Anfang an Lohn erst bei meiner Übernahme der Grafschaft vor. Bis dem so ist, sollte euch der Spaß genügen, den euch keiner verwehrt, wenn ich mit dem Vögelchen durch bin.«
»Pah! Dafür sorgen wir auch ohne Eure Erlaubnis. Aber wie lange wird es wohl noch dauern, bis Ihr endlich in Amt und Würden kommt? Unter all den Punzen, die wir Euch brachten, war noch keine, die Euch als Gemahlin genehm war.«
Die Männer stimmten ihm mit hämischem Gelächter zu. Der Blick des zukünftigen Grafen nagelte den Redner förmlich an die Wand, was ihn aber nicht einschüchterte.
»Was wollt ihr von mir? Ihr habt mein Wort«, zischte Tholo.
»Euer Wort? Pah, damit lässt sich nicht viel anfangen. Machen wir’s kurz: Zehn Goldstücke für jeden von uns; als einmalige Zahlung für geleistete Gefälligkeiten.«
Tholo wollte aufschreien, doch der Sprecher ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»...und einen Silberling pro Kopf für jedes weitere Fell, das Ihr mit unserer Hilfe noch durchlöchert. Dafür könnt Ihr Euch dann auch Euer Wort ein für alle Mal in die Haare schmieren!«
»Seid ihr übergeschnappt?«, bellte der Herausgeforderte. »Ihr seid zu fünft, das hieße, ich müsste fünfzig Goldstücke zahlen ...«
»... und jedes weitere mal fünf Silberlinge, wenn wir mit dem Handel fortfahren sollen«, antwortete ihm der Mann selbstbewusst. Der Wein hatte ihm sichtlich die Zunge gelockert.
Tholo schnappte nach Luft. Mit welchem Gesindel habe ich mich da nur eingelassen? Erst jetzt wurde ihm bewusst, wie nachlässig er bei der Auswahl seiner Helfer gewesen war. Doch war es jetzt nicht an der Zeit, sich wegen derartiger Versäumnisse zu bemitleiden. Wer sich mit Pack einlässt, muss das Pack auch zu packen wissen, sagte er sich; sonst ist man ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Kurz entschlossen entschied er sich für die Flucht nach vorn. Er verlachte ihre Forderung.
»Was bildet ihr euch ein? Glaubt ihr ernsthaft, mir Geld entlocken zu können? Verdammter Pöbel, seid froh, wenn ich zu gegebener Zeit zu meinem Wort stehe. Weg mit euch! Aus meinen Augen!«
»Ist das Euer letztes Wort, Graf Morgen?«, schnaubte der Riese.
Tholo trat stumm einen Schritt zur Seite und wies mit der Hand zur offenen Tür. Er verharrte noch in seiner Geste, da wurde er von zwei der Männer zu Boden gerissen und auf die festgestampfte Erde gedrückt. Ein Dritter kniete sich behände auf seine Brust, sodass Tholo kaum des Atmens und nicht der geringsten Bewegung fähig war. Dennoch schrie und tobte der Grafensohn und bedachte seine Häscher mit allen Schimpfnamen, die ihm in den Sinn kamen. Allein ein müdes Lachen rang er ihnen dadurch ab.
»Zeigt ihm, wie ernst wir es meinen!«, befahl ihr Wortführer. Er hatte sich nicht an der Ergreifung beteiligt, sondern führte nur großspurig das Kommando.
Der auf ihm Kniende zerrte die Beinlinge des Grafensohns herab und zerriss die Bruche mit einem Ruck. Ein Messer blitzte in seiner Rechten auf. Mit der Linken griff er das freigelegte Geschlecht Tholos und setzte die Klinge unterhalb des Glieds an den Hoden.
Gottfrieds Sohn überkam Panik, als er die kühle Schneide an seinem warmen Fleisch spürte. Er brach in angstvolles Gewinsel aus. Die Furcht, die Männer könnten ihn entmannen, raubte ihm den Sinn.
»Nun, Euer Erlaucht! Wollt Ihr Eure Meinung vielleicht doch noch einmal überdenken?«
Die übertrieben wohlwollend gesprochenen Worte des Hünen brachten wohl die letzte Gelegenheit, sich der Lage noch zu entwinden. Er musste sie nutzen.
»Ja, verdammt noch mal!«, keuchte er. »Ihr kriegt das Gold!«
»Und für unsere weitere Zusammenarbeit?«, erkundigte sich einer der anderen.
»Auch da sollt ihr bekommen, was ihr verlangt.«





























