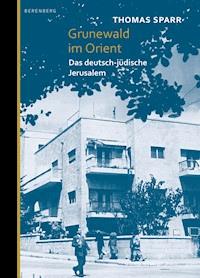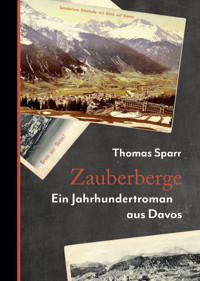Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Budapest–Berlin: Hier verlief eine der vielen ostwestlichen Fluchtlinien des 20. Jahrhunderts. Erst nach 1989 bemerkte man erstaunt die Präsenz der Ungarn in Deutschland, vor allem aber in Berlin, wo große Autoren wie György Konrád, Imre Kertész, Péter Esterházy oder Péter Nádas lebten, wo Terézia Mora und György Dalos heute leben. Dabei reicht die ungarische Präsenz hierzulande viel weiter zurück, oft verbunden mit anderen großen Umbrüchen: 1918, 1933, 1944, 1956. Thomas Sparr erzählt von einer einzigartigen historischen Konstellation, von Gedanken und Werken, vor allem aber von den Leben dahinter. Georg Lukács, Arnold Hauser, Peter Szondi und Ágnes Heller sind zu hören, Ivan Nagel, die Komponisten György Ligeti und Györgi Kurtág ebenso wie die vielen Autoren, die den Weltruf der ungarischen Literatur begründen. Die Donau, das erfahren wir hier, fließt auch durch Berlin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
THOMAS SPARR
HOTELBUDAPEST,BERLIN …
VON UNGARNIN DEUTSCHLAND
Ivan Nagel(Budapest 1931–Berlin 2012)zum Gedächtnis
Budapester Straßen
Sommer in Budapest
Menschen im Hotel
Zwischen Ost und West
Momentaufnahmen
1918
Gründerfigur
Die Seele und die Formen
Der Sonntagskreis
Metaphysikermacht
Babylon Budapest
Die Seele und die Dinge
Der Freischwebende. Karl Mannheim
Der Verwaiste. Arnold Hauser
»Wissen Sie, ich bin gerne ich.« Edit Gyömrői
1944
Einmarschmusik. Familie Nagel
Der geänderte Name. Familie Szondi
»Sie sind da.«
Retter. Rezső Kasztner
Das Ende, ein Anfang
Dr. Faustus aus Budapest
Der geteilte Ideenhimmel
1956
Péter – Peter Szondi
»Staatenlos – jüdisch – homosexuell«. Ivan Nagel
»Kein echter Ungar«. György Ligeti
»Balkanese«. Lucien Goldmann
»Genosse Lukács«. Ágnes Heller
Schnellzug »Hungaria«. Franz Fühmann
Reisen nach Berlin
Dank
Literatur
BudapesterStraßen
Die Budapester Straße im Westen Berlins misst gerade einmal 950 Meter. Sie begrenzt den Zoologischen Garten, der am Elefantentor einen Eingang neben dem Berliner Aquarium hat, unweit vom Hotel Palace und dem Europa-Center, beides Orte, deren geschichtliche Bedeutung in Berlin kaum noch jemand kennt. Die städtebauliche Veränderung auch dieser Straße erzählt, wie oft in dieser Stadt, etwas von den Umbrüchen und Zeitläuften: Ursprünglich verlief die Budapester Straße auf der stolzen Achse zwischen Potsdamer Platz und Brandenburger Tor, die man nach dem Tod des ersten Reichspräsidenten in Friedrich-Ebert-Straße umbenannte. Um den Namen Budapests nicht zu tilgen, benannte die Reichshauptstadt den nordöstlichen Teil des Kurfürstendamms, der heute vorbei am Hotel Interconti den Zoo entlangführt, in Budapester Straße um und bezog vierzig Jahre später, im Februar 1965, ein Teilstück zur Nürnberger Straße mit ein. Sechs Jahre zuvor hatte man den Kreisverkehr um die Gedächtniskirche aufgehoben und eine Verbindung von der Ecke Tauentzienstraße / Kurfürstendamm hergestellt, die sogenannte »Schnalle«. Sie führte ostwärts in Richtung Potsdamer Platz, westwärts in Richtung Hardenbergstraße. Man errichtete eine Unterführung entlang der Budapester Straße. Der Weg war so konzipiert, dass an der Ecke ein kreuzungsfreies Abbiegen nach Westen möglich war, nicht aber nach Osten. Der Westen war eben in der geteilten Stadt – denken wir an Ku’damm 59 – die entscheidende Himmelsrichtung. Es gab einen Autotunnel, einen Fußgängerbereich, Blumenbeete, um den Verkehr zu regulieren. Um 2004 gestaltete man den westlichen Teil der Budapester Straße neu, schüttete den Tunnel zu, das Bikinihaus erwachte zu neuem Leben. Der nahe gelegene Breitscheidplatz brachte es im Dezember 2016 zu trauriger Berühmtheit durch den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten und zahlreichen Verletzten.
Auch Hamburg hat eine Budapester Straße, mitten in der Stadt am östlichen Ende der Reeperbahn. Ursprünglich war es die damals noch stadtauswärts gelegene Eimsbütteler Straße, die man 1946 nach Ernst Thälmann benannte, den sechzig Jahre zuvor in der Hansestadt geborenen Sohn der Stadt, Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands und Kandidaten bei den schicksalhaften Reichspräsidentenwahlen der Weimarer Republik 1925 wie 1932. Nach der Machtübertragung 1933 wurde Thälmann verfolgt, entrechtet, verhaftet und 1944 im Konzentrationslager Buchenwald ermordet. Nach dem Aufstand in Ungarn gegen die sowjetische Besatzung im Herbst 1956 benannten die Hamburger die asphaltierte Erinnerung in Budapester Straße um. Aber der Name Thälmann verschwand nicht ganz aus dem Stadtbild. Er ist heute Namenspatron eines Platzes an seinem Geburtshaus in Hamburg-Eppendorf.
Wir fahren elbaufwärts: Die Budapester Straße in Dresden überquert an einer Stelle die Gleise, auf denen die Bahn von Budapest nach Berlin und zurück fährt. Ursprünglich war sie Teil der Chemnitzer Straße. In der DDR baute man die kriegszerstörte Strecke zu einer vierspurigen Hauptverkehrsader aus und beließ es zunächst beim ursprünglichen Straßennamen. Erst 1968 machte sich politisches Unbehagen Platz und man benannte die Straße, die doch an Chemnitz erinnerte, das man 15 Jahre zuvor brachial Karl-Marx-Stadt getauft hatte, in Budapester Straße um. Eine Verlegenheitslösung; Karl-Marx-Stadt-Straße wäre kein passender Name gewesen. Zumindest stimmte die Himmelsrichtung gen Osten, gen Budapest.
Nur: Warum heißen diese Straßen mit ihren langen, verworrenen Geschichten Budapester Straße? Kaum einer der Anwohner wird darauf eine Antwort wissen. Es wird auch kaum eine oder einen interessieren. Und doch haben die Stadtoberen in Berlin – um nur sie zu nennen – aus einem dunklen, ihnen selbst kaum bekannten Grund den Straßennamen beibehalten – nach dem Fall der Mauer, nach all den Umbenennungen von Straßen und Plätzen, abmontierten Tafeln und Plaketten, auch Denkmälern keine Selbstverständlichkeit. Die kurze Straße in der westlichen Herzkammer Berlins zeugt von der Präsenz einer anderen Stadt – man mag sie nicht Schwesterstadt nennen, das würde Bewusstheit, Nähe voraussetzen – von Budapest in Berlin. In Hamburg wird eine andere Geschichte von Budapest erzählt, in Dresden wieder eine andere. Es sind Geschichten peinlicher Umbenennungen von Straßen, Plätzen, von einer ganzen Stadt im eigenen Land.
Im Februar 1978 entdeckte ich die gerade bei Suhrkamp erschienenen Schriften von Peter Szondi, seine Theorie des modernen Dramas, die mich, wie viele Studierende der Philologien und die meisten Theaterleute, in seiner Präzision im Detail, der klaren Unterscheidung von Gattungen, in den weiten historischen Zusammenhängen faszinierte. Im Mai 1979 lernte ich in Hamburg Ivan Nagel kennen, damals Intendant des Deutschen Schauspielhauses, mit 1200 Plätzen das größte Sprechtheater in Deutschland. Das neobarocke Gebäude, 1900 mit Goethes Iphigenie auf Tauris eröffnet, erinnert nicht zufällig an Wien. Aus der Hauptstadt der K.-u.-k.-Monarchie hatten die Hamburger Bürger die Architekten geholt. Ich hatte gelesen, dass Szondi und Nagel seit ihrer Budapester Kindheit befreundet waren. Danach fragte ich ihn, und Ivan Nagel berichtete, wie er als 13-Jähriger im Frühsommer 1944, nach dem Einmarsch der Deutschen in Budapest, mit seinen Eltern, dem Bruder Gyula und dem zufällig anwesenden Peter Szondi in ihrer Wohnung verhaftet wurde. Es sei »nicht so schlimm« gewesen; später seien sie wieder freigekommen, wenn auch nur für kurze Zeit. Und er erzählte, dass er Peter Szondis frühen Tod – er hatte sich im Oktober 1971 mit 42 Jahren in Berlin das Leben genommen – nie verwunden habe. Die Antwort hat sich mir so eingeprägt, weil mir erst später bewusst wurde, dass es zwischen beidem – der Verhaftung durch die Geheimpolizei und Peter Szondis Freitod – einen Zusammenhang geben könnte.
Diese eine Antwort, vor langer Zeit in einem Hamburger Café wie dahingesagt, hat einen entscheidenden Anstoß für dieses Buch gegeben. Denn ich wurde, wiederum auch erst später, gewahr, dass Budapest, der gemeinsame Ort ihrer Herkunft, kaum je zur Sprache kam, weder in den vielen folgenden Gesprächen mit Ivan Nagel noch im Nachlass von Peter Szondi, mit dem ich mich später beschäftigen sollte. Budapest blieb eine Leerstelle. Erst am Ende seines Lebens, in einer Reihe langer Radiogespräche mit Jens Malte Fischer und Wolfgang Hagen, kehrte Ivan Nagel in seinen Erinnerungen nach Ungarn zurück und gab eine Erklärung für sein langes Schweigen: »Ich wollte keine Vergangenheit haben.«
Budapest war der Ort der Vergangenheit, die Gegenwart trug sich in Hamburg zu, Berlin würde der Ort der Zukunft sein. Zwei hell leuchtende Orte auf der Landkarte von Ivan Nagels Leben, während die Herkunft räumlich wie zeitlich eigentümlich im Schatten liegen blieb. Das weckte meine Neugier. Ich machte mich irgendwann auf den Weg nach Budapest und fuhr dann auch die gleiche Strecke mit dem Zug zurück nach Berlin.
Wenn man morgens um 7.40 Uhr den Eurocity in Budapest besteigt, erreicht man den Hauptbahnhof Berlin fast auf die Minute genau elf Stunden später, um 18.42 Uhr. Eine Tagesreise oder eine Reise durch den Abend und die Nacht über Vác und Szob, Bratislava, Brünn, Prag, Děěín, zu Deutsch: Tetschen-Bodenbach, Dresden. Drei Flüsse entlang, die Donau, die Moldau, die Elbe, drei Hauptstädte, drei Grenzübertritte, von Ungarn in die Slowakei, nach Tschechien, in Bad Schandau schließlich nach Deutschland. Eine Tagesreise zwischen zwei Metropolen, die historisch weit zurückführt. Von Budapest nach Berlin verlief im 20. Jahrhundert eine der großen Wanderbewegungen, der Fluchtrouten von Ost nach West.
Ivan Nagel und Peter Szondi hatten Berlin auf ganz unterschiedliche Weise erreicht, nachdem sich ihre Lebensläufe nach einer gemeinsamen Zeit in Zürich früh getrennt hatten. Der eine ging 1959 zum ersten Mal nach Westberlin, habilitierte sich 1961 an der Freien Universität und baute nach Stationen in Heidelberg, Göttingen und Princeton die vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität auf. Der andere übernahm 1987, nach Jahren als Kritiker und Theaterintendant, eine Professur für Ästhetik und Darstellende Künste an der damaligen Hochschule der Künste im Westen der Stadt
Ihr Weg nach Berlin steht für viele andere, lang vorher zurückgelegte Wege. Den von Georg Lukács vor dem Ersten Weltkrieg, der das Verständnis von Literatur und Theater im 20. Jahrhundert so nachhaltig prägte, von Karl Mannheim, an den am ehesten das Wort von den freischwebenden Intellektuellen erinnert, von Arnold Hauser, dessen Kunstsoziologie weithin vergessen ist und die doch zu ihrer Zeit das Verständnis von Kunst nachhaltig prägte, vom jüngeren George Tabori oder der wiederum jüngeren Ágnes Heller und anderen. Dabei sollten Leserinnen und Leser dieses Essays Berlin großzügig verorten; ein Hotel Budapest gab es auch in Heidelberg, in Frankfurt am Main, sehr ausgeprägt in Wien, Paris, über Jahre im östlichen Moskau, in New York und Australien. Einmal, im Leben von Lucien Goldmann, führt ein Budapester Weg über Bukarest nach Frankreich. Berlin war wie Budapest vielerorts.
Dieses Buch liefert keine Geschichte der ungarischen Emigration nach Deutschland oder in den Westen; es deutet auf eine in dieser Geschichte bedeutsame Konstellation, die uns im 20. Jahrhundert Kunst und Literatur, Soziologie und Politik neu sehen gelehrt hat.
Vier Jahreszahlen werden im Fortgang hervorgehoben: 1918, 1944, 1956 und 1989 mit Reisen in Berlin, Schicksalsjahre des ungarischen Jahrhunderts in Deutschland wie in Europa, das Jahr des Zusammenbruchs der K.-u.-k.-Monarchie am Ende des Ersten Weltkriegs, das letzte Kapitel der »Endlösung der Judenfrage«, das sich in Budapest und Ungarn auf Weisung von Berlin zutrug, der Ungarnaufstand als erster epochaler Befreiungsversuch, eine Befreiung, die 1989 die meisten Menschen erhofft, etliche befürchtet und bekämpft hatten und einige heute gefährden oder in ihrer Bedeutung relativieren.
Wer immer in diesem Buch auftaucht, diese vier Jahreszahlen haben direkt oder indirekt in sein, in ihr Leben eingegriffen oder doch in die Wirkung seines, ihres Werkes, sie mitgeprägt, verändert. Und sie weisen von Budapest nach Berlin und zurück.
Aber es sind nicht nur große intellektuelle Entwürfe, die auf Ungarn in Berlin und anderswo zurückführen. Der Fußball verdankte im letzten Jahrhundert einem ungarischen Spieler und Trainer entscheidende Pässe, Freistöße, Aufstellungen, wie Detlev Claussen gezeigt hat. Béla Guttmann hat den modernen Offensivfußball in die weite Welt hinein gespielt. Eine andere Spur führt durch den Magen nach Ungarn zurück. Über lange Jahre gab es in Deutschland ungarische Restaurants wie das »Csarda Piroschka« im Haus der Kunst in München mit einem unverwechselbar würzigen Gulasch, Paprika, Fischspezialitäten vom Balaton, Mehlspeisen aus der Zeit der Doppelmonarchie. Das »Csarda Piroschka« existiert nicht mehr. Ungarische Gaststätten sind heutzutage eine Rarität in Deutschland.
Von Budapest gelangten Gedanken, halbe oder ganze Theorien, Kunstwerke nach Berlin, von Ost nach West. Aber es gab auch Budapester Maler, Musiker, Komponisten, ungarische Schneiderinnen, Friseure, kleine Händlerinnen, Filmemacher, Unternehmer, Schauspielerinnen, Tänzerinnen. Es gab einzelne Orte wie das Café Nürnberger in Berlin, auch das Romanische Café, Salons, in denen Ungarn sich untereinander trafen oder auf Einheimische stießen, von denen sie, wie Sándor Márai hellsichtig wahrnahm, so vieles trennte: Charakter, Erfahrung, Hoffnung.
Über die Gedankenfracht sollte man die Vielfalt und Buntheit der ungarischen Emigration in Berlin und anderswo nicht vergessen. Eszter Gantner, die über die Emigration von Wissenschaftlern auf der Achse von Budapest nach Berlin in den 1920er Jahren geforscht hat, weist darauf hin, wie schmal der Archivbestand ist. Auf der Flucht nach 1933, während der Verfolgung und des Zweiten Weltkriegs sind viele Dokumente, Aufzeichnungen, Briefe für immer verlorengegangen. Aber Bücher und Erinnerungen, manche Briefe und Bilder sind überliefert und erzählen von Gedankengängen als Lebensläufen. Einige davon sollen zu Wort kommen. Man sollte über die Ausgewählten die vielen nicht vergessen.
Sommerin Budapest
Ans Ende seines Vorworts, das er seiner Theorie des Romans voranstellt, setzt der ungarische Philosoph Georg Lukács »Budapest, Juli 1962«. Die wenigen Seiten sind in ebenso makellosem Deutsch verfasst wie das ganze Buch, das im Jahr darauf im Luchterhand Verlag in Darmstadt und Neuwied erscheinen sollte, im kapitalistischen Ausland, wie man damals auf den Westen blickend hinzufügte. Im Sommer 1962 erinnert Lukács an einen anderen Sommer, als er seine Theorie des Romans in Heidelberg entworfen hatte. Es war der Sommer 1914, der mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Ordnung der Welt aus den Angeln hob und das 20. Jahrhundert grundstürzend veränderte. »Selig sind die Zeiten, für die der Sternenhimmel die Landkarte der gangbaren und zu gehenden Wege ist und deren Wege das Licht der Sterne erhellt« – lautet der erste Satz einer der berühmtesten Theorien der Literatur, mit dem Pathos der Zeit und dem Anspruch letzter oder zumindest langer Gültigkeit. Lukács liest im Roman, in der Erfindung des 19. Jahrhunderts, die »transzendentale Obdachlosigkeit«, den Anbruch einer unseligen und doch von Freiheit beseelten Zeit – und die Seele hat man ganz wörtlich zu nehmen, einer Zeit, für die die Landkarten neu gezeichnet werden müssen. »Der Kreis, in dem die Griechen metaphysisch leben, ist kleiner als der unsrige: darum können wir uns niemals in ihn lebendig hineinversetzen.« Wir können in der geschlossenen Welt der Antike nicht mehr atmen, schreibt der 29-Jährige. Wir haben die Produktivität des Geistes erfunden. Nirgendwo zeigt sich das Prinzip des offenen, schöpferischen Gestaltens so deutlich wie im Roman, in seiner Vielfalt, seiner Originalität wie Individualität, in seinen reichen, überbordenden Variationen, in dem, was nicht vorhersehbar, was neu ist. Der Verlust des transzendentalen Dachs bedeutet einen Bodengewinn an erzählerischen Formen, Stockwerken von Inhalten, eine Architektur des Offenen, der unabgeschlossenen Entwürfe.
Dass Georg Lukács – genauer: von Lukács – seine Romantheorie im Sommer 1914 entworfen hatte, ist so wenig Zufall wie der Ort: Heidelberg war am Vorabend des Ersten Weltkriegs ein geistiges Zentrum von unvergleichlicher Ausstrahlung, mit Max Weber und seinem Kreis, Stefan George und seinen Jüngern, mit Friedrich Gundolf und Karl Jaspers, um nur sie zu nennen. In den Jahren zuvor hatte Lukács in Berlin studiert, bei Georg Simmel Vorlesungen gehört.
In seinem neuen Vorwort blickt Lukács auf die Entstehung seiner Theorie des Romans fast ein halbes Jahrhundert zuvor zurück, vorwurfsvoll, entschuldigend, rechtfertigend, was seinen Idealismus betrifft, seine vermeintliche Blindheit gegenüber historischen Umständen. Ausgelöst sei Die Theorie des Romans von der Erschütterung des Ersten Weltkriegs gewesen. Als Marianne Weber, die Frau des Heidelberger Soziologen, einzelne Heldentaten des Kriegs anführte, erwiderte der junge Ungar: »Je besser, desto schlimmer.« In jedem möglichen Sieg sah er die Niederlage. Sein Text entstand in einem Augenblick permanenter Verzweiflung über den Weltzustand. Der denkbare Ausgang des Krieges führte zu der Frage: »Wer rettet uns vor der westlichen Zivilisation?« Und Lukács fügt in Klammern hinzu: »(Die Aussicht auf einen Endsieg des damaligen Deutschland empfand ich als einen Alpdruck.)«
Die Neuausgabe der Theorie des Romans war 1962 für eine westdeutsche Leserschaft bestimmt. In Ungarn oder den anderen sozialistischen Ländern hätte sein Buch gar nicht erscheinen dürfen. Das erklärt den defensiven, fast entschuldigenden Ton, den der Verfasser voranstellt, um seine Schrift aus Zeitumständen und Stimmungen zu erklären, die er vor allem einer jüngeren Leserschaft nahebringen will. Andererseits sperrt er sich nicht gegen die neue Ausgabe nach Jahrzehnten, und man spürt beim Rückblick eine stolze Selbstbehauptung. »Die Theorie des Romans ist nicht bewahrenden, sondern sprengenden Charakters«, schreibt der 77-Jährige und grenzt sich besonders von Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen ab, von einer »Kriegsschrift« voll von restaurativer Gesinnung, die 1918 erschienen war. In dieser Schrift rechtfertigt Thomas Mann Deutschlands Rolle im Ersten Weltkrieg, den Krieg überhaupt, die Besetzung Belgiens. Er spielt die westlichen »Zivilisationsliteraten« gegen die ernste deutsche Kunst aus, eine Kriegskunst. Diese Betrachtungen nimmt Lukács als Gegenbuch zu seiner Theorie des Romans wahr. Er sieht in seinem Buch nicht Ruinen, sondern den Sprengsatz seiner Jugend, in der Nähe zu Ernst Blochs Geist der Utopie, ein epochemachendes Buch, das zur gleichen Zeit entstanden war.
Thomas Mann wiederum wird Georg Lukács ein literarisches Denkmal setzen: Als Leo Naphta kehrt er im Zauberberg wieder, eine eigene faszinierende Verwandlung, nachdem beide Herren einander in den 1920er Jahren begegnet waren und sich noch einmal an einem symbolträchtigen Ort unter historisch ganz anderen Vorzeichen wieder treffen sollten: 1955 in Weimar, wo die DDR an Schillers 150. Todestag erinnerte. Lukács reiste aus Budapest an.
Man hat sich über die Jahrzehnte daran gewöhnt, den frühen vom späten Lukács zu unterscheiden, oft auch beide gegeneinander auszuspielen, den Essayisten gegen den Marxisten, den Lebensphilosophen gegen den Systematiker, den freien Autor gegen den Politiker. Das Späte hat man dabei früh datiert, auf sein Buch Geschichte und Klassenbewußtsein, das 1923 erschien. In Wirklichkeit ist der frühe Lukács vom späten nicht zu trennen. Die Impulse des Revolutionären, Sprengenden sind schon in den ersten Aufsätzen und impressionistischen Skizzen angelegt, wie Lukács auch von Beginn an nach dem Sozialen in der Kunst fragt. All das führte zu gravierenden methodischen Veränderungen, zu neuen Erkenntnissen, auch zu einem ganz neuen Stil. Die Emphase, ja das Pathos der frühen Jahre wich einer grauen Sprache der späteren Arbeiten von Lukács. Das Doktrinäre hielt Einzug. Man darf darüber nicht die Bedeutung von Georg Lukács vergessen.
Menschen im Hotel
Der Titel Hotel Budapest klingt nach Komfort, Reisen, heiterem Verweilen, nach Kurzweil. Für die Protagonisten dieses Buches wurde Berlin, der Westen überhaupt ein langer Aufenthalt, oft einer ohne Rückkehr. Das Hotel hat eine tiefere Bedeutung, als es auf den ersten Blick scheint. Im Budapester Sommer 1962 erhebt Lukács den Vorwurf, »die deutsche Intelligenz« – und damit meint er vor allem die Frankfurter Schule – sei in einem Grandhotel abgestiegen:
»Ein beträchtlicher Teil der führenden deutschen Intelligenz, darunter auch Adorno, hat das ›Grand Hotel Abgrund‹ bezogen, ein […] ›schönes, mit allem Komfort ausgestattetes Hotel am Rande des Abgrunds, des Nichts, der Sinnlosigkeit. Und der tägliche Anblick des Abgrunds, zwischen behaglich genossenen Mahlzeiten oder Kunstproduktionen, kann die Freude an diesem raffinierten Komfort nur erhöhen.‹«
Das »Grand Hotel Abgrund«, das Lukács erfindet oder, um es genau zu sagen: das er wieder findet, hat es zu einiger Berühmtheit gebracht. Stuart Jeffries wählte es 2016 zum Titel für sein Buch Grand Hotel Abyss über die Frankfurter Schule und ihre Zeit. Der eigentliche Antipode von Lukács’ Sätzen ist Theodor W. Adorno. Der Frankfurter Soziologe und Philosoph, eine Generation jünger, hatte vier Jahre zuvor eine scharfe Polemik gegen ein Buch von Lukács verfasst, das 1958 im Claassen-Verlag in Düsseldorf, also im Westen erschienen war: Wider den mißverstandenen Realismus. Von dem, was Lukács als sozialistischen Realismus schätzt, trennen Adorno Welten und Werke. Adorno schätzt all das, was den Realismus in der Kunst im landläufigen Sinn hinter sich lässt, also deutlich gezeichnete Figuren, soziale Szenen, historische Ereignisse. Samuel Becketts Stücke etwa zeigen für Adorno deutlicher das Reale, Individuelle. Seinen Aufsatz »Versuch, das Endspiel zu verstehen« hat er Samuel Beckett gewidmet. Der Zufall hat es gefügt, dass dieser Text in den Gesammelten Schriften gleich nach der harschen Kritik an Lukács abgedruckt ist.
Adorno rühmt Lukács’ frühe Schriften und deren Einfluss: »Die Theorie des Romans zumal hat durch Tiefe und Elan der Konzeption ebenso wie durch die nach damaligen Begriffen außerordentliche Dichte und Intensität der Darstellung einen Maßstab philosophischer Ästhetik aufgerichtet, der seitdem nicht wieder verloren ward.« In Lukács’ neuem Buch Wider den mißverstandenen Realismus sieht der Frankfurter Kritiker indessen kaum mehr als eine Gleichschaltung mit »dem trostlosen Niveau der sowjetischen Denkerei«, in der These von der »Widerspiegelung der objektiven Wirklichkeit« entdeckt er einen verbissenen Vulgärmaterialismus, macht eine Pedanterie des Duktus wie eine Schlamperei im Einzelnen aus, mit der Lukács den Realismus verteidige und Joyce, Beckett, auch Proust kritisiere, weil sie jedenfalls nach Lukács’ Urteil die Fühlung zur Wirklichkeit verloren hätten.
Dabei überrascht, dass Adorno Lukács’ Buch überhaupt mit einer so ausführlichen Kritik bedenkt oder sagen wir: beehrt. Diese Energie lässt auf enttäuschte Nähe schließen. Lukács war ein Lehrmeister des Philosophen und Soziologen, ja ein Idol seiner Jugend. Adorno hat die Freiheit im Denken, in Stil und Methode des jungen Lukács bewundert, seine souveräne Verbindung von Literatur und Soziologie, sein souveränes Setzen von Begriffen. Es sind Donnerwörter wie Freiheit, Form oder Seele, alles Wörter, die wir heute, wenn überhaupt, nur noch mit größter Vorsicht verwenden. 1924 hatte der junge Philosophie- und Musikstudent Adorno Lukács in Wien besucht. Und erst recht verbindet den Jüngeren mit dem Älteren die Form des Essays, der beide nachsinnen.
Auf die scharfe Kritik seines enttäuschten Schülers antwortet Georg Lukács vier Jahre später, als sich die historische Situation zwischen Ost und West noch einmal verändert hat. Aber »Grand Hotel Abgrund« hieß auch ein Aufsatz von Lukács aus dem Jahr 1933. In jenem Aufsatz fragt er nach dem Zuhause der Kulturschaffenden der Epoche, für die die bürgerliche Gesellschaft einen gewissen Komfort bereitstellt, um sie über ihre reale Lage am Rande des Abgrunds, vor dem sie stehen, hinwegzutäuschen, um die Illusion des Über-den-Klassen-Stehens, des eigenen Heroismus zu bewahren, die Illusion, mit der bürgerlichen Kultur bereits gebrochen zu haben:
»Der geistige Komfort des Hotels konzentriert sich nun um die Stabilisierung dieser Illusionen. Man lebt in diesem Hotel in der ausschweifendsten geistigen Freiheit: Alles ist erlaubt, nichts ist der Kritik entzogen. Für jede Art der radikalen Kritik – innerhalb der unsichtbaren Grenze – gibt es besonders eingerichtete Räume. Will man für eine ideologische Patentlösung aller Kulturprobleme eine Sekte gründen, so stehen entsprechende Versammlungsräume zur Verfügung. Ist man ein ›Einsamer‹, der von allen unverstanden allein seinen Weg sucht, so erhält man sein wohleingerichtetes Extrazimmer, in dem man, von jeder Kultur der Gegenwart umgeben, ›in der Wüste‹ oder in der ›Klosterzelle‹ leben kann. Das Grand Hotel ›Abgrund‹ ist für jeden Geschmack, für jede Richtung vorsorglich eingerichtet.«
Dieses Hotel ist ein Ort der absichtsvollen Täuschungen, vor allem der unbeabsichtigten Selbsttäuschungen der Künstler, Musiker, Schriftsteller wie Schriftstellerinnen und ihrer Theoretiker. Nach rund dreißig Jahren verortet Lukács Theodor W. Adorno ebendort, antwortet aber auch auf dessen Kritik. Zwei Herren vor einer Öffentlichkeit, die sie ins Erstaunen versetzt hätte; man weiß nur nicht recht, ob es damals überhaupt eine Öffentlichkeit gab, die diese Dimension der Auseinandersetzung wahrgenommen hat.
Zwischen Ost und West
Lukács’ Grandhotel jedenfalls liegt im Westen. Elf Monate bevor er das Vorwort für sein epochales Jugendwerk schrieb, hatte sich der Eiserne Vorhang in eine Mauer verwandelt, die von einem Sonntag im August 1961 an Ost- von Westberlin trennte. Gab es während der 1950er Jahre immer noch einen Austausch durch Reisen, Bücher, Zeitschriften, bedeutete die neue Grenze vollständige Abriegelunggen Westen, am meisten spürbar im ganz geteilten Berlin, aber auch in Budapest, das nun seine Grenze nach Österreich aufrüstete. Und der Ton der literarischen, philosophischen oder historischen Auseinandersetzung wurde schriller.
Ein weiteres weltpolitisches Ereignis sollte die Welt 1962 in Atem halten: die Kubakrise. Die Sowjetunion hatte nach der Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen in der Türkei auf Kuba unter Fidel Castro Raketen stationiert, auch mit atomaren Sprengköpfen, die unmittelbar die USA bedrohten. Kennedy stellte ein Ultimatum, auf das Chruschtschow schließlich einging. Die UdSSR zog ihre Raketen ab. Im Oktober des Jahres wurde ein atomarer Krieg der beiden Großmächte abgewendet.
Im gleichen Jahr reist ein 33-jähriger junger Mann aus Budapest zum ersten Mal nach Berlin. Imre Kertész jedenfalls datiert in der Rückschau von fast vier Jahrzehnten die Reise auf dieses Jahr. Sein Nachlass lässt vermuten, dass sie erst 1964 stattfand. Als Autor ist der junge Mann noch nicht hervorgetreten; er hat Musicaltexte und Operetten verfasst. Es ist nicht seine erste Reise nach Deutschland; die Deutschen hatten ihn 1944 nach Auschwitz und Buchenwald deportiert. Eine Reise wird man das Verfrachten in Deportationszügen allerdings nicht nennen. Viele Jahre später hat sich Kertész auf die Suche nach Spuren seiner Zeit in den beiden deutschen Konzentrationslagern gemacht. Am Flughafen Schönefeld erkennt er, gerade mit dem Flugzeug aus Budapest gelandet, in den Uniformen der Grenzsoldaten die seiner Bewacher in den Lagern. Tatsächlich zitierte die Nationale Volksarmee die Uniformen der Wehrmacht bedenkenloser als die gleichzeitig aufgebaute Bundeswehr im Westen des geteilten Landes. Auch hier wird man archivarisch einhalten: Ist der junge Imre Kertész wirklich mit dem Flugzeug angekommen? Von der Reise 1964 hat sich jedenfalls ein Rückfahrtticket Jena–Budapest mit der Reichsbahn erhalten. Aber wer weiß, ob er nicht die Hinreise mit dem Flugzeug angetreten hatte? Und ganz sicher können wir nicht ausschließen, dass der Reisende schon zwei Jahre früher in Ostberlin war. Seine Reiseeindrücke sind kalendarisch unsicher, in Bildern und Assoziationen messerscharf.
»Pourquoi Berlin?«, warum er nach Berlin gezogen sei, das erklärt Imre Kertész Jahrzehnte später seinen Lesern zuerst auf Französisch und erinnert sich dabei an den Aufenthalt in der Halbstadt, die ungewöhnliche Wärme im Frühjahr 1962 (1964), »alles war ein wenig unwirklich«, und er fährt fort:
»Wir wohnten in einem alten Hotel in der Friedrichstraße. In der Bar im Erdgeschoss stand eine elegante blonde Bardame hinter dem Tresen. Sie war ungewöhnlich gereizt. Immer wieder erzählte sie ihre Geschichte, an die ich mich heute nicht mehr genau erinnere. Das Wesentliche daran war, dass sie infolge irgendeines unglücklichen Zufalls hier in der östlichen Hälfte der Stadt festsaß und ihre Lage hoffnungslos war. ›Hoffnungslos‹, wiederholte sie immer von neuem. Wäre ich nicht aus Budapest gekommen, wäre ich erstaunt gewesen über die Offenheit – oder war es vielleicht Verbitterung? –, mit der sie ihrer Wut und Verachtung gegenüber dem Regime freien Lauf ließ; so aber hatte ich längst gelernt, dass sich Barmixer in einer Diktatur so manches erlauben dürfen, was den Gästen nicht erlaubt ist.«
»Hoffnungslos«, dieses Wort hat sich Imre Kertész eingeprägt, und er erinnert, dass zu jener Zeit der Teilung – und es würde eine lange Zeit des geteilten Himmels – Berlin in den Augen vieler Gäste der Stadt die europäischste Stadt des Kontinents zu sein schien, »und das gerade durch die bedrohte Lage« und die Teilung des Kontinents, die er ganz in der Nähe seines Hotels zu sehen bekam:
»Wenn man in Ostberlin über die Leipziger Straße ging, in die von ›drüben‹, vom Tickerband des Springer-Hochhauses, die verbotenen Nachrichten der freien Welt herüberblinkten, befiel einen das trügerische Gefühl, dass nicht Westberlin, sondern dass ganze, diesseits der Mauer beginnende und sich bis zum Eismeer erstreckende mächtige monolithische Reich ummauert war. Nie werde ich jene sommerliche Abenddämmerung vergessen, als ich verloren am Ende dieser wüstengrauen Welt stand, auf dem Boulevard Unter den Linden, und die Straßenabsperrungen, die Wachposten mit den Hunden, die über die Mauer ragenden Dächer der ›drüben‹ neugierig auftauchenden Touristenbusse betrachtete und die soeben aufgleißenden Scheinwerfer die Schande meiner totalen Knechtschaft unmittelbar zu beleuchten schienen.«
Westberlin, die Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche von der Budapester Straße aus gesehen, 1958.
Budapest vor der Kettenbrücke, ein Kiosk mit DDR-Magazinen, 1960er Jahre
1962 hatte Kertész noch kein eigenes Werk verfasst, aber der Blick auf die wachhabenden Soldaten in Schönefeld verrät schon, wie sehr er zu jener Zeit mit dem Roman eines Schicksallosen befasst war, dem Roman seines Lebens.
Warum Berlin? Kertész’ Antwort 2001 lässt sich in einem Satz zusammenfassen: »Berlin verhehlt seine schreckliche Vergangenheit nicht.« Nur war diese Vergangenheit da bereits sichtbarer, deutlicher anzuschauen und zu vernehmen als vierzig Jahre zuvor. Ein Jahr später erhielt Kertész den Nobelpreis für Literatur zugesprochen. Die Nachricht traf ein, als er in Berlin war. Das Wissenschaftskolleg richtete für seinen überraschten, etwas verlegenen, doch erfreuten Gast eine Pressekonferenz aus. Bald darauf würde er im Abgeordnetenhaus erklären, warum er in Berlin lebe.
Auf der anderen Seite, im Westen der Stadt, hatte Peter Szondi, wie Kertész 1929 in Budapest geboren, Ende Januar 1962 auf den »Berliner Universitätstagen« einen Vortrag gehalten, der wegweisend für seine Disziplin werden sollte: »Zur Erkenntnisproblematik der Literaturwissenschaft«, später unter dem Titel »Über philologische Erkenntnis« veröffentlicht. Szondi entwickelt darin eine Hermeneutik, die auf die spezifische Form des jeweiligen literarischen Werks achtet und den wissenschaftlichen Anspruch seiner Disziplin ästhetisch formuliert.
Man würde sich wünschen, dass Imre Kertész und Peter Szondi einander begegnet wären, aber schon die Grenze zwischen Ost und West hätte das verhindert. Ein Passagierabkommen zwischen den beiden Teilstädten, das die Grenze von West nach Ost etwas durchlässiger machte, gab es erst im Jahr darauf. Zudem war Peter Szondi 1962 meist in Heidelberg und Göttingen, wo er Professuren vertrat, ehe er 1965 nach Westberlin zog. Auch dann hat Peter Szondi, wie die meisten Emigranten aus dem Osten, seinen Fuß nicht auf die andere Seite der Stadt gesetzt, wo sein Onkel lebte, und schon gar nicht wäre er noch einmal nach Budapest gereist.
Ivan Nagel arbeitete im Sommer 1962 seit einem Jahr als Dramaturg in den Münchner Kammerspielen. Bei Lukács hatte er noch in Budapest Vorlesungen gehört. Gehörtes wie Gelerntes wurden zur Theaterpraxis. Zwei weitere Lehrmeister hat Ivan Nagel immer wieder genannt: Adorno und den Regisseur Fritz Kortner.
Arnold Hauser, der acht Jahre jüngere Weggefährte von Lukács, mit ihm seit Budapester Tagen befreundet und im »Sonntagskreis« besonders verbunden, lehrte zu jener Zeit, nach Jahren der Emigration in Deutschland, Österreich, in Italien wie in den USA, allein, auf sich gestellt in London. In langen Nächten, ohne sicheren Beruf, hat der Emigrant die Sozialgeschichte der Kunst begründet.
Lukács’ Assistentin Ágnes Heller, wie Kertész und Szondi 1929 in Budapest geboren, war seit vier Jahren mit Berufsverbot belegt und unterrichtete 1962 an einem Mädchengymnasium der Stadt ungarische Literatur. Mit ihren Schülerinnen gründete sie einen »Selbstbildungsverein«, in dem verschiedene Ansichten diskutiert wurden. Sie stellten Romanhelden wie Raskolnikoff »vor Gericht«. Es gab eine Anklage, eine Verteidigung und eine Jury. Diese lebendige Didaktik und Dialektik des gemeinsamen Lesens hat den Schülerinnen in Budapest gefallen und sagt schon viel über das Philosophieren von Ágnes Heller aus: Es setzt aufs Selberdenken, keine Doktrin. Ein Jahr später wechselte die Philosophin ans Institut für Soziologie, keine Selbstverständlichkeit im Budapest jener Zeit. Das Institut wurde liberal geführt und nahm die eigenwillige Denkerin gern auf.