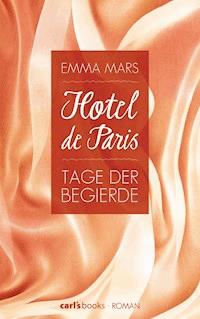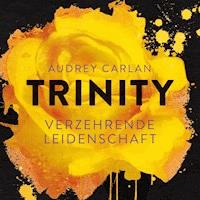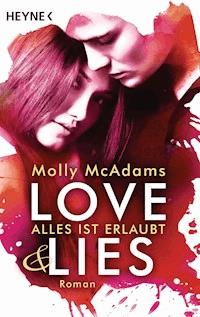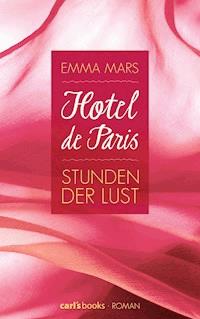
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: carl's books
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Die junge Studentin Annabelle Lorand heuert bei einem Escortservice - Belles de nuit - an. Meist verbringt sie die Nächte mit den Männern im Hotel de Paris, in dem die Zimmer nach legendären Mätressen, Kurtisanen und Liebhaberinnen und deren jeweiligen sexuellen Vorlieben benannt sind. Gleichzeitig erhält sie immer wieder Notizen von einem Unbekannten, die ihre eigenen erotischen Fantasien spiegeln. Eines Abends trifft sie den äußerst charismatischen und charmanten Medientycoon David Barlet, und beide verlieben sich ineinander. David bereitet ihr den Himmel auf Erden, und Annabelle möchte so schnell wie möglich ihr Dasein als Escortgirl beenden. Doch sie muss erst ihre Schulden bei der Agenturleiterin abarbeiten. Bei ihrem letzten Auftrag ist sie wie vom Schlag gerührt, als sich ihr Begleiter als Louis Barlet vorstellt, der Bruder ihres zukünftigen Mannes David. Er übt eine unheimliche erotische Anziehung auf sie aus. Doch was ist, wenn er seinem Bruder von ihrer Escortexistenz erzählt? Annabelle ist hin und her gerissen zwischen ihren Gefühlen und heimlichen Begierden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Die Originalausgabe trägt den Titel »Hotelle, Chambre n° 1«.
1. AuflageCopyright © 2014 by Emma MarsCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by carl’s books, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: semper smile, MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-12495-3www.carlsbooks.de
Wenn es dir gelingt, ohne einen Meister – einen Meister, egal welcher Art – zu leben, dann sag es mir, ja? Denn du wärst der Erste in der ganzen Geschichte der Menschheit.
Lancaster Dodd in The Master, Paul Thomas Anderson, Annapurna Pictures und Ghoulardi Film Company, Metropolitan Filmexport, 2012
Paris in den ersten Junitagen im Jahr 2010, ein Hotelzimmer am Nachmittag
Ich habe nie zu den Frauen gehört, die behaupten, alle Hotelzimmer sähen gleich aus. Sie seien anonyme Räume, ohne Eigenheiten und Charakter. So etwas wie ein kalter Durchgangsort, im ewig gleichen Design, der einen Standardkomfort bis zum nächsten Tag biete. Diese Frauen haben hier sicherlich nichts anderes getan, als zwischen zwei Bahnfahrten oder zwei Flügen, erschöpft von der Reise, zu schlafen. Man muss ein Hotelzimmer am Tag erleben, wenn das Haus leer ist – oder beinahe –, um das Besondere, das Einzigartige an ihm zu genießen. Man muss hier beben, seine Sinne schärfen, einen nach dem anderen, um die Spuren der Menschen zu erahnen, die vor einem hier gelacht, geweint und geliebt haben. Hier im Hotel habe ich in diesen letzten Monaten gelernt, dass man genauso viel zurückbekommt, wie man gibt. Wenn Sie nur im Schlaf, in der Eintönigkeit oder der Melancholie vor sich hin dämmern, nehmen Sie lediglich das Abbild Ihrer eigenen Traurigkeit oder Ihres Überdrusses wahr. Und Sie werden es genau so verlassen, wie Sie es betreten haben – unverändert.
Lauscht man hingegen auf das, was uns ein Hotelzimmer zu erzählen hat, erfährt man tausend Geschichten, tausend Anekdoten, tausend Seufzer, denen man zu gerne die eigenen hinzufügen möchte. Die Neugierigsten fühlen sich manchmal sogar geradezu besessen von dem, was ihre Vorgänger hinterlassen haben. Einen Duft in den Vorhängen oder im Bettüberwurf. Einen kleinen Fleck, der dem Putzlappen entgangen ist. Einen Spiegel, dessen Altersflecken einen Schatten, beinahe eine Silhouette, umreißen. Diese Einzelheiten strömen in Sie hinein, entfalten sich in Ihnen und verführen Sie, die Geschichte zu erleben, die Sie hier erwartet.
Und genau das tue ich gerade, nackt, während meine Handgelenke an Bettpfosten gefesselt sind. Ich füge einer Geschichte neue Seiten hinzu, die weit vor diesem Tag, weit vor mir begonnen hat. Wie die meisten Zimmer im Hôtel de Paris hat auch das Joséphine einen riesigen Spiegel an der Decke. Darin kann ich mich mit Muße betrachten, während ich darauf hoffe, dass es bald ernst wird. Ich, Annabelle Barlet, geborene Lorand, dreiundzwanzig Jahre alt, seit wenigen Monaten verheiratet, bereit, mich ganz und gar einem Mann hinzugeben, der sich im angrenzenden Badezimmer vorbereitet. Wer wird es sein? Ich weiß es noch nicht. Ganz sicher nicht mein Ehemann. Wären wir hier, wenn er es wäre? Ganz ehrlich, wären wir so weit gekommen?
Mein Kosename ist Elle. Seit jeher und in allen Situationen. Bestimmt, weil Belle, die Schöne, zu schwer auszuhalten wäre. Aber Elle, glauben Sie mir, ist noch schlimmer. Elle, das klingt, als würde ich in mir alle Frauen vereinen! In mir all ihre Anmut bündeln. All ihr Begehren konzentrieren. Als würden in mir alle Fantasievorstellungen verschmelzen – dieses Rohmaterial, aus dem die Männer bestehen.
Als schließlich die Badezimmertür knarzt, stoße ich überrascht kleine spitze Schreie aus. Vielleicht ein wenig zu schrill. Bestimmt hatte ich letztendlich geglaubt, seine Gegenwart sei nur ein Traum. Der Unbekannte erstarrt und zögert, das Zimmer zu betreten. Ich stelle mir seine Hand vor, welche die Türklinke umklammert, seinen stockenden Atem.
»Madame? Madame Barlet? Ist alles Ihrem Wunsch gemäß?«
Diese Stimme ist nicht seine. Sie kommt vom Flur. In den Kulissen ist man um mich besorgt. Man legt Wert darauf, dass ich zufrieden bin. Madame ist Stammgast. Madame ist in diesen Räumen eine Privilegierte. Mein Freier hat ihnen seine Anweisungen gegeben. Er gehört zu denen, auf die man hier hört, die man hört und erhört.
»Ja, Monsieur Jacques … Keine Sorge, es ist alles in Ordnung.«
Als ich vor einem Jahr zum ersten Mal in diesem Zimmer war, wurde ich nicht so umsorgt. Ich war auch noch nicht so selbstsicher. Die großen Spiegel warfen mir ein ganz anderes Bild zurück. Ich hatte schon dieselben Formen wie heute, dieselben Rundungen, und sie waren mir eine Bürde und ein Versprechen. Aber ich kannte noch nicht ihre Macht und noch weniger ihren Nutzen. Ich genoss den anderen nicht – und mich selbst noch weniger.
Was bringt dich zum Orgasmus, Elle? Wie? Was mich zum Orgasmus bringt? Weiß ich es denn? Was genau ist es, das mich heiß macht? Das mich feucht werden lässt, ohne dass ich mich berühre, allein schon beim bloßen Gedanken? Der Körper eines nackten Mannes? Sein Geruch? Der Anblick eines mir unbekannten Schwanzes, erigiert für mich? An mir? In mir?
(Notiz vom 5. Juni 2010, von mir selbst verfasst)
Nein, noch vor einem Jahr wusste ich nicht, dass jedes Zimmer ein Liebesnest ist, wo jede Frau sich ausbrütet und schließlich lernt, sie selbst zu sein. Ich war nicht gefesselt wie jetzt, und dennoch war ich sehr viel unfreier, als ich es augenblicklich bin. Heute, täuschen Sie sich nicht, bin ich die Herrin, und nicht allein des Mannes, der da an der Tür zittert. Meine Hingabe ist absolut, aber nie zuvor habe ich den Lauf der Dinge so sehr kontrolliert wie heute.
Vor einem Jahr war ich nur ich, Elle. Die Gemeinschaft aller Frauen – abzüglich mir. Die ganze Frau, die ich noch werden musste …
1
Ein Jahr zuvor, 3. Juni 2009, im selben Hotelzimmer
An jenem Tag konnte ich mich frei bewegen und lag zusammengerollt in den zerwühlten Laken des Joséphine-Zimmers. Frei und dennoch so unbeholfen. Den Mann, der das Bett mit mir teilen sollte, kannte ich seit drei oder höchstens vier Stunden. Ich wusste wenig von ihm, nur seinen Familienstand und die Dicke seiner Brieftasche – schon bald auch anderes. An dem ganzen Abend, der diesem einen Augenblick vorausging, hatte ich nicht ein Sterbenswörtchen seines Gesprächs mit unseren Tischnachbarn mit angehört. Ich hatte nur mit sanftem Nicken daran teilgenommen und gelächelt. Ein schönes Geschöpf, so wie man es von mir erwartete. Er hingegen flößte den anderen Respekt ein – und manchmal erzwang er auch ihr Schweigen.
»Bevorzugst du eine bestimmte Stellung?«, fragte er mich, als er mir half, mein leichtes weißes Kleid auszuziehen.
Amüsant: Als wir uns noch vor wenigen Minuten über unsere mit Heidelbeeren gefüllte Gänseleberpastete beugten, siezten wir uns. Kaum hatten wir die Schwelle des Zimmers überschritten, war er einfach so zum Du übergegangen. Das liegt an der trügerischen Intimität von Menschen, die sich zu rasch ausziehen.
»Wie bitte?« Ich erstickte fast an meinem Schluck Wasser.
Ein Mensch, der Sie aufrichtig begehrt und von dem Sie sich fiebrig erhoffen, dass er Sie bewundert, würde sich nie mit derlei technischen Überlegungen aufhalten. Ihr Körper würde ihm durch die Art der Hingabe reichlich Antwort geben. Jedes Wort wäre überflüssig. Alles wäre nur Musik, und der Einklang Ihrer Sinne wäre offenkundig.
»Ich will sagen … Gibt es Stellungen, die dir unangenehm sind? Sachen, die dich blockieren?«
Ich drehte mich um und beäugte ihn aufmerksamer, als ich es bislang getan hatte. Er war eher gut aussehend, in den Vierzigern, schon leicht ergraut, athletisch gebaut, bestimmt sehr sportlich, was womöglich den Anstoß für meine Anwesenheit in diesem Zimmer gegeben hatte. Sonst wäre mir nie der Gedanke gekommen, nach unserem ermüdenden Dinner mit ihm zu gehen. Ich hätte mich an die Grundleistung gehalten. Es war auch erst das dritte Mal, dass ich so einer »Fortsetzung« – so heißt das bei uns – zustimmte. Innerhalb von acht Monaten Arbeit also recht wenig.
An seiner Ungeschicklichkeit, an seiner liebestötenden Art, mich nach meinen Vorlieben zu fragen, erriet ich, dass er nicht erfahrener war als ich. Vielleicht war ich sogar sein erstes Escortgirl. Ich hielt mich zurück, ihm die Frage zu stellen, um nicht auch noch den restlichen Zauber zwischen uns zu zerstören.
»Nein … nein, nicht besonders«, log ich mit einem Lächeln, das verlockend wirken sollte.
»Okay …« Er nickte sichtlich beruhigt. »Nur damit ich Bescheid weiß.«
Ich hatte meine Gedanken woanders …
Die Hundestellung ist mir peinlich, weil sie so tierisch ist. Und darum kann ich sie nur mit Männern machen, die ich kenne.
Die Hundestellung ist für mich lustvoller als andere Stellungen … Vielleicht gerade weil sie so tierisch ist? Und deshalb träume ich davon, sie mit einem Unbekannten, dessen Gesicht am besten mit einer Maske verhüllt ist, zu machen.
(Handgeschriebene Notiz, anonym, vom 3. Juni 2009, unbemerkt in meinen Briefkasten geworfen)
Ich dachte an die Zettel, die ich seit einigen Wochen bekam, seit ich dieses Ringbüchlein mit silbernem Einband in meiner Handtasche gefunden hatte, jungfräuliches Papier, das mir ein Unbekannter bei einer Rempelei in der Metro zugesteckt haben musste. Darin klebte dieser rätselhafte Zettel mit einer mir unbekannten Schrift; er hätte mir eine Warnung sein müssen:
Eine Studie hat herausgefunden, dass Männer etwa neunzehnmal am Tag an Sex denken, Frauen nicht öfter als zehnmal. Und Sie, wie oft am Tag lassen Sie sich von derartigen Gedanken in Beschlag nehmen?
Einige Tage später habe ich in meinem Briefkasten ein einzelnes loses Blatt gefunden, dessen Löcher mit denen meines Ringbuchs übereinstimmten. Es hatte keinen Stempel und keine Briefmarke. Jemand musste es unbemerkt eingeworfen haben. Der Schreiber hatte offensichtlich Freude daran, sich meine Träumereien auszumalen. Er hatte in der ersten Person geschrieben, als wäre er ich.
Beinahe hätte ich das beschriebene Blatt ungelesen in den Papierkorb geworfen. Ich hatte sogar daran gedacht, bei der Polizei Anzeige wegen Belästigung zu erstatten. Doch meine Neugier als Journalistikstudentin war stärker, und ich habe das Blatt brav in meinem Miniordner abgeheftet, ohne im Geringsten zu ahnen, dass es das erste einer langer Reihe sein würde. Denn die unbekannte Hand hörte hier nicht auf … o nein.
»Mich blockiert nichts«, antwortete ich schließlich meinem Kunden.
Letztendlich war er nicht schlechter als die wenigen Männer, denen ich nach gewissen zu alkoholträchtigen Abenden oder nach manch mittelmäßigem Restaurant erlaubt hatte, mich zu besitzen. Und wenn ich an mein erstes Mal mit Fred dachte, die ernsthafteste Geschichte damals, musste ich zugeben, dass es auch dabei an Glamour fehlte. Wenn ich es genau bedachte, hatte ich an jenem Abend, an dem wir schließlich miteinander schliefen, nachgegeben, weil die Gelegenheit sich bot, weil der natürliche Verlauf des Abends es erforderte … und nicht aus wahrer Lust. Was sollte also heute schlecht daran sein, dem Ganzen einen geschäftsmäßigen Anstrich zu verleihen? War ich denn nicht mehr wert als ein Stück Pizza und zwei Gläser Rotwein?
Der Typ hier war zumindest reich, sauber, gut aussehend und vor allem elegant in seinem zweireihigen Maßanzug mit fuchsiafarbenem Seidenfutter und Ziernähten, die zu den Knopflöchern passten. Dank ihm würde ich an diesem Abend zu weit mehr Geld kommen, als ich innerhalb einer Woche mit kleinen Jobs verdient hätte.
Kurzum, ich motivierte mich, so gut es ging. Doch trotz der Blankovollmacht, die ich ihm gerade gegeben hatte, nahm mich der maßgeschneiderte, nun ganz in Latex gehüllte Monsieur ohne – oder beinahe ohne – Vorspiel und vor allem ohne ein Wort in keuchender Missionarsstellung. Dieses Unvermögen angeblich gut erzogener Leute bei der körperlichen Liebe wird mich immer wieder überraschen. Womöglich weil es das einzige Wissen ist, das man nicht eingebläut bekommt und für das es keine Nachhilfestunden gibt.
»Tu ich dir nicht weh?«
Nein, er tat mir weder weh noch sonst irgendwas. Mein ganzer Unterleib schien mir wie betäubt. Ich wusste, es ging um mich, um mein Geschlecht, um Penetration, um einen tatsächlichen Liebesakt, doch ich fühlte mich nicht betroffen. Dennoch begleiteten meine Hände auf seinem Hintern sanft seine Bewegungen in mir.
»Alles in Ordnung«, ermutigte ich ihn.
Meine eigene Unerfahrenheit verbot mir, die Initiative zu ergreifen, die er berechtigterweise von mir erwarten durfte. Sollte ich stöhnen, keuchen oder ihm obszöne Worte ins Ohr flüstern? Bis zu welchem Punkt sollte ich ihm eigentlich etwas vorspielen? War das Teil der Dienstleistung?
»Und ist es gut für dich?« Etwas anderes fiel mir gerade nicht ein. Ich weiß, das war ziemlich schwach.
»Ja«, stieß er röchelnd aus, was ein baldiges Ende ahnen ließ. Als kluger Geschäftsmann, der er ansonsten sein musste, wollte er diesen kostbaren Moment auskosten und hielt etwa fünfzehn Sekunden inne, bis er sich, regelmäßig wie ein Schweizer Uhrwerk, wieder in Bewegung setzte.
Obwohl ich ein wenig abwesend war, empfand ich keine Scham, keinerlei Abscheu und noch weniger Wut. Ich streichelte seinen Rücken, ganz langsam von seinen Schultern bis zu den Hüften, war mithin voll des guten Willens und wollte ihm Lust bereiten. Sein lauter werdendes Grunzen deutete ich als Zeichen seiner Zufriedenheit. Ganz ehrlich, dieses Miteinander war nicht schlechter als viele andere horizontale Gymnastikübungen, die ich in der Vergangenheit absolviert hatte. Und außerdem bietet ein leidenschaftsloser Koitus den Vorteil, dass man sich in aller Ruhe die Ausstattung des Zimmers anschauen kann. Und die des Hôtel de Paris war es wert, genauer betrachtet zu werden. Mit Ausnahme des großen Spiegels an der Decke – eines der wenigen Zugeständnisse an die Ansprüche unserer Zeit – war die Einrichtung eine getreue Nachbildung jenes Zimmers, das Madame de Beauharnais, Bonapartes Ehefrau, in ihrem Schloss Malmaison bewohnte. Der runde Raum wirkte wie ein höchst luxuriöses Zelt, das von einer Reihe schlanker goldener Säulen getragen wurde. Sie waren durch großzügige rote Stoffbahnen miteinander verbunden, deren altertümliche Drapierung ihnen eine Üppigkeit und einen höchst anmutigen Schwung verlieh. Das große Himmelbett, über dem ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen ragte, als wollte er gleich davonfliegen, war an seinem Kopfende mit zwei goldenen Schwänen und am Fußende mit zwei Füllhörnern verziert. Das übrige Mobiliar, darunter auch die Sessel und eine Chaiselongue am anderen Ende des Zimmers, war in denselben Farbtönen gehalten, Gold und Blutrot, und nahm auch das Blumendekor, das schon auf dem Bettüberwurf und den seitlichen Pfosten des Bettgestells vorhanden war, wieder auf.
Die Illusion war vollkommen, und es bedurfte keiner großen Vorstellungskraft, sich zwei Jahrhunderte zurückversetzt zu fühlen. Nahm Napoleon seine Joséphine mit derselben mechanischen Präzision, oder variierte er seine Partitur? Ich war gerade in meine ästhetischen oder sexhistorischen Überlegungen vertieft, als Monsieur mich mit einem letzten Beckenstoß beglückte und ein abschließendes Keuchen ausstieß. Er hatte höchstens drei, vier Minuten ausgehalten, vielleicht weil ihn der majestätische Ort so sehr beeindruckte oder auch ganz einfach weil ihm das Abendessen schwer im Magen lag und ihn der Alkohol schwächte.
Kaum hatte er sich aus mir herausgezogen, rollte er sich auf die Seite, sodass seine Hüfte fast meine berührte, und machte mir mit postorgiastischer Dankbarkeit das kleine Kompliment: »Du bist sehr schön, weißt du.«
»Danke.«
Was soll man auch anderes entgegnen, zumal wenn man vom Gegenteil überzeugt ist? Mein Spiegelbild an der Decke gefiel mir nicht. Es hatte mir noch nie gefallen. Und ich wusste, dass derartige Situationen mich auch nicht so bald mit ihm versöhnen würden. Zu rund, zu sehr dies, zu sehr das. Ich war ich, eher eine plumpe junge Frau als eine Femme fatale. Kurzum: hoffnungslos unvollkommen.
»Ich tu mich schwer mit diesen mageren Mädchen«, sagte er. »Ich habe Angst, ich könnte sie zerbrechen …«
Das war seine Art, mir zu sagen, dass ihm meine üppigen Formen nicht missfielen. So war zumindest einer von uns beiden zufrieden mit dem Menü, das ich zu bieten hatte. Fülle auf allen Ebenen. Und keine hervorstehenden Ecken. Offenbar genügend, um vorerst seinen Hunger zu stillen.
Ich griff nach dem kleinen Bündel Geldscheine, das für mich auf dem Mahagonitischchen lag, checkte mit einem Blick die Summe und nutzte die Gelegenheit, als er im Badezimmer verschwand, meinerseits das Zimmer zu verlassen, stumm wie die Geister, die in ihm wohnten. Was hätte ich ihm auch sagen sollen, das nicht wie eine Lüge oder ein falsches Versprechen klang?
Draußen schlüpfte ich in meine Schuhe und ging schnurstracks in die Halle und zur Rezeption. Dort gab mir Monsieur Jacques hinter seinem glänzenden Tresen diskret ein Zeichen – eine unmissverständliche Einladung, näher zu kommen.
»War alles zu Ihrer Zufriedenheit, Mademoiselle?«
»Ja, ja«, sagte ich leise. »Ja, sehr.«
Der Portier des Hôtel de Paris war imposant in seiner schmalen, mit Gold- und Silberposamenten verzierten Livree eines Kammerdieners aus der Zeit Ludwigs XIV. Doch mehr noch als seine Uniform beeindruckte mich sein Aussehen: Der alte Mann hatte nicht ein einziges Haar am Kopf, keinen Schnauzer, keinen Bart, keine Augenbrauen. Nicht einmal Wimpern um seine großen, leicht vorstehenden blauen Augen. Ausgeschlossen, dass jemand noch glatter rasiert war als er oder eine weißere Haut hatte.
Meine Mutter hingegen hatte erstaunlicherweise trotz ihrer Chemotherapie ihre grauen Haare nicht verloren. Die Behandlung hatte in den letzten sechs Monaten zwar ihre Muskeln und ihre Spannkraft angegriffen, aber nicht ihr Haupthaar. Maude Lorand zeigte Stehvermögen. Wie immer hielt sie mit Mut und Demut durch, ohne ein Wort zu viel und ohne die geringste Klage. Ihre Lungen gingen kaputt, aber ihre Würde war unerschütterlich. Eine Bronzestatue inmitten von Asche.
»Werden Sie in den kommenden Tagen ein Zimmer benötigen? Vielleicht morgen?«
»Das weiß ich noch nicht. Und sollte es der Fall sein … dann bestimmt zum letzten Mal.«
Er schien nicht überrascht von der Endgültigkeit meiner Aussage, sondern beinahe glücklich, wie er mir mit seinem aufrichtigen Lächeln zu verstehen gab. Monsieur Jacques wollte nur mein Bestes. Oder genauer gesagt – bei jeder unserer seltenen Begegnungen hatte ich den Eindruck gehabt, dass er das Gute in mir sah. Dass er ungeachtet des Anscheins und der objektiven Gründe für meine Anwesenheit in seinem Etablissement erkannte, was ich an Gutem oder sogar Besserem tun konnte. Sein Blick, der einige Sekunden auf mir ruhte, genügte, um mich aufzubauen.
Doch an diesem Abend verweilte ich nicht länger an dieser wohltuenden Quelle. Er lächelte mich noch an, als ich bereits draußen auf der Straße war und die milde, noch junge Nacht mich umfing.
2
Ein wenig später am selben Tag
»Also Basisleistung … oder Fickbasis?«
Dieses schlechte Wortspiel stammte von Sophia, die permanent ins Vulgäre verfiel und so ganz bewusst ihren ordinären Charme aufpeppte. Sie war meine beste Freundin. Eigentlich meine einzige, um ehrlich zu sein. Sophia Petrilli, mir an Alter zwei Jahre und an Erfahrungen mit Männern und Sex mindestens fünf Jahre voraus. Mit dunklen Locken, die alle Blicke auf sich zogen. Mit Brüsten, die danach gierten, dass Hände ihre perfekten Rundungen umschlossen. Mit Augen, in die alle Männer sich versenken wollten. Einer ihrer ersten Liebhaber hatte sie Esmeralda genannt, weil sie, die junge Tänzerin, wilde Unabhängigkeit verströmte und glühende Leidenschaft weckte. Im Alltag war sie einfach nur Sophia, etwas verloren, ohne ernsthafte Beziehung und ohne feste Arbeit. Doch das reichte, um sie zu dem lebendigsten und unabhängigsten Wesen zu machen, das ich kannte, und sie war mir eine unerschütterlich treue Gefährtin. Die Verehrer kamen und gingen, aber Sophia blieb.
»Hmmm …« Ich wich der Frage mit einem Schulterzucken aus. »Letzteres.«
»Hab ich mir fast gedacht um diese Uhrzeit.«
An den Abenden, an denen wir beide im Dienst waren, galt die Verabredung, dass wir uns im Café des Antiquaires, Rue de la Grange-Batelière, trafen, das nur zwei Schritte vom Auktionshaus Drouot entfernt mitten im neunten Arrondissement lag. Die Regel war ganz einfach: Die eine, die zuerst ihren Kunden verabschiedet hatte, wartete auf die andere. Die erste Option dehnte sich selten über elf Uhr nachts hinaus. Die zweite konnte schon mal bis nach Mitternacht dauern.
»Und wie war es bei dir? Ein schöner Abend?«
»Das kann man wohl sagen.« Sie verzog das Gesicht zu einem anzüglichen Lächeln.
»Ein reicher Typ?«
»Widerlich reich, meinst du wohl. Ich habe noch nie so eine fette Rolex gesehen. Und das Beste ist, ich konnte alle Register ziehen, die Pompadour-Suite und das ganze Trallala.«
Das war die andere Besonderheit des Hôtel de Paris: Alle Zimmer – jedes stundenweise zu mieten – trugen den Namen einer großen Verführerin oder Kurtisane der französischen Geschichte: Lieblingsfrauen, Mätressen, Königinnen und einfache Freudenmädchen, die in der Nachwelt fortleben, und eine erstaunliche Mischung von Tänzerinnen, Spioninnen, Künstlerinnen und Damen aus der Halbwelt, die alle berühmt waren für ihren außergewöhnlichen Einfluss auf Männer und für die Art und Weise, wie sie ihn im Laufe ihres turbulenten Lebens genutzt hatten. Diesen Namensgeberinnen waren keine Zimmernummern zugeordnet, und an den Türen standen auch keine. Dafür stimmte die Dekoration eines jeden Zimmers mit dem Charakter und der Zeit der jeweiligen Abenteurerin bestens überein, sodass jeder Raum ein einzigartiges Schmuckkästchen war. Jedes Zimmer verkörperte eine Frau, jede Traumwelt nahm in einem dieser Räume Gestalt an.
»Nicht schlecht«, sagte ich mit etwas gezwungener Begeisterung. »Ich hab die Joséphine beerbt.«
»Ganz große Klasse! Warst du da noch nie?«
»Nein, bisher nicht.«
Sophia ging im Paris viel regelmäßiger ein und aus als ich. Bisweilen zwei-, dreimal im Monat, aber aus Prinzip nicht öfter als ein Mal in der Woche. Dabei waren je nach Gegebenheiten und je nach ihren Bedürfnissen diese Rendezvous ihre Haupteinnahmequelle.
»Und dann?« Sie warf mir ihr mehrdeutigstes Lächeln zu. »Wie war’s? Gut?«
»Ach, Sophia!«, empörte ich mich der Form halber. »Du weißt doch … Ich kann nicht.«
Sie kannte die Regeln genauso gut wie ich: Die Agentur, die uns unsere vermögenden Kunden vermittelte, verbot uns ausdrücklich, dass wir hinterher über sie redeten. Alles, was in diesen kostbaren und herrlich altmodischen Alkoven geschehen war, durfte nie den Raum verlassen. Manche Männer, die wir begleiteten, waren bedeutende Persönlichkeiten, einige hatten sogar Macht, und jede Information über ihr Intimleben, insbesondere Einzelheiten über ihre sexuellen Vorlieben, konnte in den Händen ihrer Gegner zu einer höchst gefährlichen Waffe werden. Verschwiegenheit war angesagt, Geheimhaltung war für uns ein Dogma.
Um ganz ehrlich zu sein, diese Forderung kam mir entgegen. Sie schützte mich vor Sophias Enthüllungen und bedeutete auch für mich eine hilfreiche Barriere. Über Sex zu reden war für sie ein Vergnügen, das dem Akt zumindest ebenbürtig war. Eine natürliche Fortsetzung, als wäre für sie die Zunge ein ebenso erregbares Organ wie die Klitoris und als wären die beiden Körperteile geheimnisvoll miteinander verbunden. Sie sprach über dieses Thema bei jeder Gelegenheit, an jedem Ort, mit Vertrauten genauso wie mit dem Erstbesten. »Jetzt mal ganz im Ernst, kennst du etwas, das interessanter ist als Sex?«, provozierte sie mich oft. »Wir wollen doch wohl nicht über die Börse oder über Kinder reden. Wir haben keinen Cent in der Tasche und, unterbrich mich, wenn ich mich irre, wir sind doch noch weit davon entfernt, Kinderchen in die Welt zu setzen. Einunddreißig, das ist das Durchschnittsalter einer Erstgebärenden in Paris! Einunddreißig!«
Da sie nun wieder bei ihrem Lieblingsthema angekommen war, war sie nicht zu bremsen. Sie genoss es, ohne jede Scham Details auszubreiten, und weidete sich an denen, die sie ihrem Gegenüber entlocken konnte.
»Mein Kunde heute Abend … du hättest sehen müssen, wie gut er ausgestattet ist! Gigantisch! Ein Riesending! Noch dicker als sein Bankkonto, das sagt ja wohl alles.«
»Sophia!«, empörte ich mich und unterdrückte ein Lachen.
»Der Typ müsste im Zirkus auftreten, ich schwör’s dir.«
»Hör auf!«
»Aber was denn? Ich habe doch seinen Namen nicht genannt! Ich rede nur von seinem Penis.«
»Genial«, sagte ich ironisch. »Erzähl die Abenteuer eines namenlosen Glieds.«
»Nein, wirklich, er war so riesig, dass ich geglaubt habe, ich ersticke, als ich ihn gelut…«
»Ja, du hast recht«, unterbrach ich sie, um nicht mehr davon zu hören. »Mit dem Blowjob darf man sich keinesfalls zu lange aufhalten. Sonst werden sie süchtig danach und wollen nur noch das.«
Das war meine klassische Reaktion auf ihren Tsunami an unpassenden Vertraulichkeiten, die einzige, die ich kannte: Ich verschanzte mich vorsichtig hinter Klischees und vorgefertigten Sätzen, die ich hauptsächlich in den neuesten Sexartikeln der Frauenzeitschriften gelesen hatte.
»Trotz allem«, setzte sie wieder an, »ist das doch nichts gegen den, der mich nicht angerührt und von mir verlangt hat, dass ich mich zwei Stunden lang vor ihm selbst befriedige. Der hat mich fertiggemacht.«
»Ja, schon, aber wenn du dich vor ihm befriedigst, zeigst du ihm, wie er dir Lust bereiten kann. Das ist nicht unbedingt verlorene Zeit.«
Cosmo, Sonderheft Sex, Juli-August 2007. Daraus musste ich es haben. Aber was wusste ich eigentlich davon, ich, Annabelle Lorand? Nicht allzu viel.
In Wahrheit war die Klausel der Agentur mein bestes Alibi, um nicht mehr von mir preiszugeben. Meistens reichte sie aus, Sophias Neugier zu besänftigen oder ihre schamlose Logorrhö zu ersticken. Meine Beichten hätte ich mir für mein kleines Ringbuch aufheben können. Doch eine andere Hand schrieb für mich auf diese weißen Seiten.
Es ist verrückt, aber ich habe das Gefühl, dass jedes Geschlechtsteil sein verwandtes Pendant hat. Als gäbe es für jede Vagina nur ein einziges männliches Glied auf der Welt, das in Form und Größe perfekt zu ihr passt. Und umgekehrt. Solange das Pendant nicht gefunden ist, kann das Geschlechtsteil sich nicht vollends entfalten. So ist das bei mir, davon bin ich überzeugt: Mein Geschlechtsteil hat sein männliches Pendant noch nicht gefunden.
(Handgeschriebene Notiz, anonym, vom 2. Juni 2009, in meinen Briefkasten geworfen. Er hat nicht unrecht.)
Dass eine andere Hand an meiner Stelle schrieb, erregte mich genauso, wie es mich empörte, ohne dass ich diese beiden Gefühle auseinanderhalten konnte. Jedenfalls musste mich der Gedanke dermaßen verwirren, dass ich ihm beipflichtete, denn ich hatte das Ringbuch aufgehoben und die unmoralischen Träumereien brav eingeheftet, die der Unbekannte mir zukommen ließ, manchmal mehrere an einem Tag. Ein-, zweimal hatte ich mich stundenlang, den Briefkasten im Blick, auf die Lauer gelegt. Aber erwischt hatte ich ihn nie.
Anfangs gelang es mir, dieses Ringbuch vor Sophia, die ja geradezu einen siebten Sinn für Geheimnisse dieser Art hatte, zu verheimlichen. Bis ich einige Tage später in einem Café, genau zu ihren Füßen, meine Handtasche umwarf. Reflexartig beugte sie sich über den auf dem Boden verstreuten Inhalt.
»Was ist denn das?«
»Nichts … Gib her!«
»Ganz schön bling-bling, dieses Ding! Ist das dein Fickverzeichnis?« Sie gluckste.
»Nicht doch … hör auf …«
»Doch, doch … du wirst ja ganz rot!«
Ohne mich um Erlaubnis zu fragen, schlug sie das Ringbüchlein auf und begann mit leiser Stimme, die ersten Seiten zu lesen …
»Ich werde nicht rot! Gib es mir sofort zurück!«
… dann las sie lauter.
»›… und ich frage mich auch, was ein Typ riecht und schmeckt, wenn er mich unten leckt …‹ Wahnsinn! Mademoiselle Lorand! Du lässt dich ja ganz schön gehen!«
»Sophia, gib es mir, verdammt!«
Schließlich gehorchte sie, aber das Unglück war geschehen.
»Hast du beschlossen, das Sexleben der Annabelle L. zu schreiben, oder was?«
»Ich habe das nicht geschrieben …«
»Ach, komm schon.«
»Ich schwör’s dir. Irgendein Typ wirft diese Zettel in meinen Briefkasten, jeden Tag. Ich habe keine Ahnung, wer es ist und was er von mir will.«
»Wirklich? Und du heftest sie einfach hier drin ab?«
»Ich versichere dir, das ist die Wahrheit.«
Da ich nun in der Falle steckte, erzählte ich ihr, unter welch mysteriösen Umständen dieses Ringbuch in meinen Besitz gelangt war und dass Tag für Tag ein anderer – eine andere? – diese Seiten eines intimen Tagebuchs schrieb, das meines hätte sein können.
Sie war eher amüsiert als schockiert über diese Anekdote. Mir war kurz der Gedanke gekommen, dass vielleicht Rebecca, die Chefin unserer Agentur, hinter diesem heimtückischen Geschenk stecken könnte. Doch wenn es so wäre, warum war ich dann die einzige der Belles de nuit, die diese Zettel erhielt? Denn andernfalls hätte Sophia sofort vor mir damit angegeben.
»Ich glaub, ich spinne. Unter all den Mädchen von Paris kommt dieser Verrückte ausgerechnet auf dich!«
»Warum sagst du das?«
»Ach, Elle … So etwas ist doch eher mein Ding als deins. Ich würde es irre finden, wenn mir ein Typ so ein Geschenk macht! Und ich sage dir, ich hätte nicht abgewartet, dass er es für mich schreibt.«
Ich reichte ihr das silberne Ringbuch, als wollte ich es loswerden. »Wenn ich dir damit eine Freude machen kann … ich schenk es dir.«
»Hör auf, nein! Es gehört dir«, entgegnete sie plötzlich ernst.
»Ach was … Er hätte es genauso gut in die Handtasche irgendeines anderen Mädchens in der Métro stecken können.«
»Nein«, wehrte sie ab. »Wenn man es genau bedenkt, glaube ich nicht, dass es ein Zufall war. Er hat gespürt, dass du es brauchst. Mehr als all die anderen Tussen um ihn herum.«
Damit du lockerer wirst! Diese Bemerkung hatte sie womöglich gerade noch hinuntergeschluckt. Ich sah sie zweifelnd an.
Seit jenem Ereignis – und erst recht, seit David in mein Leben getreten war – fiel es mir immer schwerer, die stürmischen Fragen meiner Freundin abzuwehren. Der Freund, den ich seit drei Monaten hatte, war kein Kunde. Er war es nie gewesen. Die Regeln, die für Kunden galten, waren bei ihm außer Kraft gesetzt.
»Und David, du hast mir nie erzählt …«
»Nie was erzählt?«
»Na, wie er ausgestattet ist. Normal? Riesig? Mini, aber mit dem Maximum an Einsatz?«
»Glaubst du wirklich, ich antworte dir auf diese Frage?!«
Fragen kostet ja nichts, sagte mir ihr lachendes Gesicht.
»Triffst du ihn gleich?«
Sie ging wieder zu Keuscherem über.
»Ja. Nein. Er wird erst spät nach Hause kommen. Ich sehe ihn erst morgen früh. Wenn ich ihn sehe …«
Der gelinde gesagt außergewöhnliche David, seine Person, sein Status, weckte in ihr den Teenager, die Nymphomanin, die Träumerin und Männerfresserin zugleich. Dass ich mir so ein Exemplar hatte angeln können, hatte sie verblüfft. Und sie hielt es für ausgemacht – sei es nur aus Solidarität oder im Namen unserer Freundschaft –, dass ich ihr alles erzählte, was ich an Exotischem oder Erregendem an ihm entdeckte.
»Ist das nicht komisch für dich, ihn nach einem Kunden zu treffen?«
»Ich hab’s dir doch gerade gesagt. Wahrscheinlich sehe ich ihn erst morgen.«
»Dennoch …«, beharrte sie. »Hast du keine Angst, dass er etwas erfährt?«
»Und kommt es dir nicht komisch vor, dass du nie zwei Mal hintereinander mit demselben Kerl schläfst?«, konterte ich.
Getroffen. Sogar zu gut. Ihr Gesicht verfinsterte sich.
Sophia gelang es, ohne dass sie sich anstrengen musste, Begehren zu wecken. Doch dieses Talent, gepaart mit ihrer ausgeprägten Vorliebe für Sex, hinderte sie daran, einen Mann mehr als nur einige Nächte neben sich zu ertragen. Wenn sie nicht gerade ihren augenblicklichen Liebhaber mit dem nächsten betrog, knüpfte sie auf ein Neues mit einer alten Liebschaft an, was bisweilen zu Zwischenfällen führte, für die allein sie den Preis zahlte. Daher verbrachte sie, wenn sie mal wieder erwischt worden war oder ganz einfach von dem einen oder anderen die Nase voll hatte, die meiste Zeit mit ihren Sexspielzeugen. Sie hatte es im Laufe der Jahre zu einer stattlichen Sammlung gebracht.
»Entschuldige …«
»Nein, schon okay. Du liegst ja nicht völlig daneben … Schnappen wir ein bisschen frische Luft?«
Wir liebten diese Spaziergänge durch das nächtliche Paris, durch menschenleere Straßen, über die nur die Scheinwerfer der Taxis strichen. Ziellos flanierten wir umher.
Eines unserer größten Vergnügen war, in die Auslagen der Antiquitäten- und Schmuckgeschäfte zu schauen, von denen es um das Auktionshaus Drouot herum nur so wimmelte. Da feststand, dass all diese Schätze – selbst der bescheidenste – unseren Geldbeutel bei Weitem überstiegen, ließen wir unseren Fantasien freien Lauf. Wir träumten in aller Ruhe von dem Tag, an dem mit einem Mal der Reichtum über uns käme und ein Geldsegen vom Himmel fiele.
»Mensch! Hast du diese Uhr gesehen?« Ich deutete auf ein Modell ganz vorn in der Auslage.
»Den Chronometer für Herren?«
Dieser Laden, Antiquités Nativelle, legte klugerweise neben jeden Gegenstand ein kleines erklärendes Kärtchen, so wie manche Buchhandlungen ihre Leseempfehlungen mit einem bunten Zettel kennzeichneten.
»Ja, schau doch … die ist hundert Prozent mechanisch, 1969 hergestellt!«
»Na und? Suchst du etwa eine erotische Uhr?«, neckte sie mich ironisch.
»69, année érotique«, hatte Jane Birkin im selben Jahr zu der schmachtenden Musik von Serge Gainsbourg gesäuselt.
»69, das ist Davids Geburtsjahr. 5. Januar 1969.«
»Jetzt sag mir nicht, dass du ihm so ein Geschenk machen willst.«
»Lust hätte ich schon. Sie ist wunderschön, nicht?«
Diese schlichte, feine Uhr blinkerte mir von ihrem kleinen Samtsockel zu, denn im Halbdunkel funkelte ihr nachtblaues Zifferblatt prächtig. Insbesondere die leichte Wölbung des Glases fiel mir auf, sie bürgte bestimmt für das Alter und die Echtheit der Uhr.
»Eine winzige Spielzeuguhr im Vergleich zu der meines Kunden …«, spottete Sophia. »Aber wenn ich sie geschenkt bekäme, würde ich sie nicht ablehnen. Ganz klar.«
»Boah … Hast du den Preis gesehen?«
»Ja, dreitausendzweihundert Euro. Du wirst Extraschichten einlegen müssen, Süße, wenn du deinen Krösus verwöhnen willst!«
Dieses Luxusteil kostete mehr, als ich für zwei ganze Monate zum Leben hatte. Ganz zu schweigen von …
Ich seufzte. »Mit den Behandlungskosten für Mama kann ich mir das nie leisten.«
Ihre Krankenkassengrundversorgung deckte bei Weitem nicht die Kosten für die Behandlung, und ich bezahlte, soweit es meine Mittel zuließen, den Rest der Rechnungen und bemühte mich, ihr ein Minimum an Komfort zu bieten, zu Hause ebenso wie während ihrer häufigen Klinikaufenthalte. Eine Woche Chemo, eine Woche, um sich davon zu erholen, und schließlich eine Woche, die sie in einem einigermaßen guten Zustand genießen konnte, um sich dann wieder sieben Tage lang der harten Therapie auszusetzen. So war der höllische Rhythmus, dem sie sich unterwerfen musste. Sie hatte in meiner ganzen Kindheit so viel für mich getan, sie hatte mir so viel gegeben, dass sie es verdiente, dass ich nun im Gegenzug ein Gutteil meiner Einkünfte für sie ausgab.
Hinter der Uhr zog noch ein anderer Gegenstand meine Aufmerksamkeit auf sich. Eine silberne Ziernadel fürs Haar, »die der Schauspielerin Mademoiselle Mars gehörte«, wie das Kärtchen daneben erklärte. Ein Prachtstück aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das die Kleinigkeit von eintausendsiebenhundert Euro kosten sollte. Noch so eine Kostbarkeit, die ich mir nicht leisten konnte.
Ohne Vorwarnung zerrte mich Sophia von dem verführerischen Schaufenster weg. »Komm schon, Süße! Dein Märchenprinz wird sich schon nicht in Luft auflösen, nur weil du ihm nicht bei jedem Treffen ein Spielzeug schenkst, das einen Preis von drei Mindestlöhnen hat!«
»Na klar …«
»Im Übrigen, wenn du erlaubst, wäre es doch eher an ihm, dir solche Geschenke zu machen. Er hat schließlich das Geld.«
»Genau das ist das Problem«, stimmte ich zu. »Es ist sein Geld und nicht meins …«
Ich konnte meiner Freundin nur recht geben. Beim Spielchen der Liebesbeweise in klingender Münze lag ich von vornherein bei einem Rivalen wie David im Hintertreffen. Wie viel verdiente er wohl im Monat? Doch eigentlich war es mir lieber, dass ich es nicht wusste. Meine bescheidene Herkunft und die armseligen Verhältnisse, in denen ich aufgewachsen war, hatten mein Bewusstsein geschärft für das, was in Geldangelegenheiten anständig war und was nicht. So eine Uhr zu kaufen, überstieg daher bei Weitem den Rahmen, den ich mir normalerweise zugestehen würde. Dennoch konnte ich nicht umhin, von ihr zu träumen.
»Und verdient er sie überhaupt, dieser Monsieur?«, fragte Sophia etwas beschwingter. »Du zerreißt dich für ihn, und man weiß nicht einmal, wo er auf der Hitliste deiner Liebhaber steht. Unter den Top Fünf? Oder den Top Drei?«
Schon war sie wieder bei ihrem Lieblingsthema. Sie hielt sich für mein Ringbuch – bald würde sie sich angewöhnen, es mein »Zehnmal-am-Tag« zu nennen, entsprechend der Anzahl der erotischen Gedanken, die ich tagtäglich darin festhalten sollte – und war jeden Augenblick bereit, meine geheimsten Gedanken in sich aufzunehmen.
»Mit David ist es anders …«
»Anders als was? Ist er nicht so mies wie die anderen Männer? Schlägt er dir merkwürdige Dinge vor?«
»Ich liebe ihn.«
Ich hatte mich bemüht, es nicht im Jammerton zu sagen, denn ich wollte nicht einfältiger und hasenherziger klingen, als ich mich im Innersten fühlte. Doch das Gesicht, das Sophia daraufhin zog, zeigte mir, dass sie beinahe überkochte.
»Oh, pardon, dieses Detail hatte ich ausgelassen … Duuu liiiebst iiihn! Darum darf er dich bespringen wie ein Bock, ist doch egal, na klar, wie blöd von mir.«
»Hör auf … Du weiß genau, dass ich das nicht meine.«
»Hat er dir zumindest einmal einen Orgasmus bereitet, dein Millionär?«
Bingo. Darauf wollte ich nicht antworten. Nein. Tatsächlich wollte ich mir diese Frage keinesfalls stellen. Ich ließ es deshalb bei einem Schulterzucken bewenden und schenkte ihr ein Lächeln, das rätselhaft wirken sollte. Sie war ja nicht naiv. Sie kannte mich viel zu gut. Und um jede weitere Frage zu verhindern, wechselte ich abrupt das Thema. Die Schilder verschiedener Kabaretts kamen mir wie gerufen.
»Und du, das Tanzen … Hast du neue Engagements in Aussicht?«
»Puh. Ich hör nur überall: ›Wir sind in der Krise.‹ Ich schwör dir, ich habe nicht den Eindruck, mit Choreografen oder Produzenten zu tun zu haben, sondern mit Bankleuten!«
»Und deine Tanztruppe, da in Neuilly?«
»Sie hat sich aufgelöst. Die Misere ist so groß, dass selbst die Betuchtesten unter uns in Schwierigkeiten geraten.«
»Kannst du dich über Wasser halten?«
»Geht schon, ich komm zurecht …«, versuchte sie mich halbherzig zu überzeugen.
Ich wusste ganz genau, welche Konsequenzen für sie die Arbeitslosigkeit hatte.
»Du bist gezwungen, mehr Typen zu treffen. Ist es das?«
»Hmm«, brummte sie und ließ den Blick über die bunten Neonreklamen wandern.
»Viele?«
»Im Schnitt … zwei pro Woche.«
Das hieß, sie musste über die Grenze hinausgehen, die sie niemals überschreiten wollte. Wie würde sie das verkraften?
Unwillkürlich runzelte ich die Stirn. Ich machte mir Sorgen um sie. Sophia würde die Agentur nicht so schnell verlassen. Wie so viele andere gewagte Arrangements, die man unter dem Vorwand, sie seien nur vorübergehend, akzeptiert, würde auch dieses andauern. Das war jetzt ihr Leben.
3
Paris, Dezember 2008, acht Monate zuvor
Es liegt nicht nur an der mir eigenen Diskretion. Ich kann mich heute tatsächlich nicht mehr daran erinnern, wie und wann genau Sophia mir gegenüber zum ersten Mal die Belles de nuit, die Schönen der Nacht, erwähnt hatte. Ich glaube, damals hatte sie den Vertrag noch nicht unterschrieben, auch wenn sie schon den einen oder anderen Auftrag angenommen hatte. Gerüchte hatten sie irritiert und verschiedene Fantasien, die zum Teil ihrer Lektüre und Filmen entsprangen. Sie hatte Belle de jour von Luis Buñuel und China Blue bei Tag und Nacht von Ken Russel gesehen oder erst kürzlich das finstere Buch von Laura D., Mein teures Studium, gelesen, eine wahre Geschichte.
Wie hatte sie selbst von der Agentur erfahren? Hatte sie jemand dorthin gebracht, damit sie aufgenommen würde? Und falls ja, wer hatte diese Rolle des Vermittlers übernommen?
»Belles de nuit, Belle de jour … Ich gebe zu, sie haben sich nicht gerade ein Bein ausgerissen für den Namen«, sagte sie mit ihrer üblichen kritischen Haltung. »Aber man geht ja auch nicht wegen ihrer Kreativität dahin.«
Wir standen vor einem recht prunkvollen Gebäude mitten im Marais, auf einer dieser Straßen, die am Rand des Schwulenviertels liegt. Das Schildchen über der Sprechanlage verriet nichts über die Art der Tätigkeit. Die Firma hätte genauso gut Kopfkissen verkaufen oder leichte Tänzerinnen vermitteln können. Belles de nuit, 5. Stock, geradeaus.
»Ich finde, das klingt ganz gut.« Ich versuchte, es positiv anzugehen. »Geradezu poetisch.«
»Bist du sicher, dass du da hineinwillst?«
»Sophia, es ist doch nur ein erstes Treffen. Ich will mich informieren, das ist alles.«
»Okay, okay … Aber komm mir nicht eines Tages mit dem Vorwurf, ich hätte dich zu etwas gedrängt, das du selbst nicht gewollt hast. Klar?«
Ich verdrehte die Augen und sprach wieder mit dieser kehligen, etwas plärrenden Stimme, die ich mir im Laufe der Radiopraktika nun im letzten Jahr meines Journalistikstudiums versucht hatte abzugewöhnen. Noch vier, fünf Monate, und ich würde mit einem Diplom in der Tasche bei den renommiertesten Medien des Landes anklopfen, eine kleine Karrieristin, die zu allem bereit war, um ihren Namen unter einem Artikel zu lesen.
»Ich bin zweiundzwanzig. Alles klar. Ich bin ein großes Mädchen.«
»Kommt herein!«
Die blonde, schlanke Frau um die fünfzig, die uns die Tür öffnete, verströmte eine Aura höchster Eleganz. Erleichtert sah ich, dass sie nicht dem Bild einer Geschäftsführerin eines Stundenhotels entsprach.
Sie reichte mir die Hand, die mit Ringen und Armreifen überladen war, als sollten sie die Altersflecken verbergen, die hier und da hervorspitzten.
»Guten Tag … Rebecca Sibony. Ich bin die Leiterin von Belles de nuit«, stellte sie sich mit der rauen Stimme einer starken Raucherin vor.
Wir folgten ihr in der Wolke ihres leicht berauschenden Parfüms in das große, schlicht möblierte Büro.
»Annabelle ist etwas … nervös«, begann Sophia.
Ich hätte sie umbringen können.
»Sie sollten ihr erklären, was Sie von den Mädchen, die für Sie arbeiten, wirklich erwarten.«
Ich verteidigte mich mit kindlicher Unbeholfenheit: »Überhaupt nicht! Ich habe das sehr gut verstanden!«
Mit meiner geflickten alten Jeans, den abgetragenen Ballerinas und den seit Monaten ungeschnittenen Haaren sah ich aus wie eine dumme Gans ohne einen Cent in der Tasche. Ich konnte gut darauf verzichten, dass Sophia es mit ihrer Bemerkung noch schlimmer machte.
Rebecca musterte mich von Kopf bis Fuß, um dann zu einem Monolog anzusetzen, den sie bestimmt auswendig kannte: »Hören Sie, ich weiß nicht, was man Ihnen über uns erzählt hat, aber vieles davon ist mit Sicherheit falsch. Unsere Tätigkeit ist Gegenstand vieler Gerüchte und jeder Menge Verleumdungen. In Wirklichkeit ist das, was wir anbieten, ganz einfach und vor allem, darauf lege ich besonderen Wert, absolut legal: Bei unseren Kunden handelt es sich um reiche, meist unverheiratete Männer, die es sich nicht erlauben können, zu den zahlreichen gesellschaftlichen Verpflichtungen, die sie im Laufe des Jahres wahrnehmen müssen, ohne Begleitung zu erscheinen. Ihre Aufgabe, wenn Sie denn für uns arbeiten wollen, wird darin bestehen, Ihr schönstes Kleid anzuziehen, einen ganzen Abend zu lächeln, ohne sich den Kiefer auszurenken, und sich nur dann an der Unterhaltung zu beteiligen, wenn man sie nach Ihrer Meinung etwa über den letzten Woody-Allen-Film fragt. Sie sehen, es ist wirklich halb so schlimm.«
Was hab ich dir gesagt!, bedeutete mir Sophia mit beredter Geste.
Dabei war sie es, die mir von einem heißen Rendezvous erzählt hatte, das vor einiger Zeit von der Agentur für sie arrangiert worden war. Diese Begebenheit hatte mir übrigens einige Argumente geliefert, die mich ihr Angebot, ich solle doch auch für Rebecca Sibony arbeiten, zunächst ablehnen ließen.
»Ein Fick bei einem totalen Blind Date! Wahnsinn!«
»Ach ja? Aber wie hast du …«
»Na ja, wie im Film, meine Liebe. Ich sollte um Punkt drei im Raphaël sein, keine Minute später. Die Fensterläden waren schon geschlossen, die Vorhänge zugezogen. Vermutlich hatte er dem Personal entsprechende Anweisungen gegeben. Ich musste mich nackt aufs Bett legen und das Licht ausmachen.«
»Und dann?«
»Dann war der Typ da. Etwa zehn Minuten später.«
»War dir nicht ziemlich … mulmig?«
»Im Gegenteil! Na ja, erst war mir etwas kalt, als ich so reglos auf dem Bett lag, so ganz nackt, und auf ihn gewartet habe. Doch dann hat er sich ausgezogen und mich in die Arme genommen, um mich zu wärmen.«
»Habt ihr sofort miteinander geschlafen?«
»Nicht sofort. Wir haben uns einige Minuten aneinandergeschmiegt, bis er angefangen hat, mich zu streicheln.«
»Und hat er nichts zu dir gesagt?«
»Kein Wort! Seine Hände waren supersanft. Ich schwör dir, so zärtlich hat mich noch nie jemand gestreichelt. Ich war sofort feucht.«
»Hast du nicht versucht, sein Gesicht zu sehen? Vielleicht war der Typ ja Quasimodo!«
»Den Eindruck hatte ich nicht, zumindest soweit ich es ertasten konnte. Aber ehrlich, so wie der mich berührt hat, hätte ich, auch wenn er E.T. gewesen wäre, Ja gesagt.«
»So toll?«
»Er hat mir mindestens eine Viertelstunde lang die Möse massiert. Mit den Fingern, mit der Nase, mit der Zunge … Ich konnte nicht mehr! Ich war völlig nass. Ich glaube, ich bin mindestens zwei-, dreimal gekommen, einfach so, ehe er in mich eingedrungen ist. Und das war nur die Vorspeise! Wir sind über drei Stunden im Bett geblieben.«
»Zwei-, dreimal«, wiederholte ich versonnen.
»Und außerdem roch er gut, der Kerl!«
»Wie … gut?«
»Ach, ich weiß nicht, irgendwie total süß. Und sein Schwanz, ich schwör’s dir, der hat nach Erdbeeren oder Himbeeren geschmeckt … Ich hätte ihn den ganzen Tag lutschen können!«
»Sophia!«
»Was denn? Das kannst du dir nicht vorstellen … Das ist wie Kaviar mit verbundenen Augen essen. Was du nicht siehst, nimmst du mit den anderen Sinnen umso deutlicher wahr. Vor allem Geruch und Geschmack.«
»Okay, okay, ich glaub, ich hab verstanden.«
Rebecca riss mich mit ihrer rauen Stimme aus meinen Erinnerungen.
»Natürlich hat die Agentur einen gewissen Ruf. Wir engagieren und vermitteln nur hübsche Mädchen, jung, sauber und vor allem kultiviert, mit einer tadellosen Sprache. Kleiderständer oder Porzellanfiguren gibt es bei mir nicht. Aber nach dem, was ich sehe und höre, mache ich mir bei Ihnen keine Sorgen.«
»Und das ist wirklich alles?«, wagte ich nachzufragen.
»Ja. Das ist alles, wozu Sie sich uns gegenüber vertraglich verpflichten, und mehr stellen wir unseren Kunden nicht in Rechnung.«
»Gut«, sagte ich lakonisch.
»Sie wirken enttäuscht. Was haben Sie denn erwartet?«
Ihr Ton war schroffer geworden. Ja, Rebecca Sibony wusste sich Respekt zu verschaffen.
Dann huschte ein kaum wahrnehmbares Lächeln über ihr Gesicht, das an Mona Lisa denken ließ, und sie raunte: »Danach … falls Ihnen der betreffende Herr gefällt … das ist eine andere Geschichte. Ihre Geschichte. Sie sind beide erwachsen. Und ich werde nicht auftauchen, um Sie und ihn daran zu hindern, Ihrem Verlangen nachzugeben.«
»Genau das sag ich auch immer«, ergänzte Sophia ernst.
Ich versuchte, das Bild meiner Freundin aus meinem Kopf zu verscheuchen: sie nackt in einem dunklen Luxuszimmer, ausgeliefert jenem Unbekannten mit dem Geschmack nach roten Früchten, dem erfahrenen Mösenstreichler.
»Und ich werde auch nicht nur Frauen kurz vor den Wechseljahren engagieren, um … Fälle dieser Art zu vermeiden!«
Das Wort »Fälle« hatte sie mit einem leisen Seufzer untermalt, als fände sie so etwas nicht so tragisch. Dann stieß sie ein kehliges Lachen aus, fast schon ein Husten.
Die Botschaft war klar: Es stand uns frei, die Herren nach den vertraglich zugesicherten Leistungen ins Hôtel de Paris oder sonst wohin zu begleiten. Doch sie wollte nichts davon wissen und noch weniger davon hören. Dieser Teil war allein unsere Sache, Zeit, Tarif und Verdienst eingeschlossen. Damit übernahmen wir auch die Risiken, die damit verbunden waren.
Sie warnte mich: »Ich übernehme keinerlei Verantwortung für das, was in diesen Zimmern geschieht. Von dem Moment an, wo Sie sich auf so etwas einlassen, genießen Sie keinen Schutz mehr. Sind wir uns da einig?«
»Und wenn einer gewalttätig wird?«
»Hör auf mit deinen Filmgeschichten!«, mischte sich Sophia ein. »Das sind Abgeordnete, Anwälte, Firmenchefs … Niemand von denen geht das Risiko ein, dir eine zu knallen, nicht mal zum Spaß.«
»Wie auch immer«, unterbrach Rebecca sie. »Ich wiederhole: Von dem Augenblick an, da Sie mit Ihrem Kunden ein Zimmer betreten, sind Sie auf sich gestellt. Was auch passiert, ich werde Ihnen dann auf keinen Fall zu Hilfe eilen. Haben Sie mich verstanden? Auf keinen Fall!«
»Ja«, sagte ich und nickte.
»Und sollten Sie den Fehler begehen, mich doch zu Hilfe zu rufen oder die Agentur gegenüber Dritten zu erwähnen, zum Beispiel gegenüber der Polizei, werde ich rundheraus abstreiten, Ihnen jemals begegnet zu sein. Und noch in derselben Minute werde ich Sie aus meiner Kartei löschen.« Plötzlich entspannte sich das strenge Gesicht, das sie aufgesetzt hatte. »Schön! Dann also: Glückwunsch! Und willkommen bei Belles de nuit!«
In der nächsten Viertelstunde wurde der Papierkram erledigt, und schon gehörte ich offiziell zur Agentur. Es folgten die grundsätzlichen Anweisungen, mit denen Sophia mich bereits vertraut gemacht hatte: niemals über die Aufträge sprechen, mit niemandem, auch nicht mit Freunden oder Verwandten oder einem anderen Mädchen aus der Agentur; niemals eine Information oder eine Vertraulichkeit ausplaudern, die ein Kunde während des Auftrags geäußert hat; niemals den Namen eines Kunden erwähnen; niemals versuchen, einen Kunden außerhalb der Vermittlung durch die Agentur wiederzusehen.
»Sophia hat mir erzählt, dass Sie Journalistin sind«, sagte die Agenturleiterin schließlich und neigte sich leicht argwöhnisch vor.
»Na ja, noch nicht. Ich schließe gerade mein Studium ab.«
»Perfekt. Aber ich werde nie eine Zeile über unser Gespräch oder Ihre Aufträge in der Presse lesen, nicht wahr?«
Die Frage klang wie eine Drohung.
»Nein. Ich brauche Geld. Keinen Ärger.«
»Perfekt!«, rief sie erneut und hob die Hände. »Übermorgen am späten Vormittag. Haben Sie da Zeit?«
Es verschlug mir die Sprache. Hatte sie etwa bereits einen Kunden für mich? Hatte sie auf das, was Sophia ihr möglicherweise von mir erzählt hatte, vertraut – ich hörte meine Freundin geradezu ihr von meiner »aristokratischen Sinnlichkeit« und meinem »Sexappeal aus gutem Hause« vorschwärmen –, und hatte sie sich berechtigt geglaubt, meine Dienste im Voraus an einen ihrer Stammkunden zu verkaufen?
Als ich wegen meines rasanten Auftakts verärgert die Stirn runzelte, wurde sie plötzlich ganz milde. Sie stand auf, legte mir fast mütterlich die langen, beringten Finger auf die Schulter und tätschelte meinen billigen Wollpullover.
»Das kriegen wir schon hin. Ich werde Ihnen dabei behilflich sein. Wir beide gehen erst mal shoppen. Ich liebe das!«
»Shoppen?«, stammelte ich.
Sophia trampelte mit den Füßen auf den Boden wie ein Schulmädchen.
»Ja, Sie werden sehen, zwei, drei kleine Einkäufe, und Sie sehen bezaubernd aus!«
Bezaubernd.
Dieses Wort kam mir vor wie ein Kleid, das mir drei Nummern zu groß war. Aber ich würde mich daran gewöhnen müssen. Und zwar schnell.
4
Aus Paris heraus in die Vorstadt zu fahren, zerriss mir jedes Mal das Herz. Mehr noch, ich empfand es als einen Abstieg. Die Hauptstadt übte eine große Anziehungskraft auf das kleine Mädchen aus Nanterre aus, das ich noch immer war. Der RER in Richtung Westen, den ich abends an der Haltestelle Les Halles, Opéra oder Étoile nahm, kam mir vor wie ein Schinderkarren. Nur dass ich ihn jeden Tag bestieg.
Die Qualen würden so lange andauern, bis ich in der Lage wäre, mir eine eigene Wohnung zu mieten. Und was das betraf, war ich mir jetzt schon ganz sicher: lieber ein schäbiges, winziges Zimmer mitten in Paris als eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung mit allem Komfort in einer der Vorstädte. Ich wollte im Herzen der großen Stadt wohnen, im Herzen der Welt. Am Puls der Zeit.
An jenem Abend stieg ich mit dem Vertrag der Agentur in der Tasche in die Bahn, deren Inneres frisch mit Graffiti besprüht war, Sitze und Notsitze eingeschlossen. Kaum hatte ich mich gesetzt, spürte ich Blicke auf mir. Blicke von Männern, versteht sich. Ich war sie zwar bereits gewöhnt, doch sie machten mich noch immer verlegen. »Ich versteh nicht ganz, worüber du dich beschwerst!«, wunderte sich Sophia manchmal. »Warte mal ab, wenn du fünfzig bist und dir die Titten bis auf die Knie hängen, bist du froh, wenn dich die Kerle anstarren.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: