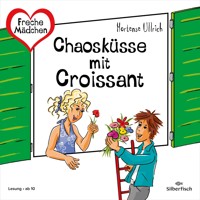Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hörbuch Hamburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist kein altruistischer Charakterzug, der Gwendolyn Herzog von Wohlrath dazu treibt, eine psychologische Praxis zu eröffnen. Sie braucht Geld. Dass sie gar keine Psychologin ist, stört sie nicht. Ihr erster Patient ist Frederick Ackermann, Enddreißiger, mit einem eher ungewöhnlichen Beruf - er ist Leichenbestatter in der 20. Generation. Schon als kleines Kind waren für ihn zwei Dinge ganz sicher: Er wollte das väterliche Unternehmen weiterführen und eine Familie gründen. Mit letzterem scheint es aber nicht so recht zu klappen. Frederick hat eine extrem hohe Ausfallquote - weigern sich doch viele Frauen energisch, beim ersten Rendezvous von einem Leichenwagen abgeholt zu werden. Zu einem zweiten kommt es dann meist nicht mehr. Die verbleibenden Einzelexemplare, die tapfer dem morbiden Hauch, der Frederick umweht, die Stirn bieten, ereilt jedoch ein tragisches Schicksal: Sobald Frederick ihnen die Ehe anträgt, sterben sie. Und zwar auf der Stelle. Nachdem er die dritte Freundin auf diese Art verloren hat, sucht er Hilfe bei einer Therapeutin. Und landet bei Gwendolyn. Sie hat Freude an dieser skurrilen Geschichte – bis ein erneuter Todesfall sie zwingt, seine Geschichte ernst zu nehmen. Panik setzt ein, als sie erfährt, dass sich ihre Nichte Britta in Frederick verliebt hat. Nun muss sie mit allen Mitteln verhindern, dass Frederick Britta einen Heiratsantrag macht – zur Not auch mit Hühner-Voodoo …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hortense Ullrich
Hühner Voodoo
Roman
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
EINS
Es klingelte an der Haustür. Gwendolyn warf einen Blick auf den Bildschirm ihrer Überwachungsanlage. Der Mann kam ihr vage bekannt vor. Sie seufzte, ging zur Eingangstür und öffnete.
«Guten Tag, Frau Herzog von Wohlrath.»
Gwendolyn nickte kaum merklich.
«Bernhard Ziegler», stellte er sich vor. «Ich arbeite bei Wulf und Partner. Ich bin Ihr Anlageberater.»
Sie sah ihn misstrauisch an.
«Wir verwalten Ihr Vermögen.»
«Ich weiß.»
Er schien sehr nervös zu sein, wirkte fahrig und wischte sich mit einem billigen Papiertaschentuch den Schweiß von der Stirn. Ein kleiner Fetzen blieb über seiner rechten Augenbraue hängen. Gwendolyn war versucht, ihn darauf aufmerksam machen, aber er schien ein dringendes Anliegen zu haben.
«Ich, ähm, also … kann ich mich setzen?», fragte er.
«Was denn? Hier? Vor die Tür?»
«Nein, also, ich dachte eher drinnen.»
Gwendolyn starrte auf das Papierschnipselchen auf seiner Stirn.
«Es ist wirklich wichtig.»
«Dass Sie sich setzen?»
«Ja, das auch. Aber eigentlich meinte ich, es ist wichtig, dass ich mit Ihnen rede. Bitte.»
Gwendolyn öffnete die Tür nun ganz.
Bernhard Ziegler wankte etwas, als er eintrat. Sie wies ihn in ihr Wohnzimmer.
«Brauchen Sie einen Cognac? Oder ist Alkohol bereits der Grund, dass Sie so unsicher auf den Beinen sind?»
«Nein. Ja.»
«Was nun?»
«Cognac wäre gut.»
Er ließ sich auf dem Sofa nieder, Gwendolyn holte einen Remy Martin XO und einen Cognacschwenker aus dem Schrank, schenkte ein und stellte Ziegler das Glas hin.
«Schenken Sie sich am besten auch einen ein, es geht um Ihr Vermögen», seufzte er.
Gwendolyns drei Scheidungen hatten sie reich gemacht. Ihr Vermögen war angelegt, sie lebte sehr angenehm von den Zinsen. Und mit Ehemann Nummer vier hatte sie endlich den Mann fürs Leben gefunden; zumindest für das letzte Drittel. Er hatte eine sehr elegante Jugendstilvilla erworben, wo er nach vielen Jahren im Ausland, bedingt durch seine Arbeit im diplomatischen Dienst, mit Gwendolyn sesshaft werden wollte. Doch dazu kam es nicht mehr. Ihr Ehemann verstarb, und Gwendolyn brachte es nicht übers Herz, die Villa zu verkaufen; sie hielt an dem gemeinsamen Plan fest und bezog das Haus alleine.
«Was ist mit meinem Geld?»
«Nun, haben Sie noch welches?»
«Wie bitte?»
«Na ja, vielleicht gibt es noch Konten, Anlagen, Aktien, Fonds, die wir nicht betreuen?»
«Nein. Was soll die Frage?»
Statt zu antworten, fragte Bernhard Ziegler weiter: «Wertvollen Schmuck, Goldbarren in einem Banksafe? Oder Bargeld unter der Matratze?»
«Nein, nein und nein. Worum geht es?»
«Ich hab schlechte Nachrichten für Sie.»
Gwendolyn zog die Augenbrauen zusammen. «Ich schätze es nicht, wenn jemand aus dem Büro meiner Vermögensverwaltung von schlechten Nachrichten spricht.» Sie schätzte es auch nicht, mit jemand ein ernsthaftes Gespräch zu führen, auf dessen Stirn ein Stück Papiertaschentuch klebte. Sie seufzte.
Ziegler seufzte ebenfalls, kippte den Cognac, atmete tief durch und sagte: «Also wenn Sie Ihr gesamtes Vermögen Herrn Wulf anvertraut haben, dann muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Sie mittellos sind.»
«Mittellos?»
«Arm.»
«Arm?»
«Kein Geld.»
Gwendolyn sah ihn scharf an und sagte: «Ich würde es begrüßen, wenn Sie sich etwas deutlicher ausdrücken würden.» Und sich den Papierschnipsel von der Stirn entfernen, fügte sie im Geiste hinzu.
«Ich dachte, das wäre bereits sehr deutlich.»
«Nein.»
Bernhard Ziegler holte tief Luft. «Herr Wulf, der Inhaber unserer Firma, hat die Konten unserer Kunden geplündert und sich mit dem Geld abgesetzt. Er ist weg. Spurlos verschwunden.»
Der nervöse Anlageberater hielt ihr sein leeres Glas hin, sie schenkte nach, nahm ihm dann allerdings den Cognac aus der Hand und trank ihn selbst aus.
Das waren tatsächlich unerfreuliche Nachrichten. Äußerst unerfreulich. Kein Geld. Sie hatte kein Geld mehr. Wie verhält man sich in einer solchen Situation? Was ist eine adäquate Reaktion? Sie würde darüber nachdenken müssen. Zunächst beschränkte sie sich darauf, Ziegler sehr hochmütig anzusehen.
Gwendolyns Hochmütigkeit war nicht gespielt. Hochmut war ihre Art, auf Stress zu reagieren. Sie zitierte gerne aus Camus’ Der Mythos des Sisyphos: «Es gibt kein Schicksal, das nicht durch Verachtung überwunden werden könnte.» Camus’ Philosophie des Absurden lag ihr. Nicht in letzter Konsequenz. Sie sah es eher als Aufforderung, Konventionen zu ignorieren und Impulsen zu folgen.
Gwendolyn Herzog, ewige 59, Modell «Grand Dame», war nach vier Ehen finanziell abgesichert, kinderlos und immer offen für neue «Thrills», Dinge, die sie nicht mit «been there, done that» abtun konnte. Sie war mit einem speziellen Blick auf die Wirklichkeit gesegnet. Das Leben war für sie eine Theaterbühne; teils spielte sie mit, teils saß sie im Zuschauerraum, manchmal griff sie in die Handlung ein. Da sie sich ständig im Theater wähnte, kleidete sie sich entsprechend. Dezent war nicht das Wort, das man wählen würde, wenn man ihre Garderobe beschreiben sollte. Heute hatte sie ein brokatbesetztes Gewand gewählt, das laut ihren Angaben aus dem Nachlass von Eleonora Duse stammte.
Und nun das. Kein Geld mehr. Sie legte die Stirn leicht in Falten und versuchte Contenance zu bewahren.
«Und was bitte soll ich nun Ihrer Meinung nach tun?»
Ziegler blickte sich um. «Das Haus hier … Sie könnten es verkaufen.»
«Nein. Das ist keine Option.»
«Das Haus verursacht Kosten. Wie wollen Sie das finanzieren? Und wovon wollen Sie leben?»
«Als Finanzberater sollten Sie mir solche Fragen nicht stellen, sondern sie beantworten!», fauchte Gwendolyn. «Und wischen Sie sich das Stück Papiertaschentuch von der Stirn, das sieht ja lächerlich aus.»
Ziegler zuckte zusammen, fuhr sich hektisch über die Stirn und murmelte: «Entschuldigung.»
Gwendolyn atmete auf. Eins ihrer Probleme war gelöst. Nun kam das nächste dran.
«Also, was schlagen Sie vor?», fragte sie etwas freundlicher.
«Wohnen Sie hier ganz alleine?»
«Was soll die Frage?»
«Sie könnten vermieten. Eine Etage. Oder einzelne Zimmer.»
«Ich will nicht mit fremden Leuten unter einem Dach leben.»
«Was ist mit dem Souterrain? Ich hab gesehen, da gibt es einen separaten Eingang.»
«Das ist auch unter demselben Dach.»
«Aber Sie könnten es als Büro vermieten. Dann haben Sie nur tagsüber Leute im Haus, die abends wieder gehen. Das wäre eine Mieteinnahme, die, wenn Sie Glück haben, die Kosten des Hauses trägt. Dann könnten Sie hier wohnen bleiben. Für Ihren Lebensunterhalt müssten Sie allerdings arbeiten.»
Diese Ankündigung übertraf die ursprüngliche Schreckensnachricht bei weitem.
«Arbeiten?», rief Gwendolyn entsetzt.
Bernhard Ziegler sah die tiefe Falte, die sich augenblicklich auf ihrer Stirn gebildet hatte, und verspürte das dringende Bedürfnis zu gehen. Er fürchtete, dass dieser Ausruf nur das Vorbeben eines mächtigen Erdstoßes war, der gleich folgen würde, und stand auf.
«Hören Sie, es läuft ein Haftbefehl gegen Wulf», sagte er im Hinausgehen. «Wer weiß … vielleicht … womöglich erwischt man ihn und kann einen Teil Ihres Geldes retten. Mehr kann ich im Moment nicht für Sie tun.»
Gwendolyn folgte ihm. In ihren Augen zeigte sich ein gefährliches Funkeln.
Ziegler griff in seine Jackentasche und reichte ihr eine Visitenkarte. «Rufen Sie hier an. Einigen unserer Klienten, die in einer ähnlichen Lage wie Sie sind, hat es geholfen.»
«Ist das die Nummer eines Auftragskillers?»
Bernhard Ziegler riss die Augen auf. «Bitte? Oh Gott, nein. Natürlich nicht.»
Er hatte erheblich an Farbe verloren.
«Nicht für Sie. Für Wulf», stellte Gwendolyn klar.
«Ähm, also … es ist die Karte einer Psychologin. Sie können mit ihr über Ihre Probleme reden.»
«Ich soll jemanden dafür bezahlen, dass ich ihm erzählen darf, dass ich kein Geld mehr habe?»
«Aber nein. Die Behandlung ist für Sie kostenlos. Unsere Firma hat für solche Fälle einen Fonds eingerichtet. Wir übernehmen zehn Sitzungen. Sagen Sie Frau Doktor Wittenfeld, dass sie die Rechnung an uns schicken soll.»
«Was für ein Schwachsinn! Geben Sie mir lieber dieses Geld in bar, und gut ist», fauchte Gwendolyn.
Ziegler hatte die Türklinke in der Hand. «Tut mir leid, das ist im System nicht vorgesehen. Wir können Ihnen nur die zehn kostenlosen Sitzungen anbieten.» Er nickte ihr noch einmal zu und zog die Eingangstür hinter sich ins Schloss.
Gwendolyn fluchte. Man veruntreute ihr Geld und bot ihr als Entschädigung eine Therapie an? Sie war wütend.
Sie ging zurück ins Wohnzimmer, griff nach einer Karaffe aus Muranoglas, stellte sie aber wieder hin. Die Lalique-Kristallvase? Nein. Alles um sie herum war zu teuer, sie würde die Einrichtung nicht für einen Wutausbruch verschwenden. Wer weiß, womöglich würde sie einiges verkaufen müssen. Allerdings nur, wenn es zum Äußersten kommen würde. Zunächst würde sie sich einschränken. Die großzügige monatliche Spende, die sie dem «Verein zum Wohlthun» zukommen ließ, bereitete ihr Kopfzerbrechen. Der Verein hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Leute finanziell zu unterstützen, die unverschuldet in Not geraten waren. Just bevor Ziegler kam, war sie dabei gewesen, einen Scheck für den Verein auszustellen. Es war eine sentimentale Geste und hatte mit ihren Eltern zu tun. Die beiden hatten sich nämlich auf die Liste der Bedürftigen geschwindelt, um auch im Alter noch ein angenehmes Leben führen zu können. Gwendolyn hatte davon erst bei der Beerdigung ihrer Eltern erfahren, seufzend den Kopf geschüttelt und entschieden, dass sie es indirekt wiedergutmachen würde. Das wollte sie nicht aufgeben.
Ihr Blick fiel auf die Karte der Psychologin. Sie schnaubte höhnisch. Zehn kostenlose Sitzungen! Rechnung an Wulfs Büro. Tzz. Sie sollte das Geld bekommen!
Genau! Sie würde der Vermögensverwaltung im Namen von Frau Doktor Wittenfeld eine Rechnung über zehn Sitzungen schicken, jedoch mit ihrer Kontonummer. Am besten einer neuen Kontonummer.
Gwendolyn lächelte. Und goss sich noch einen Cognac ein. Sie würde einen Termin bei Frau Doktor Wittenfeld vereinbaren, eine einzige Behandlung in Anspruch nehmen und sich eine Rechnung geben lassen. Mit den entsprechenden Änderungen versehen würde daraus eine Rechnung über zehn Behandlungen werden, sie würde sie an Wulfs Büro schicken und das Geld kassieren. Außerdem wäre es sicher sehr unterhaltsam, mal zu einer Psychologin zu gehen.
Sie griff zum Telefon.
«Guten Tag, hier ist Edna Gabler. Ich brauche einen Termin bei Ihnen.» – «Was? Erst in einem halben Jahr?» – «Sagen Sie, stimmt es, dass man für ein Jagdgewehr tatsächlich einen Waffenschein braucht?» – «Hm. Nun ja, machen Sie sich keine Gedanken, mir fällt schon eine Alternative ein.» – «Wie bitte? In zwei Stunden? Ja, kein Problem, da kann ich bei Ihnen sein.»
Gwendolyn legte auf. «Na bitte, geht doch», murmelte sie.
Die Einsicht, dass ihre Lebenszeit begrenzt war und dass einem, wenn man jenseits der 60 ist, für unorthodoxes Verhalten meist mildernde Umstände zugestanden wurden, führte dazu, dass sie sich selten Zurückhaltung auferlegte, wenn ihr ein absurder Gedanke durch den Kopf schoss.
Zwei Stunden später saß Gwendolyn Frau Doktor Wittenfeld gegenüber.
«Die Waffe, von der Sie am Telefon sprachen, brauchen Sie die, um sich zu schützen?», begann die Psychologin das Gespräch.
«Allerdings.»
«Sie fühlen sich also bedroht?»
«Ja.»
«Von wem?»
Gwendolyn beugte sich vor und flüsterte: «Von den Eichhörnchen.»
Doktor Wittenfeld verzog keine Miene. «Erzählen Sie mir mehr darüber.»
Gwendolyn hatte sich für eine massive Eichhörnchenphobie entschieden, um etwas Spaß mit der Therapeutin zu haben.
Sie gab sich sehr viel Mühe, ihre Beschwerden zu schildern. Doch Frau Doktor Wittenfeld, eine blasse humorlose Mittvierzigerin, beschränkte sich darauf, zu nicken, sich gelegentlich eine Notiz zu machen und immer wieder eine Blumenvase mit einer einzigen Lilie, die vor ihr auf ihrem Schreibtisch stand, um ein paar Millimeter zu verrücken. Sie hatte ganz offensichtlich einen Lilientick und ein Faible für Bauhausmöbel. Der weiße Schreibtisch und die Stühle, auf denen sie beide saßen, waren klassische Marcel-Breuer-Entwürfe der Firma Thonet. Die weiße Ledercouch und der am Kopfende platzierte Sessel waren unverkennbar Le Corbusier. In Reichweite des Sessels stand ein kleiner runder Glastisch, ebenfalls von Le Corbusier; auf dem Tisch wieder eine Vase mit einer einzigen Lilie. Ob die Möbel Originale waren und wirklich aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammten?
«Eichhörnchen also», fasste Frau Doktor Wittenfeld schließlich zusammen und lehnte sich leicht zurück. «Seit wann haben Sie dieses Problem?»
«Schon lange.»
«Und wieso haben Sie sich jetzt entschieden, etwas dagegen zu unternehmen?»
«Es werden immer mehr.»
«Gab es ein einschneidendes Erlebnis, das zu Ihrem Entschluss, zu mir zu kommen, führte?»
«Ja, man wollte mir keine Waffe verkaufen.»
Die Psychologin zeigte nach wie vor keine Emotion.
«Wie lautet denn Ihre Erklärung für Ihre Angst vor Eichhörnchen?»
«Sie wissen, dass die meisten Eichhörnchen keine Eichhörnchen sind, sondern kleine Teufel im Eichhörnchenpelz? Sie sind verkleidet.»
In diesem Moment klingelte das Handy der Psychologin.
«Bitte entschuldigen Sie. Normalerweise gehe ich während einer Behandlung nicht ans Telefon, aber da wir uns außerhalb meiner Sprechzeit befinden, möchte ich den Anruf gerne entgegennehmen.»
Gwendolyn nickte.
«Wittenfeld», meldete sie sich. «Ja, ja, ist gut. Ich komme auf der Stelle.» Sie stand auf und eilte zur Tür. «Dringender Notfall. Wir müssen abbrechen, ich muss sofort los. Es tut mir wirklich sehr leid», rief sie Gwendolyn noch zu, als sie nach ihrer Jacke griff.
Gwendolyn folgte ihr mit sichtbarer Empörung ins Vorzimmer.
Doktor Wittenfeld sah sich nach ihrer Empfangsdame um. «Frau Vollmer ist gerade in der Mittagspause. Wenn Sie kurz warten, können Sie mit ihr einen neuen Termin ausmachen.» Schnell schrieb sie etwas auf einen Zettel und legte ihn für ihre Mitarbeiterin auf den Empfangstisch. Dann sah sie Gwendolyn an und sagte: «Bitte sehen Sie vom Erwerb einer Waffe ab. Wir können Ihr Problem anders lösen.» – Und weg war sie.
Gwendolyn entfernte den Zettel vom Empfangstisch, nahm einen neuen und schrieb: «Bitte Rechnung an Edna Gabler, Rosenthal 14 schicken.»
Sie griff nach ihrem Mantel, sammelte ein paar der herumliegenden Zeitschriften ein, steckte sie in ihre Handtasche und wollte gerade gehen, als ein junger, ausgesprochen gut aussehender Mann im dunklen Anzug die Praxis betrat.
«Guten Tag, Frau Doktor Wittenfeld. Mein Name ist Frederick Ackermann. Ich brauche Ihre Hilfe.»
«Tut mir leid, aber ich bin nicht …»
«Ich weiß, Sie sind nicht in der Lage, mir so kurzfristig einen Termin zu geben, aber es ist wirklich dringend. Ich zahle auch gern das doppelte Honorar.»
Gwendolyn wollte ihn eigentlich auf seinen Irrtum hinweisen, aber die Erwähnung von Geld hielt sie davon ab. «Nun, also …», begann sie und wählte bereits instinktiv eine Psychologenstimme, als sie die Tür zum Behandlungszimmer öffnete und eine einladende Geste machte. «Nehmen Sie Platz», sagte Gwendolyn und deutete zur Couch.
Dankbar trat Frederick Ackermann ein.
Gwendolyn setzte sich ihm gegenüber auf den weißen Ledersessel und rückte die Vase mit der Lilie ein paar Millimeter zur Seite. Sie war bester Laune. Hoffentlich hatte sie einen echten Verrückten erwischt. Ein interessantes Business, diese Psychologie. Und lukrativ.
Sie lächelte und begann mit ihrer Behandlung.
«Was für ein Problem haben Sie denn?»
«Die Ehe.»
«Wie lange sind Sie denn schon verheiratet?»
«Ich bin nicht verheiratet!»
«Dann haben Sie auch kein Eheproblem!»
«Doch. Ich hab ein Problem mit der Ehe. Ich möchte gerne heiraten. Aber Sandra …» Er brach ab.
«… aber Sandra will nicht», ergänzte Gwendolyn für ihn.
«Nein, das ist es nicht. Sie will, ich will, … aber ich … ich glaube, ich sollte nicht.»
Gwendolyn machte ein ziemlich enttäuschtes Gesicht. Wie langweilig. Das war alles? Er glaubte, er sollte seine Freundin nicht heiraten? Sandra war doch seine Freundin, oder? Hoffnung keimte auf.
«Ist Sandra vielleicht Ihre Mutter?»
«Nein!», rief Frederick entsetzt.
«Ihre Schwester?»
«Ich habe keine Schwester.»
«Würden Sie denn Ihre Schwester heiraten wollen, wenn Sie eine Schwester hätten?», bohrte Gwendolyn weiter.
«Sandra ist nicht mit mir verwandt. Ich kann sie nicht heiraten, weil ich sie höchstwahrscheinlich umbringen werde.»
«Umbringen?» Gwendolyn sah ihn fasziniert an. «Hervorragend!» Sie strahlte. «Das nenn ich ein Problem. Legen Sie sich doch bitte hin und erzählen Sie mal ausführlich von sich.»
Frederick Ackermann berichtete, dass er 39 sei und Single aus Notwendigkeit, nicht aus Überzeugung, was wohl mit seinem eher ungewöhnlichen Beruf zusammenhängen könnte: Er war Leichenbestatter, und zwar aus Leidenschaft. Er führte seit dem Tode seiner Eltern das Familienunternehmen, das auf eine lange Tradition zurückblickte. Schon als kleiner Junge machte er sich mit der Materie vertraut. Sein bester Freund war der städtische Totengräber, mit dem er viel Zeit verbrachte. Zu Weihnachten standen auf seiner Wunschliste Bücher mit Titeln wie Begräbnisrituale im Wandel der Zeit und Wie ich meine Freunde zu Grabe trug, eine nicht unumstrittene Biographie des Ober-Leichengräbers des Wiener Zentralfriedhofs. Für seine Familie war das normal, und man freute sich, dass der einzige Sohn so viel Interesse und Enthusiasmus für das Familienunternehmen zeigte. Deshalb schenkte man dem kleinen Frederick zu Weihnachten einen exakten Nachbau des elterlichen Bestattungsinstituts in Puppenstubengröße. Kleine Särge, kleine Kränze, kleine Leichenwagen. Während andere Kinder liebevoll mit Puppenstuben oder Kaufmannsläden spielten, war der kleine Frederick stundenlang mit seinem Miniatur-Bestattungsinstitut beschäftigt. Schon als Teenager arbeitete er in seiner Freizeit im elterlichen Betrieb. Seinen Vorschlag, zeitlich begrenzte Angebote mit dem Slogan «Sterben Sie noch diese Woche, und Sie sparen bis zu 30%» zur Umsatzsteigerung einzusetzen, lehnte sein Vater allerdings ab. Seine Mitschüler mochten ihn, fanden ihn aber sehr überspannt mit seinem Friedhofstick. Es dauerte ein wenig, bis er seine erste Freundin fand. Sie war Anhängerin einer Satanssekte. Die Beziehung hielt nicht lange. Der kleine Sarg, den er liebevoll für ihre Ratte gebastelt hatte und ihr als Geschenk überreichte, erzielte nicht die erhoffte Wirkung, da die Ratte noch lebte. Frederick ist konservativ, ein Kavalier der alten Schule und wusste schon als kleines Kind zwei Dinge ganz sicher: Er wollte das väterliche Unternehmen weiterführen und eine Familie gründen.
Mit Letzterem will es aber nicht so recht klappen. Frederick hat eine Ausfallquote von 90% zu beklagen – weigern sich doch viele Frauen energisch, beim ersten Rendezvous in einen Leichenwagen einzusteigen. Zu einem zweiten Rendezvous kommt es dann auch nicht mehr. Bleiben also nur lausige 10%, die tapfer dem morbiden Hauch, der Frederick umweht, die Stirn bieten.
«Vor ungefähr zwei Jahren habe ich Sandra kennengelernt. Sie akzeptiert meinen Beruf, und nun ist es so weit: Ich möchte ihr einen Antrag machen. Aber ich habe Angst, dass sie stirbt, wenn ich sie frage, ob sie mich heiraten will. Aus diesem Grund suche ich nun Hilfe», beendete er seinen Rapport.
«Spannend. Wirklich», lobte ihn Gwendolyn. «Tolle Geschichte!»
Im Vorzimmer waren Geräusche zu hören. Die Mittagspause war wohl zu Ende. Wäre gut, wenn sie nun möglichst rasch das Feld räumen würde. Gwendolyn wandte sich an den gutaussehenden Totengräber.
«Ich kann Ihnen bestimmt helfen. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. Wir machen einen neuen Termin aus.»
Frederick nickte. «Ich kann morgen wiederkommen.»
Gwendolyn überlegte. Sie war sich nicht sicher, ob Frau Doktor Wittenfeld ihr ihre Praxis zur Verfügung stellen würde.
«Nein, das machen wir anders. Geben Sie mir Ihre Visitenkarte. Ich werde zu Ihnen kommen.»
«Ist das nicht etwas ungewöhnlich?»
«Nun, Ihr Problem ist auch ungewöhnlich. Ungewöhnliche Probleme, ungewöhnliche Behandlungsmethoden. Ich muss Ihr Umfeld kennenlernen, um zu entscheiden, wie wir vorgehen werden. Das ist dann allerdings ein Hausbesuch, und ich muss Ihnen dafür ein höheres Honorar in Rechnung stellen.»
Frederick zuckte die Schultern. «Wenn das so üblich ist.»
«Ist es», bestätigte Gwendolyn. Sie begleitete Frederick nach draußen, grüßte freundlich die ziemlich verblüffte Empfangsdame, murmelte als Erklärung etwas von wegen «Paartherapie» und machte sich auf den Heimweg.
Sie war sehr glücklich: Sie würde als Psychologin tätig werden. Sie würde den Geschichten anderer Menschen lauschen und dafür Geld kassieren. Wie wunderbar. Und den ersten Patienten hatte sie bereits. Einen echten Irren. Das versprach äußerst amüsant zu werden und eine mühelose Einnahmequelle.
Als sie durch die Fußgängerzone lief, nahm sie einen kleinen Tumult wahr. Neugierig blieb sie stehen. Zwei Polizisten redeten auf eine aufgebrachte, rundliche ältere Dame ein, die auf einem Campingstuhl saß, vor sich einen kleinen Tisch. Ihr gegenüber, auf der anderen Seite des Tisches, stand ein weiterer Stuhl. Leer.
«Aber Sie können mich doch nicht verhaften!», rief sie empört.
«Wir verhaften Sie nicht! Ich sagte doch, wir machen Sie auf eine Ordnungswidrigkeit aufmerksam, die Sie begangen haben. Es wird lediglich eine Geldbuße zur Folge haben», sagte Polizist Nummer eins, offensichtlich nicht zum ersten Mal, aber bemüht freundlich.
Polizist Nummer zwei war nicht so freundlich: «Also, jetzt Ihren Namen bitte.»
«Bernadette Kunz. Und ich möchte festhalten, dass ich nichts Unrechtes getan habe!»
Polizist Nummer zwei bellte: «Sie gehen einer gewerblichen Tätigkeit nach, und nach § 55 der Gewerbeordnung brauchen Sie dafür eine Erlaubnis vom Ordnungsamt. Und die haben Sie nicht. Was Sie hier tun, gilt als Reisegewerbe, und dafür ist eine Reisegewerbekarte Vorschrift.»
«Dann warten Sie hier, ich geh mal schnell und besorge mir diese Karte.»
Nummer eins erklärte: «Sie brauchen dafür ein Lichtbild und Ihren Personalausweis, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, ein polizeiliches Führungszeugnis von der Meldebehörde, einen Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis vom Amtsgericht und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister. Wenn das in Ordnung ist, zahlen Sie eine Gebühr und bekommen eine Reisegewerbekarte.»
Bernadette Kunz sah ihn verblüfft an. «Ist das nicht ein bisschen viel Umstand für einen kleinen Tisch in der Fußgängerzone?»
Das brachte den Kollegen zwei noch auf ein weiteres Vergehen: «Und außerdem haben Sie auch keine Standerlaubnis. Selbst wenn Sie die Reisegewerbekarte haben, brauchen Sie noch eine Standerlaubnis. Und die Reisegewerbekarte muss vom Inhaber ständig mitgeführt werden und wird vom Gewerbeaufsichtsamt kontrolliert. Das sind die Vorschriften, an die sich Straßenverkäufer halten müssen.»
«Aber ich verkaufe doch nichts.»
«Sie bieten Leistungen an.»
«Ich will kein Geld dafür.»
«Das behaupten Sie jetzt, aber …»
Gwendolyn straffte sich, schob sich an ein paar Schaulustigen vorbei und trat mit autoritärer Attitüde auf die beiden Polizisten zu. «Guten Tag. Ich bin die behandelnde Psychologin von Frau Kunz. Sie ist meine Patientin. Was sie hier tut, geschieht unter ärztlicher Aufsicht. Es ist Teil eines Experiments. Ein Feldversuch. Sie verstehen. Sie ist bei mir in Behandlung wegen …» Sie warf einen Blick auf den Tisch, dort lagen kleine Knochen und ein handgeschriebener Zettel: «Hühner Voodoo – Hilfe in allen Lebenslagen.» Mit leicht spöttischer Stimme fuhr sie fort: «… ihres Hühner-Voodoo-Problems.» Sie lächelte die beiden Polizisten an. «Es tut mir sehr leid, dass wir Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet haben. Ich nehme Frau Kunz jetzt wieder mit in meine Praxis.»
Ihre freundliche Formulierung täuschte nicht darüber hinweg, dass es eine Aussage war, der man nicht widersprach. Es wirkte.
Ein Teil der Wirkung beruhte allerdings auf ihrer Körpergröße. Gwendolyn überragte die meisten Frauen um einen Kopf. Mit Männern war sie auf Augenhöhe. Körperlich. Ansonsten hielt sie Männer für das schwächere Geschlecht und ging meist sehr nachsichtig mit ihnen um. «Man darf ihnen nicht zu viele Informationen auf einmal geben, das verwirrt sie», sagte sie stets. «Sie brauchen klare Anweisungen, was sie tun sollen. Keine Andeutungen.»
Polizist Nummer zwei brummte, Nummer eins sagte: «In Ordnung.»
Bernadette sah die beiden Polizisten triumphierend an, Gwendolyn legte Bernadette die Hand auf die Schulter, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und sagte: «Dann packen Sie mal bitte zusammen, Frau Kunz, wir wollen die Herren nicht weiter aufhalten.»
Bernadette stand auf, sammelte die Knöchelchen und den Zettel vom Tisch, verstaute alles in ihrer Handtasche, klappte die beiden Stühle und den Tisch zusammen, befestigte sie mit ein paar Expandern auf einem kleinen Einkaufstrolley und war bereit, zu gehen. Gwendolyn nickte den Umstehenden inklusive der Polizisten noch einmal zu und verließ dann gemeinsam mit Bernadette den Ort des Geschehens.
Als sie außer Hörweite der Leute waren, sah Bernadette Gwendolyn kritisch an und fragte: «Sie halten sich nicht wirklich für meine Psychologin, oder?»
«Bitte? Nein!»
«Gut.»
«Wieso fragen Sie das mit diesem Unterton?»
«Ich wollte nur sichergehen, dass Sie nicht, nun ja, wie soll ich sagen … verrückt … sind.»
«Ach was! Sie haben Angst, dass ich verrückt bin?»
«Nein, Angst habe ich nicht. Aber ich wollte Sie zu einer Tasse Kaffee einladen. Als Dank. Das tue ich aber nur, wenn Sie nicht …, na ja, Sie wissen schon … sind.»
Gwendolyn schnappte leicht nach Luft.
«Sie haben in der Fußgängerzone einen Campingtisch aufgebaut und bieten Hühner Voodoo an», erinnerte sie Gwendolyn. «Und da machen Sie sich Sorgen um meine geistige Gesundheit?!»
«Ja», sagte Bernadette schlicht und beließ es dabei.
Gwendolyn sah die kleine runde Frau nachdenklich an. Entweder war sie völlig durchgeknallt, oder sie würde ihre neue beste Freundin werden.
Bernadette deutete auf ein Café am Beginn der Fußgängerzone.
«Wir gehen ins Café Florian. Die haben dort ein wunderbares Kuchenbuffet. Für fünf Euro kriegt man eine Tasse Kaffee und Kuchen, so viel man will.» Sie schob sich noch etwas näher zu Gwendolyn und flüsterte: «Ich nehme mir da auch immer ein Stück für zu Hause mit. So spare ich Geld.»
Neue beste Freundin, entschied Gwendolyn. Aber eins musste sie noch klären: «An dieses Hühner Voodoo glauben Sie doch nicht wirklich?»
«Oh nein.»
Gwendolyn nickte und grinste.
«Ich glaube nicht daran», fuhr Bernadette fort, «ich weiß, dass es funktioniert.»
Beste Freundin ade. Aber die Aussicht auf einen kostenlosen Kaffee und ein Stück Kuchen ließ Gwendolyn das Gespräch fortführen.
«Und aus welchem Grund machen Sie das?»
«Um Leuten zu helfen. Ich kann aus den Knochen Antworten auf Lebensfragen herauslesen. Eine Art Orakel. Für mich ist es wichtig, eine Aufgabe zu haben. Und anderen zu helfen, ist eine sehr schöne Aufgabe.»
«Ach was. Und es kommen tatsächlich Leute zu Ihnen, die sich ihre Zukunft aus Hühnerknochen vorhersagen lassen?»
«Ja.»
«Was sind das denn für Leute?»
«Na ja, heute waren zwei ältere Damen da, die fragten, ob sie sich mal kurz setzen dürften, weil sie erschöpft sind. Ein Betrunkener, der ein halbes Hähnchen bestellte. Ich glaube, er hat das mit dem Hühner Voodoo missverstanden. Und ein junges Mädchen, ganz in Schwarz gekleidet, mit kleinen Knochen als Ohrringe. Für sie sollte ich herausfinden, ob es okay sei, wenn sie ihrem Freund eine Bierflasche über den Schädel zieht – ihre Worte, nicht meine –, weil er sie betrügt.»
«Und, was haben die Knochen gesagt?»
«Dafür brauchte ich nicht mein Hühner Voodoo zu befragen, das wusste ich auch so. Ich hab ihr abgeraten.»
«Ah ja. Und was machen Sie jetzt?»
«Na, Kuchen essen.»
«Nein, bezüglich Ihres … Hühner Voodoos, meine ich.»
«Oh. Tja, ich weiß nicht. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass sie mich erwischen. Auf Dauer muss ich mir was anderes einfallen lassen.»
Bernadette Kunz, jenseits der 60, sanfte Stimme, rosig, rundlich, freundlich, lebte nach wie vor in dem kleinen Reihenhaus, in dem sie aufgewachsen war. Bis vor ein paar Jahren noch mit ihren Eltern. Diese hatten lange gehofft, ihre Tochter würde irgendwann einmal ausziehen, doch als Bernadette auch nach ihrer Pensionierung immer noch keine Anstalten machte, das Haus zu verlassen, beschlossen ihre Eltern, selbst auszuziehen. In ein sehr nettes Seniorenheim.
Bernadette hatte als Gemeindeschwester für die katholische Kirche gearbeitet. Als sie ihren Ruhestand antrat, konnte sie sich ganz ihrem Hobby widmen: Hühner Voodoo. Die wichtigen Entscheidungen ihres Lebens – pflanze ich vor den Eisheiligen schon Begonien? Lohnt sich der Kauf von Sonnencreme in diesem Jahr? Vollkornbrot oder Toast? – traf sie stets mit Hilfe ihres Orakels: Sie las die Antworten aus Hühnerknochen. Sie hatte meistens welche dabei. Falls nicht, war dem Problem schnell mit dem Kauf eines halben Hähnchens an der nächsten Pommesbude oder Chicken Wings in einem Fastfood-Restaurant abgeholfen.
Ihrem Bedürfnis entsprechend, Gutes zu tun, hatte sie vor kurzem beschlossen, diese Lebenshilfe nun auch anderen Leuten zugänglich zu machen. Sich mit einem Tisch in die Fußgängerzone zu setzen, war suboptimal, aber ihr war nichts Besseres eingefallen.
Nachdem sie gegessen hatten, bezahlte Bernadette, und Gwendolyn verabschiedete sich mit den Worten: «Man sieht sich» – ihre Umschreibung für «Ich habe kein Interesse an Ihnen». Aber zumindest war sie zu kostenlosem Kaffee und Kuchen gekommen, und sie hatte Frühstücksmuffins und Nachmittagskuchen für den nächsten Tag.
Das Leben war gut zu ihr. Nach der schlechten Nachricht am Vormittag hatte es ihr einen Weg aus ihrer Misere aufgezeigt. Sie war nun Psychologin. Zieglers Vorschlag, das Souterrain in ihrem Haus zu nutzen, war perfekt. Dort würde sie ihre Praxis eröffnen.
ZWEI
Gleich am nächsten Tag machte Gwendolyn sich auf den Weg zu einem Schildermacher. Sie wollte sich ein Praxisschild anfertigen lassen. «Gwendolyn Herzog von Wohlrath – Psychologin – Termine nach Vereinbarung.»
Der Name «von Wohlrath» war ein Überbleibsel ihrer ersten Ehe. Sie hatte den Namen auch während der nächsten Ehen beibehalten, da er in Kombination mit ihrem Mädchennamen Herzog wirklich etwas hermachte: «Herzog von Wohlrath».
Beim Schildermacher stellte sich heraus, dass er für seine Arbeit Geld haben wollte.
«Haben Sie auch gebrauchte Schilder?»
«Nein», sagte er, bot aber, nachdem sich eine ärgerliche Falte zwischen Gwendolyns Augenbrauen bildete, an: «Wir haben ein paar ausrangierte Musterschilder und zwei, drei Schilder, die nicht abgeholt wurden. Die sind günstiger.» Er hatte durchaus verstanden, was ihr Problem war.
Sie begleitete ihn ins Lager, und er ließ sie eine Kiste mit besagten Schildern durchwühlen. Schließlich zog sie eins hervor.
Der Name gefiel ihr ausgesprochen gut. Und sie erkannte blitzschnell eine Reihe von Vorteilen darin, für ihre neue Tätigkeit nicht ihren eigenen Namen zu verwenden.
«Das nehme ich», entschied sie. Sie entschied ebenfalls, nichts dafür zu bezahlen, und ging.
Der Schildermacher lief ihr hinterher, blieb am Eingang seines Geschäftes stehen und rief: «Entschuldigen Sie bitte.»
Gwendolyn drehte sich um und sah ihn an. «Ja?»
«Ähm … viel Spaß mit dem Schild. Ich schenke es Ihnen.»
«Danke, ich werde Sie weiterempfehlen.»
«Nein, bitte nicht», sagte er und ging wieder zurück in seinen Laden.
«Merkwürdiger Geschäftsmann», murmelte Gwendolyn.
Sie blickte lächelnd auf das Schild. In schönster Arnold-Böcklin-Jugendstilschrift stand dort: «Luna Madison». Sonst nichts. Nur: «Luna Madison». Sie steckte es in ihre Tasche. Heute hatte sie eine Arzttasche gewählt; sie hielt es für angebracht, aufgrund ihrer neuen Profession, denn sie hatte vor, Frederick Ackermann zu besuchen.
Das Bestattungsinstitut war in einem sehr gut erhaltenen und aufwendig renovierten Barockgebäude untergebracht.
Ein Vorfahr Fredericks, Heinrich Ackermann, hatte es im Jahre 1763 günstig erwerben können. Der siebenjährige Krieg war gerade zu einem Ende gekommen, der Vorbesitzer, ein französischer Geschäftsmann, war durch den für ihn ungünstigen Ausgang des britisch-französischen Konfliktes in Nordamerika gezwungen, sich von einigen Besitztümern zu verabschieden. Das Geschäft Heinrichs hatte in den letzten Jahren kriegsbedingt geboomt, und er sah die Notwendigkeit und Chance, sich zu vergrößern. Seither war dieses Gebäude der Arbeitsplatz und Wohnsitz der Familie Ackermann.
Dem Gebäude haftete etwas Schweres an. Mit einer Mischung aus Ehrfurcht und leichtem Schauer betrat Gwendolyn das Haus.
Das ungute Gefühl verflog jedoch sofort wieder, als eine junge Frau sie im Foyer ansprach und nach ihren Wünschen fragte.
«Ist Herr Ackermann zu sprechen?», erkundigte sich Gwendolyn.
«Zurzeit nicht. Er ist mit einer Kundin im Gespräch.»
«Sind Ihre Kunden nicht tot?»
«Nein, also, nun ja, ich meinte damit, er ist mit der Angehörigen eines Verstorbenen im Gespräch. Aber vielleicht kann ich Ihnen ja auch helfen?»
«Nein. Ich warte auf Herrn Ackermann.»
«Gut. Nehmen Sie doch so lange Platz», bot die junge Frau an und deutete auf einen goldfarbenen, mit schwarzem Samt bezogenen barocken Sessel im Foyer.
Gwendolyn saß kaum, da sprang sie wieder auf, lächelte und sagte: «Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, Sie können mir doch helfen.»
«Gerne. Was kann ich für Sie tun?»
«Ich möchte ein paar Särge ausprobieren.»
«Ähm. Also, Sie meinen, Sie möchten ein paar Modelle sehen?»
«Nein, ich möchte sie ausprobieren. Probeliegen. Sie verstehen?»
Die Angestellte blickte etwas unglücklich drein. Sie arbeitete noch nicht sehr lange bei Herrn Ackermann. In einem Bestattungsinstitut Arbeit zu finden, war auch nicht Chantal Fischers erste Wahl gewesen. Nachdem all ihre Bewerbungen in den von ihr favorisierten Bekleidungs- und Kosmetikläden abschlägig beschieden wurden, reagierte sie schließlich auf eine Anzeige des Bestattungsinstituts Ackermann, in der eine Empfangsdame gesucht wurde. Chantal hatte keine Konkurrenz und bekam den Job sofort. Frau Reichelt, Chantals Vorgängerin, hatte sich mit einem Burnout-Syndrom langfristig krankgemeldet. Trotz der angespannten Arbeitsmarktlage und obwohl Fredericks Sozialleistungen sich sehen lassen konnten – 13 Monatsgehälter, Weihnachtsgeld, 31 Urlaubstage, 30% Nachlass bei Inanspruchnahme der Dienste des Unternehmens –, war es für Frederick nicht einfach, Mitarbeiter zu finden.
Chantals Aufgaben waren klar umrissen: Wenn das Telefon klingelte, abheben, höflich nach den Wünschen fragen und an einen geschulten Mitarbeiter weiterleiten. Das Gleiche galt für Leute, die höchstpersönlich vorbeikamen. Soweit hatte sie das bei Gwendolyn ganz gut hinbekommen. Doch was nun? Da ihr Chef immer sagte, der Kunde sei König und dass sie es sich zur Aufgabe machen müssten, jeden noch so kuriosen Wunsch der Kunden zu erfüllen und dabei freundlich zu lächeln, nickte sie tapfer und bot an: «Dann gehen wir doch am besten mal in unseren Ausstellungsraum.»
Kaum waren sie dort angelangt, machte Gwendolyn Anstalten, in einen Eichensarg, der geöffnet auf dem Boden stand, hineinzusteigen.
«Halt, warten Sie, ich weiß nicht, ob das wirklich geht.»
«Natürlich geht es.» Zum Beweis stellte Gwendolyn ihren Fuß hinein.
«Aber … dann ziehen Sie doch bitte wenigstens die Schuhe aus. Sie machen ja sonst den Stoff des Innenpolsters schmutzig.»
«Beerdigen Sie die Leute ohne Schuhe?»
«Nein, natürlich nicht. Es sei denn, das wird gewünscht.»
«Nun, ich wünsche das nicht. Ich will mit Schuhen beerdigt werden; können Sie gleich notieren.» Sie kletterte in den Sarg und legte sich hin. «Sie müssen nicht warten, ich werde eine Weile liegen bleiben. Sagen Sie Bescheid, wenn Herr Ackermann Zeit für mich hat», tönte es der Angestellten aus dem Sarg entgegen.
Die junge Frau öffnete den Mund, schloss ihn dann aber wieder, ohne etwas zu sagen. Ihr fehlten die Worte. Aber sie würde sich nicht von der Stelle rühren. Sie würde diese Person zumindest im Auge behalten.
Gwendolyn fand ihre Liegestätte erstaunlich bequem. Sie versuchte sich zu erinnern, ob sie in ihrer Doktortasche, die sie vor dem Sarg abgestellt hatte, wohl etwas Lektüre finden würde. Doch dann hörte sie Fredericks Stimme, der gerade mit seiner Kundin den Ausstellungsraum betrat.
«… wenn ich Ihnen hier einmal eine Auswahl zeigen dürfte … Unser Klassiker ist die Eiche, er hat …»
Seine Ausführungen wurden von einem schrillen Schrei seiner Kundin unterbrochen, denn Gwendolyn hatte sich im Sarg aufgesetzt und sehr höflich «Guten Tag» gesagt.
Frederick reagierte gelassen. Während er versuchte, die schreiende Kundin zu beruhigen, und sie zu einem Stuhl führte, lächelte er Gwendolyn begrüßend zu. Dann bat er Chantal Fischer um ein Glas Wasser für die Kundin. Eilig verließ sie den Raum.
Gwendolyn kletterte aus dem Sarg und ging zu der inzwischen hyperventilierenden Dame.
«Alles in Ordnung?», fragte sie.
Doch das führte nur dazu, dass die Dame erneut anfing zu schreien. Frederick gab Gwendolyn mit dem Kopf ein Zeichen, sie möge doch bitte nach draußen gehen.