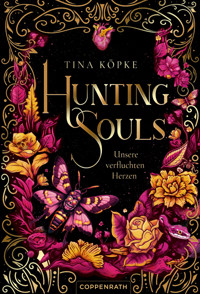14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Coppenrath Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Hunting Souls
- Sprache: Deutsch
Fühlst du meinen Herzschlag? Spürst du das Kribbeln auf der Haut? Das darf nicht echt sein! Katrina Smythe ist 18 Jahre alt, Highschool-Schülerin und seit einem Jahr untot. Ein Glücksfall, ist sie so doch endlich diesen mühsamen Gefühlskram los: Schmerzen, Eifersucht, Aufregung – nicht mehr ihr Problem! Dafür ist sie stark und passt viel besser in ihre außergewöhnliche Familie aus Vampiren, Hexen und Werwölfen. Doch alles ändert sich, als der neue Nachbarsjunge Tate Walker bei ihnen klingelt. Der ist nicht nur unverschämt gut aussehend, sondern leider auch Mitglied einer Familie von Jägern – den Erzfeinden aller Übernatürlichen. Katrina ist sofort bereit, mit diesem nervigen Tate kurzen Prozess zu machen. Aber dann geschieht das Unglaubliche: Die Walkers greifen nicht an, sondern bitten die Smythes um Hilfe. Und Katrina und Tate kommen sich näher als beiden lieb ist. Denn nach einem missglückten Seelenfluch können sie sich nur noch wenige Meter voneinander entfernen. Mehr Horror geht nicht – selbst für eine Untote! Wäre da nicht Katrinas verräterisches totes Herz, das plötzlich wieder sanft zu schlagen beginnt ... Band 1 des mitreißenden Enemies-to-lovers-Zweiteilers: verführerisch, witzig, herzergreifend
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tina Köpke
Hunting Souls
Unsere verräterischen Seelen
5 4 3 2 1
eISBN 978-3-649-64857-4
© 2024 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG,
Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
Text: Tina Köpke
Umschlaggestaltung und Illustration der
Innenseiten: Frauke Schneider
Lektorat: Sara Falke
Satz: Sabine Conrad, Bad Nauheim
www.coppenrath.de
Die Print-Ausgabe erscheint unter der ISBN 978-3-649-64707-2.
TINA KÖPKE
HUNTING SOULS
Unsere verräterischen Seelen
Für meinen Mann,der meinen alltäglichen Irrsinn erträgt,als wären wir die Addams Family.
INHALT
KATRINAS PLAYLIST
PROLOG
KATRINA
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
TATE
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KATRINA
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
TATE
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KATRINA
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
TATE
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KATRINA
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
TATE
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KATRINA
KAPITEL 47
KAPITEL 48
DANKSAGUNG
KATRINAS PLAYLIST
Anthony Willis – Toxic
Mcevoy – Wicked Game
Christina Aguilera – Haunted Heart
Metallica – Enter Sandman
My Chemical Romance – Teenagers
The Runaways – Cherry Bomb
Ava Max – Sweet but Psycho
Ashe – Angry Woman
Wallows – 1980s Horror Film II
Shayfer James – Villainous Thing
Jamie Bower, King Sugar – Run On
Imagine Dragons – Sharks
Keyrenity – Clean
Jeremy Renner – House of the Rising Sun
Cults – Always Forever
Smith Westerns – All Die Young
PROLOG
Seit ich denken kann, liebe ich die Addams Family.
Nicht die Pritchett-Dunphys, die Simpsons oder – möge Lilith sich meiner untoten Seele erbarmen – die Kardashians.
Nein. Meine Lieblingsfernsehfamilie ist ein seltsam zusammengewürfelter Haufen gesellschaftlich ausgestoßener Kreaturen mit einer ausgeprägten Vorliebe für groteske und morbide Sachen wie Friedhöfe, Giftmorde und abgetrennte Rosenköpfe.
Genau wie meine Familie. Mit dem kleinen Unterschied, dass die Addams Family fiktiv ist. Meine dagegen ist sehr wohl echt, wenn sich auch nicht unbedingt jedes Mitglied eines funktionierenden Herzschlags oder einer physischen Existenz erfreut. Dennoch sind wir hier.
Wir sind real, und keine sterbliche Seele weiß, was wir eigentlich genau sind …
Für unsere Nachbarn sind wir beispielsweise nur die seltsamen, aber netten Smythes. Die Außenseiter dieses in sich geschlossenen Mikrokosmos namens Kleinstadt, wo sich jeder kennt und auf der Straße grüßt. Grundsätzlich gibt es eine Familie wie unsere überall. Auch New Arcadia, ein Ort im tiefsten Norden von Washington, bildet da keine Ausnahme. Hier sind wir die Sonderlinge und für uns ist das völlig okay. Wir sind uns durchaus bewusst, dass wir eine Kuriosität in dieser perfekten kleinen Welt darstellen.
Ich meine, wie sollte es auch anders sein?
Meine Eltern führen in unserem Keller ein angesehenes Bestattungsunternehmen, und wir wohnen in einem alten Haus im viktorianisch-gotischen Stil mit dunkler Sandsteinfassade, das weitab vom Schuss am Rande der Stadt liegt.
Mum und Dad verlassen nie ohne Sonnenschirme das Haus und meine Schwester Carolyn tanzt gerne mal auf dem Dach des Anwesens herum. Mein Bruder Anthony ist zum Glück vor ein paar Monaten ans College gezogen – seitdem wundert sich niemand mehr, wieso wir jede Woche so große Mengen rohes Rindfleisch gekauft haben. Allerdings regt das mitternächtliche Gebell unseres Hundes Frankie, den noch nie jemand gesehen hat, ab und an eine schlaflose alte Dame auf. Ein wenig kann ich sie sogar verstehen – er hat echt ein ungewöhnlich lautes Organ, selbst für einen Geist.
Vor Jahrhunderten hätte man uns – prophylaktisch – schon für unsere düstere Erscheinung verbrannt. Heute haben unsere Nachbarn stattdessen genug Respekt vor uns, um sich einfach fernzuhalten. Niemand lädt uns freiwillig zu einer Bar-Mizwa oder einem Dinner ein. Ich kann mir auch kaum etwas Schlimmeres vorstellen als ein langweiliges Abendessen mit Sterblichen, während sie Small Talk betreiben.
In den achtzehn Jahren, die ich nun schon existiere, behandelt man uns also wie skurrile, aber friedliche Einzelgänger und nicht wie die, die wir in Wahrheit sind. Niemand glaubt an die Existenz von Vampiren, Werwölfen, Hexen oder Untoten. Für unsere Nachbarn sind wir wie sie, nur mit einem ungewohnt schwarzen Lebensstil.
Das kann sich allerdings schnell ändern. Ich spüre es in jeder Faser meines untoten Körpers, dass etwas auf uns zukommt, und womöglich hängt es damit zusammen, dass wir nicht mehr allein am Ende dieser Straße von New Arcadia leben.
Gegenüber ist in das seit Jahren verlassene Warrington House eine neue Familie eingezogen.
Irgendwas sagt mir, dass die guten alten Zeiten damit ein plötzliches Ende finden werden …
KATRINA
KAPITEL 1
Manche Dinge sind bei uns verstörend normal. Zum Beispiel das morgendliche Klingeln meines Weckers.
Obwohl ich bereits achtzehn bin und damit laut amerikanischem Gesetz in einigen Bereichen als erwachsen gelte, besuche ich noch die Highschool. Es ist mein letztes Jahr, und ich kann kaum erwarten, dass dieser Spuk endlich ein Ende findet. Nichts ist schlimmer als Schule – und ich darf das sagen. Ich bin bereits gestorben und für sehr viele Menschen ist der eigene Tod der größte Albtraum.
Diese ganze Weckergeschichte wird erst recht ad absurdum geführt, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich gar keinen echten Schlaf benötige. Egal, wie blass ich aussehe und wie blank meine Nerven liegen – es hat absolut gar nichts mit dem durchschnittlichen Schlafmangel einer Teenagerin zu tun. Dennoch besteht Mum darauf, dass ich mich wenigstens ein paar Stunden am Tag ausruhe, um möglichst entspannt und in aller Frische die New Arcadia High zu besuchen. Wofür mein Schulabschluss jetzt noch nötig sein soll, habe ich bis heute nicht verstanden, aber ich gebe mir auch wenig Mühe, die Gründe nachzuvollziehen. Am Ende müsste ich noch einsehen, dass sie recht hat, was unsere tolle Mutter-Tochter-Beziehung aus dem Gleichgewicht bringen könnte.
Ich taste nach dem Wecker neben mir und haue so lange darauf herum, bis er mit einem kläglichen Laut einen leisen Tod stirbt. Fünf Minuten. Ich will nur weitere fünf Minuten. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil ich keine Lust habe, aufzustehen. Kurzerhand drehe ich mich auf die andere Seite und hoffe – wie jeden Morgen – einfach das Beste.
Ein kratziges Schaben lässt mich zögerlich ein Auge öffnen. Wachsam schiele ich an die dunkle Zimmerdecke. Etwas Silbernes blitzt dort oben auf, und ehe es rasiermesserscharfe Klingen auf mich herabregnet, reagiert mein Körper bereits instinktiv.
Geübt von zahlreichen Morgen wie diesem, rolle ich vom Bett und lande unsanft und mit einem lauten Rumsen auf dem knarzenden Dielenboden. Zur selben Zeit graben die Spitzen von Dads geliebtem Kochmesser-Set tiefe Schlitze in meine Matratze.
Die ist dann wohl vorerst dahin.
Um mich herum erklingt ein echogleiches, diabolisches Kichern, das keine Zweifel daran lässt, wem ich diese Aktion zu verdanken habe.
»Miststück«, zische ich und stehe auf. Jedem anderen würde nun der Hintern wehtun, aber ich spüre nichts von meinem Aufprall. Nur einen dumpfen Druck, dort, wo ich zuerst aufgekommen bin. Einer der Vorteile, wenn man untot ist. Schmerzen sind in den allermeisten Fällen mein geringstes Problem.
Ich klopfe den Staub von meinen Schlafshorts und sehe mich nach weiteren Hinterhalten meiner liebreizenden Schwester Carolyn um. Hin und wieder ist sie sehr einfallsreich, wenn es darum geht, mich morgens aus dem Bett zu scheuchen. Ich würde gern behaupten, dass die schwebenden Messer die Spitze des Eisberges sind, aber wir sind die Smythes. Abgesehen davon, dass wir uns aufgrund eines umfangreichen Schutzzaubers innerhalb des Hauses nicht ernsthaft verletzten können, gibt es nur sehr, sehr wenige Grenzen für unsere Fantasie.
Es ist stockduster und dennoch kann ich hervorragend sehen. Ich erkenne die dunkle Farbe an meinen Zimmerwänden und bemerke auch jede noch so winzige Unebenheit im Mauerwerk, durch das es an allen Ecken und Enden zieht. Schwere schwarze Samtvorhänge halten das Tageslicht fern, und von meiner Decke baumelt eine einsame, nackte Glühbirne, die ich nur selten anschalte. Mein Bett, in dem die Messer wie in einem Holzblock stecken, befindet sich mitten im Raum, umgeben von einem rustikalen Kleiderschrank, einer Kommode mit einer fleischfressenden Pflanze darauf und einem Schreibtisch voller Papiere und meinem Laptop. Daneben steht ein altes, modriges Sofa aus schwarzem Samt an der Wand, das damals beim Kauf des Hauses – also noch vor meiner Geburt – bereits zum Inventar gehörte. Ein ergrauter Teppich mit breit getretenen Fusseln rundet das gemütliche Ambiente ab.
Ernsthaft: In Zeitungen findet man Zimmer wie dieses oft mit der Überschrift »Teenager opfert sein Meerschweinchen bei satanistischem Ritual« abgedruckt vor. Allerdings würde ich nie ein Meerschweinchen opfern – eher einen meiner Mitschüler. Im Gegensatz zu Menschen liebe ich Tiere viel zu sehr.
Ich finde schnell, wonach ich suche: meine Betty.
Ich wiege Betty von einer Hand in die andere, nehme das angenehme Gewicht wahr und verziehe die Lippen zu einem schmalen Lächeln. An diesem Schmuckstück hänge ich tatsächlich.
Mum und Dad haben mir die Axt zu meinem elften Geburtstag geschenkt, weil ihnen die unterschiedlichen Arten von scharfen Messern ausgingen, die ich über die Jahre zuvor von ihnen bekommen hatte. Bereits als kleines Kind haben mich solche Spielsachen mehr fasziniert als die typischen Puppen oder Klemmbausteine. Ich meine – dieser Kram kann doch nichts. Absolut gar nichts. Höchstens kichert ein Bär mal, wenn man ihm auf den Bauch drückt. Aber ein sorgsam kuratiertes Set aus Messern jeder Art? Damit bringt man seiner Tochter so viel mehr für ihr zukünftiges Leben bei – und sei es nur, wie sie sich nicht versehentlich damit verletzt.
Betty ist eine pechschwarze Schönheit und ihre Klinge so scharf, dass ich damit einen Werwolf kahl rasieren kann, ohne ihn zu schneiden. Wenn mein Bruder Anthony demnächst zum Geburtstag unserer Schwester Lyn wieder nach Hause kommt, wird er das bestätigen. Das war mein bisher liebster Halloweenstreich an ihm und irgendwo existiert noch ein Foto davon. Ein haarloser Werwolf ist echt zum Brüllen, auch wenn der Spaß eher einseitig blieb.
Ich öffne vorsichtig die Zimmertür. Wie fast jeden Morgen begrüßt mich davor ein aufgeregtes Winseln.
»Hey, Frankie«, erwidere ich ins Nichts hinein.
Frankenstein ist unsere faltige, sabbernde Bulldogge, auch wenn er eigentlich nicht so richtig unser Haustier ist. Geister kann man nicht besitzen, und wie es sich für ein waschechtes Exemplar seiner Art gehört, kam er mit dem Kauf dieses Anwesens in unsere Familie. Lyn und ich durften ihm den Namen geben, und nachdem wir auf dem Dachboden alte Fotos von ihm und den Vorbesitzern gefunden hatten, gingen wir davon aus, dass er irgendwann vor fünfundzwanzig Jahren hier verstorben sein musste.
Bevor ich das Zeitliche gesegnet habe, besaß Frankie für mich keine erkennbare Form. Er war schlicht und ergreifend unsichtbar. Wir wussten nur von Mum und Dad, woher das nächtliche Gejammer kam. Geister werden von Lebenden nicht gesehen. Man spürt ihre Präsenz in Form von unangenehmer Gänsehaut oder hört ihr klägliches Heulen, weil sie auf nervtötende Weise unfassbar weinerlich oder schrecklich wütend sind. Aber sehen? Nein. Dafür muss man selbst erst tot gewesen sein.
Frankie jault ständig herum und wird ziemlich bissig, wenn man ihm gegen den Karren pinkelt. Zu mir ist er jedoch recht handzahm, seitdem ich mehr von ihm erkennen kann. Lyn und Anthony rennen nach wie vor in aller Regelmäßigkeit durch ihn hindurch, weswegen ich Frankies Favorit unter uns Kindern bin. Ich nehme Rücksicht auf ihn und rede ihm manchmal gut zu, damit er sich besser fühlt und leiser ist.
Jetzt trete ich an ihm vorbei in den Flur vor meinem Zimmer. Unser Haus ist verwinkelt wie ein Labyrinth, weil es aus verschiedenen Anbauten unterschiedlichster Epochen besteht. Das Herzstück unseres Heimes ist die Orangerie, ein zwei Etagen umschließendes, achteckiges Stahlguss-Glas-Konstrukt, in dem sich unser Wohnzimmer-Schrägstrich-Wintergarten befindet. Dank der umfangreichen Hexenfähigkeiten meiner Tante Apollonia wird die Sonne darin so gefiltert, dass niemand, der hineingeht, sich in ein Häufchen Asche verwandelt. Gleichzeitig bekommen Mums riesige Dschungelpflanzen, die den Großteil des Raumes einnehmen, mehr als genug Licht, um fröhlich zu wachsen und zu gedeihen.
Am Wochenende weiß ich meist nicht so genau, wo sich meine liebe Familie gerade aufhält, aber an einem Donnerstagmorgen ist es nicht allzu schwer, sie zu finden.
Obwohl wir alle spezielle Vorlieben besitzen, was das Frühstück angeht, ist es Mum und Dad wichtig, dass wir uns möglichst wie Sterbliche aufführen. Sie bestehen darauf, dass wir ausreichend Schlaf bekommen, unseren Schulabschluss machen und morgens und abends zusammen essen. Deswegen ist es selbst für uns normal, dass ich Mums melodisches Summen aus der Küche höre, während ich im Korridor des oberen Stockwerkes in Richtung Treppe laufe.
Ich lehne den Griff der schweren Axt mit Leichtigkeit an meine Schulter. Wenn man wie wir ist, bringt es nichts, sich auf Zehenspitzen an jemanden heranzuschleichen. Außer Lyn kann mich praktisch jeder in diesem Haus bereits aus der Ferne riechen oder hören – oder schlimmstenfalls beides. Das macht es verdammt schwer, etwas vor ihnen geheim zu halten. Mum lacht oft darüber und nennt es den sechsten Elternsinn – ich nenne es die schlimmste Tragödie für eine Teenagerin, zwei Vampire als Eltern zu haben.
Bevor ich unten ankomme, läutet es an der Tür. Nicht das übliche mechanische Surren, das man von normalen Häusern kennt. Unsere Klingel ähnelt stark einer Katze, der man zu fest auf den Schwanz getreten ist – wie in einer Horrorkomödie. Dad liebt solche Anspielungen.
Vom oberen Treppenabsatz aus sehe ich Mum, die zur Tür geht. Das kastanienbraune Haar, das ihr bis über die Schulterblätter reicht, schlägt sanfte Wellen in den Enden und wirkt, als hätte man es dort festbetoniert. Sie trägt ein schwarzes Kleid mit langen Spitzenärmeln, das ab ihrer Hüfte in einem voluminösen Rock um ihre Beine bis zu den Knien schwingt. Stilecht dazu gleichfarbige Pumps. Ein bisschen sieht sie damit aus wie eine Hausfrau aus einer 50er-Jahre-Werbung, die plant, gleich auf eine Beerdigung zu gehen. Trauerfarbe steht ihr übernatürlich gut.
Mum öffnet die Tür, und ich erkenne dahinter einen fremden Typen, den ich noch nie zuvor in der Stadt gesehen habe.
»Guten Morgen«, begrüßt er meine Mutter mit tiefer, freundlicher Stimme. Ich laufe langsam die Stufen runter, wobei sein Blick kurz an ihr vorbei und zu mir hochrutscht. Sollte ihn der Anblick meiner Axt verwirren, lässt er sich das nicht anmerken. Ist doch auch völlig normal, mit so was durch den Flur zu laufen, nicht wahr? »Ich hoffe, ich störe nicht. Ich bin Tate Walker und meine Familie ist vor ein paar Tagen gegenüber eingezogen.«
Mum schüttelt den Kopf. »Nein, alles gut. Freut mich, dich kennenzulernen, Tate. Was kann ich für dich tun?«
Ich sehe es nicht, aber so, wie sie klingt, verwette ich Betty darauf, dass sie ihr herzlichstes Lächeln aufgesetzt hat.
Tates Mimik entspannt sich, und seine Mundwinkel heben sich ebenfalls zu einem Lächeln, das so viel Charme versprüht, dass er meine volle Aufmerksamkeit gewinnt.
»Meine Mum wollte längst mal vorbeischauen und Hallo sagen. Leider sind sie und mein Dad beruflich gerade verhindert, daher übernehme ich das.«
Bei uns schlagen selten Leute vor der Tür auf, weswegen ich ihn von meiner erhöhten Treppen-Position aus gründlich mustere.
Braune, wellige Haare, dazu dichte Brauen über grünblauen Augen, deren Färbung selbst aus der Distanz gut erkennbar ist. Seine Kieferpartie ist wie gemeißelt und die Nase ist weder zu groß noch zu klein für sein Gesicht. Tate scheint kaum älter als die meisten meiner Mitschüler und trägt ein schlichtes dunkelgraues Shirt, das sein Oberkörper perfekt mit Muskeln ausfüllt. Vermutlich ist er sportlich aktiv. Football bestimmt. Oder Schwimmen? Das Kreuz hat er dafür. Und weil wir bereits Oktober haben und es draußen schon frisch wird, hat er sich noch ein kariertes, offenes Hemd übergezogen. Die Ärmel sind hochgekrempelt, was seine kräftigen Unterarme betont. Dazu robuste schwarze Jeans und Stiefel, denen Matsch und Wasser nichts anhaben können.
Nicht der klassische Schönling, den man in New Arcadia so antrifft, aber definitiv nicht schlecht. Selbst mir fällt es schwer, ihn nicht zu lange anzustarren.
Leider ist er unglaublich sterblich. Sogar von der Treppe aus rieche ich unter einer angenehmen Aftershavenote einen weiteren, typisch-menschlichen Duft: Schweiß. Schweiß und … da ist noch etwas, nur was? Ich kann es nicht genau sagen, aber es kommt mir verdammt bekannt vor.
Ohne darüber nachzudenken, dass ich außer meinem schwarzen oversized T-Shirt und den Schlafshorts nichts anderes trage, gehe ich ein, zwei, am Ende sogar drei Stufen weiter runter, um mir das Gespräch nicht entgehen zu lassen.
»Wie freundlich von dir.« Mum klingt aufrichtig angetan. So ist sie halt – aus verschiedensten Gründen liebt sie die Sterblichen und stört sich absolut nicht daran, mit ihnen über das langweilige Alltagszeug zu reden. »Ich bin Beatrice Smythe.«
Unter meinen nackten Füßen knarzt eine Stufe verräterisch laut auf, was Mum dazu veranlasst, sich halb zu mir umzudrehen. Eigentlich weiß sie längst, dass ich da bin, aber die Jahrhunderte mit den Menschen haben sie gelehrt, sich ihrem Verhalten anzupassen. Knarzt hinter einem die Treppe besonders laut, dreht man sich eben überrascht um.
Selbst nach all der Zeit, die wir Mutter und Tochter sind, fällt mir noch immer auf, wie außergewöhnlich schön sie ist. Manch einer mag ihr Gesicht etwas zu oval und ihre Nase ein Ticken zu gerade und lang finden, aber ich kenne niemanden, der eine solche Eleganz und Würde an den Tag legt, ohne dabei auf andere herabzuschauen. Sie behandelt jeden mit Respekt und Freundlichkeit, was ihr eine ganz eigene Schönheit verleiht.
»Liebes«, empfängt sie mich mit einem perfekten Lächeln. Sie wendet sich wieder Tate zu, der mich nun unverhohlen von oben bis unten mustert. Das ist nur fair, nachdem ich eben das Gleiche mit ihm getan habe. »Meine älteste Tochter Katrina«, stellt Mum mich Tate vor, als ich die letzte Stufe hinter mir lasse.
Er nickt mir zu. Erst jetzt fällt mir so richtig auf, wie groß er ist. Ich muss den Kopf in den Nacken legen, um ihm ins Gesicht schauen zu können.
»Schöner Name.« Sein Blick wandert auf mein Shirt, aber nicht auf diese schmutzige Art, bei der ich ihm direkt zwischen die Beine treten will. »Du bist ein Fan von My Chemical Romance?«
Ich sehe an mir herab. Das Logo meiner Lieblingsband zieht sich quer über meine Brust. »Nein, ich trage gerne Shirts von Bands, die ich nicht ausstehen kann. Das ist so mein Ding.«
Sein Mundwinkel zuckt, während er auf die Axt deutet. »Und wofür ist die?«
Ich lehne mich an die Wand neben der Tür und hebe die Achseln. »Ich will meiner Schwester eine Lektion erteilen, weil sie mich mit einem Satz Küchenmesser aus dem Bett geschmissen hat.«
Bevor Tate womöglich Angst bekommt – was ich stark bezweifle, denn wie alle Jungs denkt er bestimmt, dass er mich Fliegengewicht locker händeln kann –, interveniert Mum mit einem glockenklaren Lachen. »Katrina macht nur Witze. Sie soll vor der Schule noch das Holz hacken.«
Sie legt mir eine Hand auf die Schulter und drückt mir einen Kuss auf den Scheitel. Auch sie überragt mich, besonders in diesen Schuhen. Vor allem aber, weil ich nur knapp einsfünfundsechzig groß bin. So manche unserer Standuhren kommen auf mehr Höhe als ich.
»Dachte ich mir fast«, erwidert Tate. Ernsthaft? »In welchen Jahrgang gehst du?
»Den letzten«, erkläre ich.
»Ich auch. Endlich haben wir bald unseren Abschluss.«
Das hat mir noch gefehlt. Ein Nachbar, der offenbar genauso alt ist wie ich und mangels Alternativen die gleiche Schule besucht. Ich bete stumm, dass Mum nicht auf die Idee kommt, wir könnten so was wie eine Fahrgemeinschaft bilden.
»Katrina redet von nichts anderem.« Mum schenkt mir ein Schmunzeln, das ich leidenschaftslos erwidere. Das mit der Schule tue ich nur für sie, und weil sie ist, wie sie eben ist, lässt sie mich regelmäßig ihre Dankbarkeit dafür spüren.
»Verständlich.« Tate räuspert sich. »Bevor ich es vergesse – meine Mum möchte Sie heute Abend zu einem Essen bei uns einladen. Meine Eltern kommen am späten Nachmittag wieder nach Hause. Wenn Sie also Zeit und Lust haben, würden wir uns freuen, wenn Sie alle vorbeikommen.«
Mum zeigt sich nicht sonderlich erstaunt. »Weißt du, was, Tate?«, fragt sie stattdessen. »Wie wäre es, wenn ihr zu uns kommt? Wir haben mit Mathilda eine hinreißende Köchin, die wirklich alles zubereiten kann, was das Herz begehrt.«
Oh ja. Lyn und Tante Apollonia mögen die offiziellen Hexen in unserer Familie sein, aber was Mathilda tagtäglich für unsere unterschiedlichsten Geschmäcker und Bedürfnisse zustande bringt, grenzt an wahre Magie. Dagegen ist Tote wiederauferstehen zu lassen ein billiger Partytrick.
»Mum fände es sicher nicht so toll, wenn wir Ihnen Umstände bereiten«, gibt Tate sich höflich. Die Art, wie er es sagt, lässt mich allerdings daran zweifeln, dass ihm die Einladung ungelegen kommt. Vermutlich würde die Vorbereitung eines Dinners an ihm oder einem der Lieferdienste in New Arcadia hängen bleiben.
»Keine Sorge, wir machen das gern. Ihr habt mit Sicherheit noch genug mit eurem Umzug zu tun. Komm einfach gegen acht mit deiner Familie vorbei. Es wird bestimmt ein schöner Abend.«
Tate willigt – absolut unerwartet – ein und verabschiedet sich damit, dass wir uns später in der Schule sehen werden. Ich verkneife mir das Augenrollen. Als würde dort jemand wie er mit jemandem wie mir abhängen. Ich kann mir schon denken, welcher der zahlreichen Gruppen er sich anschließen wird. Innerlich wette ich mit mir, dass er in spätestens einer Woche mit einem der beliebtesten Mädchen am Arm durch die Schulkorridore laufen und mit den Schwimmern, Football- oder Lacrosse-Spielern Handschläge austauschen wird. Gut genug aussehen tut er dafür. Es wird leicht für ihn sein, Anschluss zu finden.
Als Mum die Tür schließt, sieht sie nicht mehr ganz so glücklich aus. Normalerweise liebt sie es, neue Sterbliche kennenzulernen. Warum ist sie also nicht fröhlicher?
»Was ist los?«, frage ich.
»Etwas stimmt mit diesem Jungen nicht.«
Mir rutscht ein leises Lachen über die Lippen. »Dann ist es ja gut, dass du ihn und seine Familie zum Abendessen eingeladen hast.«
Mum drückt mir einen weiteren Kuss auf das dunkelbraune Haar. Der zarte Duft von Lavendel umhüllt sie. »Ich hätte ihm wohl schwer unsere speziellen Diäten erklären können.«
»Ich glaube, das wäre viel leichter, als ihnen klarzumachen, dass Lyn strikte Veganerin ist.«
»Hm«, gibt Mum nachdenklich von sich. Ihr Blick wirkt abwesend. »Ich werde Mathilda wohl besser darauf vorbereiten, dass wir Gäste erwarten.«
»Sie wird sich freuen, endlich mal für Normalsterbliche zu kochen.«
»Bestimmt.« Mums Hand rutscht auf meinen unteren Rücken und führt mich in Richtung Esszimmer. »Und bevor du denkst, ich vergesse es – dein Frühstückssmoothie wartet.«
Jetzt verdrehe ich doch noch die Augen und wie auf Kommando macht sich mein leerer Magen bemerkbar. Mit der scharfen Schneide nach unten lehne ich Betty gegen die Wand neben der Tür. Meinen Plan, mich an Lyn für ihre dämliche Weckaktion zu rächen, muss warten. Frühstück und Schule rufen und es fühlt sich wie jeden Morgen unerträglich durchschnittlich an.
KAPITEL 2
Als mein menschliches Leben vor anderthalb Jahren bei einem äußerst üblen Autounfall endete, tröstete mich der Gedanke, dass ich zukünftig nie mehr die New Arcadia High besuchen würde. Das war mein Hoffnungsschimmer. Das Licht am Ende des Tunnels, das mich durch die ersten schwierigen Monate meiner Verwandlung trug.
Doch ich hatte mich zu früh gefreut.
Ich habe kein Problem damit, zu lernen. Ganz im Gegenteil. Würde die Schule nur aus ihrem roten Backsteingebäude und den mäßig durchdachten Lehrplänen bestehen, wäre ich vielleicht sogar gerne hier. Zeit steht mir mittlerweile mehr als genug zur Verfügung. Nur ist die Realität etwas komplizierter als das.
Es gibt chronisch frustrierte und gelangweilte Lehrer, überempfindliche Soccermums und zu guter Letzt natürlich meine reizenden Mitschüler, die mir hinter meinem Rücken allerhand Spitznamen verpassen. Ich höre sie flüstern und kichern, wenn ich durch den Schulkorridor laufe. Ich spüre ihre Blicke, die mir mit einer Mischung aus Sensationslust, Neugierde und auch Angst und Skepsis begegnen.
Ich bin das gewohnt. Schon vor meiner Verwandlung ist das so gewesen, aber danach hat es irgendwie richtig Fahrt aufgenommen. Alle kennen die Geschichte von meinem Unfall, und sie können nichts mit der Tatsache anfangen, dass ich ihn ohne irgendwelche Folgeschäden überlebt habe – einfach so. Wenn man nachts auf glatter Straße frontal mit einem LKW zusammenknallt, weil der Fahrer am Steuer eingeschlafen ist, dann sind deine Chancen, da heil herauszukommen, statistisch gesehen vernichtend gering. Eigentlich müsste ich auf dem örtlichen Friedhof liegen und mit Geistern Bingo spielen.
Dass ich nicht eine winzige Narbe vorzuweisen habe, verstehen die meisten Sterblichen daher nicht, und was der menschliche Verstand nicht begreift, das fürchtet er. Während die Erwachsenen es für ein Gotteswunder halten, kompensieren meine Mitschüler das mit Spott. Bis zu einem gewissen Grad wäre das okay, aber inzwischen machen sie sich nur deswegen über mich lustig, damit sie selbst nicht zu Opfern von Schikanen werden.
Einer meiner vielen tollen Spitznamen ist ironischerweise Zombiva. Zombie, weil ich noch lebe, und Diva … nun, sagen wir es mal so: Wer nicht freundlich zu mir ist, zu dem bin ich es eben auch nicht. Deswegen glauben manche wohl, dass ich mich für was Besseres halte.
Zugegeben – daran könnte wohl ein bisschen was dran sein.
Mir ist egal, dass sie über mich tuscheln. Im Gegensatz zu ihnen werde ich noch so lange existieren, dass die Welt nicht einmal mehr ihre Namen kennen wird. Dann bin ich diejenige, die über sie lacht. Bis dahin dauert es nur leider noch viel zu lange.
Meine Geschwister und ich gehen ganz unterschiedlich damit um, dass wir von Gleichaltrigen nicht sehr fair behandelt werden. Die Erwachsenen sind ziemlich nett zu uns, weil Mum und Dad ehrbare Bürger von New Arcadia sind, die regelmäßig Geld an Einrichtungen spenden. Ihre Kinder dagegen haben sich seit jeher vor uns gefürchtet. Wir haben nie einen Kindergarten besucht, wo wir einander hätten kennenlernen können. Sie sahen uns draußen herumlaufen, konnten aber nichts mit uns anfangen. Sie kannten unsere Namen, aber nicht unsere Persönlichkeiten. Erst in der Schule kreuzten sich unsere Wege, aber da war es schon zu spät.
Sowohl Lyn als auch Anthony und ich haben über die Jahre Strategien entwickelt, damit mal mehr, mal weniger gut umzugehen.
Ehe er vergangenes Jahr ans College wechselte, war mein Bruder an der New Arcadia High wohl der Beliebteste von uns Smythe-Kindern. Er spielte im Lacrosseteam und gehörte zu den Stars an der Schule. Dafür gab er sich reichlich Mühe. Es ist seinem Naturell als Werwolf geschuldet, an den unterschiedlichsten Orten einer Gruppe angehören zu wollen. Vorzugsweise dem stärksten Rudel, sozusagen. So langweilig wie möglich zu sein, wenn man sich einmal im Monat in einen gefährlichen Übernatürlichen mit übermäßigem Haarwuchs verwandelt, war damals nach unserer Familie noch seine höchste Priorität. Solange es nur blöde Sprüche waren, die er sich dafür anhören musste, hat er sie geschluckt, ohne mit der Wimper zu zucken.
Carolyn hingegen nutzt alles, was sich gegen sie richtet, und dreht es so, dass sie plötzlich wieder in gutem Licht dasteht. Sie hat den Ruf, wie ein Engel auszusehen und den Verstand des Teufels zu besitzen. Wenn die Leute nur wüssten, wie recht sie damit haben. Sie mag manchmal penetrant sein, aber sooft es nur geht, setzt sie sich für die Schwachen ein – oder besser gesagt, für die, die kein Zauberbuch besitzen, in dem allerhand fiese Flüche stehen. Lyn ist auch meine einzige und somit beste Freundin und ich liebe sie über alles. Ihre Geduld mit den Sterblichen kann ich jedoch schlichtweg nicht nachvollziehen.
Im Vergleich zu Anthony und Lyn bin ich das schwarze Schaf. Daran hat sich nach meiner Wiederauferstehung nichts geändert – höchstens, dass es mir noch egaler ist, was die Leute von mir denken. Ich mache mir gar nicht erst die Mühe, die Menschen wenigstens oberflächlich von mir zu überzeugen, auch wenn Mum uns stets eintrichtert, dass es wichtig ist, die Fassade aufrechtzuerhalten. Egal wie.
»Höflichen Respekt hat jeder verdient«, pflegt sie zu sagen.
In Gedanken schüttle ich dabei nur den Kopf. Ich bringe gerade genug Respekt für die Sterblichen auf, um sie am Leben zu lassen. Mehr kann niemand von mir verlangen, auch Mum nicht. Benehmen ist keine Einbahnstraße. Wer von mir Freundlichkeit erwartet, muss selbst welche an den Tag legen. Deswegen sind mir Tiere lieber als Menschen. Die gehen nicht danach, ob man aus dem Rahmen fällt.
Während ich auf meinen Spind zuhalte, legt sich ein schlanker Arm von hinten um meine Schultern. Ich brauche nicht hinzuschauen, um zu wissen, wem er gehört. Lyns blumiges Parfüm drängt sich mir in die Nase, seit sie die Schule betreten hat.
»Schwesterherz«, säuselt sie gut gelaunt. »Wie lief dein Morgen?«
»Du kannst von Glück reden, dass Mum es mir ausgeredet hat, Betty mit zur Schule zu nehmen.«
»Die gute alte Betty.« Sie seufzt glückselig. »Aber es ist wohl besser so. Wie sollen wir den Menschen sonst erklären, dass du hinter mir herläufst, als wärst du von einem mörderischen Geist besessen?«
»Ich hätte mir etwas einfallen lassen.«
»Davon bin ich überzeugt.«
Wir halten vor den silbernen Spinden. An meinem klebt ein Zettel mit einer schrecklich schlechten Karikatur von mir, wie ich unseren Mathelehrer zombieartig jage.
Carolyn verzieht das Gesicht und reißt das Bild mit einem Ruck von der Tür, die ein metallisches Klappern von sich gibt. »Immerhin wird ihr Stil besser.«
»Kann’s kaum erwarten, wenn daraus mal eine erfolgreiche Graphic Novel wird«, murmle ich und öffne meinen Schrank, um erst nach dem Chemiebuch und dann nach meinem Lieblingslippenstift zu greifen, der mein Markenzeichen ist. Das Rot ist so dunkel wie Blut und hebt sich auf meiner blassen Haut hervorragend ab.
Lyn streicht sich eine kinnlange goldblonde Locke hinter das Ohr. »Ich kann herausfinden, wer das gezeichnet hat … und am nächsten Morgen wacht der- oder diejenige mit einem dicken Pickel auf der Stirn auf.«
Ich lache, ehe ich leicht die Lippen öffne, um den Lippenstift aufzutragen. Wenn es darum geht, bin ich eitel. Ich wähle morgens meine Kleidung mit Sorgfalt aus und schminke mich in aller Ruhe, bis mein Make-up perfekt sitzt. Es ist schrecklich menschlich, aber was soll ich sagen? Ich mag so was eben. Es ist wie Kriegsbemalung.
»Schon gut«, beschwichtige ich Lyn und stecke meinen Lippenstift zurück in den Schrank, um die Tür kurz darauf zu schließen. Ab und an erstaunt sogar mich die Rachsucht meiner kleinen Schwester. Bloß ihre weichen, runden Gesichtszüge bezeugen, dass sie an diesem Samstag erst sechzehn wird. »Sie sind nur primitive Lebende.«
»Apropos.« Sie sieht sich um, als könnten überall Spione lauern. »Hast du den Neuen schon gesehen?«
Ich runzle die Stirn. »Welchen Neuen?«
»Diesen Walker-Jungen. Mum hat erzählt, dass er vorhin bei uns war und er und seine Familie ins Warrington House eingezogen sind.«
»Ach der.« Ich laufe neben Lyn her. »Tate oder so was. Komischer Typ.«
»Wieso?«
»Keine Ahnung.« Ich überlege kurz und rufe mir das Bild von Tate Walker ins Gedächtnis. »Vielleicht, weil er nicht sehr typisch für New Arcadia rüberkam. Eher wie jemand, der nach seinem Besuch bei uns noch eine Hütte im Wald bauen und auf Hirschjagd gehen will oder so.«
Lyn kichert leise. »Dann passt er ja hervorragend zu unserer Familie.«
»Und das, obwohl wir nicht einmal aktiv jagen.«
»Stimmt, wir haben ein kostenloses Lieferdienstabo im Keller.«
Der Vorteil daran, wenn man ein Bestattungsunternehmen im eigenen Haus führt, ist der stete Zugang zu Nahrung, ohne einem lebenden Menschen zu schaden. So vermeiden wir es, Aufsehen durch eine Häufung von Todesfällen in und um New Arcadia zu erregen.
Besonders wir Kinder sind damit aufgewachsen und daran gewöhnt, zu wissen, woher die rote Flüssigkeit kommt, die unsere Eltern regelmäßig zu sich nehmen. Meinen Wechsel vom Menschen zur Untoten hat jedoch die Toleranz meiner Geschwister – und ehrlich gesagt sogar meine eigene – ziemlich überstrapaziert, was das Essen angeht.
Wenigstens kann ich die meiste Zeit tierische Nahrung zu mir nehmen, was die ganze Sache etwas leichter macht. Besonders Lyn freute es, dass ich nicht – entgegen dem gängigen Mythos – dauernd auf Menschen angewiesen bin. Ihr wurde am Esstisch oft ein wenig übel. Und wäre nicht mein ständiger Hunger, würde es mir wohl ähnlich wie ihr ergehen. Aus diesem Grund nennen wir meine Mahlzeiten nicht beim Namen, sondern einfach nur du-weißt-schon-was. Ich bin verdammt froh, dass meine Eltern den Beruf als Bestatter gewählt haben, sodass ich mich nicht selbst um mein Essen kümmern muss.
»Jedenfalls«, greift Lyn das Gespräch wieder auf, »alle tuscheln über ihn.«
»Wieso? Versteckt sich hinter dem guten Aussehen so ein Freak wie wir?«
»Niemand ist so freakig wie wir«, erinnert sie mich fröhlich. »Aber er soll ziemlich attraktiv sein. Ich habe ein Mädchen davon schwärmen hören, dass er älter und reifer aussieht als die Jungs aus der Sportmannschaft.«
Ich rolle nur mit den Augen. Wenn der Tag weiter so verläuft, werde ich damit gar nicht mehr aufhören können.
»Die Menschen sind halt oberflächlich, da kannst du nichts gegen machen«, schiebt Lyn nach.
»Da freue ich mich ja richtig auf unser Abendessen mit den Walkers.«
Carolyn stößt mich mit der Schulter an und versteckt beim Laufen die Hände in den Taschen ihres karierten Faltenrockes. »Jetzt sei nicht so voreingenommen. Vielleicht sind sie ja nett.«
»Ich bin nicht voreingenommen«, wehre ich mich, aber mir fällt nicht viel ein, das für meine Unschuld spricht.
Ich bin lang genug eine von den Lebenden gewesen, um zu wissen, wie langweilig sie für uns Übernatürliche sind. Besonders wenn man zwischen Vampiren, Hexen und Werwölfen aufwächst und selbst nichts zu bieten hat, ist das ein wunderbarer Nährboden für Selbstzweifel. Wie oft habe ich mich darüber geärgert, eine Sterbliche zu sein? Sogar meine Eltern angebettelt, mich, sobald ich alt genug bin, in eine von ihnen zu verwandeln?
Menschen sind einfach öde und dazu auch noch schwach, egal wie oft Mum mir gesagt hat, dass ich genauso besonders bin wie meine Geschwister. Wir wussten beide, dass das nicht stimmt, da kann sie ihre Worte noch so liebevoll verpacken.
»Du bist ja heute richtig gut drauf«, bemerkt Lyn, als wir vor dem Chemielabor ankommen.
»Könnte vielleicht daran liegen, dass ich ziemlich ruppig aus dem Bett geworfen wurde.«
»Immerhin hattest du so genug Zeit, dich hübsch zu machen.« Sie hebt die Hand und wischt mir mit dem Daumen dicht an der Unterlippe entlang. »So ist es besser.«
»Danke.« Ein paar meiner Mitschüler drängen sich an uns vorbei. »Du weißt aber schon, dass du für die Messer bezahlen wirst?«
»Ich bin gespannt, was du dir einfallen lässt.« Lyn grinst und macht sich bereits auf den Weg zu ihrem eigenen Kurs. Ein letztes Mal dreht sie sich zu mir um und winkt. »Bitte bringe niemanden bis zur Pause um, ja?«
»Ich verspreche nichts«, rufe ich ihr nach und fange mir direkt ein paar Blicke meiner Mitschüler ein, die sich nicht ganz sicher sind, ob ich das ernst meine oder nicht. Und ehrlich gesagt, weiß ich das selbst nicht so genau. Der Tag ist schließlich lang und voller ungeahnter Möglichkeiten.
KAPITEL 3
Das Highlight des Tages ist die Sportstunde am frühen Nachmittag. Jedes Halbjahr kann man sich für einen neuen Kurs einschreiben, und nachdem ich mich vor den Sommerferien durch Tennis – ausgerechnet Tennis! – quälen musste, darf ich mich jetzt zweimal die Woche auf Karate freuen.
Vor meiner Wiederauferstehung besaß ich praktisch keinerlei Ausdauer. Nach wenigen Runden um das Sportfeld geriet ich direkt in Atemnot, und wenn ich mehr als drei klägliche Liegestütze machen musste, bekam ich davon eine ganze Woche Muskelkater in den Armen. Ich habe es damals gehasst, so schwach zu sein. Keine Stärke zu besitzen. Keine Vitalität. Man sollte meinen – Hollywood sei Dank –, dass man als Untote noch mehr darunter zu leiden hat, weil der eigene Körper in einen Verwesungszustand verfällt. Zu meiner persönlichen Freude ist dem aber nicht so.
Letztes Halbjahr brach ich den Schulrekord bei einem Laufwettbewerb, denn was meine äußerst seltene Art richtig gut kann, ist Rennen. Wir sind nur in unseren allerschlimmsten Phasen – wenn wir zu sehr hungern – schlurfende, hässliche Zombies wie in The Walking Dead.
Zombies ist politisch übrigens unkorrekt und ziemlich beleidigend; wir ziehen es vor, Untote genannt zu werden. Nur als kleine Anmerkung am Rande.
Da ich jedoch regelmäßig Nahrung zu mir nehme, unterscheide ich mich oberflächlich kaum von den Sterblichen. Man merkt es höchstens im Detail. Zum Beispiel geht mir nicht die Puste beim Sprinten aus, da ich generell nicht mehr auf Atmung angewiesen bin. Meine Kraft hat sich außerdem – zumindest gefühlt, denn einen wissenschaftlichen Wert gibt es dazu natürlich nicht – verdreifacht. Ich werde zwar niemals an Mums und Dads Stärke herankommen, aber für eine Achtzehnjährige, die noch nie eine Hantel gehoben hat, habe ich viel Freude daran, die Sportler im Armdrücken zu schlagen.
Was übrigens einer der Gründe ist, wieso sie mich nicht leiden können. Ihre toxische Männlichkeit erlaubt es ihnen nicht, sich von einem zart gebauten Mädchen wie mir den Arsch versohlen zu lassen.
Das macht den Karateunterricht umso lustiger. Früher hätte ich nie gedacht, dass Kampfsport etwas ist, das mir tatsächlich guttut und zu den Tätigkeiten gehört, die mich entspannen. In diesem Halbjahr darf ich zweimal die Woche jeden, der es wagt, sich mir zu stellen, auf die Matte werfen. Es ist nicht schwer oder anstrengend, aber ungemein befriedigend, solange ich die Kontrolle behalte.
»Leute, werdet endlich fertig«, ruft unsere Karatelehrerin Ms Higginbottom uns aus der Turnhalle zu. Wie die meisten meiner Mitschüler trödle ich in der Umkleide, damit ich nicht helfen muss, die Matten auszulegen.
Noch so eine Sache, die ich an Karate mag, ist der geringe Anteil an Mädchen in der Umkleidekabine. Außer mir sind es nur vier andere. Wir ignorieren uns gegenseitig, während wir unsere Klamotten aus- und die weißen Karateanzüge anziehen. Auch wenn ich die Farbe hasse und darin aussehe wie ein Stück Toast mit dunklen Haaren, ist es doch ein traditionell anmutender Prozess, den ich schätze. Die Routine hat was. Es ist wie ein Ritual, das mich auf das vorbereitet, was gleich kommt. Außerdem steigt dabei meine Vorfreude auf die Stunde, und ich vergesse den penetranten Geruch nach Schweiß und Vanilledeo, der vom vorherigen Kurs in der Luft hängt.
Als letztes Mädchen verlasse ich die Umkleide und betrete die zwei Etagen umfassende Turnhalle mit ihrem hellen Holzboden und den Fenstern unterhalb des Daches. Die frische Herbstluft von draußen gibt sich wirklich große Mühe, die menschlichen Düfte meiner Mitschüler zu überdecken, aber es gelingt ihr nicht so richtig. Ich rieche ihre Aftershaves und Parfums und höre ihre teils angestrengten, teils entspannten Atemzüge. Die meisten Kursteilnehmer strafen mich mit Nichtbeachtung. Anfangs haben sie sich noch über mich lustig gemacht und dachten, sie könnten mir beweisen, wie schwach ich im Vergleich zu ihnen bin. Den Zahn habe ich ihnen direkt in der ersten Stunde gezogen und seitdem bin ich für sie so unsichtbar wie mein geliebter Frankie.
Gerade als ich mich an das Ende der Reihe aus Sterblichen stellen will, bemerke ich den Jungen, der neben Ms Higginbottom steht. Braune Strähnen wellen sich auf seiner Stirn, das markante Kinn leicht gereckt und die Arme vor der Brust verschränkt. Sein Blick fällt auf mich.
Tate Walker.
»… deswegen freue ich mich sehr darauf, zu sehen, was Sie draufhaben, Mr Walker«, beendet Ms Higginbottom die Vorstellung, die ich größtenteils verpasst habe.
Alle klatschen, was Tate mit einem schmalen, aber freundlichen Lächeln annimmt. Mit den verschränkten Armen und dem weißen Karateanzug sieht er selbst wie ein sehr junger Karatelehrer aus, nicht wie ein Schüler.
»So.« Ms Higginbottom zieht ihren Pferdeschwanz am Hinterkopf fest und lässt ihren Blick an unserer Reihe entlangwandern. »Bevor wir richtig anfangen: Wer opfert sich, damit Mr Walker demonstrieren kann, was er bereits kann?«
Die Köpfe drehen sich, bis sie alle mich anschauen. Selbst Ms Higginbottom macht sich nicht die Mühe, ernsthaft nach einem möglichen Kandidaten Ausschau zu halten. Auch sie sieht mich erwartungsvoll mit gehobenen Brauen an.
Ich zucke gleichmütig mit der Schulter und mache einen Schritt nach vorne. Gucken wir doch mal, was er so draufhat.
»Ms Smythe, sehr gut«, verkündet Ms Higginbottom. »Meine beste Schülerin«, erklärt sie Tate, der mich aufmerksam betrachtet. In seinen grünblauen Augen liegt etwas, das ich nicht anders beschreiben kann als mit dem Wort Vorfreude. Keine Ahnung, warum, aber nachdem er langsam seine Arme aus der abwehrenden Haltung gelöst hat und seinen Nacken erst nach links, dann nach rechts dehnt, wird mir klar, wie richtig ich liege. Er hat wirklich Lust auf die Nummer.
Alle rücken etwas nach hinten, um uns Platz zu machen, und Tate und ich stellen uns einander gegenüber auf.
»Hast du dich aufgewärmt?«, fragt er mich.
Beinahe lache ich. »Mach dir lieber Sorgen um dich selbst.« Das entlockt ihm immerhin ein schmales Grinsen. Erst jetzt bemerke ich die kleinen Grübchen, die sich in seine Wangen drücken.
Klar hat er Grübchen. Weil gut aussehende Typen ja ohne nicht attraktiv genug wären. Mutter Natur muss da immer eins draufsetzen.
Konzentriere dich.
Das ist der wohl schwerste Teil am Sportunterricht – ich muss die Kontrolle behalten. Über mich, über meine Kräfte, vor allem aber über die Untote, die in mir schlummert. Ein Übungskampf kann für sie schnell zu einer Jagd werden, wenn ich mich zu sehr ablenken oder von Gefühlen jeder Art überwältigen lasse. Das im Griff zu behalten, ist das eigentliche Training hier für mich.
Normalerweise meide ich die Nähe zu den Sterblichen, weil ihre Gerüche, ihre Wärme, ihr Herzschlag – eben alles, was sie lebendig macht – meine innere Untote kitzelt. Karate ist ein Halb-Kontaktsport, und ich bilde mir ein, dass ich den Menschen besser widerstehen kann, je mehr ich mich ihren Reizen aussetze. Wie bei einer Hyposensibilisierung.
Tate und ich verbeugen uns voreinander. Wir nehmen die Karaterituale hier nicht ganz so ernst, weil wir nur ein Haufen Highschoolschüler sind, die sich laut Lehrplan ein bisschen auspowern sollen. Dennoch ist die Verbeugung ein Zeichen des Respekts und Ms Higginbottom besteht darauf.
Zu Beginn halte ich mich stark zurück und überlasse es Tate, vorzustoßen. Seine Bewegungen sind fließend, nicht so ungeschickt und stolpernd wie die der anderen. Selbst wenn man kein Profi ist, erkennt man, dass er Ahnung hat.
Ich wehre jeden seiner Angriffe ab und warte darauf, dass der Moment kommt, in dem ich dran bin. Er ist da, als Tate versucht, mich mit einem geschickten Tritt in die Kniekehle aus dem Gleichgewicht und damit auf die Matte zu befördern. Ich weiche aus, drehe mich und treffe ihn fest mit dem Fuß gegen die Schulter. Er gerät kurz ins Stolpern, packt aber in einer schnellen Bewegung meinen Knöchel und dreht mich so zur Seite, dass ich im Bruchteil einer Sekunde und mit einem gedämpften Knall auf der Matte lande. Würde ich noch atmen, hätte mir diese harte Landung die Luft aus den Lungen getrieben.
Ich ignoriere das erstaunte Raunen um mich herum und drücke mich vom Boden wieder hoch in den Stand. Zurück auf den Beinen tue ich so, als wäre ich außer Atem, und mustere Tate. Er schiebt sich mit einer Hand die braunen Strähnen aus dem Gesicht und sieht äußerst zufrieden mit sich aus.
»Endlich haben wir einen würdigen Gegner für Sie gefunden, Ms Smythe«, verkündet Ms Higginbottom gerade, als ich den Kopf in ihre Richtung drehe.
»Ich will eine Revanche.«
»Sie können gleich noch üben«, verspricht sie mir.
»Nein.« Ich presse die Zähne fest aufeinander. »Ich will jetzt eine Revanche.«
Ms Higginbottom schaut sich kurz um und nickt. »Von mir aus. Ich werde Ihre Begeisterung für Karate nicht dämpfen.«
Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder auf Tate. Er hat nur Glück gehabt. Glück und offenkundig Erfahrung. Ich habe ihn unterschätzt, aber das wird mir kein zweites Mal passieren.
»Noch eine Runde?«, fragt er mich in einem munteren Ton, der verrät, dass er nun den gleichen Fehler begeht, den ich eben gemacht habe. Er hält sich für besser – wenn er sich da mal nicht verzettelt.
Wir stellen uns erneut gegenüber auf, und dieses Mal bin ich diejenige, die die ersten Angriffe startet. Immer wieder weicht er mir mit Schritten nach hinten aus, und dieses dämliche Grinsen, als würde er sich dabei bestens amüsieren, verlässt nie sein Gesicht. Tate scheint richtig Spaß zu haben, mich andauernd näher kommen zu lassen, nur damit ich am Ende ins Leere greife. Wenn ich ihn doch nur in die Finger kriegen würde. Ganz kurz. Mehr braucht es nicht, um sein Genick mit einem einzigen Ruck zu brechen.
Die Brutalität meiner eigenen Gedanken reißt mich aus meiner Konzentration, und Tate ist aufmerksam genug, um die Lücke, die sich in meiner Verteidigung auftut, zu nutzen. Mit einem Tritt zieht er mir wieder den Boden unter den Füßen weg. Aus einem Reflex heraus greife ich Halt suchend nach seiner Jacke, eine Bewegung, mit der er offensichtlich nicht gerechnet hat.
Ein weiterer, lauter Knall hallt durch den Saal, als wir auf den Matten landen. Tates volles Gewicht meißelt mich unter ihm fest. Seine Körperwärme, seine sich schnell hebende und senkende Brust über meiner, sein Geruch. Er riecht unwiderstehlich. Meine empfindlichen Sinne werden von seiner Menschlichkeit förmlich geflutet, und in mir erwacht etwas Dunkles, das verdammt hungrig ist.
»Alles in Ordnung?«, fragt Tate, der sich links und rechts von mir mit den Händen abstützt und so sein Gewicht abfängt. Schwärze rupft an meinem Sichtfeld und verengt es immer mehr, aber ich erkenne deutlich den konfusen Ausdruck in seinen Augen. »Katrina?«
»Geh runter von mir«, knurre ich und winde mich unter ihm. Hätte ich noch ein Herz, würde es jetzt rasen, denn ich kann immer schlechter sehen. Alles verschwimmt, wird konturlos und dieses andere Ich in mir krallt sich fester in mein Bewusstsein. Ich bemerke nicht einmal, dass Tate Anstalten macht, meiner Aufforderung nachzukommen.
Nicht schnell genug, flüstert es leise in meinen Gedanken. Ich muss hier weg. Sofort! Das Gefühl von Kontrollverlust ist schrecklich, aber dass es mir hier und jetzt passiert, ist eine mittelschwere Katastrophe. Bilder von mir in einem Haufen toter Mitschüler überfordern meinen Verstand.
Ohne darüber nachzudenken, stemme ich die Hände gegen Tates feste Brust und stoße ihn mit so viel Schwung von mir runter, dass er erst ein paar Meter von mir entfernt neben den ausgelegten Matten wieder aufkommt. Irgendjemand flucht ungehalten – vermutlich Tate – und andere schnappen hörbar nach Luft. Ich starre die Decke der Turnhalle an, spüre, wie mein Körper sich wieder leichter und freier anfühlt, und konzentriere mich darauf, meine andere Seite zurück in den sicheren Schatten zu verdrängen. Dank meiner nächtlichen Schlafmeditationen gelingt mir das mit jedem Mal etwas besser, aber so leicht komme ich mit alldem nicht davon.
»Katrina Smythe.« Ms Higginbottoms Stimme zerschneidet die Unruhe wie eine Machete den tiefsten Dschungel. Ich stöhne leise. »Was haben Sie sich dabei gedacht?«
»Er war schwer«, halte ich dagegen, denn eine bessere Ausrede habe ich nicht. Ich kann wohl kaum sagen, dass alles an Tates Körper mich förmlich angebettelt hat, ihn als Beute zu sehen.
»Um Gottes willen, er war dabei, aufzustehen. Armer Mr Walker. Sie sollten lernen, keine schlechte Verliererin zu sein, Ms Smythe.«
Ich blende sie einfach aus, um meine Wut besser unter Kontrolle zu behalten, und sehe zur Seite. So arm scheint Tate gar nicht dran zu sein. Er hat sich bereits mithilfe einiger Mitschüler wieder aufgerappelt und starrt mich mit angespannten Kiefermuskeln an.
Nach unserem kleinen Intermezzo wird das Abendessen nachher bestimmt richtig lustig. Ich sollte Mum besser nichts davon erzählen, sonst macht sie sich nur Sorgen, was unsere neuen tollen Nachbarn von uns halten könnten.
»Ziehen Sie sich um. Wenn Sie beim Nachsitzen darüber nachgedacht haben, wieso Ihr Verhalten falsch war, können Sie gerne zur nächsten Stunde wiederkommen und uns von Ihren Erkenntnissen berichten.«
Na klar. Ich sorge dafür, dass das alles hier nicht in einem Gemetzel endet, und werde bestraft. Wieso ist es meine Schuld, dass ich bin, was ich bin? Anstatt dass auch nur ein einziger Mensch anerkennt, wie viel Mühe ich mir gebe, damit keinem Unschuldigen etwas passiert, bestrafen sie mich mit Nachsitzen.
Auf dem Weg nach draußen werfe ich einen letzten Blick über die Schulter. Tate zieht gerade seinen Gürtel fest, als auch er zu mir schaut. In seinen Augen liegt keine Wut oder Angst. Ganz im Gegenteil. Alles, was ich in ihnen erkenne, ist eine Art Klarheit. Als wäre ihm irgendetwas bewusst geworden. Und es gefällt ihm nicht. Absolut nicht.
KAPITEL 4
»Oooh, Kat«, flüstert Lyn, begleitet von einem schweren Seufzen, das eigentlich schon alles sagt. »Du solltest wirklich besser etwas anderes machen. Leichtathletik wäre sicherlich ganz gut, denkst du nicht?«
Ich schüttle den Kopf. »Das ist auf Dauer so, als würdest du einem ausgehungerten Jagdhund ein saftiges Kaninchen vor die Nase setzen, das vor ihm wegrennt. Wettbewerbe sind eine Sache, aber jede Woche so einem Reiz ausgesetzt zu werden … könnte etwas drüber sein.«
»Immerhin dürftest du dann einen weiteren Rekord brechen.«
»Nur bringt mir das auch nichts, wenn anschließend in allen Zeitungen davon berichtet wird, dass ich Cindy McKenzie angefallen habe.«
Lyn lacht. »Wann musst du denn nachsitzen?«, fragt sie und zieht sich mit der Hand, die nicht den Regenschirm hält, den Reißverschluss ihrer gelben Übergangsjacke hoch.
Seit dem späten Vormittag heult sich der Himmel über uns richtig schön aus, was nur einer der vielen Gründe ist, wieso meine Familie in dieser Gegend lebt. Die Autorin von Twilight lag gar nicht so falsch, als sie Forks als idealen Ort für lichtempfindliche Wesen wie Mum und Dad beschrieb. Nur dass New Arcadia noch viel besser dafür geeignet ist.
Die sonnigen Tage sind praktisch kaum existent. Entweder es schüttet aus Eimern – so wie heute – oder die Wolken hängen schwer und grau über der Stadt. Wer einen Vitamin-D-Mangel hat, sollte hier besser nicht wohnen. Ich dagegen liebe dieses Wetter, weil es sich anfühlt, als hätten wir das ganze Jahr Herbst – was die beste aller Jahreszeiten ist.
»Samstag.« Ich hebe die Hand, bevor Lyn zum Protest ansetzt. »Aber ich habe nicht vor, hinzugehen und deine Hexenweihe zu verpassen.«
Sie pustet sich eine blonde kinnlange Locke aus dem Gesicht. »Gut. Ich erwarte nämlich ein unfassbar tolles Geschenk von dir.«
Ich richte meinen schwarzen Schirm etwas besser aus, damit meine Haare nicht nass werden, und weiche gleichzeitig einer Pfütze auf dem Bürgersteig aus, um meinen wunderschönen Schnürstiefeln das gleiche Schicksal zu ersparen. »Du erwartest immer und zu jeder sich bietenden Gelegenheit richtig coole Geschenke.«
»Ich habe sie auch verdient.« Lyn grinst. »Und gerade zu meiner Hexenweihe. Ich werde schließlich nur einmal sechzehn und zur Junghexe ernannt … hoffe ich zumindest.«
»In unserer Welt weiß man’s ja nie so genau.«
Wir lachen. Seit Wochen gibt es kaum ein spannenderes Thema für Lyn als ihren sechzehnten Geburtstag, an dem sie zugleich ihre Hexenweihe feiert, eine Zeremonie, bei der sie offiziell als Junghexe anerkannt wird. Ein Abgesandter des obersten Hexenzirkels kommt zu uns, quasselt ein paar Worte, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert haben, und verkündet unserer übernatürlichen Gesellschaft aka unseren zahlreichen Gästen, dass Lyn nun alt genug ist, um die nächsten Stufen ihres Hexenstudiums anzugehen, das sie neben der Schule absolviert.
Das ist eine so wichtige Nummer, dass wir eine riesige Party mit Freunden der Familie in unserem Haus schmeißen, und Geschenke wird es natürlich ebenfalls geben. Ich rechne fest damit, dass Lyn am Ende des Abends völlig überdreht sein wird, weil sie so viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
Als wir endlich die Straße erreichen, in der sich unser Haus befindet, entspannen wir uns. Nicht, dass wir Angst haben, aber hier draußen, fernab der meisten anderen Immobilien, brauchen wir uns nicht darum zu sorgen, dass jemand etwas aus unseren Gesprächen aufschnappt, das nicht für sterbliche Ohren bestimmt ist. In New Arcadia leben wir zwar außerordentlich sicher, doch damit das so bleibt, müssen wir trotzdem wachsam bleiben. Hier, in der letzten Straße, bevor man die Stadt verlässt, gibt es nur noch zwei Grundstücke: das alte Warrington House, in dem die Walkers wohnen, und unser eigenes.
Unseres entdeckt man selbst aus der Ferne sofort. Smythe Manor, wie die meisten es mittlerweile nennen, thront auf einem kleinen Hügel, der wiederum auf einem sumpfigen, nach menschlichen Maßstäben stark vernachlässigten Gelände liegt. Zahlreiche alte, knorrige Bäume säumen eine schmale, schlammige Auffahrt zu dem viktorianisch-gotischen Anwesen, das vor Jahrzehnten von einem schwerreichen Mann für seine Familie erbaut worden war. Nach außen besteht es aus einem dreieinhalbstöckigen Mittelteil, den wir nur den Turm nennen, und zwei zweieinhalbstöckigen Nebenanbauten. Das raue Wetter hat das Mauerwerk aus Sandstein dunkel verfärbt und die unterschiedlich großen Satteldächer aus schwarzem Schiefer verleihen unserem Heim den letzten Schliff.
Die Maklerin, die Mum und Dad das Anwesen kurz nach ihrer Adoption meines Bruders Anthony zeigte, verheimlichte zunächst, dass es als Horrorhaus verschrien war, weil mehrere der vorherigen Besitzer auf seltsam-tragische Weise ums Leben gekommen waren. Hätte sie gewusst, dass das der ausschlaggebende Grund für meine Eltern sein würde, es schließlich zu kaufen, hätte sie sich und ihnen viel Zeit erspart. Mum verliebte sich sofort in die kleinen Details: den Witwengang oben auf dem Turm, den steinernen Schornstein und die mit Holzornamenten verzierten Fenster mit Gauben, die aus den Dächern herausragen.
Nichts an unserem Zuhause ist gewöhnlich. Über die Jahre kamen weitere Anbauten wie die Orangerie am hinteren Teil des Gebäudes dazu – mit Blick auf den kleinen Friedhof, auf dem Freunde und Verwandte von uns ihre letzte Ruhe gefunden haben. Dad ließ zudem eine niedrige Außenmauer mit einem dazugehörigen Eisenzaun und einem dekorativ verschnörkelten Eisentor um das ganze Grundstück ziehen. So sollten neugierige und abenteuersuchende Menschen ferngehalten werden.
Auch heutzutage sehen die Menschen nicht die Schönheit, die Smythe Manor für uns ausstrahlt, und gerade in Lyns und meiner Altersgruppe fürchten sich viele vor den Geschichten des einstigen Horrorhauses. Nur die Erwachsenen haben ein paar ihrer Ängste verloren. Freiwillig auf einen Besuch möchte dennoch niemand vorbeikommen. Sie wissen, dass sie nur wenige Male das Haus für längere Zeit betreten müssen: Wenn jemand stirbt, der ihnen wichtig ist, oder wenn sie selbst das Zeitliche segnen. Spätestens dann schickt man sie – mit den Füßen voran – direkt in unseren Keller hinein.
»Was macht Mr Figaro dort?«, fragt mich Lyn und deutet mit einem Nicken auf einen älteren Herrn, der in dem behüteten Viertel direkt vor unserer abseitigen Straße wohnt.
Ich sehe dabei zu, wie der Mann mit dem schütteren ergrauten Haar und einem unfassbar hässlichen braunen Pullunder etwas an der Straßenlaterne vor unserem Tor befestigt. Mühselig hat er sich einen Regenschirm zwischen Kopf und Schulter geklemmt und hantiert auf die umständlichste Weise mit einem Stapel Papiere und Klebeband herum.
»Keine Ahnung«, erwidere ich. Wir halten auf Mr Figaro zu, der uns entdeckt und uns sofort ein breites Lächeln schenkt.
»Die Smythe-Schwestern«, begrüßt er uns. »Katrina, Carolyn. Schön, euch zu sehen. Ist alles gut bei euch?«
Ich überlasse Lyn den Small Talk. Wie Mum ist sie da viel besser drin als ich.
»Alles bestens, Mr Figaro. Und bei Ihnen?«
Er blinzelt gegen ein paar Regentropfen an, die sich in seinen hellen, kurzen Wimpern verfangen. Obwohl meine Sympathien für die Sterblichen stark begrenzt sind, tut er mir irgendwie leid. Was auch immer ihn raus in dieses Wetter getrieben hat – es muss ihm wichtig sein.
Seine gebückte Haltung ist ein bisschen krummer als sonst und seine Haut wirkt fast ungesund blass. Ich weiß noch, dass ich Mum vor ein paar Jahren fragte, ob Mr Figaro einer von ihnen, von den Übernatürlichen, ist. Sie lachte daraufhin und versicherte mir in ihrem gewohnt liebevollen Ton, dass er nur ein Mensch ist, der sich zu viel von der Last der Welt aufgebürdet hat. Jemand, der sich regelmäßig der Probleme anderer annimmt. Niemand opfert sich so auf wie er und niemanden hat das so sehr gezeichnet wie ihn.
»Unkraut vergeht nicht«, antwortet er auf Lyns Frage und hält uns einen der Zettel hin. »Ich verteile gerade diese Flugblätter. Zwei Mädchen werden vermisst.«
Ich nehme ihm den besagten Flyer ab und schaue in die Gesichter von zwei Teenagern, die kaum jünger sein dürften als Lyn. Rose und Lydia Matterhill vermisst! steht über einem Selfie, auf dem sich die Mädchen umarmen und in die Kamera grinsen.
»Was ist passiert?«, frage ich und falte den Zettel zusammen, um ihn in die tiefe Tasche meines Mantels zu schieben. Mum und Dad wird das sicherlich interessieren, schließlich geschieht in New Arcadia fast nie etwas, das nach Flyern an Straßenlaternen verlangt. Nicht einmal Haustiere verschwinden hier.
»Die beiden waren gestern Abend in Olympia im Kino. Als ihre Eltern sie abholen wollten, sind sie nicht aufgetaucht. Ihr habt nicht zufällig irgendetwas mitbekommen?«
Lyn und ich schütteln gleichzeitig die Köpfe. »Wir wussten bis eben gar nicht, dass überhaupt jemand vermisst wird«, sagt Lyn stellvertretend für uns beide.
»Auf Empfehlung der Polizei hatten die Matterhills darauf gewartet, dass die Mädchen heute wieder auftauchen, aber da das nicht passiert ist, suchen sie jetzt nach ihnen.« Mr Figaro gibt einen schwermütigen Laut von sich und umklammert die Flyer fest. »Würdet ihr mir ein paar abnehmen und in der Schule verteilen?«
»Machen wir gerne«, versichert Lyn und nimmt ihm den halben Stapel ab. »Ich werde mich mal umhören, ob jemand etwas weiß.«
Wir verabschieden uns von ihm. Während ich unser quietschendes Eisentor so öffne, dass Lyn mit den Zetteln und ihrem Regenschirm hindurchschlüpfen kann, starrt sie das Bild der beiden Mädchen an.
»Ich glaube, ich habe sie ein paar Mal in der Schule gesehen«, sinniert sie laut.
Ich zucke mit der Schulter und schließe hinter ihr wieder das Tor. »Vermutlich Middle School, oder?«
»Ja, also in meinem Jahrgang sind sie nicht.«
»Meinem definitiv auch nicht.«
Lyn brummt leise. »Ich werde gleich mal die Geister befragen. Vielleicht haben die etwas in ihrem Netzwerk gehört.«
»Gute Idee. Sie haben ihre Augen und Ohren schließlich überall.«
KAPITEL 5
Das Geisternetzwerk ist großartig. Du hast irgendwo etwas verloren? Frag die Geister! Sie kennen einander und wissen über alles und jeden Bescheid. Weil sie den lieben langen Tag nichts Besseres zu tun haben, als uns zu beobachten, können sie dir genau sagen, dass du deinen Lieblingspullover im Klassenraum des Literaturkurses vergessen hast. Lyns Idee ist daher ein guter erster Anlaufpunkt.
Kaum dass wir daheim sind, verschwindet sie in ihrem Zimmer. Fast eine halbe Stunde vergeht, bis sie mit dunklen Schatten unter den Augen wieder herauskommt. Sie sieht aus, als hätte sie seit Tagen nicht geschlafen, was damit zusammenhängt, dass Geisterbeschwörungen für Hexen in ihrem Alter eine echte Herausforderung darstellen. Normalerweise sollte sie noch gar nicht dazu in der Lage sein, aber Tante Apollonia hat früh ihr Talent erkannt und sie unter ihre Fittiche genommen, weswegen Lyn schon weiter ist als die meisten Fast-Junghexen.
»Nichts«, berichtet sie mir und fällt dabei müde auf mein Bett, das nach der morgendlichen Messerattacke völlig zerrupft aussieht. »Sie haben davon gehört, aber niemand hat gesehen, wohin die beiden Mädchen nach dem Kino verschwunden sind. Als hätte sich die Erde unter ihnen aufgetan und sie verschluckt.«
Zu gerne möchte ich Lyn aufmuntern und ihr sagen, dass schon alles gut sein wird, aber meine innere Pessimistin kann sich nicht dazu durchringen.
In der Welt um uns herum passieren schreckliche Dinge.
Wirklich sehr, sehr schreckliche Dinge und in den seltensten Fällen sind Übernatürliche wie wir dafür verantwortlich. Lyn ist noch in der Phase, in der sie glaubt, mit Magie könnte sich jedes Problem in Wohlgefallen auflösen. Meistens stimme ich ihr dabei zu, aber auch wenn sie eine fähige Hexe mit großem Potenzial ist, fehlen ihr dafür trotzdem noch die Erfahrung und manchmal die gesetzlichen Grundlagen.
Als ich bei meinem Unfall starb, war es unsere Tante, die mich mittels eines mächtigen Zaubers zurückholte. Nur für meine Eltern beging Apollonia mit der Verwendung von Nekromantie eine der schlimmsten Straftaten in unserer Welt. Immerhin trug sie mit der hundertjährigen Verbannung aus dem obersten Hexenzirkel sowie einer Begrenzung ihrer Fähigkeiten die Konsequenzen erhobenen Hauptes.