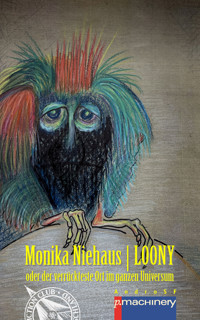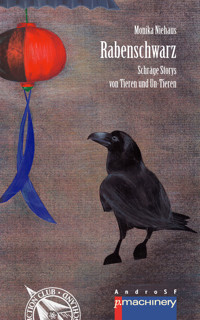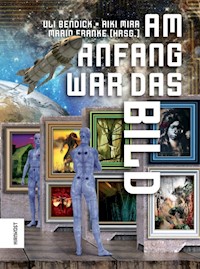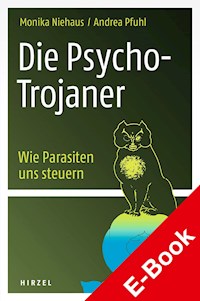5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Hyänengelächter« bietet rund drei Dutzend Storys, deren Spannweite von harter SF über Kriminelles bis zum Surreal-Fantastischen reicht. Neben ziemlich schrägen Typen wie einem Psychiater mit einer ausgefallenen Sammelleidenschaft kommt auch eine ganze Menge schräger Viecher vor, nicht nur (Wer-) Wölfe, sondern auch Fischotter, Rennpferde und Riesenwelse. Und was den Titel angeht: Hyänen mögen keine Sympathieträger sein, sind aber höchst interessante Mischwesen aus dem Katzen- und dem Hundehaften mit recht bizarrem Sozialverhalten und einem wirklich dreckigen Lachen. Monika Niehaus ist wohl eine der wenigen Frauen, die vor einigen Jahren statt Geschmeide eine prächtige Tüpfelhyäne unterm Tannenbaum vorfand – und sich ehrlich darüber gefreut hat. Heute ist Crocuta – von Rainer Schorm in seiner Grafik zur Titelgeschichte verewigt – eine Zierde ihres Wohnzimmers und ihre Muse. Sagen Sie also nicht, Sie wären nicht gewarnt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Monika Niehaus
Hyänengelächter
Storys aus unserem Teil des Alpha-Quadranten
Rund drei Dutzend SF-, Fantasy- und Krimistorys
mit Bildern von Rainer Schorm und Uli Bendick
AndroSF 159
Für meine lesebegeisterte Mutter
Charlotte Niehaus
zum 95. Geburtstag
Monika Niehaus
HYÄNENGELÄCHTER
Storys aus unserem Teil des Alpha-Quadranten
AndroSF 159
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: 28. Januar 2023
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Rainer Schorm
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 298 0
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 807 4
Das war meine erste Horrorstory, und sie spielt in einem Pariser Viertel, das ich gut kenne – das Aparte an dieser Anthologie ist, dass man das Buch umdrehen und alle Storys auch auf Französisch lesen kann.
Sammler unter sich
Monsieur Dupont tauchte sein Croissant in seinen schwarzen Kaffee und sah seine Frau über den Rand seiner Goldbrille an. Ihr geblümter Morgenmantel war voller Krümel, die auf ihrem Busen wippten, während sie sich mit energischen Bürstenstrichen durchs Haar fuhr. Monsieur Dupont hasste es, wenn sie sich beim Frühstück kämmte. Er räusperte sich. Sie sah auf, lächelte und legte die Bürste beiseite. »Ich bin ja schon fertig, mon p'tit cochon.« Monsieur Dupont war ein wenig untersetzt, und er hasste es, wenn sie ihn ihr ›kleines Schweinchen‹ nannte. Er stand auf. »Ich muss los. Bis heute Abend, Schatz.« Er nahm seinen Mantel, ergriff seine Aktentasche und drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Noch bevor er die Tür hinter sich geschlossen hatte, hatte sie sich eine Zigarette angezündet. Er hasste den Geruch von kaltem Rauch in der Wohnung.
Draußen reihte er sich in den Strom der Berufstätigen ein, die allmorgendlich zur Metro eilten. An der Haltestelle Barbès-Rochuard musste er umsteigen. Wie immer um diese Tageszeit war der Bahnhof neben dem Pariser Billigkaufhaus Tati brechend voll. Menschen aller Hautschattierungen drängelten und schoben sich aneinander vorbei. Arabische Händler boten Süßigkeiten und billige Uhren zum Verkauf, und schwarze Prospektverteiler drückten jedem Vorübergehenden ihre Werbung in die Hand. Monsieur Dupont ließ sie achtlos zu Boden fallen. Er fühlte ein leichtes Stechen in der Brust, und hinter dem rechten Auge begann es, zu pochen. Seine Migräne. Es würde einer dieser Tage werden.
Der Tag in der Buchhaltung der kleinen Autowerkstatt war noch scheußlicher gewesen, als erwartet. Als er an diesem Abend nach Hause zurückkehrte, sehnte er sich nur nach Ruhe, seinem Sessel und seiner Schmetterlingssammlung.
Diese eleganten Formen. Diese prächtigen, schillernden Farben. Diese wunderbaren, komplexen Muster. Vorsichtig, um die zarten Schuppen nicht zu beschädigen, breitete er die Flügel eines Perlmuttfalters aus. So zierlich und zerbrechlich. Fast andächtig senkte er eine Nadel durch den Brustkorb des Falters und spießte ihn an die noch leere Stelle im Schmetterlingskasten.
Schrilles Gelächter im Nebenzimmer ließ ihn zusammenzucken. Monsieur Duponts Augen verengten sich. Ständig beklagte sich seine Frau, dass er seinem Hobby mehr Zeit widme als ihr. Nun hatte sie ihre albernen Freundinnen eingeladen, sich auf seine Kosten zu amüsieren. Er musste verrückt gewesen sein, als er dieses hohlköpfige Geschöpf heiratete. Une attaque de folie. Aber Scheidung kam nicht infrage. Schließlich war er Katholik. Und sparsam.
Sein Blick fiel auf die Visitenkarte, die er in seiner Tasche gefunden hatte. Er musste sie heute Morgen beim Umsteigen gedankenlos eingesteckt haben.
# Doktor Chalid O'bango, sorcier. #
Talismane. Magie. Liebeszauber und mehr.
Erfolg garantiert. Günstige Preise.
Treffen nach Vereinbarung.
Oben in der rechten Ecke befand sich ein kleines Symbol. Er beugte sich vor. Seine kurzsichtigen Augen weiteten sich. Ein Schmetterling. Archerontia congolensis, der überaus seltene Blaue Kongofalter. Kongo, das war da, wo Afrika am schwärzesten ist, das Herz der Finsternis.
Nebenan wurden die Stimmen schriller. Monsieur Dupont fasste einen Entschluss.
Drei Tage lang zeigte er jedem schwarzen Prospektverteiler die Visitenkarte und erntete nur Kopfschütteln. Am vierten Tag zupfte ihn jemand am Ärmel. Er drehte sich um. Ein kleiner dunkelhäutiger Junge mit einem roten Fes. »Du suchst den Doktor?« Monsieur Dupont nickte stumm. »Nimm die Brille ab.« Monsieur Dupont gehorchte. Der Junge ergriff seine Hand. Monsieur Dupont folge ihm stolpernd. Schon bald hatte er im Gewirr der Gassen und Gässchen von Goutte d’Or jede Orientierung verloren.
Schließlich bogen sie in einen Hinterhof ab und stiegen eine schmale Treppe empor. Von irgendwo erklangen Trommelrhythmen. Es roch nach Moschus, Sandelholz und exotischen Gewürzen. Auf ein Klopfzeichen hin öffnete sich eine Tür. Nach einer kurzen Konversation in einer Sprache, die er nicht verstand, wurde er über die Schwelle geschoben.
Monsieur Dupont setzte seine Brille auf und blinzelte kurzsichtig. Ein großer Standleuchter spendete gedämpftes Licht. Die Wände waren mit bunt gemustertem Tuch verhängt. Der Boden war mit Sand bestreut, in dem ein paar Zwerghühner nach Körnern pickten. Der Mann auf dem niedrigen Kissen war schwarz wie die Nacht. Stirn und Wangen zierte ein Muster aus weißen Strichen und Punkten. Er trug ein Leopardenfellkäppi und war in einen weiten, weißen Kaftan gehüllt.
Monsieur Dupont befeuchtete seine Lippen. »Doktor O’bango?«
»Bien sûr«, antwortete ihm eine tiefe, gutturale Stimme mit fremdländischem Akzent und wies auf ein Polster ihm gegenüber. »Setzen Sie sich doch.« Als er sprach, sah Monsieur Dupont, dass seine Zähne spitz zugefeilt waren, wie es bei einigen afrikanischen Stämmen immer noch Brauch ist.
Monsieur Dupont war beeindruckt. Trotz seines exotischen Äußeren vermittelte ihm Doktor O’bango das Gefühl, man könne sich ihm anvertrauen. Und so erzählte er ihm erst stockend, dann immer flüssiger von seiner einzigen Leidenschaft und der Frau, die ihm dabei im Wege stand. Als er geendet hatte, schwieg der Schwarze eine Weile mit gesenktem Blick, während er die Glieder einer Bernsteinkette durch die Finger gleiten ließ. Schließlich hob er die Augen. »Fürst Samedi hat gesprochen. Die Ahnen erwarten Ihre Frau. Sie haben nicht zufällig etwas Persönliches von ihr …?«
Monsieur Dupont reichte ihm das Büschel blonder Haare, das er am Morgen vorsorglich eingesteckt hatte.
Doktor O’bango verlor keine Zeit. Geschickt verknetete er Haare und Wachs zu einer kleinen menschenähnlichen Figur. Dann griff er nach einem der schwarzen Zwerghähne und biss ihm mit einer raschen, geübten Bewegung die Gurgel durch. Ohne sich am Zappeln des Tieres zu stören, ließ er einige Tropfen Blut auf das Wachsmodell fallen und bohrte schließlich eine lange Nadel in den roten Fleck.
Monsieur Dupont, ein Taschentuch vor den Mund gepresst, beobachtete ihn mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination. Trotz allem hatte das Ritual etwas Klinisches an sich, als nehme ein Arzt eine schwierige, aber ihm wohlvertraute Operation vor.
Als Nächstes zündete Doktor O’bango einen Bunsenbrenner an und erhitzte das Figürchen in einem Tiegel. Ein beißender Geruch nach verbranntem Haar breitete sich aus. Schließlich zermöserte er den verkohlten Bodensatz zu einem feinen, dunklen Pulver, das er in ein Tütchen füllte.
»Einmal am Tag eine Messerspitze, am besten morgens in den Kaffee.« Es klang, wie die Anweisungen zur Einnahme eines Medikaments.
Automatisch streckte Monsieur Dupont die Hand aus, zog sie dann aber wieder zurück.
Doktor O’bango lächelte. »Zauberei ist in Frankreich nicht strafbar, Monsieur. Nennen Sie es ein wissenschaftliches Experiment.«
Monsieur Dupont fuhr sich über die trockenen Lippen. »Es wird funktionieren?«
»Fürst Samedi irrt nie.«
»Und … der Preis?«
»Fürst Samedi sagt: Jeder gibt, was er geben kann.« Er nannte eine Summe, die in Anbetracht der Umstände wirklich recht bescheiden war. »Im Voraus.« Als er sah, dass Monsieur Dupont zögerte, breitete er die Arme aus: »Sie wollen keine Katze im Sack kaufen, Monsieur, aber Sie müssen mir vertrauen. Ohne Vertrauen ist auch ein sorcier, ein Zauberdoktor, machtlos.«
Seufzend zückte Monsieur Dupont seine Brieftasche.
Als Monsieur Dupont am nächsten Morgen aufwachte, erschien ihm das Ganze wie ein Fiebertraum. Der Kerl musste ihn behext haben. ›Ein Narr und sein Geld sind bald geschieden‹, murmelte er ärgerlich. Aber da er das Pulver nun einmal hatte, konnte er es ja zumindest versuchen …
Wie ihm aufgetragen, mischte er eine Prise in den Kaffee seiner Frau. Und was er kaum gewagt hatte zu hoffen: Seine Frau schwand sichtlich dahin. Die Ärzte waren ratlos. Monsieur Duponts hingebungsvolle Pflege der Kranken wurde von allen gelobt, doch drei Monate nach seinem Besuch bei Doktor O’bango musste er sie zu Grabe tragen.
Die Trauerfeier war schlicht, und schon bald löste sich die kleine Trauergemeinde auf.
Als Monsieur Dupont den Friedhofsweg entlang zum Ausgang schritt, verspürte er zum ersten Mal seit Jahren kein Stechen mehr in der Brust. Endlich Frieden. Sein Sessel, eine Tasse Tee, der Schmetterlingskatalog …
Jemand zupfte ihn am Ärmel. Der Junge mit dem Fes schaute ernst zu ihm auf. »Er erwartet dich.«
Einen Augenblick zögerte Monsieur Dupont und erwog, den Jungen einfach stehen zu lassen. Dann überlegte er, dass man einen sorcier mit derartigen Fähigkeiten besser nicht verärgert.
Monsieur Dupont setzte die Brille auf und blinzelte. In der Luft lag ein Hauch von Moschus, aber das war ein ganz anderes Zimmer als beim letzten Mal. Ein weißer, karger Raum, fast wie das Sprechzimmer eines Arztes. Der Mann, der da am Schreibtisch saß, war schwarz, aber er trug weder Käppi noch Burnus, sondern einen ganz normalen Flanellanzug. Als er den Kopf hob, war Monsieur Dupont einen Augenblick verwirrt. Schwarze sehen alle so gleich aus. Dann lächelte der Mann, und Monsieur Dupont sah seine spitz geschliffenen Zähne.
»Doktor O’bango?«, fragte er unsicher.
Der Angesprochene neigte den Kopf. »In dieser Umgebung nenne ich mich Doktor Lenoir.« Sein Französisch war völlig akzentfrei. »Nun?«
Monsieur Dupont räusperte sich. »Sie … sie ist zu ihren Ahnen gegangen, Fürst Samedi hat recht behalten.«
Doktor Lenoir sah ihn einen Augenblick an und schüttelte dann langsam und fast mitleidig den Kopf. »Mein lieber Monsieur Dupont, Sie haben den Humbug doch nicht wirklich geglaubt? Voodoo, Wachspüppchen und blutige Hahnenköpfe, ich bitte Sie! Wir leben im einundzwanzigsten Jahrhundert.« Er lächelte sein breites Lächeln, das seine spitzen Zähne aufblitzen ließ. »Das Märchen vom Zauberdoktor wird Ihnen niemand abnehmen. Thallium, guter Freund. Führt zu einer Schwermetallvergiftung. Mit unspezifischem Multiorganversagen.«
Monsieur Dupont schluckte. Sein Hals war seltsam trocken. Und die Schlingen begannen, sich wieder um seine Brust zu legen. »Und Haarausfall …?«
Doktor Lenoir nickte strahlend. »Genau! Sammelt sich in den Haarspitzen an. Noch jahrelang nachzuweisen.« Er legte die Fingerspitzen zusammen und sah sein Gegenüber nachdenklich an. »Sie sind – nun ja, ein Mörder, Monsieur Dupont. Meine Pflicht wäre, der Polizei einen Hinweis zu geben …«
Als Monsieur Dupont einen erstickten Laut von sich gab, hob Doktor Lenoir beschwichtigend die Hand. »Andererseits bin ich Psychiater, und das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ist heilig …« Er griff nach seinem Terminkalender und blätterte. »Ich glaube, für den Anfang nehmen wir einen Termin pro Woche.« Er hob den Kopf, als warte er auf Zustimmung. Monsieur Dupont nickte mechanisch. »Schön, dass wir uns einig sind.« Der Doktor erhob sich und legte eine seiner langen schlanken und so erstaunlich kräftigen Hände auf Monsieur Duponts Schulter.
Monsieur Dupont sah ihn an wie ein Kaninchen die Schlange. »Warum?«, krächzte er.
Doktor Lenoir machte eine um Verständnis heischende Handbewegung. »Sie sind doch Sammler, Monsieur Dupont«, meinte er, während er ihn sanft, aber entschieden durch die Doppeltür ins Nebenzimmer schob. »Ich ebenfalls. Ich sammle Psychen. Die Psychen von Mördern.« Er lächelte, und sein Lächeln war breiter denn je.
Monsieur Dupont starrte auf den Kasten voller Blauer Kongofalter an der Wand. Das Stechen in seiner Brust nahm zu.
»Die Kälte jenseits der Träume/Le Froid au-dela des Reves«, Hrsg. Marten Munsonius, Bärenklau, 2008
Fischotter haben mich schon immer begeistert, und da die Geschichte für eine Oberrhein-Anthologie bestimmt war, boten sich Mülhausen und sein Zoo als Schauplatz an. Gleichzeitig konnte ich meiner Vorliebe für Spiegel frönen.
Reisende kann man nicht aufhalten
Die Einweihung des neuen Geheges war ein voller Erfolg gewesen. Die großzügige, einer Auenlandschaft mit Erlen, Weiden und einem breiten Bach nachempfundene Anlage war nach den modernsten tiergärtnerischen Erkenntnissen gestaltet und wurde von Fachleuten, Besuchern und Presse einstimmig gelobt.
»Das muss eine Menge Geld gekostet haben!«, meinte ich ein wenig neidisch, als wir nach dem Empfang im Arbeitszimmer meines Freundes und Kollegen saßen und uns einen trockenen einheimischen Riesling schmecken ließen. »Eine Spende?«
Mein Freund nickte. »Ja. Als mir Notar Häberli eröffnete, dass der Mühlenapotheker unserem Zoo testamentarisch eine beträchtliche Summe für den Bau dieses Geheges hinterlassen hatte, war ich natürlich begeistert …« Er stockte.
»Ja, und?«, drängte ich. »Wo steckt der Pferdefuß? Zu viele Bedingungen?«
»Nur eine einzige. Eine kleine Plakette am Gehege, ›In memoriam viatricis‹.«
»›In Erinnerung an die Reisende‹ – was soll denn das bedeuten?«
»Das habe ich Maître Häberli auch gefragt. Er hatte keine Ahnung. Aber gestern hat er mir, wie vom Erblasser verfügt, dieses Tagebuch zuschickt …« Er zögerte. »Ich habe es noch am selben Abend gelesen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es klingt ziemlich verrückt.« Ein wenig unsicher hielt er mir einen schmalen abgegriffenen, in braunes Leder gebundenen Band hin. »Würdest du vielleicht …?«
»Na klar, wenn du uns noch mal nachschenkst.« Ich griff nach dem Band, lehnte mich bequem zurück und schlug ihn auf. Ein feiner Moderduft stieg mir in die Nase, Stockflecken hatten einige Passagen unleserlich gemacht, und die Tinte war stellenweise verblasst, aber ansonsten waren die Zeilen gut lesbar. Auf der ersten Seite stand in sauberer, gestochen scharfer Schrift der Name des Inhabers, Fabian Fajus.
Mulhouse, im Januar 19…
Mülhausen oder Mulhouse, wie die Franzosen es nennen, liegt zwischen den Armen der Ill und wird bereits im achten Jahrhundert in einer Chronik als Besitz der Abtei St. Stefan als ›Dorf an der Mühle‹ erwähnt. Ganz unerwartet habe ich hier eine Bleibe gefunden …
Ich stand an der Ecke zur Rue de l’Arsenal und rieb mir die rot gefrorenen Hände. Es dämmerte bereits, die Kälte kroch mir in die Knochen, und ich hatte noch keine Unterkunft. Während ich noch überlegte, welcher Teufel mich geritten hatte, so Hals über Kopf alles stehen und liegen zu lassen, vernahm ich hinter mir einen Schrei. Ich fuhr herum.
Im Licht der Straßenlaterne vor einer Weinstube rangen zwei Gestalten miteinander. Einer der Kontrahenten, offensichtlich ein älterer Mann, war zu Boden gestürzt, versuchte aber, sich mit seinem Spazierstock gegen seinen Angreifer zu verteidigen. »Hilfe, au secours! Hau ab, du Canaille, du Escroc, du Spitzbube!«
»He, sofort aufhören!« Ich eilte auf die beiden zu.
Als der Angreifer mich kommen sah, ließ er von seinem Opfer ab und stürzte in die entgegengesetzte Richtung davon.
Ich half dem alten Mann auf die Beine und reichte ihm seine Fellmütze, die bei dem Gerangel auf den Boden gefallen war. »Sind Sie verletzt?«
Er klopfte seinen Mantel ab. »Mir geht’s jedenfalls besser als dem da.« Er wies auf die davoneilende Gestalt. »Nur Haut und Knochen, enge Pupillen – ein Fixer in fortgeschrittenem Stadium«, fügte er auf meinen fragenden Blick hinzu. »Rabanus Mutzinger, Apotheker.« Er machte eine kleine altmodische Verbeugung. »Wem habe ich meine Rettung zu verdanken?«
»Fabian Fajus, Bakkalaureus der Mathematik. Momentan in einer Schaffenskrise«, stellte ich mich ebenfalls vor. »Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause.«
»Danke, meine Apotheke liegt gleich an der Ecke.«
Mühlenapotheke, im Januar 19…
Die Mühlenapotheke an der Ecke der Rue du Boulanger ist die älteste Apotheke der Stadt. Sie wurde bereits 1649 gegründet, doch man sagt, die Tradition dieses Ortes reiche noch viel weiter zurück, bis weit vor die Zeit der Stadtgründung, als die Heilkundigen noch Kräuterweiblein und Hexen waren.
»Grandpère, wo bist du solange gewesen?«
»Das ist Via«, stellte mir der Apotheker das junge Mädchen vor, das an der Tür der Apotheke nach ihm Ausschau gehalten hatte. »Via, dieser junge Mann hat mich vor einem Spitzbuben beschützt, der mir mein beitele stehlen wollte, als ich nach meinem Schoppen in der Wistuwa heimkehren wollte. Bring uns erst mal einen Mirabellenschnaps. Den haben wir jetzt nötig!«
Mit einer einladenden Handbewegung wies der Alte auf ein paar bequeme, abgeschabte Ledersessel vorm Kamin. Via brachte Gläser samt einer hübsch geschliffenen Karaffe und hockte sich dann auf den Teppich neben dem Feuer. Während wir an dem aromatisch duftenden Schnaps nippten, begann der Alte mich auszufragen. Wo ich herkam, wo ich hin wollte, was ich im Leben tue …
»Es war eine spontane Idee«, gestand ich. »Eine Kateridee, könnte man sagen. Ich habe mich mit meiner Examensarbeit festgefahren und dachte, ein Ortswechsel täte mir gut. Dass ich hier gelandet bin, ist reiner Zufall.«
»Tatsächlich?« Ich meinte, um Vias Mundwinkel ein seltsames Lächeln spielen zu sehen, aber vielleicht war es auch nur der flackernde Schein des Feuers, der über ihr Gesicht glitt.
»Nun, was mich angeht, waren Sie jedenfalls zur rechten Zeit am rechten Ort!« meinte der Apotheker trocken. »Haben Sie Lust, mit uns zu Abend zu essen? Einfache Hausmannskost, Brot, Butter, Käse und Aufschnitt … Via wird einfach ein Gedeck mehr auflegen.«
Beim Abendessen erzählte mir der alte Mann die Geschichte seiner Apotheke, die seit Generationen im Familienbesitz war, und ich war erstaunt und erfreut, dass sich Via offenbar für meine Arbeit über die Topologie höherer Dimensionen interessierte, ein Thema, das den meisten Leuten nach kürzester Zeit ein glasiges Starren in die Augen treibt.
Der Abend endete damit, dass der Apotheker mich einlud, in die Mansarde des alten Hauses einzuziehen.
Mühlenapotheke, im Februar 19…
Ich habe das Angebot angenommen. Der alte Apotheker ist ein feiner Kerl. Und dann ist da ja auch noch Via …
»Via nennt mich zwar ›Großvater‹, aber sie ist nicht meine leibliche Enkelin«, meinte Rabanus auf meine Frage, während er den weißen Läufer vorzog. »Sie ist – mein Mündel, wenn man so will. Eines Tages stand sie plötzlich in der Apotheke. Und dann ist sie geblieben, hilft mir seitdem im Laden und bei der Zubereitung der Arzneien.«
Ich brachte meine Dame aus der Gefahrenzone und attackierte meinerseits seinen Turm. »Und woher kommt sie?«
»Über ihre Vergangenheit redet sie nicht.«
»Bist du denn gar nicht neugierig?«, wollte ich wissen.
Rabanus antwortete nicht sofort. Seine Augen, durch die dicken Brillengläser eulenhaft vergrößert, schienen durch mich hindurchzusehen. »Neugier, mein Sohn, Neugier ist ein Laster der Jugend. Ich bin zufrieden mit dem, was sie mir gibt. So habe ich wenigstens Gesellschaft. War recht einsam hier nach dem Tod meiner Miriam, Gott hab’ sie selig. Und so ein junges Gesicht bringt ein wenig Wärme in die alten Knochen …« Er schüttelte den Kopf. »Seit sie hier ist, scheint sie kaum einen Tag älter geworden zu sein. Es ist, als ob ihre Uhren anders gehen.«
Während sich Rabanus wieder in die Stellung vertiefte, hatte sich Via auf ihrem Lieblingsplatz neben dem Kamin niedergelassen und starrte so konzentriert ins Feuer, als könne sie im Spiel der Flammen lesen. So hatte ich Muße, ihr Profil zu studieren. Große braune Augen über hohen Jochbögen, eine zierliche Nase und ein kleiner Mund mit perlweißen, ziemlich spitzen Zähnen. Glattes, mahagonifarbenes Haar, das ihren Kopf wie eine Seidenkappe umschließt und ihre kleinen runden Ohrmuscheln freilässt, die hin und wieder zucken, als höre sie Dinge, die für andere unhörbar sind. Sie erinnert mich an ein Gesicht, das ich schon irgendwo einmal gesehen habe, an ein Gemälde …
Rabanus’ Stimme riss mich aus meiner Versunkenheit. »Du hast deine Deckung vernachlässigt, mein junger Freund. Schachmatt in drei Zügen.« Als er mein verdutztes Gesicht sah, kicherte er in sich hinein. »Junge Leute …«
Mühlenapotheke, im Februar 19…
Ich weiß inzwischen, an wen Via mich erinnert: an Vermeers rätselhafte Schöne mit dem Perlenohrring …
Manchmal, wenn ich eine Arbeitspause machte, redeten wir miteinander und sie schaut sich meine Bücher an. Sie hatte keine Ahnung von Mathematik, aber eine intuitive Freude an topologischen Darstellungen. Das Möbiusband und M. C. Eschers Ameisen, die auf dieser endlosen Schleife herumkrabbelten, faszinierten sie. Ihr Lieblingsbild war jedoch sein berühmter Wasserfall, der unablässig ein Mühlrad antreibt, dessen Wasser ihn speist. »Wenn du lange genug hinschaust, beginnst du dir noch einzubilden, das Wasser fließe tatsächlich bergauf«, neckte ich sie. Via schüttelte den Kopf. »Es ist die Zeit, die da fließt.«
Es klang wie eine simple Feststellung.
Säuwadala, im Februar 19…
Ich habe Via zum Abendessen in eine der schönsten Weinstuben der Stadt eingeladen ….
Via trug ein schlichtes rostrotes Leinenkleid, das wunderbar mit ihrem Haar harmonierte. Dazu hatte sie den Ohrring angelegt, den ich ihr geschenkt hatte. Sorgfältig studierte sie die Speisekarte des Säuwadala. »Ich nehme die Forelle in Riesling!«, entschied sie.
Während wir uns über unsere Vorspeisen – Flusskrebspastete für Via, hausgemachte Leberwurst für mich – hermachten, schaute ich mir die bunten Glasfenster der Weinstube an. »Ist das nicht dieselbe Mühle wie auf eurem Apothekenschild?«
Via folgte meinem Blick. »Ja, das ist die alte Otternmühle, ein Wahrzeichen der Stadt. Sie liegt ein Stück weiter die Ill hinunter.«
»Ein ungewöhnlicher Name …«
»Findest du? Wo es Wasser gibt und Fische, da hat es auch schon immer Fischotter gegeben. Ein Müller soll sogar einen zahmen Otter gehalten haben, der ihm beim Fischen half. – Ah, unser Hauptgang.«
Genießerisch sog sie den Duft ein, der von ihrem Teller aufstieg. Ihre Zunge fuhr über die Lippen, und in ihrem Mundwinkel erschien eine kleine Speichelblase. »Ich liebe Fisch!«, erklärte sie feierlich und widmete sich anschließend ihrer Forelle mit solcher Hingabe, dass ihr kaum Zeit zum Reden blieb. Fasziniert beobachtete ich, wie sie den Fisch in kürzester Zeit so sauber zerlegte und vertilgte, dass die Katze, die um unsere Füße strich, am Gerippe kaum noch ein Fitzelchen Muskelfleisch fand und sich beleidigt trollte.
Statt eines Desserts wählte Via einen kräftigen Münsterkäse, den wir mit dem Rest unseres Weins herunterspülten.
»Bist du wirklich satt? Nicht doch noch ein Dessert?«, erkundigte ich mich, nachdem sie sich schließlich zurückgelehnt hatte.
»So satt, dass ich mir vor dem Frühstück dringend Bewegung verschaffen sollte«, versicherte sie mir, während sie sich sichtlich zufrieden über ihren kleinen, wohlgerundeten Bauch strich.
Ich grinste. »Ich denke, du hasst frühes Aufstehen …«
Via lächelte ihr Sphinxlächeln und erhob sich: »Und spätes Zubettgehen. Naturen wie ich brauchen viel Schlaf.« Vor ihrem Zimmer verabschiedet sie sich mit einem Kuss auf die Wange. »Danke.«
Als ich nach meiner Schachpartie mit dem alten Rabanus in meine Mansarde hinaufstieg, stand ihre Zimmertür einen Spaltbreit auf. Ihr Bett war leer.
Beim Frühstück am nächsten Morgen war ihr Haar feucht. In ihrem Ohrring hatte sich etwas Grünliches verfangen. Ein Grashalm.
Vor dem Spiegel, im Februar 19…
Es war purer Zufall, dass ich Vias Geheimnis entdeckt habe. Ich hatte mich in das ruhige, zur Gartenseite gelegene Ankleidezimmer mit dem großen Spiegel gesetzt, um abends noch ein wenig zu arbeiten, und war im Ohrensessel eingeschlafen.
Das Knarren der Tür weckte mich aus wirren Träumen über Hyperräume und Zeitschleifen. Ich brauchte einen Augenblick, um mir klarzumachen, wo ich war. Die Nacht war hereingebrochen, und der Mond, der durchs Fenster schien, tauchte den Raum in unsicheres Licht.
Via trat ins Zimmer. Irgendetwas hinderte mich daran, mich zur rühren. Durch halb geschlossene Lider beobachtete ich, wie sie vor dem Spiegel ihr Nachtgewand abstreifte und dann ohne Zögern in die schimmernde Fläche eintauchte wie in einen Teich. Als ich mich herantastete, trafen meine Hände auf kühles Glas. Aber ich konnte hindurchsehen wie durch ein Fenster. Und ich sehe Via in ihrer wahren Gestalt …
Als sie zurückkehrt, graut schon der Morgen. Sie scheint nicht erstaunt, mich zu sehen, nennt es Fügung, dass wir uns getroffen haben. Aber erklären, was da geschieht, kann sie mir nicht. »Du bist derjenige, der immer verstehen will. Ich tue es einfach.« Sie schüttelt die letzten Wassertropfen von ihrer Haut und streicht ihr nasses Haar zurück. »Es ist für mich so normal wie atmen. Ich weiß nicht, woher diese Tore kommen oder wer sie gemacht hat. Vielleicht gibt es sie schon immer. Aber ich spüre sie wie …wie ein Zugvogel die Schwingungen des Magnetfelds spürt.«
Hinter dem Spiegel, im Februar 19…
Sie hat meinem Drängen endlich nachgegeben. Heute werde ich mit ihr durch den Spiegel gehen …
Kaum habe ich Vias Hand gepackt und bin mit ihr durch das Glas getreten, beginne ich mich zu verändern. Überall zieht und zerrt es, meine Haut kribbelt, dehnt sich hier, schrumpft dort … Voller Staunen betrachte ich meinen neuen Körper, das rostfarbene Fell, den langen kräftigen Schwanz, die Pfoten mit den Schwimmhäuten zwischen den Fingern.
»Na, wie gefällst du dir?« Neben mir hockt die hübscheste Otterfähe, die man sich vorstellen kann. Ihr rotgoldenes Fell mit der eleganten weißen Blesse an der Kehle glänzt im Mondlicht, und in ihren großen, dunklen Augen sprühen Glühwürmchen. »Komm, ins Wasser. Lass uns Fische fangen.« Sie rutscht mehr, als dass sie läuft, die Böschung hinunter und gleitet ins Wasser. Ich folge ihr. Das Wasser ist im ersten Augenblick eisig an Pfoten und Schnauze, doch mein dichter, gefütterter Pelz wärmte mich. Etwas ungelenk zunächst, doch dann immer sicherer bewege ich mich in der trägen Strömung der Ill, erkunde schnuppernd die neue Welt, die sich mir auftut, sauge den Geruch von Wasserpflanzen und Wurzeln, Erde und nassen Stein ein. Und von Fisch, köstlichem Fisch.
Mit einem raschen Schwanzschlag steht Via über der Forelle, die sich an einen ruhigen Platz unter der Uferböschung zurückgezogen hat. Ein Zappeln, ein rasches Aufblitzen kleiner scharfer Zähne, dann hält sie den kopflosen, noch zuckenden Fisch in den Pfoten. Zwei Happen, und er ist verschwunden. »So muss frischer Fisch schmecken!« Ihre Schnurrhaare zittern, die pelzigen Ohren zucken, und in ihren Augen funkelt die Aufregung der Jagd. »Und jetzt du!« Ihr schlanker Leib streicht an mir vorbei, ist bald über, bald unter mir, lockt mich, ermutigt mich, feuert mich an, während sie mir die Fische zutreibt, die aufgeschreckt aus ihren Verstecken fliehen. Doch als ich ihren wunderbar sämigen Moschusgeruch in die Nüstern bekomme, vergesse ich die Fische, und auch sie scheint jetzt anderes im Sinn zu haben. Unsere Körper gleiten immer dichter aneinander vorbei. Wir umschlingen uns, drehen uns, Schnauze an Schnauze, umeinander wie Kreisel, maunzen und miauen und flüstern uns Liebkosungen ins Ohr, bis ich sie schließlich mit festem Biss am Nackenfell packe und wir uns in einem Wirbel aus Schaum und Lust vereinen …
Hinter dem Spiegel, im März 19…
Ich lebe wie in einem Rausch. Tagsüber arbeite ich an meiner Examensarbeit, nachts gehen wir auf Jagd …
… Heute habe ich meinen ersten Wels erbeutet, einen modrig riechenden, alten Kerl, der sich gewehrt hat wie der Teufel. Via ist sehr stolz auf mich. Sein Fleisch hat schon ein wenig Hautgout, aber wir haben ihn schmatzend und schlürfend samt Herz und Hirn bis auf die letzte Gräte verputzt; nur seine ledrigen Barteln haben wir verschmäht. Die hat sich eine Füchsin geholt, die auf leisen Pfoten durch die Ufervegetation geschnürt kam.
… Langsam gewöhne ich mich auch an die Geräusche der Nacht, die so ganz anders sind als die meiner Tage. Das Gurgeln und Glucksen des Flusses, das wie eine leise geführte Unterhaltung klingt, das Kollern der Steine, die von der Strömung über den Flussboden gerollt werden, das Wispern der Weiden im Wind. Ein springender Fisch, der mit einem Platscher ins Wasser zurückfällt. Und inzwischen kenne ich auch das lang gezogene »Huhuhu« des Uhus, der auf lautlosen Schwingen über uns hinwegzieht. Und manchmal meine ich aus der Ferne eine Kirchenglocke zu hören, die die Stunde schlägt.
… In dieser Nacht sind wir durch ein Loch im Zaun in einen Stall eingedrungen. Die aufgeschreckten Hühner machen einen derartigen Höllenlärm, während wir dem einen oder anderen Vogel die Kehle durchbeißen, dass wir in diesem Gewirr von Federn, Gackern, Kreischen und kopflos herumjagenden Hühnern schließlich selbst in Rage geraten und immer wütender um uns schnappen. Erst als endlich Ruhe herrscht, kommen wir wieder zur Besinnung. Wir zupfen nur ein wenig Brustfleisch von den Kadavern, bevor wir uns erschöpft zum Fluss aufmachen, um uns Blut und Hühnerkot aus dem Fell zu waschen. Aber wir jagen nicht jede Nacht. Manchmal spielen wir auch nur, rutschen im Mondlicht die Böschung hinunter, tauchen nach den glatten Flusskieseln, vergnügen uns mit aufperlenden Luftblasen und lieben uns, während uns der alte Weidenmann von seinem Hochsitz aus bernsteinfarbenen Eulenaugen unverwandt anstarrt.
Hinter dem Spiegel, im März 19…
Via hat mich die Liebe gelehrt. Heute hat sie mir den Tod gezeigt.
Wir planschen in einem seichten, schlammigen Tümpel und amüsieren uns damit, Kaulquappen zu jagen, aber meine Gefährtin scheint abgelenkt. Sie richtet sie sich auf den Hinterbeinen auf und sichert. »He, pass auf! Du lässt sie dir durch die Pfoten schlüpfen!«
»Sei still!« Ihre Nüstern blähten sich, und sie saugt prüfend die Witterung ein. »Hörst du sie nicht? Riechst du nicht ihr stinkendes Fell? Diesmal sind wir nicht die Jäger, mein Freund, sondern die Gejagten …« Ich spitze die Ohren und lausche. In der Ferne meine ich heiseres Gebell zu vernehmen. Und es kommt offenbar näher. Meine Eingeweide ziehen sich unangenehm zusammen. »Das muss eine ganze Meute sein.«
Meine Gefährtin scheint dennoch nicht sonderlich beunruhigt. »Diese Kläffer machen mir keine Angst. In dieser Pfütze ziehen sie uns im Handumdrehen das Fell über die Ohren. Aber in tiefem Wasser haben wir nichts vor ihnen zu fürchten. Rasch hinunter zum Fluss.«
Laufend, rutschend und gleitend, wie sich Ottern an Land fortbewegen, eilen wir in Richtung Fluss. Aber Wassertiere wie wir sind nicht für den Langstreckenlauf gebaut. Bald fangen wir an zu keuchen und die Seiten beginnen zu stechen, doch unser Vorsprung sinkt. Das Gebell der Meute kommt immer näher. »Da vorn ist der Fluss!«, feuert meine Gefährtin mich atemlos an. »Dort sind wir in Sicherheit. Diese Bastarde haben doch Angst, sich das Fell nasszumachen.«
Die letzten Meter schlittern wir mehr über den feuchten Schlamm, als dass wir laufen. Der Köter, der in Führung liegt, ist jetzt so nah, dass ich seinen stinkenden Atem im Nacken zu spüren meine. Aber da ist das Ufer. Via stürzte sich mit einem gewaltigen Satz ins Wasser, während ich einen Purzelbaum schlagen, der meinen Schwanz gerade noch rechtzeitig außer Reichweite der zuschnappenden Zähne bringt. Wir halten stracks auf die kleine Insel in der Mitte des Flusses zu und erklimmen die Böschung. Via richtet sich auf den Hinterbeinen auf und äugt hinüber. Am Ufer machen rund ein Dutzend Straßenköter jaulend und bellend ihrer Enttäuschung Luft. Einige wagen sich ein paar Schritte ins Wasser, das an dieser Stelle etwa fünfzig Körperlängen breit ist und rechts schnell strömt, ziehen dann aber rasch den Schwanz ein und kehrten ans sichere Ufer zurück. Via richtet sich noch ein wenig höher auf und bleckt ihre kleinen scharfen Zähne. Dann überschüttet sie unsere Verfolger mit einer Flut obszöner Formulierungen, wie es nur eine erboste Otterfähe kann, keckert ihnen Schmähungen zu, die kein gutes Haar an der Männlichkeit sämtlicher Rüden und der Tugend ihrer weiblichen Verwandtschaft lassen.
Die Hunde antworten mit empörtem Gebell, doch plötzlich verstummen sie, und die Meute teilt sich, um eine Gasse zu bilden. Via reckt sich auf die Zehenspitzen.
Gegen den monderleuchteten Nachthimmel zeichnet sich die Silhouette des Neuankömmlings ab. Ein Rüde mit breitem Kopf und dichtem, zottigem Fell, nicht ganz so groß wie eine Dogge, aber stämmig gebaut. Er hebt die Schnauze und wittert, macht ein paar Schritte auf das Ufer zu und wittert erneut. Aus seiner Kehle dringt ein tiefes Grollen. Dann legt er den Kopf in den Nacken und heult, ein Geheul so voller Wut und Triumph, dass es durch Mark und Bein geht. Unwillkürlich sträuben sich meine Schulterhaare. »Sollen wir uns nicht lieber davonmachen? Der Kerl macht mir irgendwie Angst. Komm, lass uns abtauchen …«
Via hat sich wieder auf alle viere niedergelassen, sodass wir vom Ufer nicht mehr zu sehen sind. Alle Tollerei ist aus ihrem Verhalten gewichen. »Das wird uns nichts nützen. Das ist ein Wasserhund, eine uralte Rasse, gezüchtet zur Otternjagd. Er ist der Jäger, und er verliert nie eine Spur.«
Der große Hund ist langsam ins Wasser gewatet, das ihm nun bis zum Bauch reicht. Die Kälte scheint er nicht zu spüren. Noch einmal prüft er den Wind, dann stößt er sich vom Boden ab und hält mit stetigen, kräftigen Kraulbewegungen auf die Insel zu.
Vias Augen huschen hin und her, und ich sehe förmlich die Gedanken in ihrem Kopf wirbeln. »Ich hätte dich niemals mitnehmen dürfen … aber du musst mir jetzt vertrauen. Er weiß nicht, dass wir zu zweit sind. Etwa eine halbe Meile flussabwärts liegt die alte Otternmühle. Halt darauf zu! Ab ins Wasser.«
»Und dann?« Ich beobachtete die schwarze Silhouette, die grimmig auf uns zuhält, angefeuert vom wütenden Gebell der Meute am Ufer. Ich glaube, ich habe noch nie im Leben so viel Angst gehabt.
»Und dann, mein Freund, schwimmst du um dein Leben. Und um meins. Denn der Tod schert sich nicht um Dimensionen.« Sie gibt mir einen aufmunternden Stups mit der Schnauze, und ich gleite in den Fluss.
Meine Flucht bleibt nicht unbemerkt. Das Johlen der Hunde am Ufer nimmt zu, und die ganze Meute rast flussabwärts.
Hinter mir höre ich ein dunkles Blaffen. Der Jäger hat mich entdeckt und nimmt meine Spur auf. Ich schwimme, wie ich noch nie geschwommen bin, aber der Jäger kommt mir mit seinen raumgreifenden Bewegungen unerbittlich näher. Ich keuche, meine Lungen schmerzen bei jedem Atemzug, und ich fühle, wie meine Kräfte schwinden. In der Ferne höre ich ein Klappern, das immer stärker wird. Das Mühlrad!
Ich tauche ganz plötzlich ab. Vielleicht gelingt es mir, den Jäger abzuschütteln, vielleicht verliert er meine Spur. An eine Wurzel gekrallt, verharre ich, bis mir schließlich die Luft ausgeht und ich auftauchen muss. Und erstarre. Direkt vor mir wartet der Jäger. Ich hatte ihn keinen Augenblick täuschen können. Er macht einen Ausfall, schnappt nach mir, lässt mich ein Stück weit entkommen, um mich dann wieder einzuholen – der Jäger spielt mit mir wie die Katze mit einer Maus. Wenn er sein Vergnügen lange genug ausgekostet hat, wird er mich am Nackenfell packen und tot schütteln, das weiß ich. Dennoch klammere ich mich an meinen Lebensfunken, halte verbissen auf die Mühle zu.
Und dann sehe ich an seinen Augen, dass er dem Spiel ein Ende machen will. Der Tod ist nur noch einen einzigen Atemzug entfernt.
Ein schrilles, ohrenbetäubendes Kreischen, ein Schatten, ein schmerzliches Aufjaulen. Meine Gefährtin hat den Jäger eingeholt, während er mit mir gespielt hat, hat sich in seiner Schnauze verbissen. Der Jäger lässt von mir ab. Blut spritzt aus seinen Lefzen, er schüttelt heftig den Kopf, um den Quälgeist fortzuschleudern. Via fliegt in hohem Bogen durch die Luft, landet im Strudel, der uns mit sich reißt. Das Mühlrad ist jetzt ganz nahe, wir können das Tosen des Stauwehrs hören, auf das wir zutreiben. Der Strudel wirbelt uns herum, Jäger und Gejagte drehen sich im Kreis, suchen Atem zu holen. Das riesige Schaufelrad kommt auf uns zu, droht uns zu zermalmen. »Festhalten!« kommandiert meine Gefährtin atemlos. »Jetzt!« Ich klammere mich mit aller Kraft an die Schaufel, lasse mich unter das Rad ziehen, tiefer und immer tiefer, bis ich meine, mein Kopf werde bersten, meine Lungen platzen. Endlich wird es heller über mir, das große Rad taucht auf, hebt uns hoch in die Luft und schleudert uns durch das Tor. Irgendwo hinter uns heult der Jäger schaurig um seine verlorene Beute.
Vor dem Spiegel, im März 19…
Ich habe sie angefleht zu bleiben. Aber sie hat sich nicht umstimmen lassen. Ich habe noch immer ihre Abschiedsworte im Ohr …
»Du bist ein Mann, der geträumt hat, ein Otter zu sein. Ich bin eine Otterin, die geträumt hat, eine Frau zu sein. Unsere Sphären haben sich ineinander verwoben, nun trennen sie sich wieder. Es ist Zeit, dass ich gehe.« Ihre Schnurrhaare berühren meine Wange, und ihre Zunge, rau und ein wenig nach Fisch riechend, gleitet über meine Lippen. »Leb wohl!«
Ich schlinge meine Arme fest um ihren Leib, versuche sie zu halten. »Bleib!«
Sie entwindet sich mir ohne Mühe, ihre Augen stieben goldene Funken. »Ich bin Viatrix, die Reisende!« Sie lächelt mir zu, während sie in den Spiegel eintaucht. Dann wird ihre Silhouette schwächer und schwächer, bis nur noch ihr Lächeln in der Luft hängt, einen Augenblick verharrt und schließlich ebenfalls verschwindet.
Hier bricht das Tagebuch ab, es folgt lediglich ein letzter Eintrag.
Mulhouse, im März 20 …
All das ist vor nunmehr fast fünfzig Jahren geschehen. Die Mathematik ist meine Freundin geblieben, aber ich habe sie nicht zu meinem Beruf gemacht. Ein Jahr nach Vias Verschwinden starb der alte Rabanus, und ich habe die Mühlenapotheke übernommen, führe sie, so gut ich kann, und sorge dafür, dass der Spiegel immer klar bleibt. Oft mache ich lange Spaziergänge an der Ill, setze mich vor der Mühle auf eine Bank und schaue dem Mühlrad beim Drehen und dem Fluss beim Fließen zu. Seit einiger Zeit sollen an einem Seitenarm des Ill seltsame Trittspuren gefunden werden, heißt es … ich werde jedenfalls da sein, wenn Viatrix, die Reisende, mich sucht.
Ich klappte den schmalen Band zu, stand auf und trat ans Fenster. Draußen war inzwischen der Mond aufgegangen und tauchte Bach und Bäume des Otterngeheges in milchiges Licht. »Wirklich eine seltsame Geschichte.«
Mein Freund war neben mich getreten.
»Nicht wahr?«
Er schenkte uns nach und hob sein Glas. »Auf die Reisende, wohin auch immer ihre Reise sie führt!«
»Auf die Reisende!« wiederholte ich, und wir leerten unsere Gläser.
»Land der Verheißung«, Phantastischer Oberrhein II, Hrsg. Jörg Weigand, Schillinger Verlag, Freiburg im Breisgau 2010
Eine Kriegsgeschichte zu schreiben, war thematisch wirklich eine Herausforderung für mich. Glücklicherweise hatte ich kurz zuvor ein Buch über Fehlentscheidungen übersetzt, in dem auch ein militärisches Memorandum über einen folgenschweren Irrtum zitiert wurde.
Eine Verkettung unglücklicher Umstände
»Was, noch mehr Papier?« General Dillon überflog die dekodierte Mitteilung, die ihm sein Untergebener reichte, während seine Finger ein Stakkato auf der Tischplatte trommelten. »Japanische Diplomaten sollen Anweisung bekommen haben, ihre geheimen Unterlagen zu vernichten, heißt es in dieser Nachricht, die unsere Jungs abgefangen haben. Wahrscheinlich wieder so eine Scheißhausparole. Und das FBI hat ein Telefonat mitgeschnitten, in dem der Koch des japanischen Konsulats auf Hawaii einem Kumpel in Honolulu erzählt hat, im Konsulat würden Akten verbrannt.« Er schüttelte den Kopf. »Was soll man dazu sagen? Jetzt kommen die uns auch noch mit Küchengewäsch! Legen Sie’s auf den Stapel zu den anderen. Hat auf jeden Fall bis Montag Zeit.« Er warf einen Blick auf die Uhr. »Verflucht, bin spät dran. Shorty erwartet mich zum Dinner.« General Walter C. Short, der Oberkommandierende des Heeresbezirks Hawaii, war bekannt für seinen Pünktlichkeitsfimmel. »Sie haben heute Abend Dienst, nicht wahr, Forty?«
Der Angesprochene nickte. »Yes, Sir, bis Sonntagfrüh. Dann löst mich Gillam ab!«
»In Ordnung.« Der General zog die Uniformjacke glatt, beäugte sich kritisch im Spiegel der Fensterscheibe und nickte. Offensichtlich war er mit seinem Aussehen zufrieden. Er wies auf das Funkgerät. »Na, wünsche eine ruhige Nacht. Bis Montag!«
»Danke, Sir!« Beide salutierten, dann wandte sich der General zum Gehen. In der Tür drehte er sich nochmals um. »Wenn Sie sich langweilen, können Sie den Stapel ja schon mal vorsortieren.«
»Yes, Sir!« Intelligence Officer John P. Fortunato wartete in Habtachtstellung, bis sich die Tür geschlossen hatte, bevor er eine Grimasse zog. Scheißnachtdienst, er hätte etwas Besseres mit diesem Abend anzufangen gewusst. ›Aber was soll’s!‹, dachte er. ›Muss die Kleine eben warten. Machen wir’s uns so bequem wie möglich!‹ Er musterte die Privatvorräte des Generals mit Kennerblick und entschied sich schließlich für einen alten Sherry. Das Glas in der Hand, ließ er sich in dem Sessel am Schreibtisch des Generals fallen und streckte die Beine aus. Auch wenn der General ein Bonvivant war und seinen Posten eher seinem Umgang mit Messer und Gabel als überragenden militärischen Talenten zu verdanken hatte, war ein Befehl ein Befehl. Lustlos zog Fortunato den Papierstapel heran und begann die Flut von Memos, dekodierten Funksprüche und abgehörten Nachrichten vor sich auszubreiten. Was für ein Durcheinander! Nicht mal nach Datum waren sie sortiert. Er beugte sich vor und machte sich an die Arbeit.
Irgendwann stand er auf, um sich die Beine ein wenig zu vertreten. Da war etwas, das er noch nicht so recht greifen konnte, aber es erfüllte ihn mit einem vagen Gefühl der Unruhe. Ein Blick auf die Wanduhr verriet ihm, dass es bereits fast neun war. Vielleicht hatte er einfach Hunger. Aber keine Lust auf den üblichen Kasinofraß. Wenn sich der Alte schon einen einheimischen Koch leistete … er öffnete die Tür. »Kalahoe! Wo steckst du, alter Kanake?«
Leichte Schritte näherten sich, und ein schmächtig gebauter, dunkelhaariger Mann in weißer Schürze blieb im Türrahmen stehen. »Sir?«, fragt er, während er sich die Hände an der Schürze abtrocknete.
»Komm rein! Der Alte hat mir ‘ne Nachtschicht aufgebrummt, und Hamburger mit Fritten hängen mir zum Hals raus. Mach’ mir doch eine von deinen berühmten Fischplatten!«
Der Angesprochene sah sein Gegenüber einen Moment schweigend an, als müsse er das Für und Wider dieses Ansinnens sorgsam abwägen. Wie kann ein derartiger Hänfling, ein solches Pfannkuchengesicht nur eine so hübsche Frau haben, wunderte sich Fortunato nicht zum ersten Mal. »Ich wollte eigentlich gerade gehen«, meinte sein Gegenüber schließlich.
»Ach was!« Fortunato legte dem Koch den Arm um die Schulter und grinste ihn vertraulich an. »Das kannst du doch für mich tun. Wir sind doch Freunde, nicht wahr?« Dabei stopfte er ihm eine halb volle Packung Zigaretten in die Brusttasche.