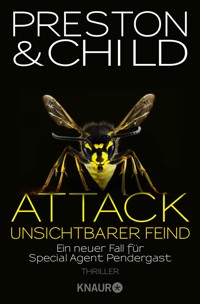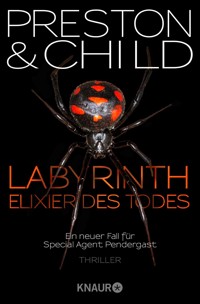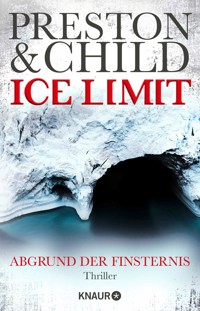
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Gideon Crew
- Sprache: Deutsch
Wissenschaft - Action - Horror: ein mitreißender Science-fiction-Thriller von Amerikas Meisterduo Preston & Child Bei einer Expedition in die Antarktis ging vor sechs Jahren ein riesiger Meteorit über Bord. Noch immer liegt er dort in eisiger See auf dem Meeresgrund. Eli Glinn, der Chef von Effective Engineering Solutions (EES), drängt auf eine schnelle Lösung. Er möchte damit nicht zuletzt seine Schuld an der Havarie damals begleichen, bei der über hundert Menschen ums Leben kamen und er selbst schwer verletzt wurde. Die Zeit drängt: Das Objekt hat sich inzwischen als Alien-Lebensform entpuppt, als Samenkapsel, aus der ein riesenhaftes Gewächs mit Fangarmen geworden ist, das offenbar eine Invasion der Erde im Sinn hat. Um das zu verhindern, rüstet Glinn eine Expedition an die Eisgrenze aus. An Bord des hypermodernen Forschungsschiffs "Batavia" ist auch Agent Gideon Crew. Als Nuklearexperte soll er die Vernichtung des Aliens ins Werk setzen, das mit einer unterseeischen Atombombe getötet werden soll. Ein hoch riskanter Plan ... "Eine absolute Tour de force." David Baldacci
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
ICE LIMIT Abgrund der Finsternis
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Michael Benthack
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Bei einer Expedition in die Antarktis ging vor sechs Jahren ein riesiger Meteorit über Bord. Noch immer liegt er dort in eisiger See auf dem Meeresgrund. Eli Glinn, der Chef von Effective Engineering Solutions (EES), drängt auf eine schnelle Lösung. Er möchte damit nicht zuletzt seine Schuld an der Havarie damals begleichen, bei der über hundert Menschen ums Leben kamen und er selbst schwer verletzt wurde. Die Zeit drängt: Das Objekt hat sich inzwischen als Alien-Lebensform entpuppt, als Samenkapsel, aus der ein riesenhaftes Gewächs mit Fangarmen geworden ist, das offenbar eine Invasion der Erde im Sinn hat. Um das zu verhindern, rüstet Glinn eine Expedition an die Eisgrenze aus. An Bord des hypermodernen Forschungsschiffs Batavia ist auch Agent Gideon Crew. Als Nuklearexperte soll er die Vernichtung des Aliens ins Werk setzen, das mit einer unterseeischen Atombombe getötet werden soll. Ein hoch riskanter Plan!
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
Epilog
Anmerkung für unsere Leser
Über die Autoren
Die Romane
Für Jamie Raab
1
Gideon Crew sah Eli Glinn ungläubig an. Der Mann stand – stand! – in der Küche von Gideons Hütte hoch oben in den Jemez Mountains und musterte ihn mit seinen sanften, grauen Augen. Glinns Geländerollstuhl – der, in dem er immerzu gesessen hatte, seit Gideon ihn vor mehreren Monaten kennengelernt hatte – stand ungenutzt da, nachdem er zu Gideons großem Erstaunen vor einigen Minuten daraus aufgestanden war.
Glinn deutete auf den Rollstuhl. »Entschuldigen Sie bitte das kleine Drama. Ich habe es jedoch aus gutem Grund inszeniert: um Ihnen zu beweisen, dass unsere Mission zur Verlorenen Insel trotz gewisser bedauerlicher Aspekte nicht vergebens war. Ganz im Gegenteil. Ich bin der lebende Beweis für ihren Erfolg.«
Es folgte eine Stille. Sie zog sich hin, eine Minute, zwei Minuten. Schließlich ging Gideon zum Herd, griff nach der Bratpfanne, in der die Wildentenbrust in einer Ingwer-Trüffel-Reduktion lag, die er kurz zuvor mit äußerster Sorgfalt zubereitet hatte, und warf sie in den Abfalleimer.
Wortlos wandte sich Glinn um und ging ein wenig unsicher zur Tür der Hütte, wobei er sich auf einen Wanderstock stützte. Manuel Garza, der Leiter der Einsatzabteilung von Glinns Firma Effective Engineering Solutions, bot ihm an, ihm in den Rollstuhl zu helfen, aber Glinn winkte ab.
Gideon sah den beiden Männern hinterher, wie sie die Hütte verließen – Garza schob den leeren Rollstuhl –, während ihm das, was Glinn einige Minuten zuvor gesagt hatte, wieder in den Sinn kam. Das Ding wächst wieder. Wir müssen es vernichten. Wir müssen sofort handeln.
Gideon griff nach seinem Mantel und ging ebenfalls nach draußen. Der Hubschrauber, der die EES-Leute an diesen abgelegenen Ort gebracht hatte, stand mit laufendem Motor vor der Hütte. Die Rotoren zwitscherten, die Abwinde fegten über das Wiesengras.
Gideon stieg nach Glinn in den Hubschrauber, setzte sich, schnallte sich an und setzte ein Headset auf. Der Helikopter stieg empor in den blauen Himmel über New Mexico und flog Richtung Südwesten. Gideon sah seine Hütte immer kleiner werden, bis sie nichts weiter war als ein kleiner Punkt auf einer Wiese in einem weiten Gebirgskessel. Plötzlich beschlich ihn das merkwürdige Gefühl, dass er sie nie mehr wiedersehen würde.
Er wandte sich zu Glinn um und sagte schließlich: »Sie können also wieder gehen. Und Ihr verletztes Auge … können Sie damit wieder sehen?«
»Ja.« Glinn hob die rechte Hand, ehemals eine gekrümmte Klaue, und beugte langsam die Finger. »Meine Finger werden täglich beweglicher. Wie auch meine Fähigkeit, ohne fremde Hilfe zu gehen, langsam zurückkehrt. Dank der Heilkräfte der Pflanze, die wir auf der Insel entdeckt haben, kann ich nun mein Lebenswerk vollenden.«
Gideon musste gar nicht nach der Pflanze fragen. Auch nicht nach Glinns »Lebenswerk«. Er kannte schon die Antworten auf beide Fragen.
»Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir besitzen das Geld, wir haben das Schiff, und wir verfügen über das Equipment.«
Gideon nickte.
»Aber bevor wir Sie zur EES-Zentrale zurückbringen, müssen wir noch einen kleinen Abstecher machen. Es gibt da etwas, das Sie sehen müssen. Allerdings bedauere ich, sagen zu müssen, dass der Anblick nicht ganz angenehm sein wird.«
»Worum geht’s dabei?«
»Dazu möchte ich mich lieber nicht weiter äußern.«
Typisch Glinn, wieder einmal gab er sich undurchschaubar, rätselhaft. Ein wenig verärgert lehnte sich Gideon zurück. Nach einem kurzen Blick auf Garza war ihm klar, dass der sich genauso wenig entlocken lassen würde wie sein Chef.
»Könnten Sie mir dann zumindest mitteilen, wohin die Reise geht?«
»Gerne. In Santa Fe werden wir den EES-Jet besteigen und nach San Jose fliegen. Von dort geht’s im Privatwagen in die Berge oberhalb von Santa Cruz, wo wir einem Mann, der dort wohnt, einen Besuch abstatten werden.«
»Klingt rätselhaft.«
»Ich habe nicht die Absicht, rätselhaft zu sein.«
»Sind Sie aber.«
Ein leises, sehr leises Lächeln. »Sie kennen mich zu gut. Aber dann wissen Sie ja auch, dass alles, was ich tue, Hand und Fuß hat.«
Der Hubschrauber ließ die Berge hinter sich. Gideon sah das schimmernde Band des Rio Grande, der sich tief unter ihnen durch den White Rock Canyon schlängelte, und dahinter die Hügellandschaft der Caja del Rio. Links von ihm erstreckte sich Santa Fe. Während sie über den Südteil der Stadt flogen, kam der Flughafen in Sicht.
»Was Sie da eben über Ihr finales Projekt gesagt haben«, begann Gideon. »Sie erwähnten einen Alien. Einen Samen. Sie sagten, er bedrohe die Erde. Das klingt alles ziemlich vage. Wie wär’s, wenn Sie mich einweihen und mir als Erstes mitteilen, warum genau Sie meine Hilfe brauchen?«
»Alles zu seiner Zeit«, sagte Glinn. »Nach unserem kleinen Ausflug nach Santa Cruz.«
2
Auf dem Flughafen in San Jose wurden sie von einem Lincoln Navigator abgeholt, den ein kleinwüchsiger Mann mit grüner Kappe chauffierte. Von dort fuhren sie auf der Route 17 nach Süden, in eine von Redwood-Bäumen bewachsene Hügellandschaft. Es war eine wunderschöne Fahrt durch verwunschene Wälder voller Baumriesen. Glinn und Garza sprachen kein Wort. Gideon spürte, dass ihnen unbehaglich zumute war.
Tief im Redwood-Wald bog der Wagen von der Schnellstraße ab und fuhr auf kurvenreichen Straßen durch eine Reihe von Tälern, vorbei an kleinen Farmen und Ranches, abgelegenen Dörfern, schäbigen Wohnwagen und heruntergekommenen Hütten, an kleinen Wäldchen mit Redwood-Bäumen, an Wiesen und plätschernden Bächen. Schließlich wich die schmale, von Rissen durchzogene Asphaltstraße einer mit Kies bestreuten Auffahrt. Es dämmerte, dunkle Wolken zogen auf und tauchten die Landschaft in schattiges Dunkel.
»Ich glaube, wir sind da eben am Bates Motel vorbeigekommen«, sagte Gideon und lachte nervös. Außer ihm fand das keiner witzig. Die nervöse Unruhe, die im Wagen herrschte, hatte seinem Gefühl nach zugenommen.
Die mit Kies bestreute Straße führte in einen weiteren Redwood-Wald, fast unmittelbar dahinter gelangten sie vor ein großes gusseisernes Tor in einer hohen Steinmauer. Auf einer hölzernen Plakette, einst mit eleganten Lettern beschriftet und gerahmt, inzwischen jedoch ziemlich verwittert, stand:
DEARBORNE PARK
Darunter hatte man ein hässliches, zweckmäßiges Schild angeschraubt.
PRIVATEIGENTUM
WIDERRECHTLICHES BETRETEN
WIRD MIT ÄUSSERSTER HÄRTE DES GESETZES STRAFRECHTLICH VERFOLGT
Während sie näher kamen, öffnete sich das Tor automatisch. Sie fuhren hindurch, der Wagen blieb neben einem kleinen Torhaus stehen. Der Chauffeur mit der grünen Kappe ließ sein Fenster herunter und sprach mit einem Mann, der aus dem Torhaus getreten war. Prompt winkte der ihn durch. Die Straße, die kurvenreich zwischen düsteren Redwoods hindurchführte, stieg an. Es fing an zu regnen, dicke Tropfen pladderten auf die Windschutzscheibe.
Inzwischen herrschte im Auto eine bedrückende Atmosphäre. Der Fahrer schaltete die Scheibenwischer an, in monotonem Rhythmus schlugen sie hin und her, hin und her.
Als der Geländewagen bis zum Bergrücken hinaufgefahren war, wichen die Redwoods plötzlich einer mehrere Hektar großen, hoch gelegenen Wiese. Durch den strömenden Regen glaubte Gideon, in der Ferne den Pazifischen Ozean zu erkennen. Am gegenüberliegenden Ende der Wiese erhob sich eine hoch gelegene Rasenfläche, an deren Ende ein Herrenhaus aus grauem Kalkstein stand, erbaut im Stil der Neugotik, an der Fassade lief das Wasser hinunter. Vier hoch aufragende, an Zinnen erinnernde Türme rahmten eine große Halle, deren gotische Spitzbogenfenster im Dämmerlicht des Unwetters gelblich schimmerten.
Der Wagen näherte sich dem Herrenhaus auf einer gewundenen Zufahrt, die Räder knirschten auf dem Kies. Der Wind frischte auf und peitschte gegen die Windschutzscheibe. In der Ferne blitzte es, kurz darauf hörte Gideon den zeitversetzten Donner.
Er verkniff sich eine Witzelei über die Addams Family, als der Fahrer unter einem von Säulen gerahmten, überdachten Portal anhielt. Unten an der Treppe zum Haus stand wartend ein rothaariger Hausdiener in weißer Jacke, die kräftigen Arme verschränkt. Sie stiegen aus, doch der Diener kam ihnen nicht entgegen, um sie zu begrüßen, sondern machte lediglich eine brüske Handbewegung, dass sie ihm folgen sollten, dann drehte er sich um und ging die steinerne Treppe wieder hoch. Sie betraten hinter ihm die Eingangshalle. Sie war spärlich möbliert, fast leer, so dass ihre Schritte in dem großen Raum laut hallten. Dröhnend fiel die Tür hinter ihnen zu wie von unsichtbarer Hand geschlossen.
Der Diener wandte sich nach rechts, schritt durch eine Tür mit Spitzbogen, dann weiter über einen langen Flur und in einen Wohnraum. Am gegenüberliegenden Ende befand sich eine geschnitzte Eichentür, an die der Diener klopfte. Eine Stimme rief: »Herein.«
Es war ein kleines, behagliches Büro. Hinter dem Schreibtisch stand ein grauhaariger Mann auf, mit breitflächigem, freundlichem Gesicht und gekleidet in ein Tweedjackett mit Lederflicken an den Ellbogen. An allen Wänden standen Bücherregale. In die gegenüberliegende Wand war ein Kamin eingelassen, die Scheite loderten.
»Herzlich willkommen, Mr. Glinn«, sagte der Mann, trat um den Schreibtisch herum und streckte die Hand aus. »Mr. Garza.« Sie schüttelten einander die Hand.
»Und Sie müssen Dr. Crew sein. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Hassenpflug. Bitte setzen Sie sich doch.« Dies unterstrich er mit einer Geste zu den Stühlen, auf denen sie Platz nehmen sollten und die gemütlich um den Kamin gruppiert standen. Die angenehme Wärme des Kaminfeuers stand in deutlichem Kontrast zum Unbehagen, das Garza und Glinn ausstrahlten.
Ein kurzes Schweigen folgte. Schließlich brach Dr. Hassenpflug das Eis. »Ich kann mir denken, dass Sie gern erfahren möchten, wie es dem Patienten geht. Leider habe ich keine guten Nachrichten.«
Garza legte die Hände zusammen und beugte sich vor. »Vielen Dank für die Auskunft, aber wir sind nicht gekommen, um etwas über den Zustand des Patienten zu erfahren. Wie wir besprochen haben, geht es uns nur darum, ihn zu treffen. Seine gesundheitliche Zukunft interessiert uns nicht.«
Hassenpflug setzte sich zurück. »Verstehe, aber vielleicht wäre es angebracht gewesen, den Patienten vorab zu informieren –«
»Ich fürchte, jede Art von Vorabinformation wäre unangemessen«, sagte Glinn.
Der Arzt verstummte, ein finsterer Ausdruck huschte über seine Gesichtszüge. Sein freundliches Gebaren war unter dem Einfluss von Glinns knappem, unfreundlichem Tonfall verschwunden. »Nun gut.« Er wandte sich zu dem Krankenwärter um, der, die Hände vor der weißen Jacke gefaltet, hinter ihnen gestanden hatte. »Ronald, ist der Patient bereit, Besuch zu empfangen?«
»So bereit, wie er je sein wird, Dr. Hassenpflug.«
»Bitte begleiten Sie die Herren in sein Zimmer. Sie und Morris bleiben aber ganz in der Nähe.« Hassenpflug wandte sich wieder an Glinn. »Sollte sich der Patient erregen, müssen wir Ihren Besuch eventuell abbrechen. Ronald und Morris werden darüber befinden.«
»Verstehe.«
Sie durchquerten den Salon und die weitläufige Eingangshalle, gingen wieder durch eine Tür mit Spitzbogen und betraten etwas, das wie ein ehemaliger großer Empfangsaal aussah. Am gegenüberliegenden Ende befand sich eine Tür, nicht aus Holz, sondern aus genietetem Stahl. Auf diese Tür gingen sie zu. Der Krankenwärter namens Ronald blieb davor stehen und drückte auf einen kleinen Knopf in einer Gegensprechanlage.
»Ja?«, erklang eine blecherne Stimme.
»Mr. Lloyds Besucher sind hier.«
Der Summer ertönte, die Tür öffnete sich mit einem Klicken, und zum Vorschein kam eine lange, prächtige Galerie mit Marmorboden und Wänden, an denen Porträtgemälde irgendwelcher Vorfahren hingen. Das Ambiente ließ keineswegs an eine psychiatrische Klinik denken, obgleich Gideon inzwischen klar war, dass es sich um genau das hier handelte. Am Ende des Gangs betraten sie ein strahlend hell erleuchtetes Krankenzimmer. Eingerichtet war es mit dunklen viktorianischen Sofas und Sesseln, die Wände waren voll mit Gemälden von Bergen, Flüssen und anderen Naturszenen im Stil der Hudson River School. Doch was Gideon besonders faszinierte, das war der rüstige alte Herr. Ungefähr siebzig Jahre alt, dichter Schopf weißer Haare, so saß er auf einem der Sofas. Allerdings trug er eine Zwangsjacke. Neben ihm saß ein Krankenwärter – bei dem es sich wohl um Morris handelte – mit einem Tablett, auf dem mehrere kleine Teller standen, auf denen jeweils ein Klacks püriertes Essen lag. Der Pfleger fütterte den Herrn gerade mit irgendeinem dunkelbraunen Brei. Gideon fiel auf, dass auf dem Tablett auch eine Flasche Rotwein stand – ein Château Pétrus. Neben der Flasche stand eine Schnabeltasse aus Plastik, gefüllt mit dem Wein.
»Ihre Besucher sind hier, Mr. Lloyd«, sagte Ronald.
Der Mann namens Lloyd hob seinen massigen, strubbeligen Kopf, die stechend blauen Augen weiteten sich und starrten Glinn an. Trotz der Zwangsjacke und seines hohen Alters strahlte er immer noch große psychische Energie und körperliche Kraft aus. Langsam, ganz langsam stand er auf und schaute seine Besucher an, wobei er vor außerordentlicher Intensität geradezu anzuschwellen schien. Erst jetzt erkannte Gideon, dass der Mann Fußfesseln trug und nur in winzigen Schritten gehen konnte.
Er beugte sich vor und spuckte das braune Zeug aus, das ihm der Pfleger soeben in den Mund gelöffelt hatte.
»Glinn.« Er spuckte das Wort aus so wie das Püree. »Und Manuel Garza. Was für eine Freude.« Der Tonfall ließ allerdings darauf schließen, dass er sich ganz und gar nicht freute. Die Stimme klang seltsam, zitternd und tief, krächzend. Die Stimme eines Geisteskranken.
Jetzt richtete er den Blick aus seinen blauen Augen auf Gideon. »Und Sie haben einen Freund mitgebracht?«
»Das ist Dr. Gideon Crew, mein Geschäftspartner«, sagte Glinn.
Die Atmosphäre im Zimmer wurde noch angespannter.
Lloyd drehte sich zu dem Krankenwärter um. »Ein Freund? Das ist ja eine Überraschung.« Er wandte sich wieder an Glinn. »Ich möchte Sie anschauen. Ich möchte Ihnen in die Augen sehen – aus der Nähe.«
»Es tut mir leid, Mr. Lloyd«, sagte Glinn, »aber Sie müssen bleiben, wo Sie sind.«
»Dann kommen Sie zu mir – wenn Sie den Mumm dazu haben.«
»Ich glaube nicht, dass das ratsam wäre …«, begann Ronald.
Glinn ging hinüber zu Lloyd. Die Krankenwärter strafften sich, gingen aber nicht dazwischen. Eineinhalb Meter vor Lloyd blieb Glinn stehen.
»Näher«, brummte Lloyd.
Glinn machte noch einen Schritt, dann noch einen.
»Näher. Ich will Ihnen in die Augen schauen.«
Glinn ging weiter, bis sein Gesicht nur Zentimeter von Lloyds entfernt war. Der weißhaarige Mann musterte ihn lange. Die Krankenwärter rührten sich nervös und wichen dem Patienten nicht von der Seite, wappneten sich offenbar für alles, was gleich passieren könnte.
»Gut. Sie können jetzt bitte wieder zurücktreten.«
Glinn gehorchte.
»Warum sind Sie hergekommen?«
»Wir stellen eine Expedition zusammen. In den Südatlantik. Zur Eisgrenze. Wir wollen das Problem dort unten ein für alle Mal beheben.«
»Haben Sie denn das nötige Geld dafür?«
»Ja.«
»Sie sind also nicht nur auf kriminelle Weise skrupellos, sondern auch noch ein Idiot.«
Stille.
Lloyd fuhr fort: »Es ist jetzt fünf Jahre und zwei Monate her, dass ich Ihnen gesagt, Sie angefleht, Ihnen befohlen habe, den Totmannschalter zu betätigen. Und Sie, Sie irrer, besessener Dreckskerl, haben sich geweigert. Wie viele Menschen sind damals ums Leben gekommen? Einhundertacht. Die armen Schweine auf der Almirante Ramirez nicht einmal eingerechnet. Sie haben Blut an den Händen, Glinn.«
In ruhigem, neutralem Ton entgegnete Glinn: »Nichts, dessen Sie mich beschuldigen können, habe ich mir nicht selbst schon hundertmal vorgeworfen.«
»Mir kommen die Tränen. Wollen Sie meine Qualen erleben? Schauen Sie mich an. Um der Liebe Gottes des Allmächtigen willen wünschte ich, ich wäre mit dem Schiff untergegangen.«
»Ist dieser Wunsch der Grund für die Zwangsjacke?«, fragte Glinn.
»Haha! Ich bin sanft wie ein Kätzchen. Die Zwangsjacke hat man mir angelegt, um mich am Leben zu halten, gegen meinen Willen. Befreien Sie eine meiner Hände und geben Sie mir nur zehn Sekunden Zeit, und ich bin ein toter Mann. Ein freier Mann. Aber nein, die halten mich am Leben und verbrennen mein Geld. Schauen Sie sich mal mein Abendessen an. Filet Mignon, Kartoffelgratin mit Gruyère, zart gegrillte Cavolini des Bruxelles, natürlich püriert, damit ich keinen Suizidversuch unternehme und mich ersticke. Dazu gibt’s einen Pétrus Jahrgang 2000. Möchten Sie auch was essen?«
Glinn schwieg.
»Und jetzt sind Sie hergekommen.«
»Ja, ich bin zu Ihnen gekommen. Aber nicht, um mich zu entschuldigen – denn ich weiß, dass keine Entschuldigung angemessen wäre oder akzeptiert würde.«
»Sie hätten das Alien töten müssen, als sich Ihnen die Gelegenheit dazu bot. Aber dafür ist es nun zu spät. Sie haben nichts unternommen, als es gewachsen und angeschwollen ist und sich vollgestopft hat –«
»Mr. Lloyd«, sagte Morris, »erinnern Sie sich, dass Sie uns versprochen haben, nicht mehr über Aliens zu sprechen?«
»Glinn, haben Sie das gehört? Man verbietet mir, über Außerirdische zu sprechen! Die versuchen schon seit Jahren, mich von meinem angeblich psychotischen Gefasel über Aliens abzubringen. Hahaha!«
Glinn schwieg.
»Was also ist Ihr Plan?«, sagte Lloyd, als er sich wieder beruhigt hatte.
»Wir werden es vernichten.«
»Verzeihung«, sagte Morris, »aber es geht nicht an, den Patienten in seinen Wahnvorstellungen zu bestätigen –«
Glinn brachte ihn mit einer ungeduldigen Geste zum Schweigen.
»Es vernichten? Mutige Worte! Aber das können Sie gar nicht. Sie werden versagen, so wie Sie vor fünf Jahren gescheitert sind.« Eine Pause. »Fährt McFarlane mit?«
Jetzt war es an Glinn innezuhalten. »Dr. McFarlane ist es in den vergangenen Jahren nicht gut ergangen, deshalb schien es mir unklug –«
»Nicht gut ergangen? Nicht gut ergangen? Ist es denn Ihnen in den letzten Jahren gut ergangen? Mir?« Lloyd lachte freudlos. »Statt Sam nehmen Sie also andere mit, darunter diesen grünen Jungen, wie heißt er noch gleich? Gideon. Sie schicken diese Leute in eine Hölle, die Sie selbst geschaffen haben. Weil Sie kein Gespür für Ihre eigene gottverdammte Schwäche haben. Sie glauben, alle Menschen zu durchschauen, aber für Ihre eigene Überheblichkeit und Dummheit sind Sie blind.«
Lloyd verfiel in Schweigen, atmete schwer, Schweißperlen rannen ihm übers Gesicht.
»Mr. Glinn«, warnte Ronald, »der Patient darf sich keinesfalls erregen.«
Lloyd drehte sich zu dem Krankenwärter um, plötzlich war er ganz ruhig, die Stimme der Vernunft. »Wie Sie sehen, Ronald, errege ich mich nicht im Geringsten.«
Der Pfleger trat unruhig von einem Fuß auf den anderen.
»Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen«, sagte Glinn ruhig. »Ich verdiene das alles und noch viel mehr. Und ich bin auch nicht hergekommen, um Sie darum zu bitten, mein Handeln zu entschuldigen.«
»Warum sind Sie dann hergekommen, Sie Mistkerl?«, schrie Lloyd so unvermittelt, dass sein Speichel und das pürierte Filet Mignon Glinn ins Gesicht spritzten.
»Das reicht«, sagte Ronald. »Der Besuch ist beendet. Sie müssen jetzt gehen.«
Glinn zog ein Taschentuch aus der Hosentasche, wischte sich sorgfältig das Gesicht ab und sagte ganz ruhig: »Ich bin gekommen, damit Sie mir Ihre Einwilligung geben.«
»Da können Sie genauso gut den Laternenpfahl fragen, ob er sich von einem Hund anpinkeln lassen will. Ich bin dagegen. Sie sind ein Idiot, wenn Sie glauben, dass Sie immer noch das vernichten können, was dort unten gewachsen ist. Aber Sie waren ja schon immer ein arroganter, scheißefressender Gauner. Soll ich Ihnen einen guten Rat geben?«
»Das genügt!«, sagte Ronald, trat näher, fasste Glinn am Arm und dirigierte ihn Richtung Tür.
»Ja, ich möchte Ihren Rat hören«, sagte Glinn über die Schulter.
Während Gideon dem Pfleger folgte, der Glinn sanft, aber entschieden aus dem Zimmer geleitete, hörte er Lloyd zischen: »Wecken Sie keine schlafenden Aliens.«
3
Als sie in die EES-Zentrale in der Little West 12th Street, ins Vorstandszimmer hoch über dem Meat Packing District in New York City, zurückgekehrt waren, setzte sich Gideon gleich an den Konferenztisch. Sie waren lediglich zu dritt, Garza, Glinn und er selbst; es war drei Uhr morgens. Glinn, der ganz ohne Schlaf auszukommen schien, erwartete von seinen Angestellten offenbar das Gleiche.
Inzwischen fragte sich Gideon, ob Glinn sich wohl tatsächlich verändert hatte. Er hatte den Mann noch nie derart getrieben erlebt, wenngleich auf die ihm eigene, ruhige, intensive Art. Das Treffen mit Lloyd in der riesigen Ein-Mann-Irrenanstalt hatte ihn offenbar zutiefst erschüttert.
Der Angestellte, der ihnen Kaffee serviert hatte, schloss die Tür hinter sich. Im Zimmer herrschte Schummerbeleuchtung. Glinn, der am Kopfende des Tisches saß, die Hände vor sich gefaltet, ließ die Stille wirken. Dann richtete er seine grauen Augen auf Gideon und sagte: »Nun, was halten Sie von unserem Besuch bei Palmer Lloyd?«
»Der Mann hat mir eine Heidenangst eingejagt«, sagte Gideon.
»Wissen Sie jetzt, warum ich wollte, dass Sie ihn kennenlernen?«
»Sie haben es selbst gesagt. Damit Sie seine Einwilligung erhalten, seinen Segen bekommen. Schließlich hat ihn die ganze Sache eine hübsche Stange Geld gekostet – von seiner geistigen Gesundheit ganz zu schweigen.«
»Das gehörte dazu. Außerdem war es meine Absicht, Ihnen – wie Sie sich ausgedrückt haben – eine Heidenangst einzujagen. Ihnen den Ernst unserer Unternehmung deutlich zu machen. Sie müssen mit offenen Augen in diese Sache hineingehen. Ohne Sie können wir keinen Erfolg haben.«
»Haben Sie wirklich den Tod von einhundertacht Menschen auf dem Gewissen?«
»Ja.«
»Hat es denn keine gerichtliche Untersuchung gegeben? Ist denn keine Anklage erhoben worden?«
»Es gab gewisse, ähm, ungewöhnliche Umstände, die das Verhältnis zwischen Chile und den Vereinigten Staaten betreffen und die die beiden Außenministerien dazu bewogen haben, sicherzustellen, dass die Untersuchung nicht übermäßig gründlich durchgeführt wurde.«
»Mir gefällt gar nicht, wie Sie das formulieren.«
Glinn drehte sich zu Garza um. »Manuel, machen Sie Gideon bitte mit den nötigen Hintergrundinformationen vertraut.«
Garza nickte, zog aus seiner Aktentasche eine große Mappe und legte sie auf den Tisch. »Einiges hiervon kennen Sie ja bereits. Ich will dennoch von vorne anfangen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, unterbrechen Sie mich bitte. Vor sechs Jahren hat sich Palmer Lloyd an EES gewandt, damit wir einen seltsamen Auftrag für ihn übernehmen.«
»Derselbe Palmer Lloyd, den ich eben in Dearborne Park kennengelernt habe?«
»Ganz recht. Der Milliardär plante, im Hudson River Valley ein Naturkundemuseum zu bauen. Er sammelte das Seltenste, Beste und Größte von allem – Geld war kein Thema. Den größten Diamanten, den größten T-Rex, eine echte ägyptische Pyramide hatte er sich bereits gesichert. Da erhielt er einen Bericht, wonach man den größten Meteoriten der Welt gefunden habe. Er befände sich auf der Isla Desolación, einem unbewohnten Eiland der Kap-Hoorn-Inseln an der äußersten Spitze Südamerikas. Die Inseln gehören zu Chile. Lloyd wusste, dass Chile den Meteoriten niemals freigeben würde. Deshalb beauftragte er EES und einen Meteoritenjäger namens Sam McFarlane, den Meteoriten zu stehlen.«
»Entschuldigen Sie«, sagte Glinn, »stehlen ist nicht ganz der richtige Ausdruck. Wir haben nichts Illegales getan. Wir hatten die Schürfrechte für die Isla Desolación geleast, was uns erlaubte, Eisen in jeder Form von der Insel zu entfernen.«
»Mag ja sein, dass ›stehlen‹ nicht das treffendste Wort ist«, sagte Garza, »aber es handelte sich eindeutig um eine Täuschung.«
Auf diese Zurückweisung hin verstummte Glinn. Garza fuhr fort. »Der Meteorit war äußerst schwer – fünfundzwanzigtausend Tonnen. Er hatte eine tiefrote Farbe, war sehr dicht und besaß, ähm, sonderbare Eigenschaften. Also haben wir unter dem Deckmantel, nach Eisenerz schürfen zu wollen, ein Schiff ausgestattet, die Rolvaag, sind mit ihr zu der Insel gefahren, haben den Meteoriten aus dem Boden geholt und an Bord verfrachtet. Es genügt wohl zu sagen, dass es sich um ein anspruchsvolles Ingenieursprojekt handelte. Aber wir haben es erfolgreich durchgeführt, und zwar auf ziemlich brillante Art und Weise. Und dann hat man uns erwischt. Der Kapitän eines chilenischen Zerstörers war dahintergekommen, was wir im Schilde führten. Er befehligte die Almirante Ramirez, das Schiff, das Lloyd erwähnt hat. Statt seine Vorgesetzten zu informieren, entschloss er sich, den Helden zu spielen, und hat uns in Richtung Süden bis an die Eisgrenze verfolgt.«
»Eisgrenze. Sie haben das Wort schon einmal verwendet. Worum genau handelt es sich dabei?«
»Um die Grenze, an der das Südpolarmeer auf die antarktischen Eisberge trifft. Wir haben zwischen den Eisbergen Verstecken gespielt. Die Rolvaag musste im Zuge dieser Konfrontation mehrere Treffer einstecken, aber letztlich ist es uns gelungen, den Zerstörer zu versenken.«
»Sie haben den Zerstörer versenkt? Wie?«
»Das ist eine komplizierte Geschichte, die Sie besser in Ihrem Briefing-Book nachlesen. Jedenfalls war die Rolvaag, die einen fünfundzwanzigtausend Tonnen schweren Meteoriten im Laderaum hatte, von dem Zerstörer stark beschädigt worden. Das Wetter verschlechterte sich. Irgendwann blieb uns nur noch eine Wahl: Entweder wir werfen den Felsbrocken über Bord oder wir sinken.«
»Wie haben Sie einen solchen Brocken über Bord geworfen?«
»Wir hatten zu dem Zweck eine Totmanneinrichtung installiert, für den Notfall. Wir mussten den Schalter nur umlegen, dann wäre der Meteorit durch ein Luk im Rumpf aus dem Schiff herausgefallen.«
»Hätte das Schiff danach nicht untergehen müssen?«
»Nein. Zwar wäre eine große Menge Wasser eingedrungen, bevor die Luke sich wieder schloss, aber das Schiff war mit Pumpen und selbstschließenden Schotts ausgestattet, die das Problem bewältigt hätten. Besatzung und Kapitän wollten den Felsbrocken aufgeben …« Garza zögerte und warf Glinn einen kurzen Blick zu.
»Erzählen Sie die Geschichte bis zum Schluss, Manuel. Lassen Sie nichts aus.«
»Am Ende wollten alle den Meteoriten über Bord werfen. Sogar Lloyd hatte schließlich eingewilligt. Aber nur Eli besaß den Code für die Totmanneinrichtung. Er behauptete steif und fest, dass das Schiff alles abwettern könne. Sie baten ihn, sie flehten, sie drohten, aber Eli lehnte ab. Doch er irrte sich. Die Rolvaag sank.« Wieder warf Garza Glinn einen kurzen Blick zu.
»Lassen Sie mich den Rest erzählen«, sagte Glinn ruhig. »Ich habe mich geweigert, den roten Knopf zu betätigen. Eine Fehlentscheidung. Der Kapitän ordnete die Evakuierung des Schiffs an. Einige kamen runter, aber viele nicht. Der Kapitän …«, er zuckte, kurz versagte ihm die Stimme, »die Kapitänin, eine überaus mutige Frau, ist mit dem Schiff untergegangen. Viele andere sind in den Rettungsbooten ums Leben gekommen oder auf einer nahegelegenen Eis-Insel erfroren, bevor Hilfe eintraf.«
»Und Lloyd? Was ist mit ihm passiert?«
»Er wurde mit dem ersten Rettungsboot evakuiert – gegen seinen Willen, wie ich hinzufügen könnte.«
»Und wie haben Sie überlebt?«
»Ich habe mich im Laderaum aufgehalten und versucht, den Meteoriten zu sichern. Aber schließlich hat er sich aus der sogenannten ›Wiege‹, der Aufnahmevorrichtung, gelöst, wodurch das Schiff in zwei Hälften zerbrach. Es gab eine Explosion. Offenbar reagierte der Meteorit, als er mit dem Salzwasser in Berührung kam, auf ungewöhnliche Weise und sandte eine Schockwelle aus. Ich wurde vom Schiff geschleudert. Ich erinnere mich, auf einer Art Floß aus treibenden Wrackteilen wieder zu mir gekommen zu sein. Ich war schwer verletzt. Einen Tag später hat man mich gefunden, dem Tode nahe.« Glinn verfiel in Schweigen und spielte mit seinem Kaffeebecher.
»Jetzt liegt das Ding also auf dem Meeresgrund. Warum dann diese Besorgnis, dieses Gerede von Gefahren? Und … über Aliens?«
Glinn schob den Becher von sich weg. »McFarlane, der Meteoritenjäger, hat herausgefunden, worum es sich bei dem Meteoriten in Wirklichkeit handelt.«
Es folgte ein längeres Schweigen.
»Es gibt in der Astronomie eine anerkannte Hypothese namens Panspermie«, fuhr Glinn schließlich fort. »Sie besagt, dass das Leben sich möglicherweise in Form von Bakterien oder Sporen auf Meteoriten oder in Staubwolken in der Galaxie verbreitet hat. Doch diese Theorie geht von mikroskopischem Leben aus. Allen Forschern ist die naheliegende Idee entgangen, dass sich das Leben durch Samen verbreitet haben könnte. Doch eine gigantische Samenkapsel kann die kalte, intensive Strahlung im Weltraum aufgrund ihrer schieren Größe und Widerstandskraft besser überstehen. Aus einem ähnlichen Grund sind Kokosnüsse so groß: um lange Reisen auf dem Meer zu überstehen. In der Milchstraße gibt es viele mit Wasser bedeckte Planeten und Monde, auf die ein solcher Same fallen und auf denen er dann keimen könnte.«
»Wollen Sie damit sagen, dass es sich bei diesem Meteoriten tatsächlich um solch einen Samen handelt? Und dass er, als die Rolvaag unterging, auf den Meeresgrund sank und dort … Wurzeln geschlagen hat?«
»Ja. Drei Kilometer unter der Meeresoberfläche. Und dann ist er gesprossen.«
Gideon schüttelte den Kopf. »Das ist unglaublich. Wenn es denn wahr ist …«
»Oh, es ist wahr. Der Meteorit schlug Wurzeln und wuchs wie ein gigantischer Baum in die Höhe – und zwar rasant. Erdbebenmessstationen auf der ganzen Welt haben an dem Ort eine Reihe kleinerer Seebeben registriert. Mehrere kleine Tsunamis sind auf die Küsten Südgeorgiens und der Falkland-Inseln getroffen. Doch das alles geschah in drei Kilometern Tiefe, zudem vermittelte die seismische Signatur der Seebeben den Eindruck, als handelte es sich dabei um die Auswirkungen unterseeischer Vulkanausbrüche. Das Gleiche galt für die Tsunamis. Da dieser ›unterseeische Vulkan‹ in einem Gebiet weit außerhalb aller Schifffahrtswege lag und für niemanden eine Gefahr darstellte, hat man ihn also nicht weiter beachtet. Selbst Vulkanologen ignorierten ihn, denn er war einfach zu tief und zu gefährlich, um ihn untersuchen zu können. Und dann wurde er inaktiv. Dies alles erklärt, warum niemand dahintergekommen ist, was sich tatsächlich dort abspielte – außer mir natürlich. Und Sam McFarlane. Und Palmer Lloyd.« Glinn verlagerte sein Gewicht auf dem Stuhl. »Aber im Laufe der vergangenen fünf Jahre haben wir einen Plan entwickelt, um mit diesem Problem fertigzuwerden. Manuel wird unser Vorhaben für Sie zusammenfassen.«
Garza sah Gideon an. »Wir werden das Ding vernichten.«
»Aber Sie haben doch gesagt, dass es inaktiv ist. Warum sich die Mühe machen und die Kosten aufbringen, von den Gefahren gar nicht zu reden?«
»Weil das Ding ein Alien ist. Es ist riesig. Es ist gefährlich. Nur weil es ruht, heißt das noch lange nicht, dass es so bleiben wird. Unsere Modelle sagen sogar das genaue Gegenteil voraus. Denken Sie einen Augenblick darüber nach. Was passiert wohl, wenn das Ding blüht oder weitere Samen produziert? Was, wenn sich diese Pflanzen ausbreiten, die Meeresböden überziehen? Was, wenn sie auch an Land wachsen? Ganz gleich, von welcher Seite man es auch betrachtet, dieses Ding stellt eine enorme Bedrohung dar. Es könnte die Erde vernichten.«
»Wie wollen Sie es also zerstören?«
»Wir haben in unserem Besitz einen Plutoniumkern von rund drei Kilogramm, eine Polonium-Neutronen-Auslösevorrichtung, schnell und langsam explodierende Explosivlinsen, einen Wärmeschutz vor Uran, Hochgeschwindigkeitstransistoren – alles, was nötig ist, um eine Atombombe herzustellen.«
»Wo haben Sie denn das ganze Zeug her?«
»In gewissen ehemaligen Satellitenstaaten gibt es heutzutage alles zu kaufen.«
Gideon schüttelte den Kopf. »Jesus Maria.«
»Und wir haben einen Atomwaffenexperten in unserem Team.«
»Wen?«
»Sie natürlich.«
Gideon sah Glinn ungläubig an.
»Ganz recht«, sagte Glinn ruhig. »Jetzt kennen Sie den wahren Grund, warum ich Sie eingestellt habe. Weil wir immer gewusst haben, dass dieser Tag kommt.«
4
Es wurde still im Raum. Gideon erhob sich langsam aus dem Stuhl, wobei es ihm gelang, seine Wut zu verbergen. »Sie haben mich also angeheuert, damit ich den Bau einer Atombombe überwache«, sagte er ruhig.
»Ja.«
»Anders ausgedrückt: Vor drei Monaten, als Garza zu meiner Angelstelle am Chihuahuenos Creek gekommen und mir hunderttausend Dollar für eine Woche Arbeit angeboten hat, wenn ich die Pläne eines abtrünnigen chinesischen Wissenschaftlers für irgendeine neuartige Waffe stehle, da war es in Wirklichkeit dieser Augenblick, dieser Job, der Ihnen vorschwebte.«
Glinn nickte.
»Und Sie wollen die Bombe dazu verwenden, eine gigantische außerirdische Pflanze zu vernichten, die angeblich auf dem Meeresgrund wächst.«
»So kann man das, kurz gesagt, ausdrücken.«
»Vergessen Sie’s.«
»Gideon«, sagte Glinn, »wir haben diesen ermüdenden Tanz doch schon mehrmals getanzt: Ihre hitzige Weigerung, Ihr Hinausstürmen aus dem Besprechungszimmer, dann schließlich Ihre Rückkehr, nachdem Sie die Sache zu Ende gedacht haben. Könnten wir das alles bitte überspringen?«
Die Sätze kränkten Gideon. »Lassen Sie mich Ihnen bitte erklären, warum ich das Ganze für eine verrückte Idee halte.«
»Bitte.«
»Zunächst einmal können Sie das nicht allein und ohne fremde Hilfe hinbekommen. Sie müssen sich mit diesem Problem an die Vereinten Nationen wenden und dafür sorgen, dass die Welt sich vereint in dem Bemühen, dieses Ding zu vernichten.«
Glinn schüttelte betrübt den Kopf. »Manchmal erstaunen Sie mich, Gideon. Sie machen einen so intelligenten Eindruck – und dann sagen Sie etwas so erstaunlich Dummes. Haben Sie da eben vorgeschlagen, dass wir die Vereinten Nationen darum bitten sollen, das Problem zu lösen?«
Gideon hielt inne. Bei näherer Betrachtung klang sein Vorschlag tatsächlich nicht gerade brillant. »Okay, vielleicht nicht die UNO, aber legen Sie Ihren Plan zumindest der US-Regierung vor. Soll die sich doch mit dem Problem befassen.«
»Sie meinen, unser höchst exzellenter Kongress soll sich mit dieser Situation auf die gleiche Art und Weise befassen, wie er sich um andere drängende nationale Probleme gekümmert hat, wie beispielsweise die globale Erwärmung, Terrorismus, Bildung und die bröckelnde Infrastruktur in unserem Land?«
Gideon suchte nach einer schlagfertigen Antwort auf diese Erwiderung, fand aber keine.
»Dies ist nicht die Zeit für lange Reden«, sagte Glinn. »Wir sind die Einzigen, die das Problem aus der Welt schaffen können. Es muss jetzt getan werden, solange diese Lebensform inaktiv ist. Ich hoffe, Sie werden uns dabei helfen.«
»Und wenn nicht?«
»Dann wird die Welt, wie wir Sie kennen, früher oder später enden. Denn ohne Sie werden wir definitiv scheitern. Und Sie werden sich für den Rest Ihres Lebens Vorwürfe machen.«
»Soll heißen, für den Rest meines kurzen Lebens. Dank dessen, was da in meinem Gehirn wächst, habe ich noch neun Monate zu leben. Das wissen wir beide, Sie und ich, ganz genau.«
»Wir sind da nicht mehr so sicher.«
Gideon schaute Glinn an. Er wirkte um Jahre jünger; beim Sprechen gestikulierte er mit beiden Händen, das blinde Auge war verheilt und wirkte ganz klar. Der Rollstuhl war nirgends zu sehen. Bei der letzten gemeinsamen Mission hatte Glinn – wie auch Gideon – von dem stärkenden und gesundheitsfördernden Lotos gegessen. Bei Glinn hatte der Lotos gewirkt, bei ihm selbst dagegen offenbar nicht.
»Glauben Sie wirklich, dass Ihre Mission ohne mich scheitert?«, fragte Gideon.
»Ich sage nie etwas, von dem ich nicht überzeugt bin.«
»Und ich muss überzeugt sein, dass dieses Ding so gefährlich ist, wie Sie behaupten, bevor ich Ihnen bei etwas helfe, das mit nuklearen Dingen zu tun hat.«
»Ich werde Sie davon überzeugen.«
Gideon zögerte. »Und Sie müssen mich zum Co-Leiter der Unternehmung machen.«
»Das ist völlig absurd«, sagte Glinn.
»Wieso? Sie haben doch selbst gesagt, dass wir gut zusammenarbeiten. Aber wir haben nie als gleichberechtigte Leiter zusammengearbeitet. Sie haben mir immer gesagt, was zu tun ist, ich habe es auf meine Art getan, Sie haben protestiert, und am Ende hat sich dann gezeigt, dass ich richtig- und Sie falschgelegen haben.«
»Das ist allzu simpel dargestellt«, sagte Glinn.
»Ich möchte nicht, dass Sie mich im Unklaren lassen und überstimmen. Vor allem, wenn wir es mit etwas so Gefährlichem wie Atombomben zu tun haben – und diesem Samen, von dem Sie gesprochen haben.«
»Es liegt mir nicht, einem Ausschuss vorzustehen«, sagte Glinn. »Ich muss das mindestens durch unsere Qualitativen-Verhaltensanalyse-Programme laufen lassen, um festzustellen, ob so etwas praktikabel ist.«
»Sie haben doch selbst gesagt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben«, sagte Gideon. »Treffen Sie Ihre Entscheidung jetzt, oder ich gehe. Machen Sie zur Abwechslung mal etwas ohne Ihre verdammten QVA-Programme.«
Einen Augenblick lang funkelten Glinns Augen zornig, dann aber legte sich die Wut, und seine gleichgültige Miene setzte sich durch, bis er wieder ganz der alte »Glinn von der entschlossenen Rätselhaftigkeit« war.
»Gideon, denken Sie mal eine Minute darüber nach, was für Entscheidungen ein Leiter – sogar ein Co-Leiter – treffen muss. Er ist ein Teamplayer. Er ist gut darin, seine Mitarbeiter zu inspirieren. Er ist imstande, seine wahren Gefühle zu verbergen, nötigenfalls eine Fassade zu errichten. Er verströmt allzeit Optimismus, selbst wenn er selbst nicht zuversichtlich ist. Er kann kein freier Mitarbeiter sein. Und er ist sicherlich kein Einzelgänger. Und nun sagen Sie mir: Beschreiben irgendwelche dieser Eigenschaften Sie?«
Eine Pause entstand.
»Nein«, gab Gideon schließlich zu.
»Sehen Sie.« Glinn stand auf. »Unser erster Stopp ist das Ozeanographische Forschungsinstitut in Woods Hole. Und dann fahren wir in den Südatlantik – und über die Eisgrenze hinaus.«
5
Während der Hubschrauber eindrehte, spiegelte sich die nachmittägliche Sonne schimmernd im Wasser von Great Harbor, Massachusetts, und das Forschungsschiff Batavia kam in Sicht. Gideon staunte, wie groß es von oben aussah, wie sehr es mit seinem mächtigen Bug und den hohen, mittschiffs gelegenen Aufbauten alle anderen Forschungsschiffe im Hafen überragte.
»Ein Ozeanographie-Forschungsschiff der Walter-N.-Harper-Klasse«, sagte Glinn vom Nachbarsitz, als er Gideons Interesse bemerkte. »Länge 320 Fuß, Breite 58 Fuß, Tiefgang 31 Fuß. Das Schiff verfügt über zwei Z-Antriebe mit je 3500 PS, einen Azimut-Jet mit 1400 PS, vollautomatische Positionierung, es hat eine Tankkapazität von 250000 Gallonen und eine Reichweite von 18000 Seemeilen bei einer Reisegeschwindigkeit von zwölf Knoten –«
»Den Teil mit dem ›Azimut-Jet‹ habe ich nicht ganz verstanden.«
»Das heißt nur, dass der Jetantrieb in jede horizontale Richtung gedreht werden kann, so dass das Schiff kein Ruder benötigt. Der Jetantrieb ermöglicht eine extrem genaue dynamische Positionierung, und zwar selbst bei schwerem Seegang, bei starken Winden und Strömungen.«
»Und was heißt dynamische Positionierung?«
»Das Schiff an Ort und Stelle halten. Gideon, nach Ihrem jüngsten Abenteuer da unten in der Karibik wissen Sie doch bestimmt alles über Schiffe.«
»Ich weiß, dass ich Schiffe nicht mag. Ich kann es nicht leiden, auf See zu sein, und es macht mir überhaupt nichts aus, in allen nautischen Dingen unwissend zu bleiben.«
Der Hubschrauber beendete seinen Anflug und setzte zur Landung auf dem mittschiffs gelegenen Hubschrauberdeck an. Ein Deckmatrose wies sie mit Flaggensignalen ein, kurz darauf wurde die Tür des Helikopters geöffnet, und die drei Männer sprangen heraus. Es war ein strahlender Herbstnachmittag, der Himmel eine kalte blaue Kuppel, die Sonne schien schräg aufs Schiffsdeck.
Gideon ging hinter Manuel Garza und Glinn über das Hubschrauberdeck, wobei sich der EES-Direktor ein wenig steif gegen den Luftstrom der Rotoren duckte. Sie traten durch eine Tür in einen spärlich möblierten Warte- und Durchgangsraum. Sofort standen drei Personen auf, zwei in Uniform, eine in Zivil. Draußen hob der Helikopter ab.
»Gideon«, sagte Glinn, »ich möchte Ihnen Kapitän Tulley, den Schiffsführer des Forschungsschiffs Batavia, und die Erste Offizierin Lennart vorstellen.«
Der Kapitän, kaum größer als ein Meter fünfzig, trat vor und schüttelte Gideon mit großem Ernst die Hand, während sich auf seiner verkniffenen, sauertöpfischen Miene der Anflug eines Lächelns zeigte. Er nickte knapp und trat dann einen Schritt zurück.
Der Erste Offizier Lennart bildete einen fast komischen Gegensatz zu Tulley – eine blonde, skandinavisch wirkende Frau von Anfang fünfzig, die den eher kleinen Kapitän um Haupteslänge überragte. Sie strahlte Herzenswärme aus und gab ihnen die Hand – der Handschlag war so warm und einhüllend wie ein Ofenhandschuh.
»Und das hier ist Alexandra Lispenard, ihr untersteht unsere aus vier DSVs bestehende Flottille. Sie wird Ihre Fahrlehrerin sein.«
Lispenard warf die langen, teakholzfarbenen Haare in den Nacken, ergriff lächelnd Gideons Hand und schüttelte sie ausgiebig. »Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte sie, wobei ihre Altstimme in deutlichem Gegensatz zur förmlichen Schweigsamkeit der anderen Schiffsoffiziere stand.
»DSVs?«, fragte Gideon sie und bemühte sich, Alexandra Lispenard nicht anzustarren. Sie war ungefähr fünfunddreißig und ungeheuer attraktiv, hatte ein herzförmiges Gesicht und ein wenig exotische, achatfarbene Augen.
»Deep Submergence Vehicles, Tiefsee-U-Boote. Im Grunde sind das motorisierte Tiefseetauchkapseln. Wunderwerke der Ingenieurskunst.«
Gideon spürte den Druck von Glinns Hand auf seiner Schulter. »Ah, da ist ja unser Herr Doktor. Gideon, darf ich Ihnen Dr. Brambell, unseren Expeditionsarzt, vorstellen?«
Im Türrahmen stand ein drahtiger alter Herr mit Glatze und im weißen Laborkittel. »Angenehm, sehr angenehm!«, rief er. Er sprach mit irischem Akzent und bot keinen Händedruck an.
»Dr. Brambell«, sagte Glinn, »ist auf der Rolvaag gefahren, als sie unterging. Wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, wird er Ihnen sicherlich alles darüber erzählen.«
Auf die unerwartete Bemerkung folgte Stille. Die beiden Schiffsoffiziere blickten erstaunt – und verärgert.
Gideon fragte sich, ob Brambell vielleicht als eine Art Unglücksrabe galt.
»Das ist keine Geschichte, die ich gerne herumerzähle«, sagte Brambell brüsk.
»Ich bitte um Entschuldigung. Wie auch immer, Gideon, nun haben Sie einige der wichtigsten Leute an Bord kennengelernt. Alexandra bringt Sie gleich nach unten zum Hangardeck. Ich habe leider einen anderen Termin.«
Daraufhin drehte sich Lispenard wortlos um, und Gideon folgte ihr durch eine offene Schott-Tür, eine metallene Wendeltreppe hinunter und durch ein Labyrinth aus schmalen Fluren, Treppen und Türen, bis sie beide völlig unvermittelt einen riesengroßen, hellen Raum betraten. An den Seiten befanden sich mehrere Nischen, einige davon waren von Abdeckplanen verdeckt, aber vier standen offen. In drei von diesen Nischen standen kleine, identische, rundliche Fahrzeuge, hellgelb gestrichen und mit türkisfarbenen Zierleisten versehen. Sie verfügten über eine Reihe dicker Bullaugen, dazu diverse Ausbuchtungen und Vorsprünge sowie eine Art Roboterarm im Bug. An der Rückwand des Hangars befand sich ein Rolltor, das offen stand, so dass das Achterdeck des Schiffs zu sehen war. Dort stand ein viertes U-Boot unter einem Dreieckskran.
»We all live in a yellow submarine«, begann Lispenard zu summen.
»Das finde ich auch«, sagte Gideon. »Ist ein echt niedliches Ding.«
»Das niedliche Ding kostet zwanzig Millionen Dollar. Das da unter dem Kran heißt George. Die anderen drei sind Ringo,John und Paul.«
»O nein.«
Lispenard schritt durch den Hangar, trat an George heran, legte ihre Hand darauf und tätschelte das Tiefsee-U-Boot liebevoll. Es war überraschend klein, nicht länger als drei Meter und ungefähr zwei Meter hoch. Sie drehte sich zu Gideon um. »In dem DSV befindet sich eine Personenkapsel aus Titan, fast ein U-Boot im U-Boot, mit einer Luke auf der Oberseite und drei Bullaugen. In dieser Personenkapsel gibt es ein Elektronikbedienfeld, einen Sitzplatz, Steuerinstrumente, Videomonitore – und das war’s auch schon. Ach ja, am Bug ist ein Sammelkorb angebracht, in den der Roboterarm Gegenstände ablegen kann. Sollte irgendwas schiefgehen, gibt es eine Notauslösevorrichtung, die die Kapsel freigibt und an die Wasseroberfläche schickt. Der Rest des DSV besteht aus Ballasttanks, einem Quecksilber-Trimmtank, Kameras, Kennleuchten und Scheinwerfern, einem Sonarsystem, einer Reihe von Akkus, einem Heckantriebsmotor, Propeller und einem Ruder. Simpel.« Sie zuckte mit den Achseln. »Probefahrt ist morgen.«
Gideon drehte sich von George weg und sah Lispenard an. »Und wer fährt?«
Sie lächelte. »Sie und ich. Start um sieben.«
»Moment mal. Sie und ich? Sie glauben, ich würde eines von diesen Dingern fahren? Ich bin doch nicht Kapitän Nemo.«
»Die Tauchboote sind so entworfen, dass jedes Kind sie steuern kann. Die sind idiotensicher.«
»Vielen Dank.«
»Was ich damit sagen will: Sie sind mit Selbstfahrer-Software ausgestattet, so wie ein Google-Car, aber mit einem Joystick statt einem Lenkrad. Sie bewegen einfach den Joystick, um anzuzeigen, wohin Sie wollen, und die KI des Mini-U-Boots erledigt den Rest – sie nimmt all die Dutzenden kleinen Anpassungen vor, weicht Hindernissen aus, manövriert durch enge Räume, erledigt all die Feinsteuerungen, ohne dass Sie irgendwas davon mitbekommen. Sie können das U-Boot nicht mal crashen, selbst wenn Sie wollten.«
»Es kommen doch sicher noch andere Leute mit auf unsere kleine Spritztour, die über mehr Erfahrung mit DSVs verfügen. Oder?«
»So ist es. Antonella Sax zum Beispiel, die Leiterin unserer Exobiologie-Abteilung. Aber sie kommt erst später an Bord. Außerdem hat Glinn gesagt, dass es einen Grund gibt, warum Sie sich mit der Bedienung eines DSV auskennen sollen. Das hat wohl irgendetwas mit der Rolle zu tun, die Sie bei der Mission insgesamt spielen.«
»Dass ich ein Unterseeboot fahren soll, hat er mit keinem Wort erwähnt. Ich mag es nicht, auf dem Wasser zu sein, von darin gar nicht zu reden – und dann auch noch in drei Kilometern Tiefe, um Himmels willen.«
Sie sah ihn an und lächelte ein wenig. »Seltsam. Ich habe Sie gar nicht für einen Feigling gehalten.«
»Aber ich bin ein Feigling. Ich bin definitiv, ohne Zweifel, eine hasenfüßige, feige Memme ohne jeden Mumm in den Knochen.«
»Memme? Hübsches Wort. Aber Sie fahren morgen mit mir zusammen runter. Ende der Diskussion.«
Gideon schaute sie wütend an. Gott, wie er bevormundende Frauen satthatte. Aber es war sinnlos, mit ihr zu streiten; er würde die Sache mit Glinn ausfechten. »Also, was haben wir hier sonst noch auf dem Schiff?«
»Es gibt diverse Labors – sie sind fantastisch, Sie werden sie noch schnell genug zu Gesicht bekommen. Außerdem das Kontrollzentrum, eine Bibliothek, Kombüse, Speisesaal, Lounge und Gaming-Zimmer sowie die Mannschaftsunterkünfte. Vom Maschinenraum, der Werkstatt, dem Proviantlager, der Krankenstation und all dem anderen, was man sonst noch alles auf einem Schiff braucht, ganz zu schweigen.« Sie sah auf die Uhr. »Aber jetzt ist es höchste Zeit, zu Abend zu essen.«
»Um siebzehn Uhr?«
»Wenn Frühstück um halb sechs ist, verschieben sich alle Essenszeiten.«
»Frühstück um halb sechs.« Auch hierüber – diese völlig unnötige Verneigung vor militärischer Zucht und Ordnung – musste er mit Glinn sprechen. »Ich hoffe doch stark, dass es Alkohol auf dem Schiff gibt.«
»Zurzeit noch. Aber nicht mehr, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Vor uns liegt eine ziemlich lange Schifffahrt.«
»Wie lang?«
»Neuntausend Seemeilen bis zum Zielgebiet.«
Es war Gideon gar nicht in den Sinn gekommen, dass es eine lange vorbereitende Reise geben würde, bevor sie am Ziel eintrafen. Natürlich, wenn er nur kurz darüber nachgedacht hätte, wäre ihm das klar gewesen. Was hatte Glinn noch gleich über die Reisegeschwindigkeit des Schiffs gesagt? Zwölf Knoten. Zwölf Seemeilen in der Stunde, geteilt durch neuntausend Seemeilen …
»Zweiunddreißig Tage«, sagte Alex.
Gideon stöhnte.
6
»Gehen wir doch mit unseren Drinks nach draußen an Deck«, sagte Gideon zu Alex Lispenard.
»Gute Idee.«
Er stand vom Bartresen auf, wobei er zu verhindern versuchte, dass sein zweiter Martini über den Rand schwappte. Die Bar auf der Batavia, ein Seitenraum, der vom Speisesaal abging, war klein und spartanisch eingerichtet, aber angenehm auf eine maritime Art. Durch die Reihe von Fenstern schaute man über Great Harbor hinweg zum tiefliegenden Ufer von Ram Island. Sie traten durch die niedrige Tür an Deck. Es war ein makelloser Oktoberabend, kühl und klar, das goldene Licht fiel schräg aufs Deck, in der Ferne hörte man Möwengeschrei.
Gideon trank einen ordentlichen Schluck und lehnte sich an die Reling, Alex schloss sich ihm an.
Es ging ihm gut – sehr gut, genau genommen. Die seelische Verfassung, in der er noch zwei Stunden zuvor gewesen war, hatte sich völlig gewandelt. Schon erstaunlich, wie ein ausgezeichnetes Essen und ein Martini die Lebensgeister wecken konnten.
»Glauben Sie, dass wir auf der ganzen Reise so gutes Essen bekommen?«, fragte er.
»Oh, ja, ja. Ich bin schon auf vielen Forschungsschiffen gefahren, und die Verpflegung war immer gut. Wenn man monatelang auf See ist, ist schlechtes Essen gleichbedeutend mit schlechter Stimmung an Bord. Auf einer Fahrt wie dieser stellt der Proviant die geringsten Kosten dar, deshalb kann man auch gleich das Beste bunkern. Und mit Vince Brancacci haben wir einen ausgezeichneten Chefkoch an Bord.«
»Meinen Sie den Kerl im weißen Kittel, der wie eine Hyäne lacht und die Figur eines Sumo-Ringers hat?«
»Genau den.«
Gideon nahm noch einen Schluck und betrachtete Alex. Sie lehnte an der Reling, die Brise zerzauste ihre glänzenden kastanienbraunen Haare, die Stupsnase und die achatgrünen Augen waren auf den blauen Meereshorizont gerichtet, die Brüste leicht gegen die Reling gedrückt.
Er wandte den Blick ab. So gut Alex auch aussah, es war ausgeschlossen – absolut ausgeschlossen –, dass er sich auf einer langen Seereise bis ans andere Ende der Welt auf eine Affäre einlassen würde.
Sie drehte sich zu ihm um. »Also, was haben Sie bisher so beruflich gemacht?«
»Man hat Sie nicht gebrieft?«
»Das Gegenteil von ›gebrieft‹. Glinn hat mich gebeten, Sie mit dem DSV vertraut zu machen, aber darüber hinaus hat er total geheimnisvoll getan. Ich hatte das Gefühl, er wollte, dass ich es allein herausfinde.«
Das hieß, dass sie nichts über sein gesundheitliches Problem wusste. Gideon war erleichtert. »Wo soll ich anfangen? Ich habe meine Berufslaufbahn als Kunstdieb begonnen, danach habe ich einen Job als Entwickler von Atombomben bekommen.«
Sie lachte. »Natürlich.«
»Es stimmt. Ich arbeite in Los Alamos und entwickle die hochexplosiven Linsen, die zur Implosion der Nuklearkerne verwendet werden. Ich war Mitarbeiter am Stockpile Stewardship Program, ich habe Computersimulationen vorgenommen und die optischen Linsen optimiert, um sicherzustellen, dass die Bomben auch dann noch explodieren, wenn sie jahrelang irgendwo in irgendeinem Atombunker vor sich hin gerottet sind. Im Moment bin ich, ähm, für längere Zeit beurlaubt.«
»Moment mal … Sie machen keine Witze?«
Gideon schüttelte den Kopf. Sein Glas war enttäuschenderweise leer. Sollte er sich an der Bar einen dritten Martini bestellen? Nein, eine leise Stimme im Kopf sagte ihm, dass das gar keine gute Idee wäre.
»Sie stellen also wirklich Atombomben her?«
»Mehr oder weniger. Tatsächlich nehme ich deshalb an dieser Seereise teil.«
»Was haben Atombomben mit dieser Reise zu tun?«
Gideon schaute sie an. Man hatte sie wirklich nicht eingeweiht. Rasch trat er den Rückzug an. »Es ist nur, weil ich als Ingenieur Kenntnisse über Sprengkörper besitze – das ist alles.«
»Und was diese Kunstdiebstahlsache angeht, da haben Sie auch keine Witze gemacht?«
»Nein.«
»Eine Frage. Warum?«
»Ich war arm, hab Geld gebraucht. Und was noch wichtiger ist: Ich habe die Kunstgegenstände, die ich gestohlen habe, geliebt und deshalb nur Historische Gesellschaften und Museen bestohlen, die sich nicht um ihre Sammlungen gekümmert haben, Kunstgegenstände, die sowieso niemand zu Gesicht bekommen hat.«
»Und darum waren die Diebstähle vermutlich moralisch in Ordnung.«
Die Bemerkung ärgerte Gideon. »Nein, das waren sie nicht, aber ich entschuldige mich auch nicht dafür. Erwarten Sie bloß nicht, dass ich mich in Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen wälze.«
Stille. Jetzt konnte er wirklich einen dritten Drink gebrauchen. Vielleicht war es aber auch höchste Zeit, das Thema zu wechseln. »Außerdem bin ich als Zauberer aufgetreten. Als Taschenspieler, um genau zu sein.«
»Sie haben als Zauberer gearbeitet? Ich auch!«
Gideon trat einen Schritt von der Reling weg. So etwas hörte er nicht zum ersten Mal. Jemand lernte ein paar Kartentricks und verlieh sich dann selber den heiligen Titel »Zauberer«.
»Sie können also eine Münze hinter jemandes Ohr hervorzaubern?«
Alex runzelte die Stirn und schwieg.
Gideon lehnte sich wieder gegen die Reling. Weil er merkte, dass er sie beleidigt hatte, sagte er: »Ich war ein Profi. Ich bin aufgetreten, wurde gut bezahlt. Ich hab sogar ein paar Tricks erfunden. Habe mit lebenden Tieren gearbeitet – Kaninchen und dergleichen. Ich hatte ein fantastisches Kunststück im Programm mit einem zwei Meter langen Python, bei dem die Hälfte der Zuschauer den Saal verlassen hat.« Er befingerte sein leeres Glas. »Und ich bin immer noch in Übung, mache aus Spaß Taschendiebstähle, solche Sachen. Es ist wie Geige spielen. Man muss immer weiter üben, sonst gehen die Fertigkeiten verloren.«
»Verstehe.«
»Die Zauberei und der Kunstdiebstahl sind im Grunde genommen vergleichbare Felder.«
»Wie kann es anders sein.«
Gideon hatte eine Idee. Eine wirklich gute Idee. Das würde amüsant werden. Er beugte sich zu Lispenard vor. »Ich gehe wieder rein und hol mir noch einen Drink – darf ich Ihnen auch einen bringen?«
»Zwei sind mein Limit, aber machen Sie nur. Sie dürfen mir bitte ein Glas Wasser bringen.«
Im Gehen streifte er sie wie zufällig und nutzte die ablenkende Berührung, um die Brieftasche aus ihrer offenen Handtasche zu ziehen. Er steckte sie ein, zu seiner eigenen Brieftasche, ging zurück in die Bar und stellte sich an den Tresen. »Bitte noch einen Hendricks auf Eis, mit Zitrone, und ein Glas Wasser.«
Er sah zu, wie der Barkeeper den Martini mixte. Plötzlich stand Alex neben ihm. »Ist da draußen etwas kalt geworden.« Zu seiner Überraschung schmiegte sie sich an ihn. »Könnten Sie mich ein bisschen wärmen?«
Er legte den Arm um sie und spürte, dass sein Herz schneller schlug. »Besser so?«
»Ja. Das ist gut, jetzt ist mir wärmer, danke.« Sie entzog sich seiner leichten Umarmung.
Irgendwie enttäuscht griff er nach seinem Drink, während sie etwas ungeschickt ihr Glas Wasser entgegennahm und ein wenig davon verschüttete.
»Mist.« Sie griff nach einer Serviette und wischte sich das Wasser von der Bluse.
Er nippte an seinem Drink. »Also, was können Sie denn so von sich erzählen?«
»Ich bin an der Küste von Maine aufgewachsen. Mein Vater besaß eine Austernfarm, und ich habe ihm bei der Arbeit geholfen. Ich bin sozusagen auf dem Wasser groß geworden. Wir haben Taucheraustern angebaut, deshalb hab ich mein PADI-Open-Water-Zertifikat gemacht, als ich zehn war, das PADI-Wracktauchen mit fünfzehn, das Nitrox-Zertifikat mit sechzehn, schließlich hab ich meinen Tauchschein in Höhlen-, Tief-, Eistauchen und den Rest erworben. Ich liebe das Meer und alles, was darin ist. Ich hab an der Universität von Kalifornien Meeresbiologie studiert und bin in dem Fach promoviert.«
»Worüber?«
»Benthische Lebewesen im Calypsotief. Das ist der tiefste Teil des Hellenischen Grabens, fast sechstausend Meter tief.«
»Wo liegt dieses Calypsotief genau?«
»Im Mittelmeer, westlich des Peloponnes. Ich habe da drüben viel Zeit auf dem Forschungsschiff Atlantis verbracht, bin in der Alvin runtergegangen – dem genau genommen ersten Tiefsee-U-Boot überhaupt.«
»Vor Griechenland kreuzen – eine nette Art, um seine Diss zu schreiben.«
»Auf einem Schiff fühle ich mich wie zu Hause.«
»Komisch, ich überhaupt nicht. Das Meer macht mich krank. Ich brauche zu meinem Glück die hohen Berge im Westen und einen Bach voller Cutthroat-Forellen, dann geht’s mir bestens.«
»Sie werden seekrank, ich bekomme die Höhenkrankheit.«
»Jammerschade«, sagte Gideon. »Das war’s dann wohl mit meinem Heiratsantrag.«
Der kleine Scherz kam nicht besonders gut an, in der darauffolgenden Stille nippte Alex an ihrem Wasser.
»Und diese Sache mit der Zauberei? Machen Sie das immer noch?«, fragte Gideon schnell.
Sie winkte ab. »Mit Ihnen könnte ich es niemals aufnehmen! War nur ein kleines Hobby von mir. Ich hab nur ein bisschen gezaubert, um mich und meine Freunde zu amüsieren.«
»Ich könnte Ihnen ein paar Grundlagen beibringen.«
Sie hob den Blick. »Das wäre wundervoll.«
»Vielleicht sollten wir zurück in meine Kabine gehen – wenn ich sie denn finde. Ich hab ein paar Zauberutensilien eingepackt. Mit ein bisschen Hilfe hätten Sie die Tricks bestimmt schnell drauf.«
»Gehen wir. Ich zeige Ihnen den Weg zu den Mannschaftsunterkünften.«
Gideon trank aus und tastete die Taschen seiner Jeans ab. »Ach, ich hab meine Brieftasche vergessen. Könnten Sie die Rechnung bezahlen? Ich übernehme die nächste.« Mit einem Lächeln der Vorfreude beobachtete er, wie Alex in ihrer Handtasche nach ihrer Brieftasche suchte, wohlwissend, dass sie die nicht finden würde. Zu seiner riesengroßen Überraschung zog sie sie hervor und legte sie auf den Tresen.
»Warten Sie … ist das Ihre Brieftasche?«
»Natürlich.« Sie nahm einen Zwanziger heraus und bezahlte die Rechnung.
Gideon griff in seine Tasche – und stellte fest, dass ihre Brieftasche verschwunden war. Und seine eigene ebenso.
»O Mist«, sagte er automatisch, »ich muss draußen an Deck irgendwas fallen gelassen haben.« Er stand vom Barhocker auf – und stürzte. Verwirrt blickte er auf seine Schuhe – nur um festzustellen, dass die Schnürsenkel zusammengebunden waren. Als er hochschaute, sah er, dass Alex übermütig lachte, sie hielt seine Brieftasche in der Hand – und seine Armbanduhr.
»Also, Gideon?«, sagte sie zwischen zwei Lachanfällen. »Wie war das noch gleich mit den Grundlagen?«
7
Gideon errötete vor Verlegenheit. Gott, er kam sich vor wie ein Idiot. Er löste die Schnürsenkel, während Alex über ihm stand und keinerlei Anstalten machte, ihr Triumphgefühl zu verbergen. Er stand auf und staubte sich ab. Seine Verlegenheit verwandelte sich langsam in ein anderes Gefühl, als sie ihm die Brieftasche und die Armbanduhr zurückgab.
»Sind Sie denn gar nicht wütend?«, fragte sie, als sie die Fassung wiedergewonnen hatte.
Er sah sie an: ihr leuchtendes Gesicht, das Funkeln in den achatgrünen Augen, die langen, widerspenstigen Locken, die auf die sonnengebräunten Schultern fielen, die Brüste ein wenig bebend nach dem Lachanfall kurz zuvor. Da hatte sie ihn gedemütigt – und wie reagierte er darauf? Mit überwältigender Begierde.
Er wandte den Blick ab. »Ich hab’s wohl nicht anders verdient.« Er warf dem Barkeeper einen kurzen Blick zu, aber der verzog keine Miene, so, als hätte er nichts mitbekommen.
»Möchten Sie immer noch, dass ich Ihnen die Mannschaftsunterkünfte zeige?«, fragte sie.
»Ja, klar.«
Sie drehte sich um und eilte mit langen Schritten aus der Bar, dann durch den Speisesaal; er folgte ihr. Dann ging’s wieder durch ein Labyrinth aus Gängen und Treppen, durch eine wasserdichte Schott-Tür und über einen langen Flur mit Zimmern auf beiden Seiten.
Vor einer der Türen blieb Alex stehen und öffnete sie. »Die Einzelkabinen der Wissenschaftler … das hier ist meine.«
Er betrat hinter ihr das Zimmer, das überraschend geräumig war: schmales Doppelbett, zwei Bullaugen, Einbau-Kleiderschrank, kleiner Schreibtisch mit Laptop, Spiegel, die Wände cremeweiß gestrichen.
»Hier ist mein Bad.« Sie zog eine weitere Tür auf, so dass ein kleines Badezimmer mit einem dritten Bullauge zum Vorschein kam.
»Sehr schön. Ist ein super Zimmer für eine … na ja, Wissenschaftlerin.«
Sie drehte sich um. »Ich bin hier nicht nur als DSV-Fahrerin angestellt. Wie Sie sicher wissen, bin ich die leitende Ozeanographin der Mission. Ich arbeite jetzt seit fünf Jahren für EES.«
»Ehrlich gesagt, habe ich das nicht gewusst. Ich bin auch nicht richtig gebrieft worden. Wieso bin ich Ihnen noch nie begegnet?«
»Sie kennen doch Glinns Vorliebe für Bereichsbildung.«
»Und in welcher Beziehung stehen Sie zu Garza?«
»Er ist Ingenieur, ich bin Wissenschaftlerin. EES hat keine gewöhnliche Unternehmensstruktur, wie Ihnen sicherlich klargeworden ist. Die Dinge ändern sich von Mission zu Mission.«
Er nickte und sah ihr zu, wie sie mit fließenden, anmutigen Bewegungen im Zimmer herumging. Sie hatte die Figur einer Schwimmerin, geschmeidig und athletisch. Er hatte sich geschworen, absolut geschworen, sich auf gar keinen Fall auf Liebeshändel einzulassen. Angesichts des ärztlichen Todesurteils, das über ihm schwebte, wäre das nicht fair, weder für ihn noch für die Frau. Aber das war graue Theorie, Alex war wirklich.