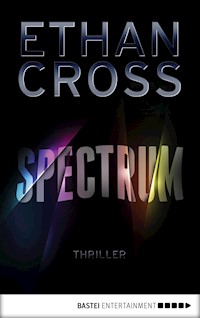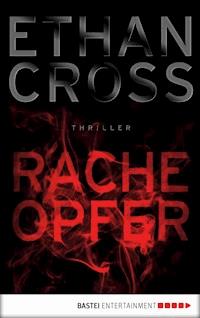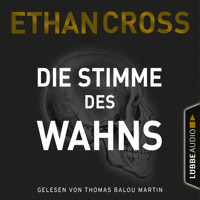Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Shepherd Thriller
- Sprache: Deutsch
Die Shepherd Organization wurde gegründet, um besonders grausame Fälle aufzuklären. Diesmal haben es Marcus Williams und sein Team mit dem "Anstifter" zu tun, einem Killer, der zuerst die Familie eines unbescholtenen Mannes entführt, bevor er diesem befiehlt, einen anderen unbescholtenen Mann zu töten. Weigert sich der Erpresste, werden seine Lieben brutal ermordet. Auf der Jagd erhält Marcus Hilfe von seinem Bruder, dem Serienkiller Francis Ackerman jr. Denn dieser weiß, wer hinter dem Anstifter steckt: sein Vater. Der, der ihn zu dem gemacht hat, was er ist: dem absolut Bösen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 23 min
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Erster Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Zweiter Teil
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Dritter Teil
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Über den Autor
Ethan Cross ist das Pseudonym eines amerikanischen Thriller-Autors, der mit seiner Frau und zwei Töchtern in Illinois lebt. Nach einer Zeit als Musiker nahm Ethan Cross sich vor, die Welt fiktiver Serienkiller um ein besonderes Exemplar zu bereichern. Francis Ackerman junior bringt seitdem zahlreiche Leser um den Schlaf und geistert durch ihre Albträume. ICHBINDER SCHMERZ ist der dritte Band um den gnadenlosen Serienkiller und seinen Verfolger, Marcus Williams.
Ethan Cross
ICH BIN DERSCHMERZ
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonDietmar Schmidt
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Aaron Brown
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Father of Fear«
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Judith Mandt
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus, Oberhausen
Umschlaggestaltung: Massimo Peter
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1404-5
be-ebooks.de
lesejury.de
Für meine Tochter Madison,auch wenn sie zu ängstlich ist,meine Bücher zu lesen.
Prolog
Donny Jeung überlegte, ob er die Dienstmarke ablegen sollte, ehe er sich den Schuss setzte. Es war ein flüchtiger, eigentümlicher Gedanke. Was spielte es schon für eine Rolle, ob er die Uniform auszog, Dienstmarke und Waffe ablegte? Ein Cop blieb er trotzdem. Und ein Junkie.
Diese Gedanken verflüchtigten sich, als er den Kolben in die Spritze drückte und das Heroin in seine Adern strömte. Donny lehnte sich an die Kloschüssel. Die Keramik war kühl auf seiner Haut. Geräusche, Gerüche, Farben – alles nahm eine übernatürliche, irreale Intensität an. Das Fichtenaroma des Lufterfrischers und der beißende Uringestank waberten über dem gedämpften Stimmengewirr und Tellerklirren im Speisesaal des Restaurants. Ein Hochgefühl erfasste Donny, und für ein paar Augenblicke konnte er den heftigen Streit mit seinem Vater vergessen.
Donnys Vater, Captain Dae-Hyun Jeung vom KCPD, dem Kansas City Police Department, war der höchstrangige koreanische Einwanderer im Strafverfolgungsapparat der Vereinigten Staaten. Sein größter Wunsch war, dass sein Sohn in seine Fußstapfen trat. Aber Donny hatte nie Polizist werden wollen; er war nur deshalb in die Akademie eingetreten, weil er seine begrenzten Möglichkeiten auf diese Weise am besten nutzen konnte.
Er zuckte zusammen, als das Funkgerät an seiner Schulter zu knistern und zu rauschen begann. »Donny, komm da raus«, quäkte eine Stimme. »Wir haben einen Einbruch.«
»Bin unterwegs.«
Donny riss sich zusammen, so gut er konnte. Er musste wieder einen klaren Kopf bekommen. Er drückte die Tür der Toilettenkabine auf, spritzte sich am Waschbecken kaltes Wasser ins Gesicht und schwebte auf dem Weg zum Streifenwagen an den Restaurantgästen vorbei – um diese Uhrzeit vor allem Betrunkene und Collegestudenten. Als er sich auf den Beifahrersitz fallen ließ, bemerkte er, wie sein Partner, ein hünenhafter Bursche namens Neil Wagner, ihn mit herablassenden Blicken musterte, ehe er vom Parkplatz fuhr.
Donny hätte Wagner den abfälligen Ausdruck am liebsten mit der Faust aus dem Gesicht gewischt. Dem Kerl hing die fette Wampe übers Koppel, und er stank nach Zigarettenqualm. Seinen letzten Sport-Eignungstest hatte er nur mit Ach und Krach bestanden. Trotzdem hatte der Fettsack die Frechheit, ihn, Donny, wegen ein paar harmloser Privatvergnügen zu verurteilen. Zum Glück war Wagner nicht so dumm, dass er etwas gesagt oder Donny gar angeschwärzt hätte. Was solche Dinge anging, machte es sich bezahlt, dass Donny der Sohn von Captain Dae-Hyun Jeung war. Nicht dass sein Vater ihn aus Liebe geschützt hätte; vielmehr wollte Jeung seinen glänzenden Ruf wahren, damit er seinen Traum verwirklichen konnte, eines Tages Commissioner zu werden.
Auf Straßen, an denen sich bescheidene, schmucke neue Häuser mit gepflegten Gärten reihten, folgten sie der Barry Road in die Jefferson Highlands. Die Häuser standen ein Stück von der Straße weg; Schatten verdeckten die Hausnummern und Eingänge.
Als sie das Haus fanden, aus dem angerufen worden war, hielt Wagner am Bordstein. Sie stiegen aus und sahen auf dem Grundstück nach dem Rechten. Donny überprüfte die Ostseite des Hauses, während Neil es im Westen im Augenschein nahm.
Als Donny die Fenster auf Spuren gewaltsamen Eindringens absuchte, tanzte der Strahl seiner Taschenlampe über die roten Felsblöcke, mit denen der Garten gestaltet war. Sein Kopf fühlte sich an, als wäre er nicht richtig mit dem Oberkörper verbunden. Donny hatte Mühe, sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren. Er stolperte über einen Gartenzwerg mit roter Mütze, die zu seinen dicken Wangen passte. Donny kicherte, als er die merkwürdige kleine Figur sah; dann versetzte er ihr einen Tritt, und sie fiel um.
»Ich glaube, ich habe vorn etwas gehört. Ich gehe auf dem gleichen Weg zurück«, meldete Wagner über Funk.
»Verstanden.«
Donny ging weiter um das Haus herum zur Rückseite. Keine Schaukel, kein Sandkasten, kein Spielzeug. Also waren keine Kinder im Haus. Er beglückwünschte sich zu dieser Schlussfolgerung. Er hatte das Zeug zum Kriminalbeamten. Siehst du, Dad?
»Donny, zurück zum Wagen. Wir sind am falschen …«
»Keine Bewegung! Ich habe eine Waffe!«, kreischte in diesem Moment eine Stimme hinter Donny. Er erschrak so heftig, dass er instinktiv handelte: Er fuhr herum, ließ sich auf ein Knie fallen und feuerte auf die schattenhafte Gestalt.
Eine dünne Stimme schrie vor Schmerz, und die Gestalt sank auf dem Rasen hinter dem Haus zusammen. Donny hielt die Waffe auf den reglosen Angreifer gerichtet. Er hörte Schritte, die sich rasch näherten. Als er aufblickte, kam Wagner zu ihm, außer Atem und mit weit aufgerissenen Augen.
Donny verharrte in Schießhaltung, die Waffe in den vorgestreckten Armen, während Wagner das Licht seiner Taschenlampe auf den Angreifer richtete. Dann kniete er nieder, fühlte nach dem Puls und erhob sich mühsam. »Scheiße! Mann, was bist du für ein dämlicher Sack!« Wagner stieß eine lange Folge von Schimpfwörtern hervor und raufte sich das struppige braune Haar, während er auf dem gepflegten Rasen auf und ab stapfte.
»Immer mit der Ruhe«, sagte Donny. »Der Kerl wollte mich abknallen. Ich habe mich nur verteidigt.«
Mit verzerrtem Gesicht trat Wagner auf ihn zu, packte ihn am Kragen und zog ihn zu der Leiche. »Sieh dir das an. Das ist eine alte Frau! Ich hab dir doch gesagt, wir sind am falschen Haus. Wahrscheinlich hat sie uns für Einbrecher gehalten!«
»Sie hatte eine Waffe.«
»Wo denn? Siehst du hier eine Waffe? Ist dir eigentlich klar, was du getan hast?«
Donny suchte nach Antworten. Im Geiste ging er die Sekunden bis zum tödlichen Schuss noch einmal durch. »Es war Notwehr«, sagte er dann.
»Wir sind im Arsch, Donny! Du hast gerade eine harmlose alte Frau in ihrem eigenen Garten erschossen.«
»Ich … es war meine Schuld. Du hast nichts falsch gemacht. Ich übernehme die alleinige Verantwortung.«
Wagner stieß Donny mit dem Finger gegen die Brust. »Du naives Arschloch. So einfach ist das nicht. Mit der Nummer hast du das ganze Department in die Scheiße geritten. Die Medien werden uns zur Schnecke machen. Womöglich kommt deine kleine Rauschgiftgeschichte ans Licht. Und dann ist dein Alter erledigt.«
»Ich dachte … ich … die Frau …«
»Du hast eben nicht gedacht, du blöder Wichser. Das ist ja das Problem. Halt jetzt die Klappe und tu, was ich dir sage. Ich rufe deinen Alten an, und dann überlegen wir uns, wie wir aus der Sache rauskommen.«
Erster Teil
1
Ihr richtiger Name war Rhonda Haynie, aber ihre Kunden nannten sie nur »Scarlett«. Keiner von ihnen hatte sie je nach ihrem Nachnamen gefragt oder wissen wollen, ob wirklich Scarlett in ihrer Geburtsurkunde stand. Die Männer, die sie bezahlten, interessierten sich nicht für sie als Person. Sie zahlten für ein Fantasiebild, und das bekamen sie auch. Einige dieser Fantasien stießen an die Grenzen dessen, was Rhonda für Geld zu tun bereit war; sie offenbarten in manchen Menschen, die nach außen ganz normal wirkten, Abgründe an Perversion.
Als Rhonda die Tür des Motelzimmers öffnete, wusste sie sofort, dass der Job in dieser Nacht sie wieder an diese Grenzen führen würde.
Die Farbe an den Wänden hatte ihr Leben vermutlich als Mattweiß begonnen, war jedoch zu einem hässlichen Gelb gealtert. Eine einsame Lampe erhellte die hinterste Ecke des Zimmers, ließ den größten Teil aber im Dunkeln. Unter der Decke hingen keine Lampen, und das war gut so, denn auf diese Weise blieben die fleckige Bettwäsche und der Fußboden, der vermutlich einmal im Jahr gefegt wurde, vor den Blicken verborgen. Billige Drucke, die plätschernde Bäche und einsame Wälder zeigten, verdeckten ausgebesserte Stellen, wo betrunkene Bewohner Löcher in die Wände geschlagen hatten. Aus irgendeinem Grund waren sämtliche Bilder entfernt und in einer Ecke gestapelt worden. Das Bett war unberührt, aber eine Decke und ein Kopfkissen lagen zerknüllt vor der gegenüberliegenden Wand auf dem Boden. Im Zimmer roch es, als hätte der Teppich tagelang draußen im Regen gehangen.
Kein Wunder, dass die anderen Zimmer des Motels frei zu sein schienen und auf dem Parkplatz kein Auto stand.
Dann sah Rhonda den Kunden. Er hatte einen alten Schreibtischstuhl mitten ins Zimmer gestellt und sich mit Handschellen darangekettet. Nun saß er da, ohne Hemd, und starrte an die Wand – eine in Dunkelheit gehüllte, gespenstische Gestalt.
Rhonda überkam ein ungutes Gefühl, aber die Miete musste bezahlt werden, also trat sie vorsichtig ins Zimmer und schloss die Tür hinter sich.
»Hallo, Darling. Offenbar bist du schon bereit für mich«, säuselte sie, trat an die Kommode und schaltete eine weitere kleine Lampe ein.
Als sie sah, was das Licht offenbarte, schnappte sie nach Luft.
Narben bedeckten Brust und Arme des Mannes. Als Rhonda noch auf den Straßen gelebt hatte, hatte sie vieles gesehen, aber so etwas nie: Verbrennungen, Schnittwunden, Schusswunden. Mehr Narbengewebe als gesunde Haut. Der Körper des Mannes war ein lebender Leitfaden für Schmerz und Leid.
»Stimmt was nicht?«, fragte er mit tiefer, fester Stimme.
Rhonda zwang sich, dem Mann zum ersten Mal ins Gesicht zu blicken. Es passte nicht zum verunstalteten Körper. Es war ein attraktives Gesicht. Jung. Ausdrucksstark. Wache, kluge Augen.
Rhonda fragte sich oft, was ihre Kunden dazu bewog, die Dienste einer Frau in Anspruch zu nehmen, wie sie eine war. Bei diesem Mann waren die Gründe offensichtlich. Wer wagte sich mit solchen Narben schon ans Tageslicht?
Rhonda schenkte ihm ihr verführerischstes Lächeln. »Nein, Süßer, alles in Ordnung. Gib mir ’ne Minute, um mich frisch zu machen, dann fangen wir an.«
Sie ging zum Bad, doch seine nächsten Worte ließen sie innehalten. »Das brauchen Sie nicht. Zwischen uns wird es keinerlei sexuelle Aktivität geben.«
»Was?« Rhonda erstarrte. »An was für Aktivitäten hast du … haben Sie denn gedacht?«
»Auf der Kommode liegt ein Messer. Ich möchte, dass Sie mich damit schneiden. Drücken Sie mir die Spitze ins Fleisch und machen Sie einen schönen langen Schnitt. Fangen Sie an einem Trizeps an.«
Rhonda hatte in ihrem Job mehr als genug verrückte Aufforderungen erhalten. Manche Männer wollten geschlagen, ausgepeitscht oder sonst wie gedemütigt werden, oder sie, Rhonda, musste sich die abgefahrensten Outfits anziehen, um den Typen ihre kranken Fantasien zu erfüllen. Aber noch nie hatte ein Kunde sie gebeten, ihn körperlich zu verletzen. Allein der Gedanke verursachte Rhonda Übelkeit.
»Ihre Agentur hat mir versichert, dass Sie die abenteuerlustigste Dame sind, die sie zu bieten hat. Neben dem Messer liegt Geld. Da, auf der Kommode. Es ist das Dreifache des vereinbarten Betrages.«
Rhonda blickte auf die Kommode und sah die Geldscheine. Nach der Dicke der Rolle zu urteilen, sagte der Mann die Wahrheit. Dennoch, sie kannte ihre Grenzen. So etwas konnte sie nicht machen. Sie wollte nicht einmal in der Nähe eines Perversen bleiben, der sie zu so etwas aufforderte.
Dann kam ihr eine Idee. »Sind die Handschellen echt?« Ein ängstlicher Unterton ließ ihre Stimme zittern.
»Standardausführung der Polizei.«
»Und wie wollen Sie die Dinger loswerden, wenn wir fertig sind? Sind Sie Zauberer?« Rhonda versuchte zu lachen, doch selbst in ihren eigenen Ohren klang es gezwungen.
Der Mann lächelte, ohne dass die Heiterkeit seine Augen erreichte. »Ich bin davon ausgegangen, dass Sie so freundlich wären, die Handschellen zu öffnen. Der Schlüssel liegt ebenfalls auf der Kommode.«
»Schön. Das habe ich gehofft.«
Rhonda klopfte ihm auf die Schulter, schnappte sich Geld und Schlüssel und hetzte zur Tür. Ihre Finger schlossen sich um den Knauf. Im gleichen Augenblick traf sie etwas von hinten. Starke Hände packten sie bei den Schultern, rissen sie herum, rammten sie mit dem Rücken gegen die Türfüllung.
Der verunstaltete Mann drückte Rhonda eine Messerklinge an den Hals, ohne die Haut zu ritzen. Sein Atem war heiß auf ihrer bloßen Haut. »Ich möchte mich entschuldigen, sollte ich den Eindruck erweckt haben, an den Stuhl gekettet zu sein. Wegen der vielen Narben auf meinen Unterarmen sind meine Handgelenke so dick, wie meine Hände breit sind. Das ist sehr praktisch, wenn ich mich von Handschellen befreien möchte. Sie sollten verhindern, dass ich im Reflex zuschlage, wenn Sie die Schnitte machen. Sie dienten zu Ihrem Schutz.«
Rhonda liefen Tränen über die Wagen und hinterließen Streifen in ihrem Make-up. »Bitte, ich …«
Der Mann nahm das Messer von ihrer Kehle und beugte sich näher an sie heran. »Ich sollte mit meinem Urteil wohl nicht allzu streng sein. Ich bewundere Frauen mit Initiative, deshalb werde ich Ihnen den Versuch, mich übers Ohr zu hauen, nicht übel nehmen. Aber zwischen uns beiden besteht ein mündliches Abkommen, und Sie haben Ihren Teil noch nicht erfüllt.«
Rhondas Hand wanderte hinauf zum Oberschenkel. Sie zog ihren schwarzen Minirock hoch. Darunter hielt sie ein kleines Springmesser versteckt – für Situationen wie diese. »Sie wollen von mir geschnitten werden?« Sie ertastete den Metallgriff, zog das Messer und drückte den Knopf, der die Klinge herausspringen ließ. »Wie wär’s für den Anfang damit?«
Rhonda rammte ihm das Messer ins Bein und stieß ihn von sich weg. Sie rechnete fest damit, dass er zu Boden ging, aber er blieb auf den Beinen und warf sich gegen die Zimmertür, sodass Rhonda nicht hindurchkam. Mit einem schrillen Schrei rannte sie zum Bad und wäre beinahe über den Stuhl in der Zimmermitte gestürzt. Kaum war sie im Bad, knallte sie die Tür hinter sich zu und schloss ab.
Mintgrüne Fliesen bedeckten die Wände. In dem kleinen Raum stank es nach Schimmel und Urin.
Ein wuchtiger Schlag ließ den Türrahmen erzittern. »Sie strapazieren meine Geduld«, sagte der Mann auf der anderen Seite der Tür mit ruhiger Stimme.
Rhonda zitterte am ganzen Körper und wischte sich die blutigen Hände am Kleid ab, während sie sich hastig nach einem Ausweg umsah. Der weiße Duschvorhang war dünn; Licht schimmerte hindurch. Sie riss ihn so wild beiseite, dass die Vorhangringe zersprangen und mit leisem Klirren auf den gefliesten Boden regneten.
In der Wand hinter der Dusche war ein Fenster. Rhonda kletterte in die Wanne und versuchte, den Fensterrahmen hochzuschieben. Er rührte sich nicht. Sie entdeckte einen Riegel, legte ihn um, schob noch einmal. Das Fenster bewegte sich keinen Millimeter. Offenbar hatten Lack oder Farbe es verklebt.
Die Badezimmertür flog auf. Das Holz splitterte, der Knauf schmetterte gegen die Kacheln an der Wand. Die grüne Keramik bekam Risse, splitterte und prasselte zu Boden.
Rhonda schrie auf, doch der Mann war bereits bei ihr. Sein Griff war fest wie ein Schraubstock. Er drückte ihr die Luftröhre zusammen, schnitt ihren Schrei ab und hob sie aus der Wanne.
Rhonda kratzte an seiner Hand und trat ihn, doch er war viel zu stark für sie. Ihre Gegenwehr erlahmte. Ihr wurde schwarz vor Augen.
In diesem Moment erkannte Rhonda, dass sie sterben würde. Sie würde ihr kleines Mädchen nie wiedersehen, würde ihrer Großmutter nie sagen können, wie leid es ihr tat, nach dem Tod ihrer Eltern durchgebrannt zu sein.
Rhonda fragte sich benommen, was der Mann mit ihrer Leiche anstellte. Würde er sie verstümmeln? Sie irgendwo verscharren, wo die Käfer sie fraßen? Sie stellte sich vor, wie Maden sich durch ihre Adern wanden …
Der Mann hob das Messer, betrachtete versonnen die Klinge. Das Licht, das durchs Fenster fiel, funkelte und tanzte über das Metall.
So also ist der Tod …
Rhonda versuchte, nicht an die Schmerzen zu denken, die ihr bevorstanden. Würde er ihr das Messer in den Bauch rammen, wieder und wieder, und jeden Stoß auf perverse Weise genießen? Oder würde er ihr die Kehle durchschneiden und sie rasch verbluten lassen? Stumm erflehte sie einen schnellen Tod.
Die Klinge näherte sich ihr. Rhonda wollte die Augen schließen, wollte sich den Anblick des eigenen Blutes ersparen. Doch aus irgendeinem Grund weigerten sich ihre Lider, dem Befehl zu gehorchen, den ihr Hirn ihnen erteilte. Rhonda beobachtete, wie die Klinge ganz nahe vor ihrem Gesicht über den Unterarm des Mannes strich und drei lange Schnitte machte. Blut quoll hervor, tropfte in die Badewanne. Der Mann schloss die Augen, als wollte er den Moment auskosten, und leckte die Klinge ab. Dann lockerte er den Griff und trat zwei Schritte zurück.
Rhonda sank auf die Knie, holte gierig Luft und schluchzte so heftig, dass sie am ganzen Körper bebte. Als sie den Blick hob, saß der Mann auf der Toilettenschüssel und beobachtete sie. Dann atmete er tief ein und sagte: »Ich möchte mich entschuldigen. Für einen Moment ist mir die Sicherung durchgebrannt. Ich wollte Ihnen nicht wehtun. Wissen Sie, es ist das erste Mal, dass ich jemanden aus Ihrem Berufsstand herangezogen habe.«
Rhonda tastete nach dem Badewannenrand und drückte sich hoch. Kaum stand sie, wollte sie zur Tür, doch der Mann schien ihre Absicht erahnt zu haben, denn er verstellte ihr blitzschnell den Weg.
»Wie heißen Sie? Sagen Sie mir Ihren richtigen Namen.«
»Leck mich.« Rhondas Kehle fühlte sich an, als hätte sie Sandpapier verschluckt.
Er trat näher, kniff die Augen zusammen. »Ich habe schon viele Menschen getötet, Männer und Frauen. Mit Messern und Schusswaffen, mit Feuer und mit den bloßen Händen. Ich habe ein widernatürliches Talent, Leben auszulöschen. Bei Ihnen jedoch versuche ich, Güte zu zeigen. Deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir wenigstens ein wenig Respekt erwiesen. Wie heißen Sie?«
»Rhonda …«, sagte sie unter Tränen.
»Danke, Rhonda. Es sind Augenblicke wie dieser, in denen ein Mensch mit seiner Existenz und seinem Platz auf Erden ins Reine kommen muss. Wir alle bereuen das eine oder andere. Manche Fehler kann man wiedergutmachen, andere nicht. Es kommt darauf an, dass man den Unterschied erkennt und entsprechend handelt. In der Vergangenheit hätte es mir große Freude bereitet, Sie zu töten. Ich hätte Ihr Sterben in die Länge gezogen und jeden noch so kleinen, köstlichen Augenblick des Schmerzes genossen. Inzwischen aber weiß ich, dass es auf der Welt drei Arten von Menschen gibt: Im tiefsten Innern sind wir entweder Schöpfer, Bewahrer oder Zerstörer.«
Er machte noch einen Schritt auf sie zu und packte sie bei den Händen. Sie zuckte nicht vor der Berührung zurück, stand einfach nur da, wie gelähmt und hypnotisiert von seinem durchdringenden Blick.
»Bewahrer erhalten den Status quo aufrecht. Sie sind die Arbeiterbienen unseres kleinen Stocks, den wir Zivilisation nennen. Sie sorgen dafür, dass die kosmischen Rädchen sich weiterdrehen. Dazu wurden sie gemacht. Ohne die Bewahrer würde unsere Wirklichkeit in sich zusammenbrechen. Dann gibt es die Schöpfer. Diese seltenen Exemplare entdecken immer wieder Neues. Sie denken anders als alle anderen. Sie zerreißen die Ketten der Angst und bringen Schönes hervor, nie Dagewesenes, Einzigartiges. Aber ich bin kein Schöpfer, und auch kein Bewahrer. Ich gehöre zur dritten Gruppe, den Zerstörern. Aber ich möchte besser sein, mehr sein als die anderen. Leider habe ich feststellen müssen, dass ich mich nur lebendig fühle, wenn ich anderen Schmerz zufüge oder selbst Schmerzen erleide.«
Der Mann hielt Rhondas Hand fest, während er sie mit sanftem Nachdruck zurück ins Motelzimmer zog. »Deshalb möchte ich Sie bitten, mir einen Gefallen zu erweisen. Ich möchte, dass Sie mir helfen, ein besserer Mensch zu werden. Helfen Sie mir, meine Natur als Zerstörer zu überwinden und eine Person zu werden, die anders ist, mehr ist.«
Er wies auf den Stuhl und drückte Rhonda das Messer in die Hand. Sie starrte verwirrt darauf. Als ihr Blick zum Gesicht des Mannes zurückkehrte, lächelte er und fragte: »Sind Sie bereit?«
2
Marcus Williams blickte an die Decke seines Büros, zählte die Punkte auf den Fliesen und versuchte, das entsetzliche Pochen in seinem Schädel zu ignorieren. Der pulsierende Schmerz bearbeitete die Rückseiten seiner Augäpfel wie mit kleinen Hämmern. Hätte jemand ihm glaubhaft versichert, es würde die Schmerzen lindern, sich ein Loch in den Schädel zu bohren – er stünde jetzt schon vor einem Eisenwarengeschäft und würde darauf warten, dass der Laden aufmacht.
Marcus fragte sich benommen, ob die Kopfschmerzen verschwanden, wenn er nicht mehr für die Shepherd Organization arbeitete. Nach außen hin präsentierte sich die Organisation als eine Art Denkfabrik, die im Auftrag des Justizministeriums tätig war. In Wahrheit war die Organization mit der Aufgabe betraut, Serienkiller zur Strecke zu bringen – mit allen Mitteln, selbst wenn das Gesetz gebeugt oder gebrochen werden musste.
Marcus zog sanft den Arm unter Maggie Carlisles nacktem Körper hervor. Sie bewegte sich träge, rollte die Schultern und sagte müde: »Du brauchst endlich mal ein richtiges Bett.«
»Das ist ein richtiges Bett.«
»Das ist ein Futon. In der Todeszelle schläft man besser als bei dir.«
»Ich weiß nun mal, wie man Mädels behandelt.«
Marcus erhob sich. Der dünne Stahlrohrrahmen des Futons knarrte, als er sein Gewicht verlagerte.
Maggie gähnte. »Wo willst du hin?«
»Nirgendwohin. Schlaf weiter. Ich brauch eine Schmerztablette. Mir platzt der Schädel.«
Maggie drehte sich herum und zeigte ihren wundervoll geschwungenen, gebräunten Rücken und ihr goldblondes Haar.
Marcus betrachtete sie stumm. Ihre Beziehung war von Anfang an schwierig gewesen. Sie hatten eine Art Pattsituation erreicht, doch seit dem Zwischenfall mit einem Serienkiller in Chicago schien es, als käme er, Marcus, nicht mehr richtig an Maggie heran. Er hatte sie gebeten, sich von der Shepherd Organization zu trennen, Schmerz, Tod und Finsternis hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen. Normal zu sein.
Doch Maggie hatte ihn abblitzen lassen. Sie hatte ihren Job ihm, Marcus, vorgezogen. Das gefiel ihm verständlicherweise nicht, und auch wenn er versucht hatte, sich dagegen zu wehren, überschattete sein noch immer schwelender Zorn ihre Beziehung. Marcus hatte schon einmal darum gekämpft, dass zwischen ihnen alles wieder in Ordnung kam; jetzt hatte er nicht mehr die Energie, um weiterzukämpfen. Wozu auch?
Marcus blickte sich im Büro um und betrachtete seine Sammlung von Filmdevotionalien und Requisiten, die bei Dreharbeiten benutzt worden waren. Ein Indiana-Jones-Hut. Die Replik einer Pulse Rifle aus Alien. Carl Weathers’ abgetrennter Arm aus Predator. Für das, was er dafür hingeblättert hatte, hätte er sich ein Haus in der Vorstadt kaufen können.
Doch Marcus wollte kein Haus. Früher vielleicht, jetzt nicht mehr. Er würde niemals ein Normalbürger sein; je eher er das akzeptierte, desto besser. Fast alles, was ihm gehörte, befand sich in diesem Zimmer. Er aß, schlief und arbeitete hier, wenn er nicht unterwegs war, was aber nicht allzu oft vorkam.
Normalerweise wäre er jetzt unterwegs. Er würde einen Killer verfolgen, der unter dem Namen »Anstifter« berüchtigt war. Doch man hatte Marcus für irgendeinen Psychotest nach Washington zurückgerufen. Vorschrift. Marcus’ Chef, den er nur als »Director« kannte, behauptete, der Test wäre nichts Besonderes, bloß einer von vielen Reifen, durch den die Sesselfurzer einen springen ließen wie einen dressierten Hund. Doch Marcus hatte den Verdacht, dass mehr dahintersteckte. Denn er wusste nur zu gut, dass seine Arbeitsleistung mittlerweile unter seinen Kopfschmerzen und der Schlaflosigkeit litt.
Mit den Fingerspitzen fuhr Marcus über die dunkle Maserung der Schreibtischplatte, während er den Arbeitsbereich umrundete. Dann setzte er sich, zog eine Schublade auf und nahm seine Tabletten und eine Flasche achtzehn Jahre alten Glenfiddich heraus. Das Oxycodon, ein Schmerzmittel, spülte er mit einem großen Schluck Scotch gleich aus der Flasche herunter. Seine Augen füllten sich mit Tränen, und er verzog das Gesicht, als die dunkle Flüssigkeit ihm durch die Kehle rann.
Dann lehnte er sich zurück, wartete mit geschlossenen Augen, dass das Opioid den Schmerz dämpfte. Nach ungefähr zwei Minuten wollte er zurück zum Bett, blieb aber stehen, als irgendetwas an seinem Bein vibrierte. Das Handy. Nur eine Hand voll Leute kannte seine Handynummer, und ein Anruf so spät am Abend bedeutete nie etwas Gutes. Zwei Erklärungen waren denkbar: Entweder war es der Director, weil es einen dringenden Fall gab, oder Marcus’ älterer Bruder Frank wollte ein bisschen plaudern.
Für die meisten Menschen hätte der Anruf eines nahen Verwandten auch zu so später Stunde kein allzu großes Ärgernis bedeutet. Doch wenn der eigene Bruder zu den meistgesuchten Verbrechern des Landes zählte und ein berüchtigter Serienkiller war, bekam ein Anruf am späten Abend eine ganz andere Dimension. Dennoch, Familie blieb Familie, und außer Frank hatte Marcus niemanden mehr.
Er blickte aufs Display, erkannte die Nummer aber nicht, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bedeutete, dass Frank mit einem Wegwerfhandy anrief.
Marcus und Frank Ackerman hatten die gleichen Eltern, waren aber nicht zusammen aufgewachsen. Erst vor Kurzem hatte Marcus von ihrer Verwandtschaft erfahren. Seine Mutter hatte ihren Mann heimlich verlassen, als sie mit Marcus schwanger war, und seinen Bruder Frank der Hölle auf Erden ausgeliefert – einem Leben, das vom Sadismus ihres gemeinsamen Erzeugers bestimmt wurde. Ackerman senior war ein wenig angesehener Psychologe gewesen, dessen großes Ziel es war, den Verstand von Serienmördern zu erforschen. Dieses Ziel hatte er zu erreichen versucht, indem er den eigenen Sohn, Frank, zu einem dieser Monster machte.
Frank hatte jahrelang eine Hölle aus Folter, Demütigung und Schmerz erduldet. Eine Hölle, aus der es kein Entrinnen gab. Mit dem zweifelhaften Erfolg, dass er als Erwachsener eine Perlenschnur aus Leichen zog, die von einer Küste der Vereinigten Staaten bis zur anderen reichte, wobei die genaue Anzahl der Ermordeten bis jetzt unbekannt war.
Marcus konnte nicht anders, er empfand Mitgefühl für seinen Bruder. Marcus selbst war von einem New Yorker Polizisten in einem harmonischen, liebevollen Umfeld aufgezogen worden – bis zu dem Tag, an dem seine Pflegeeltern ermordet wurden. Danach hatte seine Tante sich um ihn gekümmert, so gut es ihr möglich gewesen war.
Dennoch war Marcus’ Wesen von Gewalttätigkeit, Düsternis und Brutalität geprägt. Trotz seiner normalen Kindheit konnte man ihn selbst keineswegs als normal bezeichnen.
Und seinen Bruder Frank noch viel weniger. Aber Frank hatte die Chancen, die Marcus erhalten hatte, ohne sie zu nutzen, gar nicht erst bekommen. Das hatte seine mörderischen Neigungen so sehr verstärkt, dass sie ihm zur zweiten Natur geworden waren. Bei den Strafverfolgungsbehörden war man überzeugt, dass Frank zwanghaft tötete.
Marcus schüttelte diese Gedanken ab und nahm das Gespräch an. »Ja?«
»Mein lieber Marcus! Tut gut, deine Stimme zu hören. Hast du mich vermisst, Bruderherz?«
»Was willst du, Frank? Ich habe schon geschlafen.«
»Nein, hast du nicht. Weißt du eigentlich, dass du der Einzige bist, der mich mit Frank anredet?«
»Nein, weiß ich nicht. Würdest du zur Sache kommen?«
»Du hast aber ’ne Scheißlaune. Die Kopfschmerzen werden schlimmer, habe ich recht?«
»Ja, und du machst sie auch nicht gerade besser.«
»Tut mir leid. Ich möchte dir nicht zur Last fallen. Ich wollte dir auch nur schnell sagen, dass ich ein braver Junge gewesen bin.«
Marcus ging ans Fenster und betrachtete die Bäume im nächtlichen Nordvirginia, die sich im Dunkeln wiegten, während er Frank zuhörte, der von seiner Begegnung mit einer Prostituierten erzählte. Er endete mit den Worten: »Du hast mir das Versprechen abgenommen, dass ich niemanden umbringe, wenn du weiter meine Anrufe entgegennehmen sollst. Ich habe mich bemüht, dieses Versprechen zu halten, auch wenn ich es als ziemlich extrem betrachte, wenn nicht sogar als ungerecht. Schließlich erfordern manche Situationen, dass man tötet, weil …«
»Nein«, fiel Marcus ihm ins Wort. »Nie.«
»Ach? Auch du tötest Menschen, schon vergessen?«
»Ich bin müde, Frank. Ich würde gern ein bisschen schlafen.«
»Ich habe gestern eine Filmvorschau gesehen, die mich nachdenklich gestimmt hat. Es ging um die Zeit nach dem Weltuntergang und handelte von den Überlebenden. Die Einzelheiten sind nicht von Bedeutung, aber mir ist klar geworden, dass ich in einer solchen Welt ein Held wäre, vielleicht sogar ein König, und …«
»Hochkönig der atomaren Wüste. Ja, das würde zu dir passen. Ich gehe wieder ins Bett.«
»… und dieser Gedanke ebnete den Weg zu anderen Einsichten. Überleg doch mal: In jeder anderen historischen Epoche hätten unsere Fähigkeiten uns zu begehrten Männern gemacht, zu Superstars, nicht zu den Ausgestoßenen, die wir heute sind. Im antiken Griechenland wäre ich vielleicht der Rivale des Achill gewesen, und du hättest mein Hektor sein können. Während der Spanischen Inquisition oder im Mittelalter hätte für meine Fähigkeiten im Zufügen von Schmerzen enormer Bedarf bestanden. Sogar in der nicht allzu fernen Vergangenheit des Wilden Westens wäre ich ein Volksheld gewesen wie Billy the Kid.«
»Oh ja, du trittst für den kleinen Mann ein. Es sei denn, du ermordest ihn im Schlaf.«
»Ich habe noch nie jemanden im Schlaf ermordet. Ich wecke sie vorher immer auf. Aber überleg doch mal. Heutzutage gibt es so viele Mörder, weil Männer mit unseren Gaben keinen ordentlichen Beruf mehr finden, der als Ventil für ihren natürlichen Raubtierinstinkt dienen könnte. Das ist doch wert, dass man darüber nachdenkt. Träum süß, Bruder.«
Frank legte auf.
Marcus ging zum Schreibtisch zurück, öffnete erneut die Schublade und warf sich noch zwei Tabletten ein.
3
Josh Stefanson hatte sich nie als Helden betrachtet, war aber zuversichtlich, jeder Situation gewachsen zu sein, wenn es darauf ankam. Auch wenn sein Schreibtischjob in einem Architektenbüro physisch und psychisch keine solche Herausforderung darstellte wie der Beruf eines Feuerwehrmannes oder Polizisten, hatte Josh immer geglaubt, seine Familie beschützen zu können. Jetzt bekam er die Gelegenheit herauszufinden, ob er recht hatte.
Josh kannte die Fernsehberichte über den Killer, der Kansas City heimsuchte. Die Medien hatten ihn den »Anstifter« genannt. Josh hatte nie groß über solche Dinge nachgedacht. Die Wahrscheinlichkeit, einem Serienkiller über den Weg zu laufen, war mikroskopisch gering – zu gering, als dass Josh seine Sicherheit oder die seiner Familie in Zweifel zog. Das nächste Opfer des Anstifters zu werden war genauso unwahrscheinlich, wie im Lotto zu gewinnen.
Doch es gab Lottogewinner.
Josh lenkte den kleinen blauen Nissan auf den Parkplatz und entdeckte eine Parknische unmittelbar vor dem Eingang. Der Parkplatz war fast leer; nur drei andere Pkw, die offenbar Angestellten gehörten, standen weit hinten. Sehr gut. Das bedeutete, dass es keine Zeugen gab.
Joshs Hände zitterten. Schweiß lief ihm übers Gesicht, und er machte sich nicht die Mühe, ihn abzuwischen. Der Revolver lag im Handschuhfach – ein .38 Special, der seinem Schwiegervater gehört hatte. Josh hatte nie mit Schusswaffen zu tun gehabt, doch Nancy, seine Frau, war auf einer Farm südlich von Kansas City aufgewachsen und hatte darauf bestanden, eine Waffe im Haus zu haben. Josh hätte nie geglaubt, dass er mal einen konkreten Grund haben würde, den Revolver in die Hand zu nehmen.
Er klappte das Handschuhfach auf und nahm die Waffe und eine Schachtel Munition heraus. Dabei zitterte er so sehr, dass mehrere Patronen in den Fußraum fielen. Sie klapperten gegen die Trommel der Waffe, als Josh sie mit bebenden Händen in die Kammer schob.
Sechs Patronen. Hoffentlich würde er nur eine brauchen.
Neben dem Tachometer hatte Josh ein Foto von Nancy und den Kindern ans Armaturenbrett geheftet. Er hatte es letzten Sommer am Blue Springs Lake aufgenommen. Josh betrachtete das Foto gern, wenn er im Stau steckte, und stellte sich vor, er läge auf dem Boot in der Sonne, ein Bier in der Hand, statt zur Arbeit zu fahren.
Als er versonnen die lächelnden Gesichter seiner Lieben betrachtete, wusste Josh, was er tun musste. Und zwar sofort. Wenn er lange nachdachte, würde sich seine Entschlossenheit in Luft auflösen. Entweder, er zog die Sache jetzt durch, oder Nancy und seine Kinder starben. So einfach war das. Für Zweifel oder Ausweichlösungen blieb kein Platz. Es hieß Schwarz oder Weiß. Zeit, seine Familie zu beschützen. Der Held zu sein, von dem Josh hoffte, dass er in ihm steckte.
Er schob den Revolver in die Tasche seiner Khakihose und stieg aus. Der Wind trug den Duft von Blumen und Pollen heran. Josh musste so kräftig niesen, dass ihm beinahe die Brille von der Nase geflogen wäre. Unter seinen Schuhen fühlte der Asphalt sich klebrig an. Die Sonne stach ihm in die Augen, die vom Weinen gereizt waren.
Er sah sein Ziel durch das Schaufenster des Buchladens, doch ein Hardcover verdeckte das Gesicht des Mannes. Der Laden war leer bis auf den Besitzer.
Die ganze Situation kam Josh surreal vor.
Als er den Laden betrat, schien er nicht durch die Tür zu gehen, sondern zu schweben, als wäre alles nur ein Traum. Ein Albtraum.
Die Tür öffnete sich, und eine Glocke kündete von Joshs Kommen. Der Besitzer senkte das Buch und begrüßte Josh mit einem Lächeln.
Josh sank der Mut. Der Mann hinter der Ladentheke wirkte überaus sympathisch. Er hatte freundliche Augen und lichtes graues Haar, und in seinem runzligen Gesicht stand dieses einladende Lächeln.
Verdammt. Verdammt.
Josh hob die Waffe, ohne zu bemerken, dass er sie aus der Hosentasche gezogen hatte. Das Lächeln des Mannes erlosch. Angst legte sich auf sein Gesicht.
»Es tut mir leid«, sagte Josh unter Tränen.
Der Mann hob die Hände. »Bitte … nehmen Sie alles Geld, was ich habe. Ich mache Ihnen keinen Ärger.«
Josh spannte den Hahn des Revolvers.
Der alte Mann schüttelte den Kopf und wich zurück. »Überlegen Sie, was Sie tun, mein Sohn.«
»Tut mir leid. Es gibt keine andere Möglichkeit.«
Der Mann schauderte, blieb angesichts der Situation aber erstaunlich gelassen. »Uns bleibt immer eine Wahl. Ich habe Ihnen nichts getan. Ich kenne Sie nicht mal. Ich bin ein ganz normaler Mann, der seine Familie wiedersehen möchte.«
»Ich auch«, sagte Josh und drückte ab.
4
EINE WOCHE SPÄTERKANSAS CITY, MISSOURI
Marcus fuhr sich durch das dunkle Haar und seufzte entnervt, als er die Akte des Kansas City Police Department auf den Eichenfurniertisch fallen ließ. In den neuesten Mord war ein Mann namens Josh Stefanson verwickelt – Ehemann und Vater zweier Kinder, die in das kranke Spiel des »Anstifters« hineingezogen worden waren. Die Taktik des Killers war simpel: Er entführte die Familie eines Durchschnittsbürgers und zwang ihn, einen unschuldigen anderen Durchschnittsbürger zu ermorden. Wurden die Anweisungen des Killers befolgt, ließ er die entführte Familie unversehrt frei. Wenn nicht, kamen sie als zerstückelte Leichen zurück.
Bislang hatte der Anstifter jedes Mal Wort gehalten und die eigenen Regeln befolgt. Aber Marcus wusste, dass mehr hinter dem Fall steckte, als der örtlichen Polizei oder dem FBI bewusst war. Nur die Shepherd Organization besaß sämtliche Informationen. Marcus wusste allerdings nicht, was er damit anfangen sollte, und ihm war ausdrücklich untersagt worden, den örtlichen Ermittlern und dem FBI mitzuteilen, was der Shepherd Organization bekannt war.
»Passiert da draußen irgendwas?«, fragte er nun seinen Partner Andrew Garrison, der aus dem Fenster des winzigen Apartments im zweiten Stock schaute.
Marcus selbst beobachtete den Schallplattenladen auf der anderen Straßenseite. Ein 42-Zoll-Bildschirm, der neben Andrew an der Wand hing, zeigte die Bilder hochauflösender Kameras, die sie im Laden und auf der Straße installiert hatten. Andrew jedoch traute seinen Augen mehr als der Technik, deshalb beobachtete er den Vordereingang des Geschäfts zusätzlich mit einem Vanguard-Spektiv auf einem Dreibeinstativ.
»Nichts. Ich glaube, er weiß Bescheid«, sagte Andrew, lehnte sich zurück und legte die Hände hinter den Kopf. »Er greift noch immer auf seine Dateien zu.«
»Ja, aber er schluckt den Köder nicht.«
Marcus wusste von einem früheren Fall, dass Ackerman durch eine Hintertür in einem der Office-Systeme Zugriff auf die Server der Shepherd Organization besaß. Als der Director von diesem Leck erfuhr, hatte er beschlossen, das Loch nicht zu schließen, sondern es gegen den Killer einzusetzen. So jedenfalls sah es der Plan vor. Bisher hatten sie Ackerman auf diese Weise dreimal falsche Informationen zugespielt, nur hatte er leider nicht angebissen.
Im aktuellen Fall hatte Marcus Beobachtungen in die Akten eingetragen, dass der Besitzer eines Plattenladens namens Permanent Records den Killer möglicherweise gesehen hatte, aus unbekannten Gründen aber nicht zu helfen bereit war. Wegen seiner Verbindung zu Marcus mischte Ackerman sich gern in die Ermittlungen ein. Bei einem Fall in Chicago hatte er einen hartnäckigen Zeugen gefoltert und den Mann schließlich ermordet, indem er eine grausame Hinrichtungsmethode anwendete, die während der Spanischen Inquisition sehr beliebt gewesen war. Der Zeuge war ein Pädophiler gewesen, der in das Verschwinden mehrerer kleiner Jungen verwickelt war. Die Informationen, die Ackerman ihm unter der Folter entlockt hatte, erwiesen sich als entscheidend für die Aufklärung des Falles. Dennoch fragte Marcus sich immer öfter, ob der Zweck es rechtfertigte, solch brutale Mittel einzusetzen wie Ackerman.
Andrew rieb sich die Augen. »Wie war dein Psychotest?«
»Hat nichts gebracht. Ich hätte lieber hier sein sollen.«
»Ob du’s glaubst oder nicht, die Welt dreht sich auch ohne dich weiter.«
»Ansichtssache. Wann musst du zu deinem Test?«
Andrew zögerte. »Ich bin mir nicht sicher.«
Marcus nickte. Sein Verdacht war bestätigt. »Findest du, es gleitet mir aus den Händen?«
»Ich finde, du bist einer der besten Ermittler, mit denen ich je zusammengearbeitet habe.«
»Das habe ich nicht gefragt.«
»Möchtest du jetzt wirklich darüber reden?«
»Du bist es doch, der mich immer dazu bringen will, über alles Mögliche zu reden. Also, nur zu.«
Sie schauten sich einen Augenblick an. Den Ausdruck in Andrews Gesicht hatte Marcus schon oft gesehen. Sein Partner suchte nach einem möglichst diplomatischen Weg, seine Bedenken zu äußern, ohne Marcus’ Gefühle zu verletzen.
»Sag einfach, was dir …« Marcus verstummte, als jemand an die Tür klopfte. Seine Hand bewegte sich zur SIG Sauer P220 Equinox an seiner Hüfte. Gleichzeitig wandten er und Andrew sich dem Computermonitor zu. Sie sahen eine Gruppe von sechs oder sieben Männern auf dem Flur. Marcus erkannte die kräftige Gestalt, die vorne stand. Es war sein Chef, den er nur als »Director« kannte. Der Director hatte sich vor Kurzem den Kopf rasiert, weil sein Haar schütter wurde, doch Marcus wusste, dass er es körperlich mit den meisten zwanzig, dreißig Jahre jüngeren Männern aufnehmen konnte, obwohl er bereits der Pensionierung entgegensah.
Andrew öffnete die Tür, und die Gruppe kam herein. Der Director begrüßte Andrew und Marcus freundlich, während seine Begleiter mit raschen, geübten Blicken die Umgebung in sich aufnahmen. Ihre effizienten Bewegungen verrieten militärische oder nachrichtendienstliche Ausbildung und Erfahrung in verdeckten Operationen.
Marcus kniff die Augen zusammen, als das letzte Mitglied der Gruppe eintrat und die Tür hinter sich schloss. Der Mann unterschied sich von den anderen. Schlank, beinahe zierlich. Teurer Anzug. Designerbrille. Manikürte Fingernägel. Durchdringender Blick, selbstsicheres Auftreten. An der linken Hand baumelte ein lederner Aktenkoffer. Offenbar ein Bürokrat. Marcus fragte sich, was ein Angehöriger der Elite aus den Marmorpalästen Washingtons in einem Beobachtungsposten im schlimmsten Viertel von Kansas City zu suchen hatte. Und wieso brachte er ein Team mit?
Welchen Grund es auch gab, es war bestimmt nichts Gutes.
Der Mann im Anzug streckte lächelnd die Hand aus. Seine Stimme war leise und liebenswürdig. Sie klang leicht näselnd und besaß einen Neuengland-Akzent. »Special Agent Williams. Ich habe viel von Ihnen gehört.«
Marcus begegnete dem Blick des Mannes. Ohne die Begrüßung zu erwidern, fragte er den Director: »Was soll das?«
Der Director blickte ihn warnend an. »Marcus, das ist Trevor Fagan, Assistent des Generalstaatsanwalts. Er ist unser neuer Chef. Das Justizministerium hat beschlossen, bei unseren Einsätzen eine aktivere Rolle zu übernehmen.«
»Tatsächlich? Und was ist mit dem Schlägertrupp?«
»Die Männer sind ein Black-Ops-Team. Dienstleister, die uns die CIA ausgeliehen hat.«
»Verdeckte Operationen? Dienstleister? Söldner, meinen Sie wohl.«
»In der Art, ja. Sie sind hier, um uns bei der Festnahme von Francis Ackerman junior zu helfen.«
»Sie meinen, diese Leute sind hier, um ihn zu töten. Darüber haben wir doch gesprochen. Wir brauchen Ackerman lebend. Er weiß viel über …«
Der Director hob eine Hand. »Reden wir im Nebenzimmer weiter.«
Der Mann, der Marcus als Shepherd angeworben hatte, betrat das kleine Schlafzimmer des Apartments. Fagan folgte ihm. Marcus kam als Letzter und schloss hinter sich die Tür. Das Zimmer war leer bis auf ein paar Decken und eine Luftmatratze in der Ecke.
Fagan öffnete den Aktenkoffer und reichte Marcus einen großen braunen Schnellhefter. Mit seiner sanften Stimme sagte er: »Hier, das Ergebnis Ihres psychologischen Tests.«
Marcus öffnete die Aktenmappe gar nicht erst. Das Pochen hinter seinen Augäpfeln wurde stärker. »Geben Sie mir die Kurzfassung.«
Fagan nickte. Sein Verhalten erinnerte Marcus an den Angestellten einer Fluggesellschaft, der ihm eröffnen musste, sein Gepäck sei verloren gegangen. »Aber sicher. Dem Ergebnis nach sollten wir Sie aus dem aktiven Einsatz entfernen. Die wichtigsten Punkte, an die ich mich erinnere …« Fagan zählte sie an den Fingern ab, während er im Zimmer auf und ab ging. »Paranoid, impulsiv, Probleme mit Autoritäten, chronische Schlaflosigkeit, Migräneanfälle, mögliche Abhängigkeit von Schmerzmitteln gegen ständige Kopfschmerzen. Dem Patienten scheint es egal zu sein, ob er lebt oder stirbt. Das geht bis an die Grenze zur Todessehnsucht. Reizbarkeit, oft nahe an einem Nervenzusammenbruch. Habe ich etwas Wichtiges vergessen, Director?«
Der Director seufzte und wich Marcus’ Blick aus. »Nein. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.«
Am Fenster ratterte nervtötend eine Klimaanlage. In Gedanken zerlegte Marcus das Gerät, betrachtete jedes Teil: Schrauben, Kompressor, Knöpfe, Lüfter, Gebläse, Plastikgitter, Filter, Kühlschlangen, Kondensatorrohre. Er versuchte sich auf die Störung zu konzentrieren, die das Rattern verursachte. Dann wiederholte er das Ganze mit dem Fenster und dem Gehäuse. Fagans Ledersohlen knarrten derweil auf dem Parkettfußboden. Der Mann trug gepolsterte Einlagen und ging mit zu viel Druck auf den Zehen – wahrscheinlich litt er an Fersenspornen. Er schonte sein rechtes Bein, ein Zeichen für eine alte Verletzung. Und was den Director anging – er hatte eine Stelle dicht oberhalb des linken Ohrs übersehen, als er sich den Schädel rasiert hatte; dort waren noch dunkle Stoppeln. Die fünf Söldner gingen im Nebenzimmer auf und ab. Marcus hörte ihre Schritte auf dem Linoleumboden der Küche und dem Parkett vor den Fenstern. Vermutlich prüften sie das Überwachungssystem. Eine zitronenfarbene Motte flatterte um die Deckenlampe. Draußen ertönte eine gellende Autohupe. Vermutlich ein Kleinwagen. Im Apartment über ihnen öffnete sich eine Tür. Füße tappten über den Teppichboden.
Marcus entging keineswegs, wie wichtig dieses Gespräch war, und er versuchte auch gar nicht, den Director und Fagan zu ignorieren. Nur konnte er die anderen Eindrücke – Geräusche, Bilder – einfach nicht ausfiltern. In seinem Kopf verschmolz alles, als betrachtete er tausend Fernsehschirme gleichzeitig. Dabei sog er jede Einzelheit in sich auf und speicherte sie zwecks späterer Verwendung in seiner geistigen Datenbank.
Wieder versuchte Marcus, sich auf das Gespräch zu konzentrieren, konnte den Rest der Welt aber nicht ausblenden, sosehr er sich bemühte. Er neigte den Kopf zur Seite, bis die Halswirbel knackten, und drückte mit Daumen und Zeigefinger auf seinen Nasenrücken – beides für ihn typische Bewegungen und Gesten.
»Sie brauchen mich bei diesem Fall, das wissen Sie«, sagte er. »Wenn Sie mich feuern oder in eine Gummizelle sperren oder was immer Ihnen einfällt, meinetwegen. Aber erst, wenn der Fall abgeschlossen ist.«
Fagan entgegnete: »Ich bin nicht hier, um Sie von dem Fall abzuziehen, Agent Williams, und ich bin auch nicht gekommen, um Sie zu feuern. Ich bin hier, um Sie wieder in die Spur zu bringen. Wir stehen auf der gleichen Seite.«
Der Assistent des Generalstaatsanwalts klopfte Marcus auf die Schulter und kehrte in den anderen Raum zurück. Der Director wollte ihm folgen, doch Marcus hielt ihm am Arm fest und flüsterte: »Was läuft hier eigentlich?«
Der Blick des Directors schweifte von Marcus zu Fagan und wieder zurück, als überlegte er, ob er seine Anweisungen missachten sollte oder nicht. Schließlich sagte er leise: »Man denkt höheren Ortes darüber nach, die Shepherd Organization aufzulösen. Fagan ist der Mann, der über unser Schicksal entscheidet. Also versuchen Sie ausnahmsweise, freundlich zu sein.«
»Und wie soll das aussehen?«
»Soweit es Fagan angeht, tun Sie einfach das Gegenteil von dem, was Ihr Instinkt Ihnen sagt.«
5
Das Werkzeug betrachtete sich nicht mehr als menschliches Wesen. Es war ein Ungeheuer. Ein lebloses Ding mit einem Auftrag, einem Geschoss vergleichbar, das auf sein Ziel zujagt. Das Ungeheuer kannte kein Bedauern. Kein Schuldgefühl. Keine Zweifel. Ihm war gesagt worden, was es zu tun hatte, und es gehorchte. Es war sich nicht sicher, ob es noch lebte oder in der Hölle war; es konnte sich nicht einmal sicher sein, ob es je gelebt hatte. Zwar schwebten gelegentlich verschwommene Bilder durch sein Bewusstsein, doch sie erschienen wie Erinnerungen an ein Leben, das aus seinem Gedächtnis gelöscht worden war.
Wenn sein Magen schmerzte, aß es. Nicht wegen des Hungergefühls, sondern weil es ihm befohlen worden war. Wenn es den Drang verspürte, erleichterte es sich in einen Eimer. Wären die Anweisungen seines Meisters in dieser Hinsicht nicht eindeutig gewesen, hätte es sich selbst besudelt. Das Ungeheuer nahm zwar den üblen Geruch der Ausscheidungen wahr, die in dem Eimer rechts von ihm schwammen, doch es empfand nichts dabei. Es empfand nie etwas. Es lebte nicht.
Das Ungeheuer saß vor dem Panoramafenster, starrte auf das Haus gegenüber und protokollierte gewissenhaft das Kommen und Gehen der Familie. Als es aufschrieb, zu welcher Uhrzeit das Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet wurde, kam ihm ein merkwürdiger Gedanke. Es konnte lesen und schreiben, es kannte die Uhr und wusste, was Täuschung, Angst und Tod waren. Es konnte Auto fahren, eine Waffe abfeuern und antworten, wenn es angesprochen wurde. Doch es konnte sich nicht erinnern, das alles erlernt zu haben. Es schien, als wäre ihm bei seiner Erschaffung eine Grundausstattung an Wissen einprogrammiert worden.
Dem Haus, in dem es sich befand, fehlte es an jeder Einrichtung bis auf den Stuhl, auf dem es saß, den Eimer zu seiner Rechten, das Fernglas und das Notizbuch auf der Fensterbank. Nun hob es das Fernglas und beobachtete Julie Dunham, wie sie das Licht im Flur ausmachte und zu ihrem Mann, Brad Dunham, ins Schlafzimmer ging. Der Raum war von einem bläulichen Schimmer erhellt, der darauf hindeutete, dass der Fernseher lief. Das Ungeheuer wusste, dass Julie sich bald ihrem Mann anschließen würde. Dann würde es die Stoppuhr starten, wie sein Meister es befohlen hatte.
Die nächsten beiden Stunden saß es an Ort und Stelle, reglos, ohne zu denken, im Kopf ein Wirbel aus undeutlichen, fremdartigen Bildern und Empfindungen. Dann piepte die Zeituhr, und das Ungeheuer stand vom Stuhl auf, bedeckte das Gesicht mit einer schwarzen Skimaske und ging hinüber zum Haus der Dunhams. Es befolgte die Anweisung des Meisters und huschte von einem Schatten zum anderen, damit es nicht gesehen wurde.
Normalerweise wäre die Alarmanlage im Haus aktiviert, doch der Meister hatte diese Möglichkeit vorhergesehen. Das Ungeheuer zog ein kleines rechteckiges Gerät aus der Tasche und drückte den grauen Knopf in der Mitte. Mit mechanischem Surren und Ächzen fuhr das Garagentor hoch.
Das Ungeheuer glitt unter Julie Dunhams Auto. Dann schloss es das Garagentor, indem es noch einmal auf den Knopf drückte. Nun würde es warten, bis Brad Dunham zur Arbeit fuhr. Sobald der Mann verschwunden war, würde das Ungeheuer, des Meisters Werkzeug, die Familie in seine Gewalt bringen, so wie der Meister es befohlen hatte.
Es wollte den Leuten im Haus nichts Böses, und es hatte das unbestimmte Gefühl, dass es etwas Falsches tat. Doch es wusste auch, dass Ungehorsam furchtbare Schmerzen zur Folge hätte.
Und Schmerzen waren alles, was das Monster noch spürte.
6
Zwei Stunden lang hatte Marcus auf der Luftmatratze gelegen und vergeblich versucht einzuschlafen, als Andrew ihn aus dem Nebenzimmer rief. Der Director hatte die Nachtschicht übernommen und war um acht Uhr morgens von Andrew abgelöst worden. Marcus sollte erst um dreizehn Uhr übernehmen. Irgendetwas musste passiert sein.
Marcus sprang auf und eilte zu Andrew. Die CIA-Dienstleister rührten sich ebenfalls, machten ihre Ausrüstung klar und bereiteten sich darauf vor, das Apartment zu verlassen. Das Zimmer roch nach verbranntem Kaffee und schien von der nervösen Anspannung aller schier aus den Nähten zu platzen.
»Ich glaube, wir haben da etwas«, sagte Andrew. Er drückte eine Taste am PC und rief ein Vollbild auf. Es zeigte einen ungepflegten Mann mit struppigem rotem Bart und langem rotem Haar, das ihm über eine Gesichtshälfte hing. Mit unsicheren Schritten näherte sich der Mann dem Eingang des Schallplattengeschäfts.
»Ist er das, Marcus?«, fragte der Director.
»Der Körperbau passt. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht sehr nach der Verkleidung aus, die er benutzt hat, als er Crowley in Chicago ermordete. Sehen Sie, wie das Haar eine Hälfte des Gesichts verdeckt? Ackerman trickst damit gern Gesichtserkennungsprogramme aus. Die Software stützt sich meist auf Symmetrien. Wenn man das halbe Gesicht verdeckt, können die Programme es nicht richtig erfassen.«
»Wir können nicht abwarten, bis wir hundertprozentig sicher sind«, sagte Fagan mit seinem näselnden Neuenglandakzent und nickte dem Chef des CIA-Teams zu, einem großen blonden Mann mit zerfurchtem Gesicht und hellblauen Augen. »Schnappen Sie sich den Burschen. Wir wollen ihn lebend. Aber gehen Sie kein Risiko ein.«
Keiner der Söldner sagte ein Wort, als sie zur Tür gingen. Sie trugen Zivilkleidung, waren aber mit Tasern und Schusswaffen ausgerüstet, die sie unter Windjacken und Kapuzenhemden verbargen. Höchstwahrscheinlich waren sie ausgebildet, in einer Menge unterzutauchen, doch hier gab es keine Menschen, zwischen denen sie verschwinden konnten. Marcus war sich ziemlich sicher, dass Ackerman die Männer auf eine Meile Abstand erkennen würde.
Er wollte ihnen folgen, doch Fagan hielt ihn am Oberarm fest. »Ich möchte, dass Sie hierbleiben. Diese Leute sind die Besten. Sie werden mit Ackerman fertig.«
Marcus riss sich aus Fagans Griff los. »Ich gehe kein Risiko ein.«
»Sie sind zu sehr in die Sache involviert, Marcus. Halten Sie sich zurück«, sagte der Director.
Zähneknirschend kehrte Marcus zu den Monitoren zurück. Man hatte ihn soeben auf die Zuschauerbank verwiesen, und er konnte nichts dagegen tun.
Jedenfalls nicht, bis die Sache aus dem Ruder lief.
***
Aus dem Augenwinkel sah Ackerman die Agenten, die das Apartmenthaus verließen. Sie versuchten wie eine Gruppe von Freunden auszusehen, die zu einer Bar oder einem Baseballspiel unterwegs waren, doch Ackerman sah genau, wer sie waren. Sie konnten ihre geschmeidigen, raubtierhaften Bewegungen nicht kaschieren. Nicht vor einem Mann, der ebenfalls zum Töten ausgebildet war.
Die Agenten bewegten sich mit selbstverständlicher Effizienz und einer Ruhe, die eine militärische Ausbildung und Kampferfahrung bewiesen. Möglicherweise gehörten sie dem Hostage Rescue Team an, dem elitären Geiselrettungsteam des FBI, doch eher noch der Delta Force oder der CIA.
Jemand hatte den Einsatz erhöht.
Ackerman fühlte sich geschmeichelt.
Der Gedanke, von solchen Spezialisten gejagt zu werden und sie im Gegenzug selbst zu jagen, ließ Adrenalin in seine Adern strömen und schärfte sämtliche Sinne. Es war lange her, dass Francis Ackerman einer echten Herausforderung gegenübergestanden hatte; er hatte beinahe vergessen, wie wundervoll es war, wie rauschhaft, in tödlicher Gefahr zu schweben. Nur dann fühlte er sich wirklich lebendig.
Nicht dass sein Bruder kein großartiger Gegner gewesen wäre. Doch Ackerman wusste, dass Marcus nie imstande sein würde, auf ihn zu feuern. Er verbarg seine Empfindungen unter einer harten Schale, doch Ackerman wusste, dass Marcus etwas für ihn empfand, mochte es noch so wenig sein, und dass er ihn retten wollte.
Doch die Männer, die ihn jetzt in die Enge zu treiben versuchten, kannten solche Bindungen nicht. Sie würden nicht zögern, sein Leben auf brutale, blutige Weise zu beenden.
Es wurde bestimmt ein Riesenspaß.
***
Marcus ließ die Monitore nicht aus den Augen. Er zitterte vor nervöser Erwartung, als die Söldner ihre Zielperson einkreisten. Der Bärtige schien ihre Annäherung gar nicht zu bemerken, doch wenn es Ackerman war, würde er sich nicht kampflos ergeben, das wusste Marcus.
Als der Mann sich durch die Eingangstür des Schallplattenladens schob, drang das elektronische Bing der Türglocke aus den Lautsprechern von Marcus’ Computer. Der Mann schien sich nach einem Verkäufer umzusehen, doch der Ladeninhaber und der einzige Kunde waren bereits zur Hintertür hinaus, kaum dass sie die Nachricht erhalten hatten, ein Verdächtiger nähere sich dem Laden. Marcus wollte auf keinen Fall das Risiko eingehen, dass Ackerman eine Geisel nahm, und der Geschäftseigentümer, ein pensionierter Cop, war mehr als hilfsbereit gewesen.
Die Zielperson blätterte durch alte Beatles-Alben. Marcus warf einen Blick auf das heranrückende CIA-Team. Zwei Mann kamen durch die Eingangstür. Ein weiterer wartete als Auffangposten auf der Straße. Die beiden verbliebenen Teammitglieder hatten sich in der Gasse hinter dem Gebäude aufgehalten und drangen nun durch die Hintertür ein. Sauber, effizient, siegessicher.
Zu siegessicher.
Marcus blickte wieder ins Innere des Ladens. Der bärtige Mann mit dem struppigen roten Haar schien sich der Angreifer gar nicht bewusst zu sein. Aber das entsprach genau Ackermans Verhalten: Er würde sich unaufmerksam geben und seine Gegner einlullen, indem er ihnen ein trügerisches Gefühl der Sicherheit vermittelte.
Dann griffen die Agenten zu, schnell und entschlossen. Der Mann auf der rechten Seite bedrohte Ackerman mit einer großkalibrigen Pistole, der von links kommende Agent streckte den Taser auf Armlänge vor.
Doch der Rotschopf wandte sich ihnen noch immer nicht zu.
Marcus legte unwillkürlich die Hand auf seine Waffe.
»Keine Bewegung. Lassen Sie uns Ihre Hände sehen«, sagte der Agent, der mit dem Taser bewaffnet war.
Endlich erregten sie die Aufmerksamkeit des Bärtigen. Mit verängstigter Miene wandte er sich den Männern zu.
»Hände hoch! Na los!«, rief der Agent, der die Pistole auf Ackerman gerichtet hielt.
Der Mann mit dem Bart wirbelte herum und floh in den rückwärtigen Teil des Ladens, aber dort kamen ihm die beiden anderen Söldner entgegen. Wie angewurzelt blieb Rotbart stehen. Seine Blicke huschten in sämtliche Richtungen. Einen Sekundenbruchteil später drangen ihm die Dornen eines Tasers ins Fleisch. Er brach auf dem Linoleumboden zusammen, wo er sich in wilden Zuckungen wand. Die rote Perücke rutschte ihm vom Kopf. Kurzes dunkles Haar kam zum Vorschein.
Eine Sekunde später waren zwei Söldner über ihm und fesselten ihn an Händen und Füßen. Die anderen blieben zurück, die Waffen noch immer auf die am Boden liegende Gestalt gerichtet. Sie überließen nichts dem Zufall.
»Das gefällt mir nicht«, meinte Marcus.
Fagan grinste. »Wie ich schon sagte, die Jungs sind die Besten. Und Sie, Marcus, haben diesen Einsatz vorbereitet. Dass die Männer es so leicht hatten, wirft ein noch besseres Licht auf Sie. Gute Arbeit.«
»Die Männer sollen ihm den falschen Bart abnehmen und sein Gesicht in die Kamera halten.«
Fagan gab die Anweisung über Funk weiter. Alle schauten zu, wie die Agenten das schmutzige Gesicht eines jungen Mannes mit blutunterlaufenen Augen und ausgezehrten Wangen freilegten.
»Das ist er nicht.«
»Das ist irgendein Obdachloser, verdammt! Ackerman hat uns an der Nase herumgeführt«, stieß der Director hervor.
Marcus hörte ihn kaum. Er hatte Andrew zur Seite geschubst und rief am PC das Videomaterial ab, das die Straße wenige Augenblicke vor dem Auftauchen des Bärtigen zeigte.
»Was tust du?«, fragte Andrew.
Marcus stach mit dem Finger auf das Bild einer jungen blonden Frau, die einen Kinderwagen schob. »Da.«
Fagan fragte: »Was wollen Sie damit …«
Doch Marcus war schon unterwegs. Er stürmte ins Schlafzimmer, riss ein Fenster auf, das auf die Feuertreppe führte. Das rostige Metall protestierte unter seinem Gewicht.
Er nahm drei Gitterstufen auf einmal und hielt sich am Geländer fest, wenn er sich um Ecken schwang. Als er das Ende der Treppe erreichte, trat er gegen die Leiter. Mit lautem Scheppern knallte sie auf den Asphalt der Gasse.
Marcus glitt auf Straßenniveau hinunter und sprintete die Gasse entlang in die Richtung, die vom Schallplattenladen wegführte. Die blonde Frau war an dem Laden vorbeigegangen und nach links abgebogen. Marcus’ einzige Hoffnung bestand darin, um den Block zu rennen und ihr den Weg abzuschneiden.