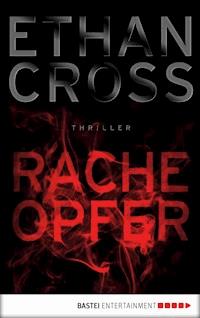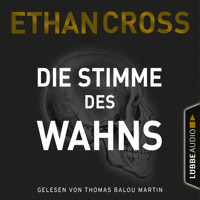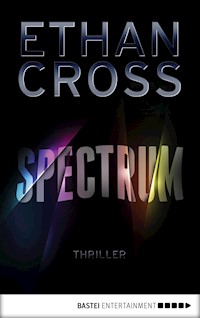
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine neue rasante Thriller-Serie von Bestsellerautor Ethan Cross, dem Autor der Shepherd-Thriller
August Burke ist anders. Irgendwie seltsam, geradezu wunderlich. Doch Burke ist auch ein Genie: Er erkennt Zusammenhänge, die allen anderen verborgen bleiben. Als es in einer Bank zu einer Geiselnahme kommt, wendet das FBI sich an ihn. Denn die Täter verhalten sich extrem ungewöhnlich und verschwinden schließlich sogar unbemerkt aus dem umstellten Gebäude. Mit Burkes Hilfe entdeckt das FBI den Zugang zu einem Geheimlabor unter der Bank - das eigentliche Ziel des Überfalls. Was haben die Räuber dort gesucht? Und haben sie es gefunden? Zusammen mit Special Agent Carter folgt Burke ihrer Spur - und bekommt es mit einem Feind zu tun, der bereit ist, tausende Menschenleben zu opfern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Teil eins
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Teil zwei
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Teil drei
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Leseprobe
Über den Autor
Ethan Cross ist das Pseudonym eines amerikanischen Autors, der mit seiner Frau und zwei Töchtern in Illinois lebt. International bekannt wurde er mit seinen Thrillern um den Serienkiller Francis Ackerman junior. Nun gönnt er diesem eine Pause und widmet sich in SPECTRUM einem neuen Helden: dem genialen wie wunderlichen FBI-Berater August Burke.
Ethan Cross
SPECTRUM
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonRainer Schumacher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Published in agreement with the author,c/o BAROR INTERNATIONAL, INC.,Armonk, New York, U.S.A.
Copyright © 2017 by Aaron Brown und Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Heike Rosbach, NürnbergUmschlaggestaltung: Massimo Peter
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4028-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Teil eins
Kapitel 1
Isabel Price platzte aus der verrosteten Tür der kleinen Wellblechhütte und rannte los, so schnell sie ihre kräftigen südafrikanischen Beine trugen.
Worte wie Albtraum und Warum schoben sich immer wieder zwischen die Gedanken, die sich in ihrem Kopf überschlugen. Ihr war schwindelig, und Übelkeit stieg in ihr auf. Sie stolperte über das karge, verwaiste Gelände zwischen den Bretterbuden der illegalen Siedler. Sie musste wissen, ob alle tot waren. Sie musste wissen, ob ihr Junge tot war.
Irgendwo hinter ihr schrie Dingani ihren Namen, aber sie ignorierte ihn. Sie musste es wissen. Und dieses Verlangen war so groß, dass sie an nichts anderes mehr denken konnte. Sie konnte nur noch an eines denken: Tyler, ihren Jungen.
Nun erschallte neben Dinganis Stimme auch die ihres Vaters. Elliot Price hatte schon immer ein kraftvolles Organ gehabt. Das hatte ihm sehr geholfen, als er noch ein aufstrebender Politiker gewesen war, damals, als allein die weiße Minderheit die Regierung gestellt hatte.
Doch Isabel ignorierte auch die Stimme ihres Vaters.
Sie sprang über einen Zaun und landete in Mrs. Eberles Kräutergarten. Dass sie dabei auch das Eigentum der freundlichen alten Dame zerstörte, kümmerte sie nicht. Wenn sie recht mit ihrer Angst hatte, würde das Mrs. Eberle ohnehin nicht stören, denn dann war Mrs. Eberle schon längst tot … genau wie alle anderen Bewohner der Squatter-Siedlung auch.
Isabel lief immer weiter, sprang über den nächsten Zaun und erreichte einen Feldweg, der früher einmal ein schmaler Trampelpfad gewesen war. Sie rannte nach Nordosten und zwischen zwei Reihen zusammengewürfelter Hütten hindurch. Jede von ihnen war ein wenig anders, je nachdem, welche Materialien beim Bau zur Verfügung gestanden hatten. Der Boden der meisten war die nackte Erde, und darauf lagen die Matratzen der Bewohner. Möbel gab es hier genauso wenig wie fließendes Wasser.
Vor sich sah Isabel ihr Ziel: eine schäbige weißblaue Wellblechhütte. Sie rannte zur Tür des winzigen Heims und hämmerte so fest dagegen, dass sie Angst hatte, das fragile Gebilde könne in sich zusammenfallen.
Keine Reaktion. Kein Geräusch. Keine Bewegung.
Wie sie es bei der Polizei gelernt hatte, trat Isabel die Tür ein und stürmte mit Taschenlampe und Pistole im Anschlag hinein. Die Hütte sah innen ein wenig besser aus als die anderen. Dafür hatte Isabel gesorgt. Ihr Junge sollte nicht im Dreck schlafen. Er sollte ein besseres Leben haben. Dann sah Isabel die Leiche von Tylers leiblicher Mutter. Sie lag auf der ausgeklappten Bettcouch, wo sie geschlafen hatte.
Isabel kämpfte gegen den Drang an, sich zu übergeben.
Sie waren alle tot.
Aber sie hatte es mit eigenen Augen sehen müssen. Isabel lief in den hinteren Teil der Hütte, wo Tyler sein eigenes »Zimmer« hatte. Es war kaum größer als ein Schrank. Trotzdem liebte ihr Junge es, einen Platz ganz für sich allein zu haben. Isabel entdeckte Blut unter Tylers Tür, und da wusste sie es.
Mehr musste sie nicht sehen. Constable Isabel Price von der südafrikanischen Polizei, kurz SAPS, hatte schon genug Tatorte, Opfer und Blut gesehen, um zu wissen, wann es zu spät war. Und jetzt wusste sie, dass Tyler tot war … genau wie seine leibliche Mutter und all die anderen weißen Bewohner des Squatter-Camps.
Isabel stolperte wieder in die kühle Morgenluft hinaus und stieß dabei mehr als die Hälfte des Mobiliars um. In ihrem Kopf drehte sich alles, Sternchen tanzten vor ihren Augen. Das musste ein Traum sein. Ein Albtraum. Jede Sekunde würde sie in einem Krankenhaus aufwachen, in das sie nach einem Autounfall, einer Schussverletzung oder einer Hirnblutung eingeliefert worden war, und dann würde sie erkennen, dass das alles nur die Folge eines schweren Traumas war.
Aber es fühlte sich real an, viel zu real.
Isabel wusste nicht mehr, was sie denken oder glauben sollte. Sie sank einfach mitten auf dem Feldweg auf die Knie, ließ Pistole und Taschenlampe fallen, und es war ihr scheißegal, dass sie ihren schönen neuen Hosenanzug ruinierte. Sie kroch durch den Staub, und die Tränen strömten ihr übers Gesicht.
Sie schrie nicht, und sie sagte auch kein einziges Wort.
Constable Isabel Price fiel einfach auf die Seite und zog die Knie an. Dann schloss sie die Augen und betete, sie möge endlich aus diesem Albtraum erwachen.
Doch sie konnte an nichts anderes mehr denken als an Tyler, ihren Jungen, dem man genau wie den übrigen fast dreihundert Slumbewohnern Kopf, Hände und Füße abgehackt hatte.
Kapitel 2
Vier Wochen später
Er hörte ein tiefes Knurren und ein Rascheln in den Büschen. Erst dann sah er die Tiere. Sofort ertönte Brüllen, und das Schreien begann. Er rannte los. Eines der Tiere sprang vor ihn und Zarina. Es schlug mit der Tatze nach ihnen. Es war mehr ein Spiel als ein Angriff. Seine Mutter kreischte, stürzte sich auf das Tier und rief ihm zu, er solle laufen. Er spürte warmes Blut auf seiner Haut, wusste aber nicht, wem es gehörte. Er rannte, versteckte sich und hörte, wie seine Mutter bei lebendigem Leib gefressen wurde.
Doch seit den Toten, die er kürzlich in der Squatter-Siedlung gesehen hatte, hatte der Traum sich verändert.
Wenn seine Mutter jetzt verschlungen wurde, dann sah er es mit den Augen des Löwen, und er fühlte, was das Tier fühlte. Er grub seine Zähne in ihr Fleisch und riss es heraus, wobei er sie mit seinen Pranken auf den Boden drückte. Und er schmeckte das Blut in seinem Maul, als er ihre Eingeweide verschlang, während sie noch lebte.
Er spürte, wie ihn irgendetwas an der Schulter traf. Er war sofort wach und griff nach seinem Messer und der Pistole.
»Es ist Zeit«, sagte Raskin. »Mach dein Ding.«
Idris Madeira – oder Krüger, wie man ihn als Profi nannte – funkelte die überhebliche kleine Amerikanerin an. Er wusste, wie spät es war, und seine innere Uhr sagte ihm, dass man ihn zehn Minuten zu früh geweckt hatte. Um den Irrtum zu bestätigen, schaute er auf seine Armbanduhr. Bei einer Mission war Schlaf oft Luxus, und Krüger hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass man jede Ruhephase nutzen musste. Schließlich wusste er nie, wann er wieder einmal tagelang kein Auge zutun konnte.
Die Zielperson schlief jetzt vermutlich. Um sicherzugehen, hatte Krüger beschlossen, bis drei Uhr früh zu warten. Seine arrogante Partnerin hatte sich deswegen beschwert und argumentiert, ein Uhr reiche auch. Doch Krüger konnte Raskin in allen Fragen überstimmen, die die Operation betrafen. Immerhin war er der Profi hier. Er hatte Erfahrung mit solchen Aufträgen.
Das geduldige Raubtier bekam stets die bessere Beute.
Raskin saß auf dem Beifahrersitz. Wortlos gab sie Krüger die Spritze und das kleine Röhrchen mit dem Wattestäbchen, als wäre Krüger ein Jagdhund, den man von der Leine ließ und auf die Beute hetzte. Hätte Krüger nicht das Wissen und die Verbindungen der Amerikanerin gebraucht, um seinen letzten Auftrag zu erfüllen, er hätte die Frau schon längst zu den Ahnen geschickt. Auf jeden Fall hatte die Amerikanerin das verdient, vermutlich sogar mehr als jeder andere, den Krüger bis jetzt getötet hatte. Doch solch ein überstürzter, emotionaler Gewaltakt wäre einfach nur dumm gewesen, und Krüger hatte durch viele schmerzhafte Fehler auf die harte Tour gelernt, dass Geduld sich für jemanden wie ihn stets auszahlte.
Krüger stieg aus dem Van und ging zu dem kleinen zweistöckigen Haus. Es war blaugrün gestrichen und hatte ein eher flaches Giebeldach mit Terrakotta-Schindeln. Krüger hatte den Grundriss des Gebäudes und die Gewohnheiten der Zielperson genau studiert, und so wusste er, dass Fred Little jetzt entweder oben in einem der Schlafzimmer lag oder in seinem Sessel von La-Z-Boy vor dem Fernseher eingeschlafen war.
Die Amerikaner waren ja so besessen von ihren Fernsehern. Krüger und Zarina hingegen besaßen noch nicht einmal einen Fernseher. Wenn Krüger sich ein Fußballspiel ansehen wollte, dann fuhren sie entweder in eine Sportsbar in der Stadt, oder sie gingen gleich ins Stadion. Krüger hatte Besseres zu tun, als anderen bei ihrem Leben zuzuschauen.
Alles war vorbereitet. Man hatte Fred Little den Schlüssel aus der Tasche gestohlen, einen Abdruck davon gemacht und ihn wieder zurückgesteckt. Den Code der Alarmanlage hatten sie bekommen, als sie Fred bei der Eingabe durch ein Teleobjektiv beobachtet hatten. Krüger ging einfach ins Haus, als würde es ihm gehören.
Als er vorsichtig die Treppe hinaufstieg, hielt er sich mit seinen Stiefeln der Schuhgröße 59 so dicht wie möglich an der Wand. Er wollte keinen unnötigen Lärm verursachen, und Stufen knarrten am Rand nur selten. In der rechten Hand hielt er eine schwarze Beretta M9A1 mit Schalldämpfer. Allerdings hatte er nicht die Absicht, die Waffe zu benutzen. Sie war nur eine Vorsichtsmaßnahme.
Als Krüger oben ankam, sah er ein dunkles Gesicht mit glühenden Augen. Instinktiv hob er die Waffe. Dann erkannte er, dass er nur in einen Spiegel schaute. Krüger trat vor, und das Spiegelbild wurde größer. Mondlicht fiel durch das große Fenster über dem Eingangsbereich. Um sich vollständig im Spiegel zu betrachten, musste Krüger seine zwei Meter dreizehn leicht vorbeugen. Erst dann konnte er sich selbst in die Augen sehen.
Aber waren das wirklich seine Augen oder Krügers?
Er wusste es nicht mehr. Er konnte nicht mehr zwischen Idris, dem Ehemann und Vater, und Krüger, dem Profikiller und Söldner, unterscheiden, den man in bestimmten Kreisen nur »das Phantom« nannte. Für ihn war Krüger immer nur ein Schatten gewesen, ein Raubtier, eine Waffe, ein Werkzeug, das Geld für Idris erwirtschaftet hatte. Doch jetzt hatte er das Gefühl, als habe Krüger sich verselbstständigt und die Kontrolle übernommen.
Und dann war er wieder in dem Squatter-Camp und ging von Haus zu Haus. Immer wieder schlug er mit der Klinge zu und hackte Stücke aus Menschen heraus, die so arm gewesen waren, dass sie im Dreck geschlafen hatten. Doch im Geiste hörte er nicht das Reißen von Sehnen oder das Brechen von Knochen. Er hörte die Schreie seiner Mutter und das Knurren der Löwen.
Doch das war Vergangenheit. Krüger schüttelte die Erinnerungen ab, richtete sich wieder zu seiner vollen Größe auf und schaute auf die Uhr. Mit einem Fluch auf den Lippen überprüfte er noch einmal seine Waffen. Offenbar hatte er ganze fünf Minuten lang in den Spiegel gestarrt.
Bei den meisten Missionen hätte solch ein Lapsus unweigerlich zu seinem Tod geführt, aber zum Glück schlief diese spezielle Zielperson tief und fest und hatte auch keine Leibwächter. Doch Krüger wusste auch, dass das Glück nicht von Dauer sein würde, und dann … Ein Fehler, ein kurzer Augenblick, in dem er nicht voll konzentriert war … Er musste raus aus diesem Spiel, und zwar schnell, sonst würde er sich keine Gedanken mehr darüber machen müssen, ob er nun Idris oder Krüger war, denn dann wären sie beide tot.
Krüger öffnete die Schlafzimmertür und schlich hinein. Fred Little schlief auf dem Rücken und schnarchte wie ein Bär. Das dünne Laken hatte er weggetreten, sodass es nur noch einen kleinen Teil seines Oberkörpers bedeckte. Er trug nur ein weißes T-Shirt und karierte Boxershorts. Diese Angewohnheiten waren in den letzten drei Nächten bestätigt worden, als eine Drohne durch Freds Schlafzimmerfenster gespäht hatte.
Vorsichtig zog Krüger das Laken weg und schob das eine Bein von Freds Boxershorts hoch. Dann holte er das Wattestäbchen aus dem Reagenzglas und tupfte damit die Einstichstelle ab. Dank der örtlichen Betäubung würde Fred den Stich nicht merken. Anschließend wartete Krüger einen Moment, bis die Betäubung eingesetzt hatte; dann injizierte er das Suxamethonium in Freds äußeren Schenkelmuskel.
Krüger beobachtete den schlafenden Fred, während das Mittel sich in dessen Körper ausbreitete. Durch seine Nachforschungen wusste Krüger, dass Fred der jüngste von drei Söhnen einer wohlhabenden Farmersfamilie aus dem ländlichen Kentucky war. Das geerbte Geld hatte es Fred erlaubt, am MIT Robotik zu studieren, doch für Krüger sah er mit seinem Schnurrbart und den langen Koteletten noch immer wie ein Hinterwäldler aus. Krüger meinte das jedoch nicht despektierlich. Er – oder besser sein Alter Ego, Idris Madeira – stammte aus einem kleinen Dorf, allerdings in Mosambik, und fühlte sich in der Savanne wohler als in einer Betonwüste.
Nachdem ausreichend Zeit verstrichen war, schaltete Krüger die Nachttischlampe an, und als das seine schlummernde Zielperson nicht weckte, schlug er Fred ins Gesicht.
Prompt riss der Mann die Augen auf und schnappte nach Luft. Dann versuchte er, sich zu bewegen, musste aber feststellen, dass er gelähmt war.
»Sparen Sie sich die Mühe, mein Freund«, sagte Krüger. »Ich habe Ihnen ein Mittel injiziert, das Sie lähmt. Schmerz können Sie jedoch noch empfinden. Der Nachteil ist, dass es auch die Muskeln entspannt, die Sie zum Atmen brauchen. Wenn Sie sich zu sehr wehren oder überanstrengen, dann ersticken Sie.«
Vermutlich noch immer im Halbschlaf und in der Hoffnung, dass das alles nur ein böser Traum war, erwiderte Fred: »Sie können sich nehmen, was Sie wollen.«
»Das wollte ich ohnehin, aber es ist wirklich sehr höflich von Ihnen, mir das zu erlauben.«
»Was soll das überhaupt?«
»Ich brauche nur ein paar Informationen.«
»Informationen? Worüber? Ich weiß doch nichts … jedenfalls nichts von Bedeutung.«
»Spielen Sie nicht den Dummen, mein Freund. Ich weiß ganz genau, wer Sie sind, was Sie tun und für wen Sie arbeiten. Ich brauche Ihren Zugangscode, Mr. Little.«
»Was? Ich habe keinen …«
»Mr. Little, eines sollte Ihnen klar sein: Ich habe alle Macht, und Sie haben nichts. Die Wirkung des Medikaments, das ich Ihnen verabreicht habe, hält lange genug an, Ihrem Körper jede nur erdenkliche Art von Schmerz zuzufügen. Sie werden nicht in der Lage sein, sich zu bewegen, geschweige denn Widerstand zu leisten. Tatsächlich könnte allein schon der Versuch zum Ersticken führen. Natürlich können Sie uns beiden diese Unannehmlichkeiten ersparen, indem Sie mir einfach den Code geben.«
»Mit meinem Code kommen Sie aber weder in den Tresorraum noch an die Boxen. Und selbst wenn …«
»Schschsch. Sie müssen mir nicht erklären, was ich kann und was nicht. Wenn ich eines im Laufe meines Lebens gelernt habe, dann dies: Das Einzige, was einen Menschen daran hindert, sich zu nehmen, was er will, ist Angst. Wenn Sie keine Angst haben, dann ist alles möglich. Aber natürlich macht auch mir vieles auf dieser Welt noch Angst, Mr. Little. Es gibt dort draußen weit schlimmere Monster als mich. Allerdings bin ich wohl der Furcht erregendste Mensch, dem Sie je begegnet sind. Sie haben etwas, das ich benötige, und ich habe die feste Absicht, jedes mir zur Verfügung stehende Mittel – einschließlich Folter – einzusetzen, um das von Ihnen zu bekommen. Und glauben Sie mir: Ich bin sehr erfahren in diesen Dingen.«
Krüger legte Fred die riesige Hand auf die Brust und fühlte den flachen Atem und den schnellen Puls seines Opfers.
»Also schön. Sie haben gewonnen«, sagte Fred. »Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Nur bitte …«
Tränen rannen Fred übers Gesicht, und Krüger kämpfte gegen den Instinkt an, sie wegzuwischen. Der Mann tat ihm leid, dieser unschuldige Kerl, dessen einziger Fehler es war, dass er ihm im Wege stand. Solche Gefühle hatte Krüger in Bezug auf eine Zielperson noch nie gehabt. Was war nur mit ihm los? Angst und Panik keimten in ihm auf, und erneut schoss ihm in Flashbacks die Squatter-Siedlung durch den Kopf. Rasch verdrängte er die Bilder jedoch wieder und ermahnte sich, dass er Krüger war. Ein Löwe hatte auch kein Mitleid mit einer Gazelle.
»Ich weiß, mein Freund. Geben Sie mir einfach den Code.«
Fred ratterte eine zwanzigstellige Zahl herunter.
Krüger schrieb sie in ein kleines Notizbuch und sagte: »Wenn der Code, den Sie mir gegeben haben, nicht stimmt, dann werden wir Ihren Sohn töten. Die entsprechenden Vorkehrungen haben wir bereits getroffen. Und mit ihm werden wir nicht so sanft umgehen wie ich mit Ihnen.«
In Krügers Stimme lag weder Boshaftigkeit noch Wut, aber er versuchte, erbarmungslose Entschlossenheit auszustrahlen. Der große Mann starrte kurz auf den Code, dann wandte er sich wieder Fred zu. »Sollte dieser Code nicht stimmen, werde ich Ihrem Sohn furchtbare Dinge antun. Das macht mir keinen Spaß. Ich will das nicht. Aber ich werde es tun.«
»Der Code ist richtig. Er wird funktionieren.«
»Gut. Und jetzt … Wo ist die Uhr?«
»Woher zum Teufel wissen Sie davon?«
Krüger seufzte. Fred brauchte eine Demonstration. Das war immer so. Krüger packte Freds linke Hand und brach ihm den kleinen Finger am Gelenk. Der gelähmte Mann schrie und hechelte wie ein Hund.
»Muss ich wirklich zweimal fragen?«, seufzte Krüger.
»In … in meiner Kommode. In der rechten oberen Schublade.« Fred schnappte nach Luft.
Krüger öffnete die Schublade und fand eine Geldkassette, die mit einem Zahlenschloss gesichert war. Fred ratterte auch diese Zahlen herunter, und Krüger öffnete die Kassette. Darin lag die Uhr. Krüger legte die Metallbox wieder in die Schublade und steckte die Uhr in seine schwarze Kampfanzughose.
»Jetzt haben Sie den Code und die Uhr«, sagte Fred. »Bitte. Ich werde für eine Weile verschwinden. Ich werde niemandem erzählen, dass ich Ihnen etwas gegeben habe.«
Krüger kehrte zum Bett zurück und zog sich einen Stuhl neben den zum Tode verurteilten Mann. Dann nickte er tröstend wie auf einer Beerdigung. »Ich fürchte, Sie werden nicht verschwinden, Fred. Ich wünschte, wir würden in einer perfekten Welt leben, in der man einem Menschen wie Ihnen vertrauen könnte, doch leider ist dem nicht so. Ich brauche noch etwas von Ihnen. Ich muss Ihnen beide Daumen abschneiden und ein Auge entfernen.«
»Nein, bitte, nein. Ich …«
Krüger drückte Fred die Hand auf Mund und Nase und beraubte ihn so des Sauerstoffs, den er so dringend brauchte. Aufgrund seines wehrlosen Zustands starb Fred Little schnell und relativ schmerzlos. Trotzdem riss er die Augen vor Angst weit auf, als das Leben aus ihm wich. Krüger hatte immer gehört, dass Ersticken eine der besten Todesarten sei. Es sei, als würde man einfach einschlafen, hieß es.
Doch man hatte Krüger auch schon mal einem Waterboarding unterzogen, und seiner Erfahrung nach waren der Mangel an Sauerstoff sowie das Gefühl des Ertrinkens äußerst schmerzhaft und traumatisch. Hätte er Fred einfach in den Kopf geschossen, wäre es für den armen Mann vermutlich schneller und weniger beängstigend gewesen, aber Krüger wollte keine ballistischen Spuren hinterlassen.
Als er seine Hand wegzog und dem Toten in die Augen schaute, sah er Bilder von Männern, Frauen und Kindern, die aus Mund, Augen, Nase und Ohren bluteten. Ihr Starren war kalt, doch die letzten qualvollen Sekunden waren in ihren Augen noch immer zu sehen … genau wie in denen von Fred Little.
Krüger versuchte sich einzureden, dass das nötig gewesen war, nur Bestandteil einer Mission. Er entschied nicht, wer am Leben blieb und wer starb. Er führte nur die Befehle von jemandem mit sehr viel Geld aus. Und würde er das nicht tun, dann würden andere das Geld einstreichen, und das Ergebnis wäre dasselbe.
Krüger akzeptierte dieses Argument. Er wusste, wie die Welt funktionierte. Er kannte die Nahrungskette und seinen Platz darin. Aber Idris Madeira dachte immer wieder an die Missionare, die einst sein Dorf besucht und Geschichten von einem Ort voller Feuer, Tränen und ewiger Qualen erzählt hatten.
Er schaute auf seine Uhr. Verdammt! Er hatte schon wieder ein paar Minuten verloren. Er holte seine Instrumente heraus und legte sie dem Toten auf die Brust. Insgesamt waren es drei: ein Spekulum, um das Auge offen zu halten, ein scharfer Löffel, um den Augapfel herauszuholen, und eine Gartenschere für die Daumen. Kurz ging Krüger in Gedanken die Prozedur noch einmal durch, dann griff er nach dem Spekulum und dem Löffel und machte sich an die Arbeit.
Kapitel 3
Dominic »Nic« Juliano überholte eine Trantüte und zog die Handbremse, um mit dem schwarzen Maserati GranTurismo MC Stradale um die Kurve und in die Lead Street zu driften. Erst kurz bevor er über die Kante zu der Einfahrt rumpelte, an der ein rotes Schild Kein Zutritt sowie ein weißes darunter Nur für Polizeifahrzeuge verkündete, wurde er ein wenig langsamer.
Schließlich rollte er auf einen Parkplatz und schaute zu seiner Beifahrerin. Sie ignorierte ihn, was dieser Tage allerdings auch die Regel bei LJ war.
Das Gebäude vor ihnen hatte etwas Persisches an sich. Ob das nun an der Sandsteinverkleidung lag oder an den Palmen, das wusste Nic nicht, aber in jedem Fall hatte es ihn schon immer an den Sultanspalast aus dem Film Aladdin erinnert.
Nic schaltete den Motor des italienischen Sportwagens aus, und die schnurrende Schönheit verstummte. Zärtlich tätschelte er die Armaturen und sagte: »Schlaf gut, Baby.«
LJ verdrehte die Augen und verknotete sich fast die Finger, als sie rasend schnell in Gebärdensprache sagte: »Onkel Nicky, findest du es etwa cool, im Wagen meines Dads herumzurasen, als hättest du ihn gerade gestohlen?«
Ebenfalls in Gebärdensprache antwortete Nic: »Nenn mich nicht Nicky, und angesichts der Tatsache, dass ich als SWAT nicht annähernd genug im Monat verdiene, um auch nur die Rate für so einen Wagen zahlen zu können … Oh, ja! Ich finde das sogar saucool! Schließlich ist das ja auch der einzige Vorteil, den ich davon habe, dass ich dich bei mir aufgenommen habe, Prinzessin.«
Nic war bereits ausgestiegen, als er erkannte, was die Worte implizierten, die er gerade seiner Nichte signalisiert hatte. Er knurrte. Er war achtundzwanzig Jahre alt, Single, und das Einzige, was er seit seinem achtzehnten Lebensjahr gemacht hatte, war, bei der Army Bomben zu entschärfen und als Cop Türen einzutreten. Sich um eine Dreizehnjährige, noch dazu hörbehinderte, zu kümmern stand nicht in seiner Jobbeschreibung.
Nic ließ seine eins dreiundneunzig wieder in den Schalensitz des Sportwagens fallen. LJ weigerte sich, ihn anzuschauen. Sie hatte die Lippen aufeinandergepresst, und ihre Wangen waren feucht.
Doch Nic wusste, dass sie ihn noch aus dem Augenwinkel heraus sehen konnte. Er begann, sich mit Gesten bei ihr zu entschuldigen, aber LJ fiel ihm ins Wort. »Dafür habe ich jetzt keinen Kopf«, bedeutete sie ihm, drehte sich aber nicht zu ihm um. »Wenn du mich nicht haben willst, dann sollte ich vielleicht zu Oma und Opa ziehen. Ich will dir nicht zur Last fallen.«
»Nein. Wir sind eine Familie. Ich habe das nicht so gemeint. Ich liebe dich, und du fällst mir nicht zur Last. Außerdem war das Testament deines Dads eindeutig. Er wollte nicht, dass du in dem Haus aufwächst.«
»Ja, klar. In deinem schäbigen kleinen Apartment bin ich ja auch viel besser dran als in einer großen Villa.«
»Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich was Neues suche. Vertrau mir, Kid: Es ist weit wichtiger, mit wem du lebst als wo. Du kennst doch unsere Familiengeschichte. Das ist nicht das Leben, das dein Dad sich für dich gewünscht hat.«
»So schlecht hört sich das aber nicht an.«
Nic knirschte mit den Zähnen. »Diese Villa, von der du da redest, hat dein Großvater Angelo gebaut. Sie haben ihn den ›Großen Schlächter‹ genannt. Als Kind habe ich nicht verstanden, was das hieß. Baseballspieler hatten schließlich auch solche Spitznamen. Also konnte das nichts Schlimmes sein. Nach Opa Angelos Tod haben wir das Anwesen dann geerbt. Anfangs war das cool, viel besser als unsere Wohnung in der Stadt. Wir hatten jede Menge Platz zum Spielen. Es gab da sogar so einen großen Raum im Keller, den wir zum Inlineskaten benutzt haben. Wir haben immer Mädels zum Skaten eingeladen.«
»Jaja, eine wirklich schwere Kindheit.«
»Der Raum war ganz aus Beton mit einem Abfluss in der Mitte. Es gab dort weder Bilder an der Wand noch Möbel, nur diesen Abfluss und ein paar seltsame Seilzüge, die von der Decke hingen. Eines Tages haben Junior und ich dort Hockey gespielt, und Ma hat uns erwischt. Sie ist vollkommen durchgedreht.«
»Ihr durftet da nicht rein?«
»Pop war das egal. Er wusste, dass wir dort spielten. Deshalb wussten wir auch nicht, was wir davon halten sollten, als Ma so ausgerastet ist. Sie hat uns verboten, je wieder in diesen Raum zu gehen. Erst Jahre später habe ich dann erfahren, dass Opa Angelo unsere Skaterbahn sein ›Schlachthaus‹ genannt hat. Und auch Pop hat den Raum oft benutzt und die Tür abgeschlossen. Doch am nächsten Tag hat er stets wieder aufgesperrt und uns viel Spaß gewünscht. Ich habe mich nie gefragt, warum der Boden immer nass war und die Luft nach Bleiche roch, wenn Pop dort fertig war.«
LJ sagte kein Wort. Sie starrte einfach nur in den Fußraum und schien darüber nachzudenken, was das hieß. Dann fragte sie mit ihren Händen: »Bist du je wieder in das Schlachthaus gegangen?«
Trotz der glühenden Hitze lief Nic ein kalter Schauer über den Rücken. »Kid, in unserer Familie großzuwerden, in diesem Haus und mit Tommy Jewels als Dad … Nun, das hinterlässt Spuren. Man fühlt sich irgendwie beschmutzt. Ich versuche immer noch, mich reinzuwaschen. Dein Dad wusste das, und er wollte dir das ersparen. Dieses Leben und dein Opa Tommy haben deine Mom und deinen Dad auf dem Gewissen.«
»Das weißt du doch gar nicht.«
»Stimmt. Aber glaub mir: Männer wie Opa Tommy leben im Schatten des Todes. Er hat ein Talent dafür, Menschen in etwas zu verwandeln, das sie hassen, oder sie in den Tod zu treiben. Ich glaube, deinem Dad hat er beides angetan. Und Junior hatte viel zu viel Angst vor Pop, um sich wie ich davonzumachen.«
»Okay. Das ist ein Argument. Das macht dich aber noch immer nicht zum Ersatzvater des Jahres, Onkel Nicky«, sagte LJ und sprang aus dem Auto.
Einen gehörlosen Teenager großzuziehen hatte einen gravierenden Nachteil: Wenn das Kind beschloss, einen zu ignorieren, dann konnte man brüllen, so viel man wollte, ohne dass das irgendwas bewirkte. Aber nach dem zu urteilen, was Nic von anderen gehört hatte, waren die meisten Teenager so.
Nic schnappte sich seine Ausrüstung und einen großen weißen Karton aus dem Kofferraum. Dann folgte er LJ in den Eingang zum Sicherheitsbereich des Polizeipräsidiums von Henderson. Die Tür konnte man nur von innen öffnen, und Nic kannte die Diensthabende gut.
»Komm schon, Darling«, sagte er. »Sonst erfrieren wir hier draußen noch.«
Über die Sprechanlage meldete sich JoAnn, eine achtundsechzigjährige afroamerikanische Großmutter: »Erfrieren? Ha! Das hier ist Nevada. Wie warm ist es da draußen? Siebenundvierzig Grad? Und das mit dem Darling kannst du dir sparen.«
»Gib’s zu. Du würdest es vermissen. Was ist jetzt? Lässt du uns nun rein oder nicht?«
»Ich sehe doch, wie du mich anschaust. Das ist Sünde.«
Nic lachte. Dann schaute er direkt in die Überwachungskamera und sagte: »Würdest du jetzt bitte aufmachen? Einige von uns müssen nämlich heute arbeiten.«
»Ihr Männer seid doch alle gleich«, seufzte JoAnn, und die Tür öffnete sich mit einem Summen.
Als sie durch die Sicherheitsschleuse waren und JoAnn am Empfang erreichten, wollte Nic JoAnn gerade um einen Gefallen bitten, als die atemberaubendste Blondine um die Ecke bog, die er je gesehen hatte.
Den meisten alleinstehenden achtundzwanzigjährigen Männern, die Maseratis fuhren, hätte es vermutlich gefallen, von jemandem wie Bristol Whelan begrüßt zu werden. Im Fall von Nic war das jedoch anders. Er war bereits mit ihr zusammen gewesen und hatte sogar schon einen Ring für sie gekauft, bevor das Ganze nicht gerade einvernehmlich auseinandergegangen war.
Bristol blieb unvermittelt stehen, versteifte sich und schien sich selbst zu sagen, wie schön, selbstbewusst und professionell sie doch war. Früher, vor der Trennung, hatte Nic ihr diese Art von Ermutigungen immer wieder ins Ohr geflüstert, denn trotz ihres außergewöhnlich guten Aussehens war sie unsicher. Und sie war sehr eifersüchtig. Auf alle und jeden. Vermutlich war sie sogar eifersüchtig auf JoAnn. Allerdings war das nicht der Grund, warum sie sich getrennt hatten. Die Eifersucht hätte Nic ihr vergeben. Schließlich hatte jeder Fehler. Was wirklich den Ausschlag für Nic gegeben hatte, waren die ständigen Spannungen zwischen Bristol und LJ.
Die beiden wichtigsten Frauen in seinem Leben konnten sich nicht riechen, und so hatten sie sich zu dritt auch nie als Familie gefühlt. Und LJ war jetzt ein Teil von ihm. Nic durfte nicht länger nur an sich denken. Er war für seine Nichte verantwortlich. Die Frau, die er irgendwann mal heiraten würde, musste nicht nur seine Ehefrau sein, sondern auch LJs Mom, und er wusste, dass Bristol das nie sein würde.
Schließlich schien Bristol sich genug aufgebaut zu haben. Sie trat zu ihnen, nickte Nic knapp zu und beugte sich dann zu LJ hinunter. »Hallo, Elisabetta«, sagte sie.
LJ verzog das Gesicht, als hätte sie eine volle Windel aufgemacht. Nic schaute zwischen den beiden hin und her. Wäre das hier ein Disneyfilm, die beiden wären ideal für die Rollen der bösen Königin und der heldenhaften Prinzessin. LJ hatte das gleiche dichte kohlrabenschwarze Haar, das auch Nic und sein Bruder von ihrem Vater geerbt hatten, und sie war auch so gebaut wie er: groß – für ihr Alter jedenfalls – und muskulös. Bristol hingegen war eher zierlich und hatte kurzgeschnittenes goldblondes Haar. LJ trug wie immer ein T-Shirt mit einem frechen Spruch darauf, während Bristol in einen grauen Hosenanzug gekleidet war, der zu ihrer Funktion als Stellvertretende Stadtdirektorin passte.
LJ drehte sich zu Nic um. Ihre Abscheu war ihr noch immer deutlich anzusehen. Mit den Händen sagte sie: »Und für die hast du ’nen Ring gekauft? Die hat ja noch nicht einmal ein einziges Handzeichen gelernt. Noch nicht mal Hallo. Du hättest diese Schlampe …«
»Elisabetta Juliano«, fiel Nic ihr ins Wort. »Pass auf deine Hände auf!«
LJ verdrehte die Augen und erwiderte: »Wollen doch mal sehen, ob sie wenigstens das Zeichen hier versteht.« Sie zeigte Bristol den Mittelfinger und schlenderte zu JoAnn.
»So liebenswert wie eh und je«, seufzte Bristol.
»Ja, sie schluckt schon zum Frühstück Feuer. Ich würde ihr nicht zu nahe kommen.«
»Was ist in dem Karton?«, fragte Bristol und deutete auf das große weiße Ding, das Nic mitgebracht hatte.
»Das ist eine Überraschung.«
»Du steckst immer voller Überraschungen.«
»Danke«, sagte Nic, bevor er erkannte, dass sie das vermutlich als Beleidigung gemeint hatte. »Erinnerst du dich noch daran, wie ich zu deinem Geburtstag den Eiffelturm im Casino Paris gemietet habe?«
Bristol lächelte schwach. »Ja, ich weiß noch immer nicht, wie du das geschafft hast. Und dann das Candlelight-Dinner auf der Aussichtsplattform …«
»Ja, von dort hat man den besten Blick auf Vegas, den es gibt. Das war eine ziemlich gute Überraschung.«
Bristols Lächeln verschwand, und Tränen erschienen in ihren Augen. »Und du? Erinnerst du dich noch daran, wie du mit mir Schluss gemacht und mir erzählt hast, du hättest mich betrogen? Das war auch eine ziemlich große Überraschung.«
»Bristol …«
»Spar dir das. Als du mir an dem Abend gesagt hast, wir müssten reden, da habe ich gedacht, du würdest mir einen Antrag machen. Doch stattdessen hast du mir das Herz gebrochen.«
»Ich wollte dir nie wehtun. Nie.«
»Wenn dem so ist, dann hast du eine verdammt seltsame Art, das zu zeigen. Ich hätte wissen müssen, dass ein Typ, der in einer Keksdose von Wohnung lebt und einen Maserati fährt, nicht zum Ehemann taugt.«
»Was haben denn das Auto und meine Wohnung damit zu tun?«
Bristol verdrehte die Augen. »Du bist ja so egoistisch. Wenn du den Wagen verkaufst, könntest du dir davon problemlos ein Haus leisten, aber ohne die coole Karre würdest du wohl nicht mehr so viel Mädels abschleppen können.«
Einen Moment lang verschlug es Nic die Sprache. Bis jetzt hatte er noch nicht einmal daran gedacht, den Wagen zu verkaufen. Der Maserati war der ganze Stolz seines Bruders gewesen. Ihn zu verkaufen wäre Verrat gewesen. Aber vielleicht hatte Bristol ja recht. Vielleicht wäre ein schönes Heim für LJ ja eher in Juniors Sinne.
»Tatsächlich habe ich mich schon nach einem Käufer umgeschaut«, log er.
»Wie auch immer, Nic. Es ist egal. Das ist nicht mehr mein Problem.«
Und mit diesen Worten drängte Bristol sich an ihm vorbei und verließ das Gebäude, ohne sich auch nur einmal umzudrehen.
Nic gesellte sich zu LJ und JoAnn am Empfang. »Was mache ich nur falsch, JoAnn?«
»So gut wie alles, aber wer bin ich schon. Andererseits glaube ich ohnehin nicht, dass Miss Whelan hart genug für dich ist.«
»Was soll das denn heißen?«
»Du brauchst eine Frau, die dir ab und an mal in den Arsch tritt. So … Was ist jetzt in dem weißen Karton? Wenn das Donuts sind und du mich zwingst, meine Diät aufzugeben …«
»Das sind keine Donuts. Das sind alles Dinge, in die du dein hübsches Näschen lieber nicht reinstecken solltest.«
JoAnn schaute ihn anzüglich an. »Jetzt komm mir nicht mit meinem ›hübschen Näschen‹, Junge. Nicht so frech. Ich habe die Frechheit erfunden. Ich und Whoopi Goldberg. Wir waren Pioniere auf dem Gebiet.«
»Whoopi wer? Warte … War die nicht bei Hollywood Squares?«
»Das reicht. Ich kann dir noch nicht einmal mehr in die Augen sehen.«
Nic lachte und wollte gerade etwas Passendes darauf erwidern, als ihr Frischling, Hank Stromberg, den Kopf um die Ecke steckte und sagte: »Chef, wir haben eine Geiselnahme. Die Beamten vor Ort fordern Verstärkung an, und Sergeant Ortiz ist nicht …«
»Ich bin direkt hinter dir.«
Nic drehte sich wieder zu JoAnn um und schaute sie mit großen, traurigen Hundeaugen an. Mehr musste er nicht tun. JoAnn verdrehte die Augen und seufzte: »Jaja. Ich werde sie in die Schule bringen. Pass auf da draußen, Junge.«
Kapitel 4
Krüger stand neben dem weißen Lieferwagen und schaute zu, wie die fünfköpfige Familie die Tresorvermietung durch den Haupteingang verließ. Das kleinste der drei Kinder, ein Junge, starrte ihn unablässig an, obwohl seine Mutter ihn weiterzog. Der große Südafrikaner machte ihm das nicht zum Vorwurf. Immerhin war Krüger ein mehr als zwei Meter großer Mann, der trotz der glühenden Hitze, die im Sommer in Las Vegas herrschte, einen langen Mantel und eine Beanie-Mütze trug.
Krüger achtete sorgfältig darauf, Abstand zu wahren, und er wartete, bis das Kind weg war. Erst dann warf er seine Sonnenbrille in den Lieferwagen. Er wollte unbedingt vermeiden, dass ihn jemand, und sei es nur grob, der Polizei beschreiben konnte.
Aber er musste auch sicherstellen, dass keine Kinder mehr in dem Gebäude waren. Das war das Wichtigste für ihn. Es gab nur wenig, was er nicht tun würde, um eine Mission zu erfüllen, aber das Töten von Kindern war stets tabu gewesen. Vielleicht war das ja der Grund dafür, warum das Squatter-Massaker ihn so aus der Spur geworfen hatte.
Noch immer sah er die Gesichter dieser armen Kinder im Geiste vor sich, als er ihnen die Köpfe abgeschlagen hatte. Ja, das war ein Gnadenakt gewesen, doch das hatten sie nicht verstanden. Die Angst in ihren Augen verfolgte ihn mehr als alles andere, was er jemals getan hatte. Er war zwar immer schon ein Raubtier gewesen, aber nie ein Monster. Das konnte er nun nicht mehr von sich behaupten.
Seine Hände zuckten; ihm war trotz der Hitze eiskalt, Tränen traten ihm in die Augen.
Krüger dachte an sein eigenes kleines Mädchen, Kianga. Sein Sonnenschein. Während er der Familie hinterherschaute, erinnerte er sich an die Zeit, die er mit seiner Tochter verbracht hatte. Er war mit ihr in den Krüger-Nationalpark auf Fotosafari gefahren, um ihr die Elefanten, Löwen und all die anderen wilden Tiere zu zeigen. Dass Löwen ihre Großmutter getötet hatten, hatte er ihr zwar verschwiegen, aber er hatte dafür gesorgt, dass sie die Raubtiere fürchtete und respektierte.
Vor seinem geistigen Auge sah er sie in ihrem mit Kätzchen bedruckten rosafarbenen Schlafanzug. Sie spielten Verstecken in dem riesigen Haus, nicht weit entfernt von der Stelle, wo Krüger und Zarina als Kinder gerettet worden waren. Warum er ausgerechnet dort hatte leben wollen, er hatte keine Ahnung. Aber es war sein Heim, und in diesem Augenblick wünschte er sich nichts sehnlicher, als wieder in den Transporter zu steigen und zu seinem wunderschönen kleinen Lockenköpfchen im rosafarbenen Schlafanzug zu fahren.
Eine seltsame Sehnsucht erfasste ihn, und er fragte sich nicht zum ersten Mal, ob er ein guter Vater war. Zweifelsohne sorgte er für seine Familie. Kianga fehlte es an nichts. Sie besuchte die besten Schulen, und er hatte genügend Geld beiseitegeschafft, dass sie für den Rest ihres Lebens geschützt und versorgt sein würde. Er liebte sie, und er hatte sichergestellt, dass sie das auch wusste. Aber war das genug?
Krüger wischte sich die Tränen ab und schrie sich in Gedanken an. Was machte er da? Bei einer Mission hatte er noch nie an Kianga gedacht. Ihr Vater war Idris. Er war es, der sie immer zugedeckt, auf die Stirn geküsst und all die Stellen gekannt hatte, an denen sie kitzelig gewesen war. Krüger hingegen war nicht ihr Vater, und deshalb dachte Krüger auch nie an sie. Doch als die Grenze des Tabus verschwamm, hatte Krüger seine Mitte verloren und war in einem Meer der Unsicherheit und Zweifel versunken.
Aber so groß seine Bestürzung auch sein mochte, er musste noch eine Weile durchhalten. Was immer von Krüger übrig war, musste Idris lange genug in Schach halten, damit er tun konnte, was er tun musste.
Krüger schaute zu Sparks und dem Doc, die sich gerade auf der anderen Seite des Transporters bereitmachten. Sein Codename für diese Mission lautete »Mr. K«. Seine Frau liebte es, Codenamen zu verteilen, und er liebte es, ihr eine Freude zu bereiten.
Obwohl Krüger noch mit keinem der beiden einen Job erledigt hatte, machte er sich keine Sorgen. Der Doc verfügte über Spezialkenntnisse, und Sparks – ein dreißigjähriger amerikanischer Niemand mit Namen Lamar Franklin, der einfach als Verstärkung gedacht war – würde seine Aufgabe perfekt erfüllen.
Krüger hatte jedes noch so kleine Detail des Plans selbst ausgearbeitet. Er hatte alle erdenklichen Umstände in Betracht gezogen und sich entsprechend vorbereitet. Trotzdem konnte noch immer etwas passieren, womit er nicht gerechnet hatte. Das wusste er. Aber darum würde er sich erst kümmern, wenn es so weit war; er würde jedes Hindernis aus dem Weg räumen. Nicht weil er zornig, verrückt oder blutrünstig war. Tatsächlich war es ihm vollkommen egal, ob andere Menschen zu Schaden kamen; das war es ihm zumindest einmal gewesen. Die Mission stand stets an erster Stelle. Das war auch der Grund dafür, warum er Erfolg hatte, wo andere scheiterten. Es gab nichts, was er für Geld nicht tun würde.
Oder zumindest hatte er das immer geglaubt. All die Dinge, die er getan hatte, hatten ihn nie bis in den Schlaf verfolgt … bis jetzt.
Krüger nickte Sparks und dem Doc zu. Es war so weit. Sie hatten bereits die Bestätigung erhalten, dass der Filialleiter sich im Gebäude befand und der potenzielle Kollateralschaden sich in Grenzen hielt. Familien würden also nicht betroffen sein, und die Zahl der Geiseln war überschaubar.
Sie hatten den Transporter außer Reichweite der Kameras abgestellt, doch sobald sie auch nur fünf Schritte auf die Tür zugingen, würden sie digitale Spuren hinterlassen, die die Polizei auswerten konnte. Darauf waren sie allerdings vorbereitet. Die drei zogen sich Skimasken über die Gesichter und marschierten auf den Eingang zu.
Der Name der Firma stand in fünf Fuß großen blauen Buchstaben an der Fassade und noch einmal in zehn Fuß großen Lettern auf beiden Seiten einer Standtafel.
GoBox.
Der Werbespruch darunter lautete: Bei uns sind Ihre Wertsachen sicher und stets griffbereit.
Krüger lächelte. Das mit dem griffbereit würde er schon bald austesten. Aber man hatte ihn nicht dafür angeheuert, irgendwas aus den Boxen oder von den Kunden zu stehlen. Die »Wertsachen«, auf die er es abgesehen hatte, gehörten der US-Regierung.
In enger Formation rückten die drei über den Parkplatz vor. Der Asphalt stank wie eine Teergrube. Die Hitze machte Krüger nichts aus. Er war das aus dem Busch gewohnt. Was ihn störte, waren die Gerüche der Stadt: der Gestank der vom Menschen vergewaltigten Natur und der pervertierten Wunder und Schönheit dieser Welt. Er fühlte sich mehr in einer Welt daheim, wo die Raubtiere Mähnen trugen und keine italienischen Maßanzüge.
Doch Raubtiere folgten ihrer Beute, und das hieß, dass Krüger dorthin gehen musste, wo das Geld war. Das galt umso mehr, da er sich so schnell wie möglich zur Ruhe setzen wollte, und wenn er anschließend seine wunderbare Frau weiter mit teurem Schmuck behängen wollte, dann musste er einen Haufen Geld erbeuten und sich damit davonmachen, ohne zum Gejagten zu werden.
Und heute, an diesem Morgen, war der Tresorraum von GoBox der Ort, wo ein gewaltiger Berg Geld auf ihn wartete.
Kapitel 5
So hatte US Army Corporal Lamar Franklin sich seine Rückkehr ganz und gar nicht vorgestellt. Tatsächlich war er überhaupt nur zur Army gegangen, um dies zu vermeiden, doch jetzt war er hier, und es ging ihm wie zehn Prozent aller anderen Veteranen auch: Er war arbeitslos. Nachdem er vier Jahre lang Sand bewacht hatte, war er in ein leeres Haus zurückgekehrt, und seine Frau, inzwischen seine Exfrau, war mit einem Möchtegern-Rapper und all ihren Ersparnissen durchgebrannt. Franklins Großmutter hatte immer gesagt, er gehöre zum unteren Ende des Genpools. Vermutlich hatte er sein ganzes Leben lang versucht, ihr das Gegenteil zu beweisen.
Franklin schaute auf sein Sturmgewehr vom Typ M4A1.
Er kannte den Plan.
Mr. K würde alle Kameras zerschießen, und Franklin – oder Sparks, wie sein Codename für diese Operation lautete – würde sich um den bewaffneten Wachmann in der Ecke kümmern. Franklin versuchte, diesen Job wie jede andere Mission zu betrachten, und er befolgte die gleiche Routine wie vor jedem anderen Einsatz auch. Er griff nach seinem Medaillon mit dem Bild des Erzengels Michael und betete: Möge ich voller Mut meine Pflicht erfüllen. Sollte der Tod mich auf diesem Feld ereilen, dann vergib mir meine Schuld. Amen.
Dann trat Franklin durch den Haupteingang der Firma, eine Monstrosität aus Glas mit einem Rahmen aus dunklem Holz. Einen Teil der Lobby konnte er bereits sehen. Sie sah aus wie in einer typischen Privatbank, doch GoBox war alles andere als das.
Krüger ging als Erster hinein. Der große Mann hob sein halbautomatisches Schrotgewehr und jagte mehrere Salven Blei in Richtung Decke. Damit erregte er nicht nur die Aufmerksamkeit aller Anwesenden, er schaltete auch die Kameras aus.
Der Doc hatte eine große, abgesägte Schrotflinte dabei, aber der Doc schoss nicht. Dafür war der Doc auch nicht da. Das wusste selbst Franklin. Was Franklin jedoch nicht wusste, war, warum jemand wie der Doc überhaupt bei diesem Überfall mitmachte. Aber wenn die Beute auch nur halb so gut war, wie Krüger versprochen hatte, dann scherte es Franklin herzlich wenig, ob der Doc hier die Startcodes der amerikanischen Atomwaffen stehlen wollte. Ein Scheck mit genug Nullen konnte selbst einen gutkatholischen Jungen wie Franklin dazu bewegen, auch noch das vornehmste der Zehn Gebote zu brechen.
Kaum war Franklin durch die Tür, da hatte er das M4 im Anschlag und auf den Wachmann in der rechten Ecke gerichtet. Natürlich wusste Franklin nicht, was er tun würde, sollte der Mann sich zur Wehr setzen. In jedem Fall würde er nicht einen vollkommen Unschuldigen töten, der bestenfalls zwölf fünfzig die Stunde verdiente.
Glücklicherweise gelang es Franklin mit einem kurzen Feuerstoß in die Wand, den weißen Mittvierziger mit dem Bierbauch davon zu überzeugen, dass er waffentechnisch massiv unterlegen und zudem deutlich unterbezahlt war. Der Mann hob die Hände, und Franklin nahm ihm die Pistole aus dem Holster.
Krüger brüllte: »Alle Mann die Hände hoch und keine Bewegung! Wenn auch nur einer einen Finger rührt, seid ihr alle tot!«
Ein paar hoben daraufhin auch die Hände, doch andere waren vor Angst wie erstarrt. »Hoch damit! Sofort!«, schrie Krüger.
Franklin packte den alten, fetten Mietbullen an der Schulter und stieß ihn mitten in den Raum zu den anderen.
Sie hatten das Innere des Gebäudes eingehend studiert. Rechts vom Eingang befand sich der Empfangstresen. Er bestand aus weißem Marmor. Dort waren auch die verschiedenen Größen der Tresorboxen ausgestellt, die den Kunden angeboten wurden. Und die drei wussten, dass sich stets ein Wachmann vorn und zwei weitere hinten aufhielten.
Links vom Empfang schloss sich ein kleines Areal an, das mit einem Holzgeländer vom Rest der Lobby abgetrennt war, ähnlich wie der Zuschauerraum in einem Gerichtssaal. Hinter dem Geländer standen vier Schreibtische. Der ganze Laden roch nach Gurken und Zitrone, als wäre normale Luft für diese Leute nicht gut genug, dachte Franklin. Zwei der Schreibtische waren im Augenblick unbesetzt, und an den beiden anderen saßen eine dunkelhäutige Schönheit Mitte zwanzig sowie eine eher kräftig gebaute Frau mit kurzem weißem Haar. Beide trugen khakifarbene Hosen und blaue Blusen mit dem Firmenlogo. Das war der Teil des Raums, den GoBox Empfang nannte. Hier wurden Neukunden über die Angebote von GoBox informiert und Verträge unterschrieben.
Krüger drückte der jüngeren Frau das Schrotgewehr ins Gesicht und sagte: »Hat eine von Ihnen den stummen Alarm ausgelöst?«
Die beiden verschreckten Frauen schüttelten hastig die Köpfe. Wie Statuen mit riesengroßen Augen saßen sie da und reckten die Hände in die Höhe. Sie sahen aus, als hätten sie sogar Angst, zu atmen oder zu blinzeln.
Krüger fügte hinzu: »Nun, dann drücken Sie mal schnell den Knopf. Nicht dass die Cops zu spät zur Party kommen.«
Kapitel 6
Eigentlich hatte Nic Juliano gedacht, nach acht Jahren bei der Militärpolizei und beim Bombenentschärfungskommando sei es für ihn mit dem Armeegrün vorbei. Doch als er in die Staaten zurückgekommen war und eine Stelle beim SWAT von Las Vegas gefunden hatte, da hatte er sich die Uniform wieder überstreifen müssen. Das SWAT-Team von Henderson bezog seine Uniformen aus den Beständen des Verteidigungsministeriums, und das hieß dunkelgrüne Tarnanzüge, die perfekt zu den grünen Helmen passten. Das einzig Schwarze an der Uniform waren die Körperpanzer, auf denen in fetten weißen Lettern POLIZEI geschrieben stand. Selbst die gepanzerten Fahrzeuge, die sie gegenwärtig nutzten, stammten aus Armeebeständen und waren dementsprechend grün. Doch Nic konnte sich nicht beschweren. Die Armee war gut zu ihm gewesen, genauso die Polizei von Henderson. Trotzdem, er sehnte sich danach, endlich die schwarze Uniform der FBI-Spezialeinheiten zu tragen und irgendwann dann auch die der FBI-Eliteeinheit zur Geiselbefreiung.
Nic schloss die Augen und konzentrierte sich auf die vor ihm liegende Aufgabe. Im Augenblick kümmerten ihn seine Wünsche nicht. Jetzt war nur eines für ihn wichtig: Er musste für die Sicherheit seiner Jungs sorgen und die Geisel retten.
Normalerweise musste das Team sich förmlich in den gepanzerten Transporter quetschen, doch heute fehlten drei Mann, weshalb der Rest ein wenig Beinfreiheit hatte. Nic ließ den Blick über seine Brüder schweifen. Insgesamt fünf von ihnen drängten sich Knie an Knie in dem grünen BearCat-Transporter, während ein weiterer Bruder und eine Schwester vorne saßen.
Nic brüllte in Richtung Fahrer: »Wann sind wir da?«
»In fünf Minuten!«
Nic beugte sich zu einem der anderen: »Stromberg, wie ist die Lage?«
Hank Stromberg, ihr neuestes Teammitglied, war ein großer blonder Bauernjunge aus Iowa. Er sah aus, als könnte er einen Cadillac stemmen. Über das Dröhnen des Motors hinweg antwortete der Frischling: »Über den Notruf meldete sich eine Frau, die erklärte, sie und ihr Mann hätten sich vor drei Tagen gestritten. Daraufhin hat er sie in einen Schrank gesperrt und hält sie seitdem gefangen. Irgendwie ist sie jedoch an ein Telefon rangekommen und hat den Notruf angerufen. Sie ist noch immer in dem Schrank. Der Mann ist so ein Survivalfreak. Er hat jede Menge Waffen, alle registriert, aber keinen Eintrag im Vorstrafenregister.«
Nic wusste, dass das nicht unbedingt etwas Gutes zu bedeuten hatte. So seltsam es auch klang, bei den Leuten mit den längsten Vorstrafenregistern benötigte man gewöhnlich die wenigste Gewalt. Der Grund dafür war einfach: Diese Leute wussten, was auf sie zukam. Doch Menschen, die bis zur Tat eine weiße Weste hatten, setzten alles daran, nicht ins Gefängnis zu kommen, egal um welchen Preis. Das waren die Leute, die Nic Sorge bereiteten.
»Was ist mit dem Haus?«, fragte er.
Einer seiner Brüder antwortete: »Ein einstöckiger Bau im Ranch-Stil. Kein Keller. Dürfte ziemlich einfach sein.«
»Wissen wir, wer das Haus gebaut hat? Gehört es zu einer Reihensiedlung?«
»Jedenfalls liegt es draußen in einer dieser schäbigen Vorstädte. Also ja, denke ich«, antwortete Stromberg.
»Vielleicht können wir uns den Grundriss ja direkt von der Webseite der Immobilienfirma besorgen. Oder vielleicht gibt es ja einen Makler vor Ort, der Führungen durch ähnliche Objekte veranstaltet.«
»Heutzutage werden die Dinger allerdings immer individueller gestaltet. Alles nach Käuferwunsch.«
»Ist die Geisel noch am Telefon?«
»Nein. In der Zentrale geht man davon aus, dass der Verdächtige sie erwischt hat. Aber sicher sind sie sich nicht.«
»Und das heißt, dass wir womöglich schon erwartet werden«, seufzte Nic. »Okay, Stromberg und ich werden uns dem Haus allein und zu Fuß nähern. Wir werden nur ein wenig Aufklärungsarbeit leisten und vielleicht einen Bot losschicken, wenn wir die Gelegenheit dazu bekommen. Der Rest bleibt bei den Uniformierten an der Absperrung. Ich will einen Plan für den Zugriff haben, und zwar bevor der Sergeant eintrifft. Und jetzt … Ihr wisst ja, was jetzt kommt.«
Die Männer drückten ihre Fäuste aneinander und senkten die Köpfe. »Passt aufeinander auf. Konzentriert euch. Wer macht’s mit mir?«
Stromberg schüttelte den Kopf. »Ich bin zwar dran, aber ich mach das nicht.«
»Musst du aber. Das bringt sonst Unglück. So … If you’re lost, you can look, and you will find me…«
Stromberg verdrehte die Augen. »Time after time.«
»Du musst das singen, Frischling. If you fall, I will catch you, I’ll be waiting!«
Ein breites Grinsen erschien auf Strombergs nordischem Gesicht. Er konnte sich nicht länger beherrschen. Dann sang er in angenehmem Bariton: »Time after time.«
»Sehr schön!«, sagte Nic. »Vergesst nicht: Passt auf euren Partner auf. Er wird das Gleiche für euch tun. Dann kommen wir alle gesund und munter wieder heim. Time after time.«
Er beendete das Ritual mit einem kurzen Gebet, und einen Augenblick später erreichte der BearCat die Absperrung der Streifenbeamten, die bereits vor Ort waren. Das SWAT-Team sprang aus dem grünen Panzerwagen und machte sich sofort an die Arbeit.
Kapitel 7
Der Notruf war aus einem von hundert nahezu identischen Häusern gekommen, die die Kreosotbüsche und Stechapfelsträucher aus den Außenbezirken von Henderson verdrängt hatten. Als Nic und Stromberg zu den dichtgedrängten Häusern im Ranch-Stil gingen, entdeckten sie sofort eine ganze Reihe von Deckungsmöglichkeiten. Sich dem Haus unbemerkt zu nähern war also kein Problem. Schwierig war nur, an all den Nachbarn vorbeizuschleichen, ohne dass sie einen sahen und einen Aufstand veranstalteten. Schlimmstenfalls warnten sie so den Täter.
Die beiden Männer hatten einen Teil ihrer Ausrüstung abgelegt, einschließlich der Helme. Dann zogen sie sich spezielle Kleidung über ihre Uniformen, die sie tarnen sollte, aber einfach herunterzureißen war. Diese Art von Kleidung war zum Infiltrieren gedacht. Sie sollte verhindern, dass ein Verdächtiger die Beamten direkt als solche identifizierte. Allerdings schienen manche Menschen einen sechsten Sinn für Cops zu haben.
Als Nic seinen Abschluss an der Polizeiakademie gemacht hatte, da hatte sein Onkel Romeo zu ihm gesagt, er rieche jetzt nach Cop, als hätte seine Berufswahl ihn irgendwie beschmutzt. Onkel Romeo war schon immer berüchtigt dafür gewesen, jeden noch so gut getarnten Cop auf Anhieb zu erkennen. Offenbar wurden manche Menschen mit dieser Fähigkeit geboren … besonders jene, die in der Welt des organisierten Verbrechens aufwuchsen.
Zum Glück gab es stets ein paar Gassen und Schleichwege, an die sie sich halten konnten. Der Frischling übernahm die Führung und suchte sich einen Weg zur Rückseite des Hauses. Jetzt mussten sie nur noch über den Zaun klettern, dann wären sie an der Hintertür.
»Wirf den Throwbot rein«, sagte Nic. »Ich gehe hinter den Müllcontainer da.«
Beim Throwbot XT handelte es sich um einen taktischen Mikroroboter, der wie eine Küchenpapierrolle mit je einem Schwungrad an den beiden Enden aussah. Nic konnte den Roboter mit einer Fernsteuerung lenken, die kaum größer als ein Funkgerät war, und dabei alles sehen und hören, was sich in Reichweite der Maschine befand. Das Ding wog nur ein Pfund, konnte bis zu vierzig Meter weit geworfen werden und operierte nahezu geräuschlos.
Stromberg sprang über den Zaun und hielt auf eines der rückwärtigen Fenster zu. Nic folgte dem großgewachsenen Wikinger ein Stück weit, hockte sich dann aber neben einen großen Müllcontainer an der Ecke des Hauses. Er schaute auf die Uhr: 10:11 Uhr. Die Müllabfuhr war mit Sicherheit schon hier gewesen, und so war es eher unwahrscheinlich, dass genau jetzt jemand aus der Nachbarschaft seinen Müll rausbringen würde. Trotzdem, Murphys Gesetz galt auch hier: Was schiefgehen kann, geht auch schief.
Nic konnte Stromberg kaum sehen, während der blonde Hüne ein Stück Glas aus dem Schlafzimmerfenster schnitt. Anschließend vergewisserte er sich mit einer Drahtkamera, dass im Inneren niemand war, und warf den Roboter hinein.
Das Haus war dunkelbeige verputzt und hatte ein braunes Schindeldach. Es war lang und schmal, und vorne gab es noch eine Garage.
Nic bereitete die Fernsteuerung vor und wartete, bis der Roboter an Ort und Stelle war. Nach nur wenigen Sekunden hatte er einen Audio- und Videostream aus dem Haus. Im Schlafzimmer war es dunkel; also schaltete Nic die Wärmebildkamera des Throwbots an.
Er lenkte das winzige Gerät durch das Schlafzimmer und einen Flur hinunter, von wo aus er ein kleines Esszimmer mit offener Küche sehen konnte. Und da, in dem kleinen Esszimmer, hinten bei der Schiebetür aus Glas, die nach draußen führte, stand ihr Schütze. Er hielt eine schwere Schrotflinte in der Hand.
Nic lenkte den Throwbot nach rechts. Ein Vorhang versperrte die Sicht durch die Schiebetür nach drinnen.
Das einzige Problem war, dass eine Straßenlaterne in der Nähe jeden, der sich im Hinterhof aufhielt, als Silhouette auf dem Stoff sichtbar machte.
Und offensichtlich bewegte Stromberg sich gerade vor genau dieser Tür entlang. Selbst auf dem körnigen Bild der Roboterkamera konnte Nic den Umriss seines Kollegen klar und deutlich erkennen.
Nic richtete die Kamera wieder auf den Schützen. Der Mann hob die Schrotflinte.
Nic ließ die Fernbedienung fallen und rannte los.
Stromberg hob verwirrt den Blick, doch Nic stürzte sich bereits auf ihn.
Er hatte keine Zeit für einen tollen Plan. Er musste Stromberg einfach nur aus der Schusslinie bringen. Dann traf er den großen Mann mit voller Wucht und warf ihn zu Boden.
Im selben Augenblick hörte Nic den Knall der Schrotflinte. Er hörte das Glas splittern, und er spürte, wie die Splitter sich ihm ins Gesicht bohrten. Den Bruchteil einer Sekunde später folgte ein furchtbarer Schlag, der Nic die Luft zum Atmen nahm und ihn durch die Luft schleuderte.
Bevor die Dunkelheit ihn holte, hörte Nic noch weitere Schüsse, Schreie und dann Stromberg, der jemanden anbrüllte, sich sofort auf den Boden zu legen.
Und dann hörte Nic gar nichts mehr.
Kapitel 8
In der hinteren Hälfte der GoBox-Filiale befanden sich die vier Räume, in denen die Kunden ungestört Einsicht in ihren Besitz nehmen konnten, das Büro des Filialleiters sowie der Zugang zum Tresorraum. Ein spezielles Transportsystem brachte die Sachen der Kunden aus dem Haupttresor herauf, einer Stahlbetonkonstruktion der Klasse 1 von UnderwriterLaboratories, der Standardfirma für solche Dinge. Krüger wusste, dass dieser Tresor nur über das Transportsystem zugänglich war. Selbst die Angestellten von GoBox hatten dort keinen Zutritt. Der einzige Weg, um an den Inhalt einer der Boxen zu gelangen, die die Firma anbot, waren ein Fingerabdruckscanner, ein Retinascanner und ein achtstelliger PIN-Code. Außerdem musste der Sicherheitsdienst von GoBox auch noch die Identität des Betreffenden anhand eines hinterlegten Fotos bestätigen.
Zum Glück hatte Krüger nicht den Auftrag, irgendetwas aus dem Hochsicherheitstresor zu stehlen.
Aber bevor er überhaupt etwas stehlen konnte, musste er erst einmal an dem bemannten Sicherheitsposten vorbei, der mit zehn Zentimeter dickem und explosionsfestem Polykarbonat gesichert war.
»Sparks«, sagte Krüger, »rufen Sie an und schalten Sie die Funkstörer an.«
Sparks/Franklin schnappte sich den Telefonhörer vom Empfang und wählte den Notruf. »Wir haben GoBox in Henderson übernommen«, sagte er. »Wir haben Geiseln, und wir verfügen sowohl über Sturmgewehre als auch Sprengstoff. Unsere Forderungen lauten: 1. Kommen Sie dem Gebäude nicht zu nahe, sonst sterben alle hier. 2. Nach diesem Anruf werden wir sämtliche Kommunikation in und aus dem Gebäude unterbinden. Später werden wir Sie wieder kontaktieren, um Ihnen weitere Anweisungen zu geben. 3. Wir werden nur mit einem leitenden Special Agent des FBI oder jemandem im Rang darüber reden. Mit der örtlichen Polizei werden wie jedoch nicht sprechen. Sollten Sie diese Anweisungen nicht befolgen, werden alle sterben.«
Franklin hatte genau das gesagt, was er hatte sagen sollen. Mit einem Lächeln unter der Skimaske lobte Krüger ihn: »Gut gemacht, Sparks.«
Krüger und Franklin sammelten die vier Geiseln aus dem vorderen Teil des Gebäudes ein.
An den Doc gewandt sagte Krüger: »Passen Sie auf sie auf.«
Dann ging er zu dem Fingerabdruck- und dem Retinascanner, die neben der Stahltür direkt hinter dem Empfang angebracht waren. Dieser Teil war leicht. Um Zutritt zu erhalten, mussten seine Fingerabdrücke und sein Retinaprofil nur im System von GoBox sein, und dafür brauchte er lediglich ein Formular, ein Foto und fünf Dollar. GoBox verlangte weder einen Ausweis noch eine Sozialversicherungskarte oder sonst etwas, das bewies, dass eine Person wirklich die war, für die sie sich ausgab. Solange man eine Hand sowie ein Auge hatte und die Gebühr für drei Monate im Voraus bezahlt war, vermietete GoBox einem eine der Boxen. Und genau das hatte Krüger getan. Er hatte sich registrieren lassen. Aber natürlich würde er nach der Mission all seine Daten wieder löschen.
Da seine Fingerabdrücke und sein Retinaprofil nun also im Computer waren, ging Krüger einfach zum Scanner und verschaffte sich Zugang zur Sicherheitstür wie jeder andere Kunde auch. Er schob seine Hand in das Lesegerät, hielt sein Auge dicht vor die Linse, und die Stahltür öffnete sich mit einem Klicken.
Krüger betrat die kleine Sicherheitsschleuse und schaute nach links zur Wachstation, wo ein Securitymann ihn mit großen Augen anstarrte. Doch der Mietbulle war nicht allein. Der Filialleiter beugte sich über ein langes, schmales Mikrofon auf dem Tisch. Als er sprach, kam seine Stimme aus einem Lautsprecher irgendwo in der Decke.
Mit einem arroganten britischen Akzent erklärte der Filialleiter: »Mein Name ist Quentin Yarborough. Ich bin hier der Filialleiter. Die Polizei ist bereits auf dem Weg, und Sie werden es unmöglich tiefer ins Gebäude schaffen. Daher möchte ich Ihnen nahelegen, dass Sie unverzüglich Ihre Flucht einleiten.«
Krüger lachte und entgegnete: »Wissen Sie, was das Problem an Sicherheitssystemen ist? Der Mensch. Solange wir keinen Weg finden, uns selbst aus der Gleichung zu nehmen, gibt es keine echte Sicherheit.«