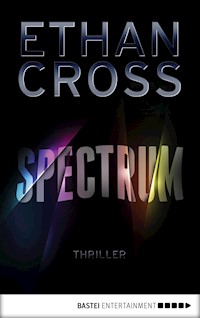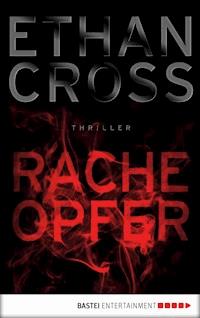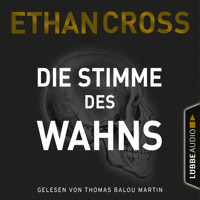Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Shepherd Thriller
- Sprache: Deutsch
Mein Name ist Francis Ackerman junior. Ich bin das, was man gemeinhin einen Serienkiller nennt. Doch ich töte nicht wahllos, und jedes meiner Opfer bekommt eine faire Chance, denn ich fordere es zu einem Spiel heraus. Wer gewinnt, überlebt. Ich habe noch nie verloren. Die meisten Menschen werden mich verabscheuen. Einige, die mir ähnlich sind, werden mich verehren. Aber alle, alle werden sich an mich erinnern. Mein Name ist Francis Ackerman junior. Ich bin die Nacht, und ich möchte ein Spiel mit Ihnen spielen ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 51 min
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Erster Teil - Die Herde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zweiter Teil - Der Wolf und der Hirte
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Dritter Teil - Stecken und Stab
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Vierter Teil - Der Wolf im Schafspelz
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Danksagungen
Leseprobe
Über den Autor
Ethan Cross ist das Pseudonym eines amerikanischen Thriller-Autors. Nach einer Zeit als Musiker gelang es Ethan Cross, die Welt fiktiver Serienkiller um ein besonderes Exemplar zu bereichern: Francis Ackerman junior. Der gnadenlose Serienkiller erfreut sich seitdem großer Beliebtheit: Jeder Band der Reihe stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Der Autor lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in lllinois.
Ethan Cross
ICH BIN DIENACHT
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonDietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by Aaron Brown
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Shepherd«
Published in agreement with the author, c/o Baror International, Inc., Armonk, New York, U. S. A.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
eBook-Erstellung: Olders DTP.company, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-4556-5
Dieses eBook enthält eine Leseprobedes in der Bastei Lübbe AG erscheinenden Werkes »ICH BIN DER HASS« von Ethan Cross.
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Wolfgang Neuhaus, OberhausenTitelillustration: © shutterstock/IgorskyUmschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Erster TeilDie Herde
1.
Das flackernde Blaulicht seines Streifenwagens tanzte über die Fensterscheiben der Tankstelle. Trooper Jim Morgan versuchte angestrengt, durch die zuckenden Reflexionen in das dunkle Innere des Gebäudes zu blicken. Die Zentrale hatte einen Raubüberfall gemeldet, aber aus einem unerfindlichen Grund regte sich am Rand von Jims Bewusstsein ein irrationales, aber überwältigend starkes Gefühl des Grauens. Erklären konnte Jim es nicht. Er wusste nur, das hier war viel schlimmer. Vielleicht war es der Instinkt des Polizisten, vielleicht Intuition. Er wusste jedenfalls, dass hier etwas nicht stimmte, ganz und gar nicht.
Jim atmete tief ein und wieder aus. Als er aus dem Streifenwagen stieg, drängte er das Gefühl beiseite, dass irgendetwas Grauenhaftes ihn erwartete.
Jim fiel auf, dass der Mond nicht schien. Die Finsternis wirkte außerhalb der hellen Teiche, das die Lichter des Streifenwagens und der Tankstelle bildeten, trostlos, wie für die Ewigkeit. Es war, als säße Jim am Rand der Welt und blickte in ein erloschenes Universum, in dem nichts anderes mehr existierte als er selbst.
Wieder schaute er zur Tankstelle.
Wieder überfiel ihn das unerklärliche Grauen.
Nur konnte er nichts und niemanden als Quelle seiner Angst ausmachen, und das bereitete ihm noch größere Furcht. Er hatte sich immer schon am meisten vor dem gefürchtet, was man nicht benennen konnte. Er überlegte, zu Hause anzurufen und sich zu vergewissern, dass mit seiner Frau und seiner Tochter alles in Ordnung war, doch nach einem Blick auf die Uhr entschied er sich dagegen. Er wollte Emily nicht aus dem Schlaf reißen.
»Alles okay?«, fragte Trooper Tom Delaine, Jims Partner bei der State Police. »Du ziehst ein Gesicht, als hätten sie dir in die Cornflakes gepinkelt.«
»Nein, alles bestens. Bringen wir’s hinter uns. Ich gehöre längst schon ins Bett, und ich will nur noch nach Hause.«
Tom war anzumerken, dass er mit Jims Antwort nicht ganz zufrieden war, aber er nickte und ging auf die Eingangstür der Tankstelle zu. Beide Männer hatten ihre Waffen nicht gezogen, denn sie wussten von der Leitstelle, dass der Täter bereits geflohen war. Trotzdem musste ein Bericht geschrieben werden, und der Tankwart hatte darauf beharrt, dass sofort ein Gesetzeshüter vorbeikam.
Als sie das Tankstellenhäuschen mit dem üblichen Lebensmittelangebot betraten, bemerkte Jim einen seltsam vertrauten Geruch, ohne dass er hätte sagen können, was es war. Er schob den Gedanken beiseite und konzentrierte sich.
Von der Tür aus ließ er den Blick durch den Raum schweifen. Die Kassentheke stand parallel zur Tür vor der rückwärtigen Wand. Dahinter saß ein Mann mit dunklem Haar und durchdringenden grauen Augen. Ein schwarzes T-Shirt spannte sich über seiner Brust. Darunter zeichneten sich harte Muskeln ab. Der Mann sagte kein Wort, starrte die beiden Trooper nur ausdruckslos an.
Als ihre Blicke sich trafen, bewegte Jim instinktiv die Hand näher zur Waffe an seinem Gürtelholster.
»Schöne Nacht, was?«, sagte der Tankwart. »Die Dunkelheit ist … wie soll ich sagen? Bedrückend, ja, das trifft’s. Sie hat Gewicht.«
So ganz begriff Jim diesen Gedankengang nicht, der bedrückende Dunkelheit mit einer schönen Nacht in Beziehung setzte. Einem Menschen, in dessen Vorstellung beides zusammengehörte, sollte man mit Vorsicht begegnen. Jims Partner jedoch schien der innere Widerspruch zu entgehen. Tom zog nur die Brauen hoch und fragte: »Haben Sie den Raubüberfall gemeldet, Sir?«
»Nein«, erwiderte der Mann, »ich habe einen Mord gemeldet.«
Jim stockte der Atem. Er hielt die rechte Hand über das Pistolenholster, aber noch zog er die Waffe nicht.
»Wer wurde ermordet?«, fragte Tom.
Der Tankwart gab keine Antwort. Jim war sich nicht ganz sicher, aber er glaubte zu sehen, wie ein mühsam unterdrücktes Grinsen über das Gesicht des Mannes huschte. Jim beugte sich vor und schaute zwischen zwei Regalzeilen.
Tom blickte in die gleiche Richtung.
Der entsetzliche Anblick traf sie beide wie ein Schlag ins Gesicht.
Der Tote am Ende des Gangs war nackt. Überall war Blut. Tiefe Schnittwunden entstellten den Körper, der auf schreckliche Weise verstümmelt war. Dem männlichen Opfer waren die Augen ausgestochen worden.
Blitzschnell zogen die Trooper ihre Waffen und richteten sie auf den seltsamen Mann an der Kasse. Tom trat einen Schritt vor. »Halten Sie die Hände so, dass ich sie sehen kann! Na los!«
Der Verdächtige machte keine Anstalten, seine Hände zu zeigen, die unter der Theke verborgen waren. Seine einzige Reaktion bestand in einem boshaften Grinsen, kalt, wie tot. Jim hatte das Gefühl, eine Fliege im Spinnennetz zu sein.
Tom ging noch einen Schritt vor, die Waffe im Anschlag, und wiederholte, was er gesagt hatte. Wieder ohne Ergebnis. Er stand jetzt keine drei Schritte von der Theke entfernt. Jim hatte sich einen Schritt zurückgezogen. Er wollte Tom gerade zurufen, dass er dem Verdächtigen zu nahe sei, als der Mann hinter der Kasse mit ruhiger, ein wenig belustigter Stimme sagte: »Gefällt es euch? Das ist meine Version eines Mordes von Andrei Tschikatilo, dem Monster von Rostow. Schon mal von ihm gehört? Nein, eher nicht. Er war Ukrainer und hat über fünfzig Morde begangen. Nun ja, ihr beide habt von Washington und Lincoln gelernt, ich von Jack the Ripper, Albert Fish und Ed Gein, um einige meiner Gründerväter zu nennen.« Er kicherte, und sein Blick huschte zwischen den beiden Cops hin und her. »Ihr erkennt mich nicht, was?«
»Nein. Und es ist mir scheißegal, wer Sie sind«, fuhr Tom ihn an, doch seine Stimme war ein wenig zittrig. »Hände über den Kopf!«
Der Mann bedachte ihn mit einem herablassenden Blick. »Ein bisschen mehr Respekt solltest du mir schon erweisen, Kumpel. Ich bin nicht ganz unbekannt. Mein Name ist Ackerman.«
Für einen Moment verschlug es Jim den Atem. Als er den Mann vorhin gesehen hatte, war er ihm irgendwie bekannt vorgekommen. Jetzt wusste er, wen er vor sich hatte. Er kannte diesen Mann aus dem Fernsehen, aus einer zweistündigen Sondersendung auf einem Nachrichtenkanal. Der Name der Sendung fiel ihm nicht ein, aber es ging in Richtung Ein Experiment mit dem Wahnsinn. Woran er sich allerdings gut erinnerte, war die Beschreibung Ackermans und seiner abscheulichen Verbrechen – die Taten eines Monstrums, wie es allenfalls in der Fantasie von Horrorschriftstellern existierte, nicht aber als Person aus Fleisch und Blut.
Tom wiederholte seine Aufforderung. Diesmal sprach er leise, als wollte er den Mann zur Aufgabe bewegen und einen Kampf vermeiden. »Halten Sie die Hände so, dass ich sie sehen kann. Ich zähle bis drei, dann …«
»An deiner Stelle würde ich nichts Übereiltes tun. Wenn du nicht vorsichtig bist, reißt es meiner hübschen kleinen Geisel vielleicht das hübsche kleine Gesicht weg.«
»Geisel?«, fragte Tom verwirrt.
Ackerman lenkte seinen Blick von Tom zu Jim. »Die Tussi unter der Theke. Sie hat die Mündung einer abgesägten Schrotflinte an der Schläfe. Ein Schuss, und die Kleine sieht gar nicht mehr gut aus. Ich hab so was schon mal gesehen. Schön ist es nicht. Ah, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Ihr glaubt, ich bluffe.« Er wandte sich wieder Tom zu. »Und du denkst, dass du mir eine Kugel zwischen die Augen jagen kannst, ehe ich abdrücken kann. Wenn du dich da mal nicht irrst, Kumpel. Mein Finger liegt am Abzug. Sobald deine Kugel trifft, verkrampfen sich meine Muskeln, und dann spritzt das Hirn von der Süßen unter der Theke hervor. Tja, Leute, wie’s aussieht, haben wir hier eine klassische Pattsituation.«
Ackerman lachte auf und fuhr in überheblichem Tonfall fort: »Ist das nicht komisch? Ihr habt diesen Tag begonnen wie jeden anderen. Ihr habt eine Tasse Kaffee getrunken, ein bisschen in der Zeitung gelesen und euren Lieben ein Küsschen zum Abschied gegeben. Aber ihr hattet keinen Schimmer, dass heute der wichtigste Tag eures Lebens sein wird. Ja, dies ist der Tag, an dem alles auf dem Spiel steht, was ihr je gesagt oder getan habt. Alles, woran ihr glaubt und wofür ihr eingetreten seid. Irgendwann geraten wir alle an einen Punkt, an dem wir uns entscheiden müssen, ob wir der Held sein wollen oder ein Schaf bleiben. Dieser Augenblick ist jetzt für euch gekommen, Freunde.
Ich stelle euch vor die Wahl. Ihr könnt verschwinden und lebt weiter. Vielleicht habe ich eine Geisel unter der Theke, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bringe ich sie um, sobald ihr zur Tür raus seid, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht könnt ihr mich fassen und werdet berühmt. Vielleicht müsst ihr bei dem Versuch dran glauben. Sicher wissen könnt ihr es nicht. Aber was können wir schon sicher wissen? Das ist ja das Schöne, oder? Hinter dem ganzen Scheiß steckt keine Bedeutung. Das Gute muss nicht unbedingt über das Böse triumphieren. Es gibt nur Zufall und Tod. Ihr seid die Pechvögel, die heute im Einsatz sind. Der blutige Klumpen, der da hinten am Ende vom Gang liegt, war der Pechvogel, der heute in dieser Tankstelle gearbeitet hat. Wir Menschen halten uns für die Krone der Schöpfung, für besser und klüger als alle anderen Kreaturen, aber soll ich euch mal was sagen?«
Ackerman blickte die beiden Cops an, als wäre er ein hungriges Raubtier und sie seine Mahlzeit. Er senkte die Stimme. »Am Ende ist es egal, mit wie viel Größenwahn wir uns blenden. Wir sind Jäger oder Gejagte, Raubtier oder Beute. Der Sieger überlebt, der Verlierer verwest. Unser Schicksal wird allein von unseren Entscheidungen bestimmt. Also, entschließt euch.«
Jim stand regungslos da, wie gebannt von dem Verrückten hinter der Kasse. Ackerman hatte seine wirre Ansprache voller Leidenschaft gehalten, wie ein Politiker, der ein hehres Ziel vertritt und mit seiner Rede die Menge aufrütteln will. Noch nie hatte Jim erlebt, wie ein Mann, auf den zwei Pistolen gerichtet waren, so ruhig blieb. Ackerman zeigte nicht die geringste Angst. Angst schien ihm so fremd zu sein wie einem Neandertaler ein Flugzeug. Vor allem schien er überzeugt zu sein, die Lage fest im Griff zu haben.
Jim fühlte sich mit einem Mal wehrlos, obwohl er eine Waffe in der Hand hielt.
»Sie bluffen doch nur! Sie haben keine Geisel!« Toms Stimme klang schrill und zittrig. »Sonst würde draußen ein Wagen stehen. Und jetzt heben Sie die Hände, Mann, damit ich sie sehen kann, oder ich jage Ihnen eine Kugel zwischen die Augen!«
Jim fand Toms Worte nicht überzeugend. Der Irre schien es ähnlich zu sehen. Ackerman hatte seinen Wagen vermutlich hinter dem Gebäude abgestellt, damit es so aussah, als wäre er der Tankwart. Wenn er hier wirklich eine Frau als Geisel hielt, hätte er auch ihren Wagen hinter die Tankstelle gefahren.
Jim wusste nicht, ob Tom diese Möglichkeiten übersah oder ob er nur verzweifelt versuchte, die Pattsituation zu beenden. Aber was Tom auch plante, es konnte nicht gut gehen. Ackerman würde niemals zulassen, dass diese Sache unblutig zu Ende ging. Tom konnte es in den Augen des Killers lesen.
Ackerman seufzte und blickte zur Theke. »Tja, mein Schatz«, sagte er mit erhobener Stimme, »offenbar glauben die beiden nicht an dich. Schrei doch mal, damit sie wissen, dass es dich gibt.«
Bei Ackermans letztem Wort zerbarst die Vorderseite der Theke. Holzsplitter flogen in alle Richtungen. Die Schrotladung traf Tom in die linke Seite. Blut spritzte Jim ins Gesicht, während Tom von dem Treffer zu Boden geschleudert wurde.
Jim warf sich in den nächsten Gang. Einen Sekundenbruchteil später schlug eine zweite Ladung Schrot in das Regal ein, vor dem er eben noch gestanden hatte. Brennende Dorito-Chips wirbelten durch die Luft.
Jim richtete sich auf und feuerte zwei Schüsse rasch hintereinander um die Ecke. Er sah, wie seine Kugeln in die Theke einschlugen, als auch schon die Schrotflinte antwortete. Wieder warf er sich in Deckung.
Tom schrie vor Schmerz. Er musste beim Sturz seine Waffe verloren haben und war offenbar halb besinnungslos, denn er machte keine Anstalten, in Deckung zu kriechen. Jim wusste, dass sein Partner keine Überlebenschance hatte, wenn er nicht sofort Hilfe herbeirief.
Mit raschen Bewegungen löste er sein Funkgerät vom Gürtel. »Trooper verletzt … benötigen Rettungswagen«, meldete er mit abgehackter Stimme. Seinen Namen und seine Position brauchte er nicht zu nennen. Das Funkgerät übertrug einen individuellen Code an die Zentrale, während das GPS im Streifenwagen anderen Einheiten seinen Standort mitteilte.
Wenn er jetzt nicht handelte, waren er und Tom tot, sobald die Verstärkung eintraf.
Jim versuchte sich zu konzentrieren, aber seine Gedanken schweiften immer wieder zu seiner Frau und seiner Tochter. Sehe ich sie wieder? Werde ich erleben, wie Ashley aufwächst? Er dachte daran, wie er ihr die goldenen Locken streichelte und sie auf die Stirn küsste, wie ihre Augen vor Bewunderung strahlten, wenn er sie auf seinen Schoß setzte und ihr vorlas, wie Emily, seine Frau, ihn jeden Morgen zum Abschied küsste und ihm sagte, er solle auf sich aufpassen. Er dachte an das wundervolle Gefühl, sie in den Armen zu halten und ihr mit den Fingern durch das schwarze Haar zu fahren. Er schwor sich, sie wiederzusehen, doch eine boshafte Stimme in seinem Kopf flüsterte: Du belügst dich selbst.
Das Gemisch aus Pulvergestank und dem Geruch der parfümierten Reinigungsmittel stieg Jim in die Nase, und ihm wurde schwindlig. Entweder lag es am Geruch oder an dem Aufruhr, der in seinem Innern tobte und kaum einen klaren Gedanken zuließ.
Was soll ich als Nächstes tun?
Jim wusste, dass er es nicht überleben würde, wenn er Ackerman frontal attackierte. Gegen die Schrotflinte kam er nicht an. Am besten, er schlich sich im Schutz der Regale an – dann konnte er den Irren vielleicht überraschen. Und je größer die Entfernung, desto größer der Vorteil, den ihm seine 9-mm-Pistole gegenüber der weniger zielgenauen Schrotflinte verschaffte.
So leise er konnte, bewegte er sich den Gang entlang in Richtung Tür. Als er das Ende des Gangs erreichte, spähte er um die Ecke.
Alles frei.
Er huschte zum nächsten Gangende.
So weit, so gut.
In der kleinen Tankstelle gab es nur vier Regalreihen mit Lebensmitteln. Wenn er es zum nächsten Ende des Gangs schaffte, ohne dass Ackerman ihn sah, hatte er freie Sicht auf das Versteck seines Gegners.
Jim warf einen raschen Blick in den Gang und wollte gerade zum nächsten Regalende huschen, als er ein merkwürdiges Geräusch aus dem vorderen Teil des Tankstellenhäuschens hörte. Er brauchte einen Augenblick, bis er wusste, was es war: ein leises Plätschern. Jemand drückte irgendeine Flüssigkeit aus einer Quetschflasche. Als er dem Geräusch folgte, wurde Toms Gebrüll noch lauter, und Jim hörte einen erstickten Hilfeschrei.
»Dein Kumpel hat einen schlechten Tag, Officer. Er will bleiben und kämpfen, aber ich nehme an, dass ich ihm keine große Wahl gelassen habe. Deshalb mache ich dir ein Angebot. Dein Partner hatte recht, ich hatte keine Geisel. Aber jetzt habe ich eine. Ihn. Er wird hier nicht mehr lebend rauskommen. Aber dich lass ich laufen. Du darfst in deinen Wagen steigen und alles hinter dir lassen, als wäre es nur ein Albtraum gewesen. Klar, vielleicht könntest du mich stoppen und deinen Kumpel retten, aber seien wir doch ehrlich: Ich beherrsche dieses Spiel besser als du. Wenn du bleibst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr beide ins Gras beißt. Du hast die Wahl.«
Jim biss die Zähne zusammen. Ackerman wusste vermutlich, wo er war. Er hatte wahrscheinlich keine Chance, dem Verrückten in den Rücken zu fallen. Ackerman hatte recht: In einer solchen Lage war er, Jim, noch nie gewesen. Eigentlich hatte er noch nie eine richtige Gefahrensituation erlebt, abgesehen von ein paar Verkehrskontrollen, bei denen es ein bisschen ruppiger zuging, und einer Geiselnahme in einem Imbiss. Aber ein Schusswechsel mit einem irren Killer war ein ganz anderes Kaliber. Sein Gegner hatte zahllose Opfer auf dem Gewissen, darunter etliche Polizisten. Außerdem war Ackerman besser bewaffnet und der Lage viel besser gewachsen.
Dennoch, Jim würde seinen Partner niemals im Stich lassen.
Tom Delaine war ein Hitzkopf, aber er war seit neun Jahren Jims bester Freund. Er war an dem Tag dabei gewesen, als Jims Tochter geboren wurde, hatte Zigarren herumgereicht und gegrinst wie ein stolzer Onkel. Und an dem Tag, als Jims Vater beerdigt wurde, war Tom der Einzige gewesen, der ihm Trost hatte spenden können. In jedem schwierigen Moment seines Lebens war Tom für ihn da gewesen und hatte nie eine Gegenleistung verlangt.
»Kommen Sie hierher, wo ich Sie sehen kann«, rief Jim, »dann gebe ich Ihnen meine Antwort.« Dieses Mal zitterte seine Stimme nicht.
»Na gut. Aber sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.«
Jim gab keine Antwort. Er war bereits in Bewegung und huschte den mittleren Gang entlang, hielt sich geduckt und versuchte, Ackermans Position anhand der Stimme auszumachen. Wenn seine Instinkte nicht trogen, erwartete der Killer ihn am Ende des dritten Regals.
Als er das Gangende erreichte, blickte er vorsichtig um die Ecke, sah den Killer aber nicht. Tom lag nur ein paar Fuß entfernt.
Jim schob sich behutsam weiter aus dem Gang. Immer noch keine Spur von Ackerman. Er wollte gerade nach Tom greifen, als er hörte, wie ein Streichholz angerissen wurde. In diesem Sekundenbruchteil fiel sein Blick auf die Spur aus Flüssigkeit, die von der Theke aus bis zu Tom verlief.
Feuerzeugbenzin.
Das Geräusch von vorhin! Ackerman hatte Feuerzeugbenzin auf den Boden gespritzt.
Ehe Jim reagieren konnte, griff eine Hand um die Theke herum und ließ ein brennendes Streichholz in die Lache fallen.
Das Benzin entzündete sich mit einem blauen Blitz, der sich ausbreitete und zu Rot und Gelb umschlug. Binnen eines Sekundenbruchteils schoss das Feuer zu Tom und hüllte ihn in Flammen.
Toms schrille Schreie gellten durch das Tankhäuschen, hallten von den Wänden und Glasscheiben wider. Die Echos überlagerten einander und klangen wie ein Chor der Verdammten.
In diesem Moment verlor Jim die Kontrolle und handelte aus reinem Instinkt. Er ließ die Pistole fallen, riss sich die Uniformjacke herunter und schlug auf die Flammen ein in dem verzweifelten Versuch, seinen Freund zu retten. Doch nach ein paar Schlägen züngelten auch an der Jacke rote und gelbe Flämmchen. Hilflos ließ Jim sie neben seinem sterbenden Partner auf das Linoleum fallen.
Nach einer Ewigkeit, wie es schien, verstummten Toms Schreie, und er hörte auf, um sich zu schlagen. Nur die Flammen blieben. Der Gestank nach verbranntem Fleisch hing in der Luft, während Jim in einen Strudel aus Entsetzen, Trauer und Wut gezogen wurde. Er kniete vor Tom, weinte um seinen Freund …
… und wusste, dass er als Nächster an die Reihe kam. Denn mit einem Mal spürte er, dass der Mann mit der Schrotflinte hinter ihm im Gang stand. Ackerman hatte Toms schreckliches Ende als Ablenkung benutzt, und sein Plan war aufgegangen.
Jims Stimme zitterte, und Tränen liefen ihm über die Wangen, als er über die Schulter fragte: »Warum haben Sie das getan? Sie haben uns gerufen, bloß damit Sie uns umbringen können? Warum?«
»Warum?«, erwiderte Ackerman. »Das ist die ewige Frage, nicht wahr? Vom Anbeginn menschlicher Existenz haben wir wie besessen nach der Antwort auf eine einzige Frage gesucht: Warum? Nun, ich fürchte, dass ich keine richtige Antwort habe – außer der, dass ich nun mal so bin, wie ich bin. Es gibt Menschen, die großartige Kunstwerke schaffen. Andere sind Ärzte oder Anwälte, Lehrer oder Handwerker. Ich bin ein Raubtier, ein Mörder. Das Leben ist ein Spiel, und ich spiele gern. Aber mein Spiel mit dir, Kumpel, ist noch nicht zu Ende. Gib mir deine Brieftasche.«
»Meine Brieftasche?«
Ein Tritt gegen den Hinterkopf beantwortete Jims Frage.
»Deine Brieftasche. Sofort. Bitte.«
Jim reichte sie ihm. Der Killer ging den Inhalt durch und verweilte beim Führerschein und bei einem abgegriffenen Foto. »Du hast ’ne nette Familie, Jim Morgan. Ich würde sie gerne näher kennenlernen.«
»Sie verdammter Mistkerl!«, brüllte Jim und stürzte sich auf den Mörder seines besten Freundes.
Ackerman schlug ihn mit der Schrotflinte zu Boden. Dann prügelte er auf ihn ein, bis Jim das Blut übers Gesicht lief. Jim spürte, wie bei jedem Hieb die Haut aufriss, konnte sich aber nicht schützen.
Endlich hörten die Schläge auf. Ackerman zielte wieder mit der Schrotflinte auf ihn. »Eigentlich wollte ich noch ein bisschen mit dir spielen, ehe ich dich zur Hölle schicke, aber ich glaube, ich habe eine bessere Idee.«
Er ging hinter die Theke und holte eine Flasche und ein Tuch hervor, ohne den Blick von seinem Opfer zu nehmen.
Jim wand sich in Schmerzen am Boden und beobachtete, wie Ackerman aus der Flasche etwas auf den Lappen goss. Seine Augen füllten sich mit Tränen, und seine Sicht verschwamm. Er schmeckte Blut und roch den beißenden Qualm von Toms verbrannter Leiche. Sein Gehirn konnte den Ansturm der Informationen nicht verarbeiten, den seine Sinne wie im Fieberrausch lieferten, und sein Verstand drohte zu ersticken.
Ackerman kniete sich hin und drückte ihm das Tuch auf den Mund. Jim versuchte sich zu wehren, jedoch vergebens. Nach nur einem Augenblick wirkte das Betäubungsmittel, und Dunkelheit umfing ihn.
***
Jim erwachte. Aus brennenden Augen betrachtete er seine Umgebung. Allmählich schwand seine Benommenheit.
Er konnte es nicht fassen.
Er war zu Hause, im Wohnzimmer.
Im ersten Moment glaubte er mit einem Anflug unendlicher Erleichterung, das Martyrium in der Tankstelle sei nur ein Albtraum gewesen.
Doch als er seine Frau und seine Tochter sah, verflüchtigte sich jede Hoffnung wie warmer Atem an einem Wintertag.
Emily und Ashley saßen am anderen Ende des Wohnzimmers auf zwei Esszimmerstühlen und schauten ihn aus schreckgeweiteten Augen an. Die Stühle standen wie bei einem Gesprächskreis nebeneinander. Beide waren gefesselt, ihre Münder mit Klebeband geschlossen. Ihr zerzaustes Haar war verfilzt und klebte auf Stirn und Wangen, die nass waren von Tränen und Schweiß.
»Ashley …« Jim wollte zu ihr, doch er war selbst gefesselt, wie er erst jetzt bemerkte. Verzweifelt bäumte er sich in den Stricken auf.
Er schaute seine Frau an. Das rabenschwarze Haar hing ihr ins Gesicht. Angst verzerrte ihre Züge. Ihr heller Teint, ein Erbe aus der seltenen Kombination einer irisch-amerikanischen Großmutter und einem japanischen Großvater, war rot angelaufen. Jim liebte ihren milchigen Teint, der ihn an feines Porzellan erinnerte. Und auch wenn er nie die richtigen Worte gefunden hatte, es Emily zu sagen, war er der glücklichste Mann auf Erden, weil er sie zur Frau hatte.
Jim rannen Tränen über die Wangen. Es brach ihm schier das Herz, seine Frau und seine kleine Tochter so hilflos und verängstigt zu sehen. Während er vor Wut zitterte, suchte Emily seine Aufmerksamkeit und bedeutete ihm mit einer Bewegung ihrer Augen, nach rechts zu schauen.
Jim folgte ihrem Blick.
Und schaute in die kalten grauen Augen eines Monstrums.
Die abgesägte Schrotflinte in der Hand, stand Ackerman auf und kam zu ihm. »Wurde auch Zeit, dass du aufwachst«, sagte er und klopfte ihm auf die Schulter. »Wir hatten hier schon eine irre Pyjama-Party, Dad, aber jetzt kann der Spaß richtig losgehen.«
Ackerman trat hinter ihn und beugte sich nahe an sein Ohr. »Du hast eine richtig nette Familie, Jim. Du hast dir ein schönes Leben aufgebaut. Hübsches Haus, das süßeste kleine Mädchen, das ich je gesehen habe, und deine Frau … geil, absolut geil. Das meine ich nicht vulgär oder geschmacklos, Jim. Ich will damit nur sagen, dass sie umwerfend ist … das dunkle Haar und die helle Haut. Sie erinnert mich an die Filmstars aus den Dreißigern und Vierzigern, weißt du. Als die Welt noch schwarz-weiß war. Jedenfalls … ich will damit sagen, dass du ein sehr glückliches kleines Arschloch sein musst. Das bist du doch, oder?«
Jim biss die Zähne aufeinander und schüttelte sich vor Wut, gab aber keinen Laut von sich. Er wollte den Irren nicht reizen und in seinen perversen Fantasien befeuern. Deshalb saß er nur da und betete, dass seine Frau und seine Tochter lebend davonkamen. Was aus ihm selbst wurde, war ihm egal. Wenn er sterben musste, um sie zu retten, würde er diesen Weg gehen, aber er flehte Gott an, Emily und Ashley zu verschonen.
»Wie denkst du über den Tod, Jim? Glaubst du, dass unser Leben vor unseren Augen vorbeizieht, wenn wir sterben? Dass wir im letzten Moment unserer irdischen Existenz alles noch einmal erleben? Glaubst du an diese Geschichte mit dem Licht am Ende des Tunnels? Nein? Und was ist mit den spirituellen Aspekten? Glaubst, dass deine kleine Familie in den Himmel kommt, nachdem ich sie getötet habe?«
Jim konnte seine Wut nicht mehr bezwingen. Keinen Augenblick länger wollte er sich die Gedanken dieses wahnsinnigen Schlächters anhören. Er stemmte sich gegen die Fesseln und brüllte aus vollem Halse, schrie seinen Hass und seine Qual heraus. Er konnte die Empfindungen, die in ihm brannten wie das Feuer der Hölle, nicht in Worte fassen. Sein Schrei war älter als alle Wörter, primitiver, urtümlicher.
Irgendwann verstummte er und lag keuchend da, voll brodelndem Hass und hilfloser Wut. Bei jedem Atemzug blähten sich seine Nasenflügel.
Ackerman klopfte ihm auf die Schulter. »Schon okay, Jim. Ich verstehe deinen Schmerz. Ich verstehe ihn gut, glaub mir.«
Jim fühlte sich geschlagen und hilflos, aber er musste stark sein, musste nachdenken. Doch er sah keinen Fluchtweg, keine Aussicht auf Rettung. Sie wohnten im Wald, niemand würde seine Schreie hören. Seine einzige Hoffnung war, dass man ihn vermisste. Ja, mittlerweile muss die Verstärkung an der Tankstelle sein. Sie werden Tom finden, und dann werden sie wissen, dass mir irgendwas passiert ist … Sie werden nach mir suchen, und früher oder später werden sie hier auftauchen.
Aber wie lange würde das dauern? Wie viel Zeit war bereits vergangen?
Er musste den Killer hinhalten, musste ihn dazu bringen, dass er weiterredete.
»Warum … warum tun Sie das?«, fragte er.
Ackerman kniff die Augen zusammen. »Warum? Das haben wir doch längst besprochen. Schon vergessen? Das Warum spielt keine Rolle. Hast du schon mal von der Zehn-zu-Neunzig-Regel gehört? Sie besagt, dass das Leben zu zehn Prozent aus dem besteht, was uns widerfährt, und zu neunzig Prozent aus unserer Reaktion darauf. Das ist das Entscheidende. Die Frage, wieso dir und deiner Familie dies und das passiert, ist unerheblich. Alle jammern ständig: ›Warum ich, warum passiert das gerade mir?‹ Die Leute glauben, es wäre das Ende der Welt, wenn ihr Vierzigtausenddollarauto nicht mehr anspringt und sie nicht zu ihrem gemütlichen Schreibtischjob kommen, der ihrer Familie den Jahresurlaub auf Hawaii sichert. Aber sie kennen die Bedeutung des Wortes ›Schmerz‹ nicht. Hör auf zu jammern, Jim. Konzentriere dich auf das, was du jetzt tun willst. Wie willst du deine Familie retten? Wie willst du mich aufhalten?«
Ackerman beugte sich näher. Jim spürte den warmen Atem des Mörders am Hals. »Ich will dich in ein kleines Geheimnis einweihen, Jim. Ich habe jemanden gesucht, mit dem sich das Spiel lohnt … einen würdigen Gegner. Ich möchte, dass du mich schlägst.«
Ackerman zog Jims Pistole aus dem Hosenbund und legte sie ihm auf den Schoß. »Also, das Spiel. Nennen wir es ›Zwei für einen‹. Zwei von euch sterben heute Nacht. Wer, ist mir egal. Wenn du dich zuerst umbringst, muss deine Tochter dran glauben. Wenn du gegen die Regeln verstößt oder das Spiel verweigerst, wirst du zusehen, wie ich zuerst deine Frau und dann dein Töchterchen kalt mache. Und ich werde mir Zeit dabei lassen. Sie werden um den Tod betteln. Du wirst dir wünschen, du hättest sie selbst umgebracht, um ihnen die Qualen zu ersparen.
Aber du kannst dich vielleicht selbst retten, indem du die beiden erschießt. Dann gebe ich dir die Chance auf ein Weiterleben. Na, wie wär’s? Nein? Okay, dann mache ich dir einen anderen Vorschlag: Du erschießt deine Frau und anschließend dich selbst, dann überlebt deine Tochter. Ich werde hinterher die Polizei anrufen und die Kleine abholen lassen. Sie hat dann vielleicht ein paar emotionale Probleme, aber sonst wird ihr nichts geschehen. Wie wär’s damit?
Doch bevor wir anfangen, musst du dir klarmachen, dass zwei Mitglieder deiner kleinen Familie hier nicht lebend rauskommen, ganz gleich, wie du dich entscheidest. Und du solltest es nicht darauf anlegen, dass ich die Sache für dich beende. Wahrscheinlich denkst du jetzt, der Schlamassel an der Tankstelle würde bald entdeckt werden und deine Kumpels von der State Police dann nach dir suchen. Tja, auch daran habe ich gedacht. Wir haben genügend Zeit, um unser kleines Spiel zu beenden. Also, fangen wir an.«
Ackerman schnitt Jims Hände los.
Jim sah seine Chance gekommen, riss die Pistole von seinem Schoß und wollte sie auf den Killer richten.
Doch Ackerman hatte nur darauf gewartet. Seine Hand zuckte vor. Er entwand Jim die Pistole und rammte ihm die Schrotflinte gegen den Nasenrücken. Dann schwenkte er die Flinte herum und zielte auf die kleine Ashley.
Jim blieb gerade noch Zeit, »Nein!« zu brüllen, als auch schon der Schuss durch das Haus donnerte.
Er wollte nicht hinsehen und kniff die Augen fest zusammen, aber er wusste, dass er damit nicht das Monster fern halten konnte, das aus seinen Albträumen in die wirkliche Welt getreten war.
Als er die Augen aufschlug, wurde ihm schwindlig vor Erleichterung, denn er sah, dass der Schuss in den Boden gegangen war. Seine Tochter lebte noch.
»Spielst du jetzt richtig?«, fragte Ackerman.
Jim rannen die Tränen aus den Augen. »Ja, ja, was immer Sie wollen. Ich mache Ihr Spiel mit … aber tun Sie ihnen nichts.«
»Gut. Ich gebe dir noch eine Chance. Aber wenn du so was noch mal versuchst, wird mir das Spiel langweilig, und ich fange ein neues an. Und das Spiel wird dir noch viel weniger gefallen. Okay, machen wir weiter.«
Ackerman knallte ihm die Pistole wieder auf den Schoß.
Diesmal rührte Jim die Waffe nicht an. Seine Gedanken rasten. Es muss einen Ausweg geben … Ich bin ein guter Polizist … Ich muss meine Familie retten … Mir muss etwas einfallen … Aber was kann ich tun? Der Irre richtet eine Schrotflinte auf meinen Kopf, und wenn ich wieder versage, sind wir alle tot …
In einem Winkel seines Verstandes nahm die einzige Möglichkeit, die ihm in den Sinn kam, Gestalt an, doch er schob die Idee beiseite. Es war zu entsetzlich. Er konnte sich nicht überwinden, es auch nur in Betracht zu ziehen.
Dennoch tat er es.
Als er seiner Frau in die Augen blickte, wusste er, dass sie demselben Gedankengang gefolgt und zum selben Ergebnis gekommen war. Wenn nur einer von ihnen überleben durfte, musste es Ashley sein.
Emilys Augen verrieten, was sie dachte. Ich liebe dich, ich verstehe dich, und es ist okay. Seine Frau, die Liebe seines Lebens, neigte den Kopf und schloss die Augen.
Jim nahm die Pistole, hob sie mit zitternder Hand, legte den Finger auf den Abzug. Doch er konnte sich nicht überwinden, abzudrücken, und senkte die Waffe.
Wie kann ich die Frau töten, die ich liebe?
Wieder zermarterte er sich das Hirn nach einem Ausweg. Konnte er seine Tochter nur retten, indem er ihre Mutter erschoss?
Eine Idee nahm Gestalt an, doch sie war aberwitzig.
Oder doch nicht?
»Was ist denn jetzt?«, drängte Ackerman. »Ich kann nicht ewig warten.«
Jim blieb keine Wahl.
Wieder hob er die Pistole. Emily hatte deutlich gemacht, was sie empfand. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit schenkten ihm die Kraft, das zu tun, was getan werden musste.
Er zielte.
Und drückte ab.
***
Jim schlug die Hände vor das Gesicht und schluchzte. Die Pistole fiel ihm aus der Hand und polterte auf die Bodenbretter.
Ackerman bückte sich und zerschnitt das Seil um Jims Fußgelenke. »Gut gemacht. Gehen wir jetzt zu einem anderen Spiel über. Nennen wir es, ›Mach’s dir leicht oder mach’s dir schwer‹. Du darfst entscheiden, wie du sterben willst. Möglichkeit eins: ein Schuss aus der Schrotflinte in den Hinterkopf. Das ist schnell und schmerzlos, aber du wärst augenblicklich tot. Möglichkeit zwei ist, dass ich dich zur Hintertür fliehen lasse. Natürlich müsstest du dabei deine Tochter zurücklassen, aber das braucht dich nicht zu belasten. Wenn du bleibst, puste ich dir den Schädel weg, und deine Kleine ist trotzdem mit mir allein. Außerdem ist deine Tochter mir egal. Mit dir kann man viel schöner spielen.
Ich gebe dir einen Vorsprung, und dann komme ich und suche dich. Ich benutze nicht die Schrotflinte, sondern das Messer. Dein Tod wird weder schnell noch leicht sein, sondern so schmerzhaft, wie du es dir in deinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen kannst. Du wirst um Gnade winseln, Kumpel. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass ich dich nicht finde, oder dass du mich besiegst. Das ist die Wahl, die du jetzt treffen musst. Gib auf und mach deinem Leid ein Ende, oder klammere dich an der Hoffnung auf Rettung fest und nimm dafür die Möglichkeit eines schrecklichen Todes in Kauf. Du hast dreißig Sekunden.«
Mit einem letzten langen Blick auf sein kleines Mädchen stand Jim auf und eilte zur Hintertür. Er wollte sie nicht zurücklassen, aber er wollte auch nicht, dass sie zusah, wie er starb.
Der Irre hatte recht. Ihm blieb keine andere Wahl.
In seinem Kopf gab es nur einen Gedanken: Rache. Sein eigenes Leben war ihm egal, aber der Killer hatte ihm eine Chance gegeben, den Tod seiner Frau zu rächen, und diese Chance wollte er nutzen.
Aber dann musste er weiterleben.
Jim verließ sein Haus durch die Hintertür und rannte in die ausgebreiteten Arme des dunklen Waldes, so schnell er konnte.
***
In der Küche des einstmals so friedlichen Hauses nahm Francis Ackerman junior den Telefonhörer ab und wählte. Beim fünften Klingeln nahm am anderen Ende jemand ab.
»Hier Father Joseph. Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Vergeben Sie mir, Father, denn ich habe gesündigt.«
Schweigen antwortete ihm.
»Sind Sie noch dran, Father?«
Der Mann am anderen Ende atmete langsam aus. »Ich bin hier, Francis.«
»Ich habe heute Nacht drei Menschen getötet, Father, und gleich töte ich noch einen. Einen Mann von der State Police.«
»Warum rufst du mich an? Ist das wieder eines deiner Spielchen?«
»Nein. Ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann. Und Sie sind der Einzige, den ich habe.« Ackerman kniff die Augen zusammen und kämpfte gegen die Tränen an. »Ich bin so müde, Father.«
»In Gott dem Herrn kannst du Frieden finden, aber du musst es wollen.«
»Ich glaube nicht an Ihren Gott. Ich will weder in Ihren Himmel noch in Ihre Hölle. Ich möchte nur noch schlafen. Ich möchte Dunkelheit … Vergessen. Ich möchte, dass es so ist, als hätte es mich nie gegeben.«
»So geht es aber nicht. Eines Tages wirst du dich dem Urteil stellen müssen, egal ob du an Gott glaubst oder nicht. Aber noch ist es nicht zu spät, Francis. Stell dich. Ich kann dir helfen. Ich kann …«
»Niemand kann mir helfen, Father. Für Ihre Erlösung ist es bei mir längst zu spät.«
»Für niemanden ist es je zu spät.« Nach kurzem Zögern fügte Father Joseph hinzu: »Du kannst nicht deinen Vater für das verantwortlich machen, was aus dir geworden ist.«
Ackerman rieb unwillkürlich über die Narben an seinen Händen und den Unterarmen, als er an seinen Vater dachte. In seinem Kopf hörte er noch immer seine Stimme, ein Flüstern im Dunkeln: Wir gehen spielen, Francis … Töte sie … Töte sie, und die Schmerzen hören auf …
»Eines Tages musst du die Verantwortung übernehmen für das, was du tust«, sagte der Priester. »Dein Vater hat dich vielleicht auf diesen Weg gebracht, aber du selbst hast dich entschieden, ihm zu folgen. Jetzt musst du den aufrichtigen Wunsch haben, damit aufzuhören.«
»Ich kann aber nicht aufhören. Ich bin eine Bestie … ein Ungeheuer.«
»Das glaube ich nicht. Du würdest nicht mit mir reden, wenn du nicht den Wunsch hättest, dich zu bessern.«
»Was ich will, spielt keine Rolle, Father. Ich wünschte, ich wäre ein normaler Mensch, aber das bin ich nicht. Nicht mehr. Ich bin zerbrochen, und niemand kann mich je wieder zusammensetzen. Außerdem gebe ich den Leuten nur, was sie wollen.«
»So etwas will niemand.«
»Aber sicher doch. Wissen Sie, wie viele Briefe ich bekommen habe, während ich in dieser … Einrichtung war? Diese Leute wollen einen Gegner, einen Widersacher. Sie sind fasziniert von mir. Ich bin ihr Gott. Wenigstens für einige. Andere brauchen das Wissen, dass es jemanden wie mich gibt, um besser mit der Finsternis zurechtzukommen, die in ihnen steckt. Damit sie sich normal fühlen können, verstehen Sie?«
»Hast du keine Angst, dass es dich selbst mal erwischen könnte?«
»Überhaupt nicht. Wenn jemand irgendwann das Glück hat und mich umbringt, ist es scheißegal. Und wissen Sie warum? Ich werde ewig leben, denn in psychologischen Seminaren an sämtlichen Unis wird man mich immer wieder analysieren. Man wird Bücher über mich schreiben und Dokumentarfilme drehen. Ich werde sogar Nachahmer finden … ist das nicht lustig? Je länger mich die Cops vergeblich jagen, je mehr Menschen mir zum Opfer fallen, je schockierender meine Verbrechen sind, umso größer wird meine Legende.«
»Weißt du, was dich wirklich zur Legende machen würde? Wenn du dein Leben änderst. Denk darüber nach, ich bitte dich. Wenn ein Mann wie du, der zu Dingen imstande ist, wie du sie getan hast, den Weg ins Licht findet, wären die Menschen wirklich fasziniert. Du könntest der Widersacher sein und zugleich der Held. Der Herr sagt: ›Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren.‹ Es gibt einen Weg ins ewige Leben, Francis, den ich dir zeigen kann. Ich kann dir helfen. Du brauchst dich nur zu stellen.«
»Gute Nacht, Father.«
»Leg noch nicht auf, ich …«
Ackerman legte auf. Er trocknete seine Tränen und schaute auf die Uhr. Es bestand zwar die Möglichkeit, dass Jim ihm entkam, aber bis jetzt hatte es noch keiner geschafft. Er war einfach zu gut in seinem Job.
Er würde seinen neuen Freund finden und sein Versprechen einlösen. Jim würde langsam sterben, sehr langsam. Er würde schreien, bis seine Lungen sich mit Blut füllten und er in der Flüssigkeit ertrank, die ihn bis dahin am Leben erhalten hatte. Es würde ein langer, qualvoller Tod.
Ackerman legte die Schrotflinte auf die Arbeitsplatte und zog ein Jagdmesser aus einer Scheide an seinem Rücken. Langsam drehte er es in der Hand, bewunderte die funkelnde, perfekt geschliffene Klinge. Er dachte über die Qualen nach, die er Jim damit bereiten würde. Bald, sehr bald schon. Er würde jede Sekunde von Jims Todeskampf genießen, würde seinen Tod so lange hinauszögern, wie er nur konnte, und seine Ekstase verlängern.
Und dann, wenn Jim jede Folter durchlitten hätte und zum Schreien zu schwach wäre, würde er ihm das Leben nehmen.
***
Francis Ackerman betrat den Imbiss und setzte sich an die Theke.
»Was darf ich Ihnen bringen, Sir?«, fragte die Kellnerin.
Er sah ihr tief in die Augen. »Ein Steak.«
»Möchten Sie auch etwas trinken?«
»Ja. Kaffee.«
Sie notierte es sich. »Wie hätten Sie das Steak gern?«
»Blutig.«
»Bratkartoffeln, Salat?«
»Nur Steak und Koffein.«
Er schaute zum Fernseher, der an der Wand hing. Etwas erregte seine Aufmerksamkeit, und er bat die Kellnerin, den Apparat lauter zu stellen.
»Bei einem Vorfall, der im Bundesstaat Colorado für Bestürzung und Entsetzen gesorgt hat, wurden gestern Nacht drei Männer getötet, ein Tankwart sowie zwei Trooper der State Police. Ein viertes Opfer wird im Augenblick wegen einer Schussverletzung am Kopf behandelt, doch man geht davon aus, dass es vollständig genesen wird.«
Ackerman beugte sich vor. Vollständig genesen?
Ein Police Officer verdrängte den Nachrichtensprecher. Die Bildunterschrift lautete: Major Christian Steinhoff, Colorado State Patrol. Ackerman prägte sich den Namen ein.
Der schwitzende Officer erklärte: »Emily Morgan befindet sich auf dem Weg der Besserung und hat das Bewusstsein wiedererlangt. Wir werden später weitere Einzelheiten mitteilen. Mrs. Morgan zufolge hat ein Fremder, auf den die Beschreibung von Francis Ackerman junior passt, ihren Mann gezwungen, sich zwischen ihrem Leben und dem ihrer gemeinsamen Tochter zu entscheiden, mit anderen Worten, entweder sie oder das Mädchen zu töten. Aufgrund der ersten Ermittlungsergebnisse nehmen wir an, dass Trooper Jim Morgan dank seiner Geistesgegenwart in der Lage war, das Leben seiner Frau zu retten.«
Der Police Officer trank einen Schluck Wasser und fuhr fort: »Trooper Morgan und sein Partner, Trooper Tom Delaine, hatten vor einigen Wochen mit einem Fall zu tun, bei dem eine junge Frau in den Kopf geschossen worden war. Sie hatten das fragliche Haus betreten und die Frau in einer Blutlache am Boden gefunden. Die beiden Trooper hielten sie für tot, stellten bei genauerer Untersuchung jedoch fest, dass sie noch lebte. Der Frau war mit einer Pistole vom Kaliber .22 aus schrägem Winkel in den Kopf geschossen worden, wobei die Kugel von ihrem Schädel abgeprallt war. Der Aufschlag des Geschosses raubte ihr das Bewusstsein, doch sie überlebte die Verletzung.
Die Wunde an Emily Morgans Kopf ist fast identisch mit der Wunde dieser jungen Frau, auch wenn in ihrem Fall eine Waffe kleineren Kalibers verwendet wurde. Trooper Morgan war am Tag des Zwischenfalls morgens auf dem Schießstand. Seine Waffe war noch immer mit Patronen geladen, die eine Treibladung von geringer Durchschlagskraft enthalten. Wir können es zwar nicht mit Sicherheit sagen, aber wir gehen davon aus, dass Trooper Morgan erfolgreich versucht hat, den vorherigen Vorfall nachzustellen, um dadurch das Leben seiner Tochter und seiner Frau zu retten. Obwohl Mrs. Morgan Teile ihres Schädelknochens und ihres Ohrläppchens verlor und wegen Schwellungen des Gehirns behandelt werden muss, wird davon ausgegangen, dass sie vollständig genesen wird. Derzeit steht sie unter Polizeischutz.«
Ackerman lehnte sich zurück. Da soll mich doch der Teufel holen.
»Gratuliere, Jim«, sagte er laut. »Dann steht es zwischen uns wohl unentschieden.«
Er bemerkte, dass der ältere Mann, der neben ihm an der Theke saß, einen Löffel mit Kartoffelbrei zwischen Mund und Teller hielt. Ackerman wandte sich ihm zu und sah, dass der Mann ihn anstarrte. Eine aufgeschlagene Zeitung lag vor ihm auf dem Tresen. Zweifellos enthielt sie ein Foto des gesuchten Killers Francis Ackerman junior.
Der Mann begann zu zittern, und eine kleine Portion Kartoffelbrei fiel ihm auf den Schoß. Er schien es gar nicht zu bemerken.
Ackerman schüttelte seufzend den Kopf. Mein Werk ist nie vollbracht.
»Wie wär’s mit einem Spielchen?«, fragte er den Mann.
2.
Marcus Williams machte sich kampfbereit. Er neigte den Kopf zur Seite und ließ die Nackenwirbel knacken. »Tut mir echt leid für dich«, sagte er, »aber ich kann gut verstehen, dass sie lieber mit einem wie mir zusammen ist, der normal mit ihr redet statt Grunzlaute auszustoßen, so wie du.«
»Mach hier bloß nicht auf Klugscheißer, Freundchen«, entgegnete der bierbäuchige Cowboy und blähte die Nüstern wie ein Bulle vor dem Losstürmen.
»Ja, ich sollte auf Dummschwätzer machen. Dann wären wir wenigstens auf einer Wellenlänge.«
Neben dem Cowboy, der Glenn hieß, postierten sich zwei Männer. Vom anderen Ende der Gasse hörte Marcus weitere Schritte, die näher kamen. Er streckte den Arm aus und zog Maggie hinter sich. Dumpfbacken wie diese hier rückten immer rudelweise an. Die Gasse war lang und schmal, kein Fluchtweg in Sicht.
Einer der Männer hinter Marcus klatschte irgendetwas rhythmisch in seine Handfläche – es hörte sich ganz nach einem Baseballschläger an. Der Mann rechts von Glenn hielt lässig ein Brecheisen in seiner schwieligen Pranke. Marcus blickte blitzschnell hinter sich. Noch zwei Typen. Also insgesamt fünf. Zwei trugen ihre Waffen offen, die anderen hatten wahrscheinlich Messer bei sich, oder Schlagringe, oder Schlimmeres.
»Ihr Wichser aus der Großstadt haltet euch für besonders schlau, was?«, sagte der Cowboy. »Ich hab die Schnauze voll davon, dass Typen wie du uns wie Hinterwäldler behandeln, die sich nicht mal die Schuhe zubinden können. Aber da liegst du falsch, Sackgesicht. Wir werden dir ein paar Dinge beibringen, die du so schnell nicht vergisst.«
Marcus dachte blitzschnell nach. Bis die Kerle sich auf ihn stürzten, blieben ihm nur wenige Sekunden. Auch wenn sie ihn nur zusammenschlagen wollten, konnte der Streit schnell von einer Prügelei zu einem Kampf auf Leben und Tod werden. Außerdem würde Maggie nicht ungeschoren davonkommen, nachdem sie ihn fertiggemacht hatten. War ein wütender Mob erst in Fahrt, war er ungefähr so leicht aufzuhalten wie ein Schnellzug.
Adrenalin schoss ihm ins Blut und verlieh ihm zusätzliche Kraft. Er packte die Ecke eines Müllcontainers, warf sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen und schleuderte ihn herum. Der Container war fast leer, die Räder nicht arretiert. Er wirbelte ihn den beiden Männern in den Weg, die sich ihm von hinten näherten.
Dann schob er Maggie zur Wand und trat auf die andere Seite. Er wollte die Angreifer von dem Mädchen weglocken und sie zugleich vom Kampf abschirmen.
Er wandte sich den beiden Gegnern zu, die von vorn kamen. Glenn, den Cowboy, hielt er für einen Feigling. Er hatte von vornherein gewusst, dass dieses Großmaul die schmutzige Arbeit seinen Kumpels überlassen würde.
Der erste Mann bekam einen Tritt gegen die Brust, der ihn von den Beinen riss und aufs Pflaster schleuderte. Der zweite Angreifer jedoch traf Marcus mit dem Brecheisen in die Seite. Marcus taumelte und wäre beinahe in die Knie gegangen. Der Schmerz schoss ihm das Rückgrat hinauf, aber er mobilisierte alle Willenskraft. Er hatte keine Zeit, um Schmerz zu empfinden.
Er wirbelte zu dem zweiten Angreifer herum und legte sein ganzes Gewicht hinter einen Schlag mitten in das rundliche Gesicht. Der Hieb traf den Mann mit verheerender Wucht. Er krachte schwer auf den Rücken. Marcus sah mit einem Blick, dass er so schnell nicht wieder aufstehen würde.
Der erste Angreifer versuchte sich aufzurappeln, doch seine Hoffnung, wieder in den Kampf einzugreifen, wurde durch Marcus’ Fußtritt beendet, der ihn seitlich am Kopf traf.
Glenn hielt sich immer noch zurück. Er schob sich von einer Seite der Gasse auf die andere, ohne Marcus auch nur einen Sekundenbruchteil aus den Augen zu lassen.
Mittlerweile hatten die Schläger, die vom anderen Ende der Gasse gekommen waren, den schweren Müllcontainer umrundet. Der Glatzkopf, der mit dem Baseballschläger bewaffnet war, stürmte brüllend auf Marcus los. Marcus packte das Brecheisen, das neben dem Bewusstlosen auf dem Boden lag, und schleuderte es dem Glatzkopf entgegen, als dieser mit dem Holzknüppel ausholte.
Das Eisen traf sein Ziel, doch es war kein vernichtender Treffer. Dennoch erfüllte die kurzzeitige Ablenkung ihren Zweck und erlaubte es Marcus, an den Glatzkopf heranzukommen, ehe dieser wieder ausholen konnte. Er packte das dicke Ende des Baseballschlägers mit der Linken, riss ihn dem Mann aus der Hand und knallte ihm die Rechte ins Gesicht.
Der Glatzkopf heulte auf, schlug blind zu und landete einen Treffer an Marcus’ Schläfe. Marcus wich wankend zurück, rächte sich jedoch mit einem harten Stoß des Baseballschlägers, einem von Kirby Puckett signierten original Louisville Slugger.
Der Treffer ließ den Glatzkopf k. o. gehen.
Nur noch ein Angreifer blieb übrig, denn Glenn war mehr Zuschauer als Gegner. Der letzte Mann musterte Marcus wachsam, suchte nach einer Schwachstelle.
Marcus packte den Baseballschläger fester. »Überleg’s dir gut.«
Der Kerl zögerte einen Augenblick, dann rannte er mit einer Geschwindigkeit, die Marcus bei einem Mann seiner Größe nicht für möglich gehalten hätte, zum Ende der Gasse und verschwand um die Ecke. Marcus grinste. Niemand weiß, wie schnell er wirklich ist, bevor er nicht verfolgt wird.
Dabei hatte er gar nicht die Absicht, den Typen zu verfolgen. Vielmehr war es Zeit, sich Glenn zuzuwenden, dem Großmaul, das die Schlägerei vom Zaun gebrochen hatte.
Marcus drehte sich um und ging lässig auf Glenn zu, der unruhig von einem Fuß auf den anderen trat. Den Baseballschläger warf Marcus zur Seite – er wusste, dass er ihn nicht brauchte.
Glenn starrte ihn an. Marcus fragte sich, ob der Dicke sich in einen Kampfrausch zu steigern versuchte, oder ob er sich gleich in die Hose machte und die Flucht ergriff wie sein Kumpel eben. Mit zittriger Stimme sagte Glenn: »Dann muss ich dir wohl eigenhändig ’ne Lektion erteilen.«
Er griff in die Tasche und zückte ein Schnappmesser.
Das wird ein Spaß, dachte Marcus.
Glenn griff an und stach zu, doch die Klinge zischte ins Leere, weil Marcus ihr längst ausgewichen war. Der Cowboy konterte mit einem Bogenschnitt, der Marcus fast den Bauch aufgeschlitzt hätte, doch er sprang gerade noch rechtzeitig nach hinten und krümmte den Rücken, um der Klinge zu entgehen.
Das war knapp.
Glenn versuchte noch zwei weitere Blitzattacken, die aber beide erfolglos blieben. Beim dritten Stoß packte Marcus den Cowboy beim Handgelenk und zog, so fest er konnte. Das Messer segelte durch die Luft und tanzte klirrend durch die Gasse. Vom eigenen Schwung wurde Glenn nach vorn gerissen. Marcus packte ihn mit ausgestrecktem Arm, riss ihn herum und trat ihm die Beine weg. Glenn knallte mit dem Kopf auf das Pflaster. Der Aufprall trieb ihm die Luft aus der Lunge, und sein Körper erschlaffte.
Schwer atmend blickte Marcus auf seinen bewusstlosen Gegner hinunter. Er war immer ein Fan von Actionfilmen und den markigen Sprüchen der Helden gewesen. Und obwohl Dirty Harry oder der Terminator die besseren Sprüche auf Lager hatten, erfüllte es ihn mit Stolz, als er nun sagte: »Game over.«
***
»Alles in Ordnung?«, fragte Maggie besorgt, während sie ein Handy aus der Handtasche zog und es sich ans Ohr hielt. »Du blutest.«
Marcus wischte sich einen Blutfaden von den Lippen. Er zerrieb das Blut zwischen den Fingern. »Ach, das ist nichts. Alles bestens.«
Maggie nickte bloß. »Dad?«, sagte sie ins Handy. »Ich bin’s.«
Während sie mit ihrem Vater sprach, beobachtete Marcus ihre Haltung, schaute in ihre Augen und lauschte ihrem Tonfall und der Stimmhöhe. Es verriet viel über einen Menschen, wie er sich nach einer überstandenen Stresssituation verhielt. Maggies Stimme war ruhig, ihr Atem ging gleichmäßig, und ihre Körpersprache ließ Selbstsicherheit erkennen. Immer wieder streifte ihr Blick über die besinnungslosen Männer, die sie überfallen hatten. Marcus hörte zwar ein kaum wahrnehmbares Zittern in ihrer Stimme, aber damit war zu rechnen gewesen. Ansonsten hielt Maggie sich verdammt gut. Sie erinnerte ihn an einen Cop, der Verstärkung anforderte.
»Glenn und ein paar von seinen Kumpels haben mir und meiner Begleitung aufgelauert … Nein, ist nichts passiert, meine Begleitung hat sie erledigt … Ja, Dad, männliche Begleitung … Nein, du kennst ihn nicht. Jetzt ist wohl nicht der richtige Augenblick, meinst du nicht? Komm bitte her. Wir sind in einer Gasse neben der Bar. Okay. Beeil dich.«
Sie klappte das Handy zu und steckte es in die Handtasche zurück.
Marcus sah, dass Glenn aufzustehen versuchte, dann aber wieder zurückfiel und reglos liegen blieb.
»Meinst du nicht, du hättest lieber den Sheriff rufen sollen als deinen Vater?«, fragte er.
Maggie lächelte. »Mein Vater ist der Sheriff.«
»Oh.«
»Das ist doch kein Problem für dich? Du wärst nicht der Erste, der sich aus dem Staub macht, wenn er hört, dass mein Dad der Sheriff ist. Manche Männer sind leicht einzuschüchtern.«
»Ich nicht, das hast du doch gesehen. Aber ich habe großen Respekt vor einem Mann mit Dienstmarke. Ich war selbst Cop, sogar in dritter Generation.«
»Du warst?«
»Ja. Jetzt bin ich’s nicht mehr.«
Zum ersten Mal seit langer Zeit kam Marcus der Gedanke, dass er wieder Cop werden könnte. Dann bekam er vielleicht einen ruhigen Job als Deputy, saß am Highway im Streifenwagen und stellte ab und zu einen Strafzettel aus. Das wäre Lichtjahre entfernt von der Welt, die er hinter sich gelassen hatte. Ein Problem wäre nur die Leistungsbewertung, die sein früherer Dienstherr ihm ausstellen würde.
Maggie ließ das Thema ruhen. Sie seufzte und strich sich eine blonde Strähne aus der Stirn. Ihre bronzene Sonnenbräune ließ ihr Haar heller erscheinen, als es wirklich war. Sie trug kein Make-up und brauchte es auch nicht. Auf ihrem rosaroten T-Shirt stand der Schriftzug The Asherton Tap, der Name der Bar, in der sie kellnerte und in der Marcus sie an diesem Abend kennengelernt hatte. Er hatte angeboten, sie nach Hause zu bringen.
»Die ganze Sache tut mir leid«, sagte Maggie nun. »Ich wusste, dass Glenn ein Auge auf mich geworfen hat, aber ich hätte nie gedacht, dass er so weit geht.«
Marcus lächelte. »Mach dir keine Gedanken. Ich kann auf mich aufpassen.«
»Das habe ich bemerkt. Du meine Güte, du hast fünf Mann fertiggemacht. Wo hast du so zu kämpfen gelernt?«
Er zuckte mit den Achseln. »Chuck-Norris-Filme.«
»Nimm mich nicht auf den Arm. Komm, sag schon.«
»Ich hatte ein bisschen Kampfsportausbildung und habe geboxt, als ich noch bei der Polizei war. Ich war schon als Junge ein harter Brocken. Aber wenn ich ehrlich sein soll … was hier passiert ist, war drei Teile Glück und nur ein Teil Können.«
Er hatte wirklich Glück gehabt, wie immer in solchen Situationen. Aus gewalttätigen Auseinandersetzungen schien er jedes Mal als Sieger hervorzugehen. Wann wurde Glück zu Können? Wann wurde aus Können ein Talent?
Aber er besaß unbestreitbar die Gabe, anderen sehr wehzutun, und das beunruhigte ihn. Es wäre ihm lieber gewesen, wenn er tatsächlich immer nur Glück hätte.
Aber tief im Innern wusste er es besser.
Er wusste, wozu er fähig war.
Mit flackerndem Blaulicht bog ein Streifenwagen um die Ecke und hielt vor ihnen. Ein Mann mittleren Alters mit silbrigem Haar und Spitzbart stieg aus. Maggie erzählte ihm, was vorgefallen war. Offenbar war der Mann ihr Vater, der Sheriff.
Am Ende der Gasse hatte sich eine Menge gebildet, die aus Gästen der Kneipe bestand. Die rockige Musik einer Coverband dröhnte über die Straße, während weitere Leute ins Freie strömten, um sich anzusehen, was los war.
Nur, dass es schon vorbei war. Viele Schaulustige wirkten enttäuscht, dass sie den Kampf versäumt hatten, und zogen murrend wieder ab.
Nachdem er sich Maggies Geschichte angehört hatte, ging der Sheriff zu Glenn und klaubte ihn vom Pflaster auf, während einer seiner Deputys sich um die Freunde des Cowboys kümmerte.
»Hast du irgendwas zu sagen, Junge?«, fragte der Sheriff.
Noch immer benommen, begann Glenn: »Ich … ich hab nichts getan, Sheriff, wirklich nicht. Ehrenwort. Wir wollten den Neuen bloß in der Stadt willkommen heißen. Zum Dank macht der Typ mich an! Als ich den Penner beruhigen will, schlägt er um sich wie ’n Bekloppter.«
Der Sheriff nickte. »Verstehe. Weiß du, Glenn, ich war immer schon der Meinung, dass du das städtische Begrüßungskomitee leiten solltest. Wie ich sehe, haben du und deine Jungs sogar Willkommensgeschenke mitgebracht. Einen Baseballschläger, ein Brecheisen … wie nett.« Der Sheriff grinste. »Stil habt ihr, das muss ich euch lassen.« Er schubste Glenn zu seinem Deputy. »Schaff diesen Müllhaufen hier weg.«
Der Sheriff sprach ein paar Worte mit Maggie, dann wandte er sich Marcus zu. »Tut mir leid wegen Glenn. Der ist so helle wie ein Brikett. Wie auch immer … ich bin zwar nicht dafür, aber Maggie hat mich überredet, Ihnen zu erlauben, sie nach Hause zu bringen. Das heißt aber nicht, dass Sie schon vom Haken sind. Kommen Sie morgen Nachmittag aufs Revier und machen Sie Ihre Aussage. Dann können wir uns zusammensetzen und hübsch plaudern.«
Marcus gefiel nicht, wie der Sheriff »hübsch plaudern« aussprach. Das Gespräch würde sich vermutlich um Maggie drehen – und die gewaltsame Entfernung diverser Körperteile, sollte er dem Mädchen gegenüber nicht den nötigen Respekt an den Tag legen.
»Ich werde da sein, Sir«, sagte Marcus.
»Das möchte ich Ihnen auch raten.«
Maggie drückte ihren Vater noch einmal verlegen, dann ging sie mit Marcus davon. Nach kurzem Schweigen ergriff sie wieder das Wort. »Warum bist du eigentlich kein Cop mehr?«
Eine dunkle Gasse, ein Schrei, Blut, Tränen …
Die Erinnerungen wirbelten Marcus durch den Kopf wie ein Tornado, der ein Haus zwar stehen lässt, aber unbewohnbar macht.
Aber woher sollte das Mädchen wissen, dass ihre Frage eine schmerzhafte Erinnerung auslöste? Sie versuchte nur, ihn besser kennenzulernen. Vielleicht, weil sie ihn mochte. Und wenn er jetzt eine Stunde brauchte, um eine so einfache Frage zu beantworten, hielt sie ihn wahrscheinlich für einen ausgebrannten Psycho.
»Na ja …«, begann er. Was sage ich ihr bloß? »Ich glaube, diese Frage sollten wir bis zu unserem zweiten oder dritten Date aufschieben.«
»Woher willst du wissen, dass es überhaupt ein zweites oder drittes Date geben wird?«, fragte Maggie.
»Weil du auf meine Geheimnisse neugierig bist.«
Sie lächelte. Als Marcus ihr in die Augen schaute, verschwanden seine düsteren Erinnerungen aus seinem Bewusstsein und glitten wieder in den Hintergrund. Vorerst hatte der Schmerz sich gelegt. Im Augenblick schliefen seine Dämonen.
»Danke, dass du mich begleitest«, sagte Maggie. »Du bist wirklich ein netter Kerl.«
Marcus verzog das Gesicht. »Der Kuss des Todes.«
Sie sah ihn verwirrt an.
»Nette Kerle werden nachts angerufen und um Rat gebeten, wie man mit festen Freunden umgeht, die sich als Dreckskerle erweisen. Nette Kerle fahren dich zum Flughafen und helfen dir beim Umzug. Sie kommen immer als Letzte. Und ich … bin nicht ganz so nett.«