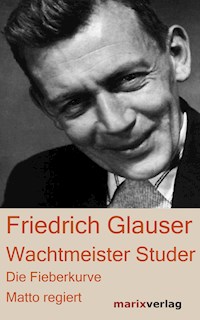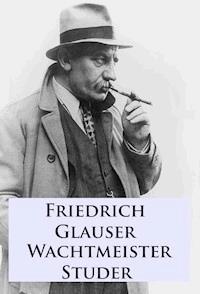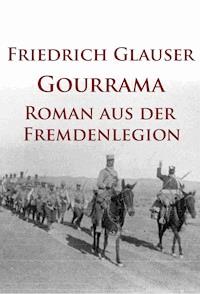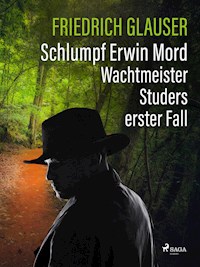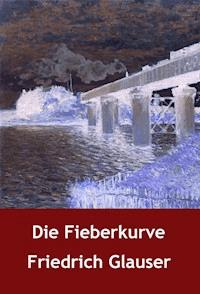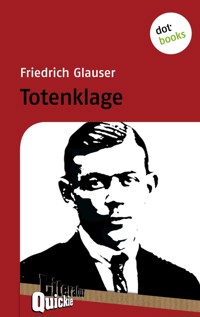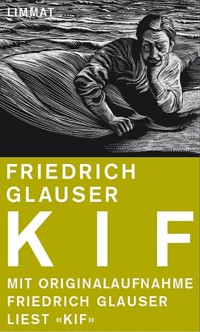9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ob Diebstahl oder Mord, Glausers 'kriminelle' Stoffe stammen immer wieder aus seinem eigenen Leben. Ob er selbst kleinere Diebstähle zur Finanzierung seiner Sucht beging oder Zeuge wurde von gewaltsamen Konfliktlösungen - etwa in der Fremdenlegion -, einige Vorfälle verarbeitet Glauser gar mehrfach in verschiedenen Erzählungen. Vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil sie ihm nahe gingen, waren die Delikte und ihre Enttarnung bei Glauser nicht primär ein Element für kriminalistische Rätsel und simple Spannung, sondern stets verknüpft mit der Suche nach Motiven und Erklärungen für das Handeln der Menschen. Der vorliegende Band präsentiert Glausers beste Kriminalgeschichten von der frühesten Wachtmeister-Studer-Geschichte bis zur Titelgeschichte über einen kleinen Diebstahl aus Gerechtigkeitsempfinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
«Daten wollen Sie? Also: 1896 geboren in Wien von österreichischer Mut ter und Schweizer Vater. Großvater väterlicherseits Goldgräber in Kali fornien (sans bla gue), mütterlicherseits Hofrat (schöne Mischung, wie?). Volksschule, 3 Klassen Gymnasium in Wien. Dann 3 Jahre Land erziehungsheim Glarisegg. Dann 3 Jahre Collège de Génève. Dort kurz vor der Matur hinausgeschmissen … Kantonale Matur in Zürich. 1 Semester Chemie. Dann Dadaismus. Vater wollte mich internieren lassen und unter Vormundschaft stellen. Flucht nach Genf … 1 Jahr (1919) in Münsingen interniert. Flucht von dort. 1 Jahr Ascona. Verhaf tung wegen Mo. Rücktransport. 3 Monate Burghölzli (Gegenexpertise, weil Genf mich für schizophren erklärt hatte). 1921–23 Fremdenlegion. Dann Paris Plongeur. Belgien Kohlengruben. Später in Charleroi Krankenwärter. Wieder Mo. Inter nie rung in Belgien. Rücktransport in die Schweiz. 1 Jahr administra tiv Witz wil. Nachher 1 Jahr Handlanger in einer Baum schule. Analyse (1 Jahr) … Als Gärtner nach Basel, dann nach Winterthur. In dieser Zeit den Legionsroman geschrieben (1928/29), 30/31 Jahreskurs Gartenbaumschule Oeschberg. Juli 31 Nach analyse. Jänner 32 bis Juli 32 Paris als ‹freier Schriftsteller› (wie man so schön sagt). Zum Besuch meines Vaters nach Mannheim. Dort wegen falschen Rezepten arretiert. Rücktransport in die Schweiz. Von Juli 32–Mai 36 interniert. Et puis voilà. Ce n’est pas très beau …»
Friedrich Glauser an Josef Halperin, 15. Juni 1937
FRIEDRICH GLAUSER
Ich bin ein Dieb
und andere Kriminalgeschichten
Inhalt
König Zucker
Der alte Zauberer
Knarrende Schuhe
Kriminologie
Verhör
Ich bin ein Dieb
Kuik
Pech
Offener Brief über die «Zehn Gebote für den Kriminalroman»
«Gibt es überhaupt gute und böse Menschen? Sind Menschen nicht einfach Menschen – weder Bestien noch Heilige –, durchschnittliche Menschen, keine Heroen, keine Schlaumeier, keine geschickten, findigen, keine gewiss bösen, sondern einfach Menschen, mögen sie nun Glauser, Brockhoff, Hitler, Riedel heißen oder Emma Künzli und Guala? Haben wir Schreiber nicht die Pflicht – auch wenn wir Spannung machen, auch wenn wir idealisieren –, immer und immerfort (ohne zu predigen, versteht sich) darauf hinzuweisen, dass nur ein winziger, ein kaum sichtbarer Unterschied besteht zwischen dem ‹gewiss bösen Menschen (im Allgemeinen)› und dem ‹geschickten, findigen mit den planmäßigen Überlegungen›? (…) Denn diese Einteilung ist genauso ein fauler romantischer Zauber wie die armen Falltüren und die Requisiten einer Zeit, die naiver war als die unsrige.»
Friedrich Glauser: Offener Brief über die «Zehn Gebote für den Kriminal roman»
König Zucker
Es war von Anfang an die trostlose Affäre par excellence gewesen, wie Polizeikommissar Kreibig sofort am Tatort feststellte. Schiebermilieu – der Tote, der am Boden lag, mit einer Stichwunde in der Brust, an der er verblutet war, hieß Jakob Kussmaul, stammte nach seinem Pass aus Riga, aber vielleicht hieß er gar nicht Kussmaul, vielleicht stammte er aus Bukarest, bei diesen Leuten war man nie sicher … Und der Kommissar Kreibig seufzte. Es war vier Jahre nach dem Weltkrieg, Wien war ausgehungert, und alle Welt schob. Seufzend dachte Kreibig daran, dass er wahrscheinlich Hofrat geworden wäre, wenn die alte Monarchie noch geblieben wäre, aber so … Und da war also dieser Jakob Kussmaul, der vielleicht gar nicht so hieß, lag am Boden, sein rosa Seidenhemd war auf der linken Seite der Brust zerrissen, und ein großer Blutfleck hatte das zarte Gewebe starr und bräunlich gemacht.
Der Tote lag neben einem Tisch, und auf dem Tisch stand ein Schachbrett mit Figuren. Eine begonnene Partie. Neben dem Brett zwei Tassen mit schwarzem Kaffee, halb geleert, daneben (Luxus!) zwei Silberschälchen für den Zucker: auf dem einen eins jener viereckigen Päckchen, in welchen drei Stückchen sogenannten Würfelzuckers verpackt sind, das andere leer.
Auf dem Boden aber lag der Jakob Kussmaul und hielt in der Rechten den schwarzen König des Schachspiels, in der Linken ein viereckiges Päckchen Würfelzucker, das Päckchen, das offenbar auf dem leeren Silberplättchen auf dem Tisch gelegen hatte.
«Wie lang hat er noch gelebt?», fragte Kommissar Kreibig den Gerichtsarzt.
«Oh, so zwei, drei Minuten, glaub ich …»
«War er noch bei Besinnung?»
«Glaub schon, glaub schon. So einer, der hat ein zähes Leben, das können Sie mir glauben, Herr Hofrat.»
«Und Sie glauben, das hat etwas zu bedeuten, das, was er da in der Hand hält?»
«Möglich wär’s schon … Aber was? Ein schwarzer Schachkönig und drei Stückerln Würfelzucker? … Was soll das bedeuten? … Verstehen Sie das, Herr Hofrat?»
«Vielleicht», sagte der Kommissar, dem der ‹Hofrat› des Doktors angenehm die Ohren streichelte. «Vielleicht hat uns der Ermordete damit einen Fingerzeig geben wollen, einen Fingerzeig, verstehen Sie, Herr Doktor, wie wir zum Mörder gelangen. Denn etwas bedeutet der Zucker doch …»
«Und die Schachfigur …», wagte bescheiden der Polizist Hochroitzpointner einzuwerfen. Er trug einen armseligen roten Schnurrbart, und seine Stirne war gefurcht.
«Ja», sagte der Kommissar, «der schwarze König … Ich kenn einen König Haber, ich kenn einen König Lear und wie die Könige alle bei Shakespeare heißen, Heinrich und Richard, und auch den König Ottokar kenn ich – aber einen König Zucker. König Zucker …», wiederholte er und schüttelte den Kopf. Er sah sich im Zimmer um. Ein Hotelzimmer, wie viele andere. Abgewetzter Teppich auf dem Boden, eine grünliche Tapete an den Wänden, verblichen bis auf ein Rechteck über dem Bett, wo sicher einmal ein Kaiserbild gehangen hatte. Das Fenster ging auf einen Lichthof, es war ein trübes Licht im Raum, es regnete draußen, und dann wollte es bald Abend werden.
Der Doktor verabschiedete sich, der Kommissar Kreibig studierte lange die angefangene Partie, schüttelte manchmal den Kopf, der Polizist in Zivil Hochroitzpointner verhielt sich still, endlich flüsterte er:
«Soll ich den Kellner rufen?»
Kreibig nickte. Er starrte auf den Toten. Unsympathisch, durchaus, sah dieser aus. Ein dreifaches Kinn, eine käsige Haut, die Stirn niedrig und Wulstlippen. Von jener berühmten ‹Majestät des Todes› war auch keine Spur vorhanden.
Kreibig wandte sich von dem Toten ab und trat an den zweiten Tisch des Zimmers, der viereckig war und neben dem Fenster stand. Papiere lagen dort, Rechnungen, Frachtbriefe, Geschäftsbriefe. «Gemäß Ihrer w. Bestellung vom 15. ct. beehren wir uns, Ihnen zu offerieren …» Eine Brieftasche, abgegriffen, zum Platzen gefüllt. Kreibig öffnete sie: türkische Pfund, Schweizer Franken, Dollars, englische Pfund, zwei Checks. Kreibig zählte mechanisch das Geld, seufzte, weil er an sein Salär dachte, das er in Inflationsgeld bekam, versorgte die Banknoten sorgfältig wieder, als er ganz hinten, verrunzelt, ein Stück Papier bemerkte. Er zog es ans Licht. Hinter ihm schlich der Polizist Hochroitzpointner auf leisen Gummisohlen durchs Zimmer.
Das Stück Papier war ein Ausschnitt aus einer französischen Zeitung: auf der einen Seite die Ankündigung eines Astrologen, aber die Annonce war nicht vollständig, in der Mitte war sie abgeschnitten, der ganze zweite Teil fehlte. Auf der andern Seite ein mit Rotstift angezeichneter Artikel:
Le traitement rationel du diabete
par le professeur Durand.
Offenbar die Ankündigung eines Buches über die Behandlung der Zuckerkrankheit. Kreibigs Augen wanderten vom Zeitungsausschnitt zum Tisch. Zuckerkrankheit? … Zucker? … Zwei hatten am Tische Schach gespielt und dazu Kaffee getrunken, aber beide hatten sie den Kaffee ungesüßt getrunken … Der eine, wohl der Mörder, hatte sein Päckchen auf dem kleinen Silberplättchen liegenlassen, der Kussmaul aber hatte das Päckchen, bevor er vom Stuhl gefallen war, noch rasch mit der linken Hand gepackt, während die Rechte … aber das kam später. Die Linke hatte also den Zucker gepackt, der Mörder war aufgestanden, hatte sich ruhig durch die Tür entfernt, dann war der Kussmaul auf den Boden gefallen, war gestorben und sein Körper in einer immerhin merkwürdigen Stellung erstarrt. Denn die beiden Unterarme, vom Ellbogen an, standen senkrecht in die Luft. Die linke Hand hielt ein Päckchen Zucker, die rechte einen schwarzen Schachkönig …
Der Etagenkellner Pospischil, Ottokar, verheiratet, wohnhaft Mariahilferstraße 45, schien für den ermordeten Kussmaul keine übertriebene Hochschätzung aufbringen zu können. Er habe gesoffen, deponierte er, ganze Nächte durch, gespielt habe er auch, mit ‹Freunderln›, und Weiber … aber davon wolle er, Pospischil, gar nicht reden. Dabei sei der Kussmaul krank gewesen, zuckerkrank, habe keine Mehlspeisen essen dürfen, er habe auch einen Spezialisten konsultiert, der habe ihn einmal besucht, ein nobler Herr, Zylinder und weiße Gamaschen und einen schönen weißen Bart, aber an den Namen könne er sich nicht erinnern.
«Ja, Herr Hofrat», sagte der Kellner Pospischil, der arg verhungert aussah, «da lassen S’ am besten die Finger davon, denn der Mann da, der hat Konnexionen g’habt, ich sag Ihnen, ein Oberst von der amerikanischen Delegation ist ihn kommen besuchen, und sie haben zusammen englisch g’redt, und überhaupt, Besuche hat er den ganzen Tag gehabt, Türken und Russen und Argentinische sind zu ihm gekommen – und auch G’sindel – wenn Sie meine Meinung wissen wollen, Herr Hofrat, der Mann war eine düstere Existenz …»
«Ja», sagte der Kommissar Kreibig und strich über sein weißes Haar, das seidig schimmerte, «ja, mein lieber Pospischil, das hab ich mir schon denkt, ich hab’s von Anfang an gesagt, nicht wahr, Hochroitzpointner? Ich hab’s von Anfang an gesagt, eine trostlose Affäre par excellence, hab ich’s nicht g’sagt?»
Und Hochroitzpointner nickte schweigend.
«Sie können gehen, Pospischil … oder nein, warten Sie noch. Der Zucker, Hochroitzpointner, wäre ja erklärt, sehen Sie hier den Zeitungsausschnitt, nicht wahr, ‹Die Behandlung der Zuckerkrankheit› von einem französischen Professor namens Durand. Nun weiß man ja, dass Zuckerkranke, gerade weil Ihnen der Zucker verboten worden ist, immer Hunger nach Zucker haben, und da hat halt der Kussmaul, wie er gesehen hat, dass er sterben wird, noch schnell das Packerl Zucker in die Hand genommen – gewissermaßen um seinen letzten Wunsch zu befriedigen. Nicht wahr? Was meinen Sie, Hochroitzpointner?»
Hochroitzpointner antwortete nichts, er hielt die Hände hängend in Schulterhöhe, was ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit einem bettelnden Hunde verlieh. Kommissar Kreibig hasste diese Allüren.
«Antworten Sie doch, wenn man Sie fragt!», schnauzte er.
Der Geheimpolizist Hochroitzpointner antwortete nicht, er fragte, und zwar fragte er den Kellner Pospischil:
«Mit wem hat der Herr immer Schach gespielt?»
«Am liebsten mit dem Swift, einem Engländer. Der Herr … eh … der Tote hat gesagt, der Swift ist der Einzige, der gut spielt. Die andern sind nur Rotzbuben …»
«Und der Herr Swift war heut Nachmittag auch da?»
«Ja, er ist um halb vier gekommen. Dann hat der Kussmaul … eh … der Verstorbene geläutet und hat zwei Schalen Braun bestellt …»
«Zwei Schalen Braun? Aber wo ist die Milch?»
«Die ist uns ausgegangen, da hab ich zwei kleine Schwarze gebracht … Und da hat der Herr Kussmaul mich ang’schrien, warum ich hab Zucker gebracht, ich weiß doch, dass er keinen Zucker nehmen soll, und der andere Herr, der Herr Swift, der darf auch keinen Zucker nehmen, von wegen der ist auch zuckerkrank …»
«So, so …», sagte der Geheimpolizist Hochroitzpointner nur und verschwand.
«Sie können gehen, Pospischil», meinte der Kommissar, «oder warten Sie noch, haben Sie den Swift fortgehen sehen?»
«Ja, Herr Hofrat, um drei Viertel vier hab ich ihn geholt, von wegen es hat jemand am Telefon nach ihm gefragt.»
«Und da hat der Kussmaul noch gelebt?»
«Das weiß ich nicht, halten zu Gnaden, Herr Hofrat, das weiß ich also wirklich nicht. Ich hab geklopft und hab gesagt: ‹Telefon für den Herrn Swift.› Da hat eine Stimme gesagt: ‹Yes›, die Tür ist aufgerissen worden, und ich bin zurückgefahren, weil, wissen S’, Herr Hofrat, der Kussmaul, der hat es nicht gerne gehabt, wenn ich ins Zimmer gekommen bin, und einmal, da hat er mir …»
«Das interessiert mich nicht, Pospischil.»
«Da hat er mir eine leere Flasche an den Kopf geworfen … Ja, also, der Herr Swift, der ist mit mir zum Telefon gegangen, und dann hat er geredt, englisch, ich hab nix verstanden, und dann ist er fortgegangen. Hat mir gesagt, ich soll dem Kussmaul sagen, er kann die Partie nicht fertigspielen … Aber ich hab mich verspätet, hab zu tun gehabt, andere Gäste haben geläutet, oh mein! Der Herr Hofrat wissen gar nicht, wie schwer es unsereiner hat, den ganzen Tag laufen, und das kleine Trinkgeld, geizig sind die Schieber …»
«Schon gut, Pospischil, und wann sind Sie dann ins Zimmer gekommen?»
«So um halb fünf, Herr Hofrat, und da ist der Kussmaul … eh, der Ermordete, es weiß ja keiner, ob er wirklich Kussmaul heißt, einmal hat ihn einer ganz anders genannt, da ist er am Boden gelegen, und ich hab der Polizei telephoniert …»
«Und Sie heißen Ottokar mit dem Vornamen, Pospischil?»
«Zu Befehl, Herr Hofrat, Ottokar, ja, wie mein Großvater …»
«König Ottokars Glück und Ende …», murmelte Kommissar Kreibig.
«Wie belieben, Herr Hofrat?»
«Nichts, Pospischil, so heißt ein Stück von dem Wiener Grillparzer, aber den kennen Sie nicht …»
«Nein, Herr Hofrat, einen Gast dieses Namens haben wir nie gehabt in unserem Haus.»
«Und Sie haben ein Messer, Pospischil?»
… Der schwarze König … König Ottokar … aber dann passte der Zucker wieder nicht … aber der Swift war zuckerkrank, der Hochroitzpointner hatte vielleicht doch recht, aber Swift, Swift … der hatte doch keine Königsdramen geschrieben, nur diese Geschichten über die Riesen … Gulliver? Ja, Gulliver … Es ging ein wenig kreuz und quer zu in Kreibigs Kopf.
«Sie haben ein Messer, Pospischil?», fragte er noch einmal, weil der Kellner schwieg.
«Oh, nur ein Federmesserl, Herr Hofrat», und Pospischil zeigte in einem rührend verlegenen Lächeln seine schadhaften Zähne.
«Zeigen!»
«Bitte schön, bitte gleich …»
Aus der glänzenden schwarzen Hose zog Pospischil ein Messer heraus, lang wie der kleine Finger. Kreibig sah es an, klappte es auf: schartig, verrostet; er zuckte mit den Achseln.
«Sie können gehn, Pospischil.»
«Gehorsamster Diener, Herr Hofrat.» Und Pospischil verschwand ebenso lautlos wie vorher der Geheimpolizist Hochroitzpointner.
Kreibig nahm einen Stuhl, stellte ihn neben das runde Tischchen, auf dem die begonnene Schachpartie stand, stützte das Kinn in die Hände und prüfte die Stellung der Figuren.
Herr Swift hatte also Weiß. Er schien ein Liebhaber alter, erprobter Spielweise zu sein. Kreibig war ein guter Schachtheoretiker. Weiß hatte Königsgambit gespielt, Schwarz hatte es angenommen, wieviel Züge hatten die beiden gemacht? Höchstens zehn. Weiß hatte einen Springer geopfert, hatte also probiert, das uralte Kieseritzky-Gambit zu spielen, aber Schwarz kannte die Erwiderung, scheinbar. Wer hatte nur die Widerlegung erfunden, die Widerlegung dieses Angriffs, der einmal als gut galt? Es war ein Kerl, wie hieß er nur? Süßkind? Nein. Schokoladentorte? Dummes Zeug! Ein bekannter Meister, ein Schachmeister aus dem vorigen Jahrhundert. Wen gab es da? Anderssen? Nein. Morphy? Nein. Pilger? Das war ein Theoretiker …
Kreibig gab es auf … Er starrte auf den Toten. In der einen Hand der schwarze König, in der andern drei Stück Würfelzucker … War der Zucker das Wichtige oder der König? War der Hochroitzpointner im Recht, der jetzt hingegangen war, den Engländer Swift zu suchen, um ihn zu arretieren? Den Swift, der ebenfalls ein Diabetiker war? «Kussmaul», dachte der Kommissar Kreibig, der es unter der Monarchie sicher zum Hofrat gebracht hätte und der auch aussah wie ein solcher, kein Wunder, dass ihn alle Leute so titulierten – mein Gott, ja, sogar unter der Republik – «Kussmaul», dachte Kreibig, «dein Tod ist zwar die trostloseste, undankbarste Affäre par excellence, aber du scheinst doch das Bedürfnis gefühlt zu haben, uns ein kleines Bilderrätsel aufzugeben. Dafür sollte man dir dankbar sein. Mein Gott, das Leben ist langweilig genug. Was hat es für einen Wert, deinen Mörder zu suchen, Kussmaul, es wird dich niemand vermissen, nicht einmal deine ‹Freunderln›, wie der Pospischil so schön sagt. Du hast nicht viel Gutes getan in deinem Leben, das sieht man deiner Visage an, Leute betrogen, Frauen verführt, ich will Gift drauf nehmen, dass du ein Erpresser bist, du bist ein Aasgeier, Kussmaul, und doch muss ich deinen Mörder suchen. Was willst du, Pflicht ist Pflicht, und wir sind es halt so gewöhnt. Und dann, wenn ich dein kleines Rätsel mit dem ‹König Zucker› nicht löse, lachst du mich vielleicht noch aus, drüben, wo du jetzt weiter herumvagierst, wie hier auf dieser Welt …»
Die Dämmerung war dicht geworden. Kreibig sprang auf, drehte das Licht an. Der Tote streckte noch immer seine halbgeschlossenen Fäuste gegen die Zimmerdecke …
… Wer hatte nur eine Widerlegung des Kieseritzky-Gambits gefunden? …
Kreibig beugte sich noch einmal über den Toten, öffnete das Hemd, das der Gerichtsarzt geschlossen hatte. Die Wunde war klein, sauber, mit ganz scharfen Rändern, nicht zerfranst …
… Wie von einer Lancette, dachte Kreibig, ging zur Tür, schloss sie von außen ab und ging die Treppen hinunter.
«Wie sieht eigentlich der Herr Swift aus?», fragte er den Portier.
«Der Herr Swift? Der ist klein, alt und zittert sehr viel in den Knien und mit die Händ …»
«So, so», sagte Kreibig nur, zog seine Glacéhandschuhe an, die ziemlich abgeschabt waren.
Im Bureau ließ er sich ein Verzeichnis der Spezialärzte Wiens kommen. Er ging die Namen durch. Plötzlich, fast am Ende der Liste, sprang er auf und begann, mit der Handfläche der rechten Hand eifrig auf seine Stirn zu schlagen. «Natürlich!», sagte er dazu. «Selbstverständlich! Das königliche Spiel! Der König des Spiels! Der Meister! Der Schachmeister! Der Zuckermeister!» Und klatschte weiter gegen seine Stirn. Bis schließlich Hochroitzpointner sachte die Türe öffnete, erschrocken ins Zimmer äugte und leise bemerkte:
«Ich hab geglaubt, der Herr Hofrat hat seinen Buben bei sich und haut ihm Watschen herunter.» Wozu zu bemerken ist, dass Watschen der Wiener Ausdruck für Ohrfeigen ist.
«Und der Swift, lieber Hochroitzpointner?», fragte Kreibig.
«Der Swift ist so eine Art Kurier bei der englischen Gesandtschaft. Der ist fort. Im Auto. Ich hab fragen wollen, ob man die Grenzposten alarmieren soll …»
«Nicht nötig, nicht nötig, aber nehmen S’ eine Zigarette, lieber Hochroitzpointner …»
Das war nobel, denn eine simple Drama kostete damals …
«Ist der Herr Professor zu sprechen?», fragte Kreibig.
«Ich glaube …», antwortete der Diener.
«Es ist eine wichtige Sache, Kommissar Kreibig, melden Sie mich nur.»
Der Herr Professor trug einen schwarzen Gehrock, eine weiße Weste, aber sein langer Bart war eigentlich viel weißer als die Weste. Der Herr Professor war nervös. Er sagte, was man in solchen Situationen scheinbar immer sagt:
«Und was verschafft mir das Vergnügen?»
«Herr Professor», sagte Kommissar Kreibig, «warum haben Sie den Falotten erstochen?» (Falott ist ein plastischeres Wort für Lump.)
«Falott? Erstochen?», fragte der Professor.
«Haben S’ keine Angst, Herr Professor», sagte Kreibig gemütlich. «Es g’schieht Ihnen nichts. Es sind noch andere Leute da, die froh sind, dass der Kussmaul hin ist. Es ist so mehr ein Privattriumph von mir, denn der Tote hat mir ein Rätsel aufgegeben, und ich hab’s gelöst. Er hat nämlich ganz deutlich den Namen seines Mörders verraten.»
«So? Wie denn?»
«Würfelzucker in der einen Hand, den Schachkönig in der andern.»
«Und?»
«Und Schwarz hat die Erwiderung zum Kieseritzky-Gambit gespielt.»
«Verzeihen S’ schon, Herr Kommissar, aber ich hab wirklich keine Zeit …»
«Sie sind doch der Herr Professor Zuckertort, Spezialarzt für Diabetiker …»
«Ja, und …?»
«Sie haben im vorigen Jahrhundert einen Namensvetter gehabt, der war ein berühmter Schachspieler, der hat auch Zuckertort geheißen. Und Sie werden zugeben, dass der selige Kussmaul (fragt sich zwar noch, ob er selig ist) den Namen nicht besser hätte andeuten können. Der König, der Meister, dessen Name mit Zucker anfängt … Und jetzt sagen Sie mir, warum Sie ihn umgebracht haben. Ich hab keinen Verhaftbefehl, ich bin sicher, Sie sind im Recht gewesen, die Sache wird niedergeschlagen. Aber gönnen Sie mir den Privattriumph?»
«Warum ich das Schwein abgestochen hab? Warum?» Das Gesicht über dem weißen Bart wurde feuerrot. «Weil mir der Falott statt Insulin Brunnenwasser geliefert hat und weil mir zwei schwere Fälle fast an Sepsis zugrunde gegangen wären.»
«Ja so», sagte der Kommissar Kreibig, «Brunnenwasser statt Insulin …», und er empfahl sich.
Denn Insulin ist ja das einzige halbwegs sicher wirkende Mittel bei schweren Fällen von Zuckerkrankheit.
Vor dem Schild des Arztes blieb Kreibig noch einen Augenblick stehen, las es murmelnd für sich. Es stand da:
Prof. Dr. Regis Zuckertort
Spezialist für Stoffwechselkrankheiten
«Auch noch ‹Regis›, Genitiv von Rex, und im Gymnasium hab ich gelernt, dass Rex König heißt. Wirklich des Guten zu viel.»
Kommissar Kreibig zog kopfschüttelnd seine schadhaften Glacéhandschuhe an, trat auf die Straße und spannte seinen Regenschirm auf, weil es ganz sanft regnete. Er verschwand im Straßengetümmel, während ihm aus einem Fenster im ersten Stock ein weißbärtiger Herr nachsah, der vielleicht zum ersten Mal in seiner langen medizinischen Laufbahn es für nötig fand, über ein psychologisches Problem nachzugrübeln.
Der alte Zauberer
Von der Bahnstation bis zur Abzweigung, die nach Waiblikon führte, war die Straße noch asphaltiert, und Polizeikommissär Studer fluchte nicht allzu sehr, obwohl es vom Himmel schüttete und ein durchaus unangenehmer Herbstwind pfiff. Außer dem Wetter störte den Kommissär einzig die Rösti, die seine Frau ihm am Morgen vorgesetzt hatte. Denn auf die Rösti am Morgen hielt er, der Kommissär Studer. Sein Vater, der im Em mental Bauer gewesen war, hatte sie am Morgen gegessen, sein Großvater auch; warum sollte er eine Ausnahme machen? Aber dass man alt wurde, war eben eine Tatsache, die Verdauung funktionierte nicht mehr wie früher, man bekam Sodbrennen von der Rösti. Studer schob dies auf das schlechte Fett, das seine Frau wohl der Sparsamkeit wegen gebraucht hatte. Irgend so ein modernes Geschlarpf war wohl das Fett. Er trappte mit den dicken Sohlen durch die Pfützen, zog den Gummimantel enger an den Bauch. Nicht einmal rauchen konnte man bei diesem Wetter.