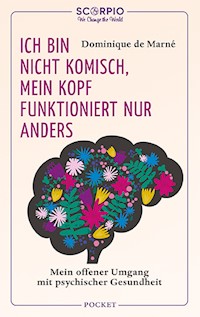
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Scorpio Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Wertlos! Sinnlos! - Gedanken, die durch den Kopf kreisen und kaum zu vertreiben sind. Bloß den Schein waren und sich nichts anmerken lassen! Die Betroffenen von psychischen Erkrankungen versuchen oft alles, um ihr Leiden vor den Liebsten, den Arbeitskollegen oder auch den Ärzten zu verheimlichen. Wohin das führen kann, hat Dominique de Marné am eigenen Leib zu spüren bekommen. Doch damit ist jetzt Schluss, denn die Autorin und stolze Betreiberin des ersten Mental-Health-Cafés in Deutschland redet heute offen über ihre eigenen Erfahrungen. Sie zeigt, dass es nicht schwer sein muss, über psychische Gesundheit zu sprechen und lädt alle ein, das Thema Mental Health aus der Tabuzone zu holen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dominique de Marné
ICH BIN NICHT KOMISCH, MEIN KOPF FUNKTIONIERT NUR ANDERS
Mein offener Umgangmit psychischer Gesundheit
Dieses Buch enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte der Scorpio Verlag keinen Einfluss hat. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Haftung übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft, rechtswidrige Inhalte waren nicht erkennbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Wichtiger Hinweis
Die Informationen und Ratschläge in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt von Autor und Verlag erarbeitet und geprüft. Alle Leserinnen und Leser sind jedoch aufgefordert, selbst zu entscheiden, ob und inwieweit sie die Anregungen in diesem Buch umsetzen wollen. Eine Haftung des Autors bzw. des Verlags für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
1. eBook-Ausgabe 2022
Vollständige Taschenbuchausgabe 2021
© 2019 der Originalausgabe »Warum normal sein gar nicht so normal ist«, Scorpio, ein Imprint der Europa Verlage GmbH, München
Logoentwurf: Hauptmann und Kompanie, Zürich
Umschlaggestaltung: Danai Afrati, München
Umschlagmotiv: © Adobe Stock / Nataliya
Satz: Danai Afrati
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95803-456-3
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.scorpio-verlag.de
INHALT
Prolog
EINLEITUNG
»Was hätte dir geholfen?«
I’m on a mission
Eine neue Art der Normalität
Gute Chancen
WIE KOMMT’S? »DEPRESSION UMSTÄNDEHALBER ABZUGEBEN«
Es liegt in der Familie
Unter diesen Umständen
Was für ein Ereignis
Die Psyche leistet Widerstand
Stress lass nach
Früher war alles besser?
Wer zählt?
WAS GIBT’S? EINE REISE INS DIAGNOSE-ABENTEUERLAND
Wie sortiert man psychische Probleme?
Gestörte Persönlichkeiten: Borderline & Co.
Darf’s noch etwas mehr sein? Formen der Abhängigkeit
Tschüss, Leben – hallo, Bleiumhang
Formen und Verwandte der Depression
Was es sonst noch gibt
Gute Diagnosen – böse Diagnosen?
Eine neue Klasse: das ICF
Reden ist besser als lesen
IST DAS NOCH KRANK ODER SCHON NORMAL?
Ich schaffe das …
… nicht
Aber das ist doch normal?
WAS HILFT? – »EINMAL DAS RUNDUMPROGRAMM, BITTE!«
Hamburg
Therapie für alle
Allerlei Helfer
Krisenwerkzeuge
PRÄVENTION!
WIE SAGEN? ÜBER DEN UMGANG MIT DEN UNSICHTBAREN KRANKHEITEN
Was sagen? Was tun?
Was nicht tun? Was nicht sagen?
Eigentlich ganz normal …
EIN PAAR WORTE AN …
… Betroffene
… Angehörige
… Mitschüler, Kollegen, Nachbarn, Lehrer, Trainer, Vorgesetzte
… Arbeitgeber
… Medienmacher
… Politiker
… Fachleute
… Ungläubige
… mich
HAPPY EVERYDAY TO ME!
Schlüssel der Veränderung
Dommi 2.0
Sag niemals nie
DANKE, BORDERLINE! MERCI, DEPRESSION! CHEERS, ABHÄNGIGKEIT
Meine Wünsche
EPILOG – 20 JAHRE SPÄTER
DANKE, EINFACH DANKE!
ZUM WEITERLESEN
PROLOG
Das Herz klopft, ich bin nervös, aufgeregt, angespannt, habe Angst, will mich unsichtbar machen. Ich stehe an der Kasse im Supermarkt. Auf dem Band neben mir liegen Knäckebrot, ein Joghurt, Kaugummis, eine Zeitschrift, Eistee und Red Bull. Und Prosecco. Und Bier. Aber das ist alles nur Alibi, nur Ablenkung. Eigentlich geht es mir um die zwei Flaschen Wodka, die auch auf dem Band liegen. Die mir zwei Tage lang zumindest ein wenig Ruhe und Sicherheit geben werden.
Ich bin dran. Bin extra freundlich, tue extra normal. Als wäre es nichts Außergewöhnliches, zwei Flaschen harten Alkohol zu kaufen. Unter der Woche. Mitten am Tag. Für mich ist es auch nicht außergewöhnlich, für mich ist es Alltag. Einpacken, bezahlen, nichts wie weg. Wieder ist es gut gegangen. Wieder hat mich niemand gesehen – denke und hoffe ich jedenfalls. Wieder hat mich niemand angesprochen, niemand erkannt, niemand versucht, mich abzuhalten.
Die Anspannung verfliegt, der Herzschlag normalisiert sich, die Aufregung ist vorbei. Jetzt beginnt der gute Teil. Zu Hause angekommen erwarten mich Entspannung, Belohnung, Ablenkung. Meine Welt wird leicht werden, das ununterbrochene Chaos in mir drin zumindest für eine Weile verschwinden. Der Schmerz wird für ein paar Stunden weniger werden, das Leben erträglicher. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Dass das alles nur kurz zutrifft, nur nach den ersten Schlucken, und dass es danach nur noch schlimmer, schmerzhafter und unerträglicher wird, weiß ich – aber ich tue es trotzdem.
Ich weiß auch, dass ich, während ich mich alleine zu Hause in meinem Zimmer betrinke, mir mit Kopfhörer bestimmte Lieder sehr laut und immer wieder anhören werde. Dass ich vielleicht versuchen werde zu schreiben. Den Dingen Namen zu geben. Und ich weiß, dass ich irgendwann eine Rasierklinge in der Hand halten werde, mit der ich mir immer wieder in den linken Unterarm schneiden werde.
Und ich weiß, dass ich dann irgendwann erschöpft einschlafen werde, um am nächsten Morgen immer noch erschöpft und mit Restalkohol im Blut versuchen werde, den vergangenen Abend anhand der umherliegenden Gegenstände zu rekapitulieren. Hauptsächlich um sicherzugehen, dass es keine Indizien dafür gibt, dass jemand etwas mitbekommen hat.
Nach diesem Routinecheck wird der erste Schluck nicht lange auf sich warten lassen. Ich werde meine Mischung für den ersten Teil des Tages ansetzen und zur Schule gehen.
EINLEITUNG
»Was hätte dir geholfen?«
Eine Frage, die mir oft gestellt wird, seit ich mich als psychisch krank geoutet habe. Eine Frage, die ich mir natürlich auch öfter selbst gestellt habe. Was hätte der 17-, 21-, 27-jährigen Version von mir geholfen, sich früher Hilfe zu suchen? Es nicht so lange allein zu versuchen? Nicht so lange ein Parallelleben zu führen?
Und inzwischen kenne ich die Antwort: Mir hätte es geholfen, wenn ich früher gewusst hätte, dass ich krank bin. Dass ich nicht nur einfach komisch, schwach, unfähig, dumm, anders bin, es im Gegensatz zu allen anderen nicht auf die Reihe bekomme. Dass es für so viele meiner Probleme eine Erklärung gibt, eine Diagnose, dass es anderen Menschen geht wie mir, dass ich nicht allein bin und vor allem: dass es eine Behandlung gibt. Dass es besser werden kann.
Das ist ein Grund, warum ich heute so offen über meine Erfahrungen spreche. Nicht weil meine Geschichte besonders schlimm oder außergewöhnlich ist. Sondern weil sie eigentlich gar nicht so außergewöhnlich ist. Weil viele Menschen, ob jung oder alt, viel zu lange, viel zu allein mit ihren Problemen sind. Weil sie im Zweifelsfall nicht wissen, dass sie krank sind.
Bei mir gingen »die Probleme« so um das Jahr 2002 herum los, als ich 15 oder 16 war. Mittlerweile weiß ich, dass es weder die Pubertät noch mein eigenes Unvermögen waren, die mein Leben, sagen wir mal, spannender machten, sondern eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Weil ich meine Diagnose aber erst 2013 erhielt, bedeutete dies, dass ich die zehn Jahre davor versucht hatte, selbst irgendwie damit klarzukommen.
Dabei hat mir für knapp 15 Jahre der Alkohol – oder wie ich ihn gerne nenne: Mr. A. – »geholfen«. Das hat er leider ganz schön gut gemacht, so dass sich zur Borderline bald auch noch eine Abhängigkeit gesellte. Trinken war mein Versuch, die Kontrolle über meinen Kopf zurückzubekommen. Doch auch das war nur eine Illusion, und ziemlich bald war es Mr. A., der mich und mein Leben kontrollierte. Es dauerte nicht lange, bis sich eine dicke, fette Depression entwickelte und sich den beiden anschloss. Und so hatte ich drei Begleiter bekommen, die mir noch lange Gesellschaft leisten würden.
Hätte mir in der Schule einmal jemand etwas über Depressionen & Co. erzählt, wäre ich vielleicht auf den Gedanken gekommen, mich zu informieren. Hat aber niemand, weswegen ich zehn Jahre meines Lebens verloren habe – und genau das möchte ich anderen ersparen. Zu verändern, wie wir über psychische Gesundheit reden, und zu bewirken, dass wir überhaupt darüber sprechen, ist mittlerweile so etwas wie meine Mission geworden.
Meine Mission und ich haben in Hamburg zueinander gefunden, wo ich 2014 eine zwölfwöchige stationäre Therapie gemacht habe. Dort habe ich zum ersten Mal erlebt, wie groß die Scham Betroffener sein kann. Welche Formen Stigmatisierung annehmen und welche Auswirkungen sie haben kann. Auch bei mir wusste lange niemand, wie schlecht es mir ging, wie viel ich trank, dass ich mich selbst verletzte, wie verzweifelt und kaputt ich war. Aber all die Zeit wusste ich nicht, dass ich krank bin.
I’m on a mission
Als ich mit 27 die Diagnosen bekam, bedeutete das für mich eine riesige Entlastung, eine unglaubliche Erleichterung. Es gab eine Erklärung für mein »Anderssein«. Es gab Bücher darüber, andere Menschen, denen es genauso ging wie mir. Und vor allem: Es gab Hilfe, Therapien, die Erfahrung, dass es anders, besser werden kann. Auch wenn es trotzdem noch eine gewisse Zeit dauerte, bis ich mein »Coming-out« hatte und offen mit meinen Problemen und Krankheiten umgehen konnte.
Dort aber, in Hamburg, saßen nun Menschen, die seit Jahren wussten, welche Krankheiten ihnen das Leben zur Hölle machten. Und trotzdem taten sie alles Erdenkliche, damit niemand in ihrem Umfeld etwas davon mitbekam. »Aber du hast dir das doch nicht ausgesucht? Es ist eine Erkrankung! Genau wie Krebs oder Diabetes. Darüber würdest du doch auch offen sprechen, dich nicht schämen!«, war die Reaktion. Ich konnte nicht glauben, es nicht fassen, dass sie das anstrengende, Kräfte zehrende Versteckspiel, welches ich auch so lange gespielt hatte, einem offenen Umgang damit vorzogen, weil die Angst vor den Reaktionen der Umwelt so enorm war.
An genau dieser Stelle beschloss ich, dass sich etwas ändern muss. Dass ich etwas verändern möchte. Wenige Monate später ging mein Blog Traveling | the | Borderline online, auf dem ich über meine Erfahrungen, meine Fortschritte, meine Rückschläge und meine Arbeit schreibe.
Dass ich – sozusagen nebenbei – ein Studium in Kommunikationswissenschaft und Psychologie abgeschlossen habe, schadet meiner Mission natürlich nicht besonders – eher im Gegenteil.
Nach und nach sind aus dem Blog mehr und mehr Projekte und Kooperationen entstanden. Mittlerweile halte ich Vorträge, gehe in Schulen und zur Polizei, um aufzuklären, bin national und europaweit vernetzt. Und nun dieses Buch, mit dem ich all das, was mir so wichtig ist, was ich in den letzten Jahren gelernt und erlebt habe, an einer Stelle bündeln darf.
Meine Therapeutin, die mich seit 2013 begleitet, sagte einmal, noch recht zu Beginn unserer Zusammenarbeit, zu mir: »Frau de Marné, Sie stecken so viel Kraft in den Versuch, allen zu zeigen, vorzuspielen, dass es Ihnen gut geht, damit bloß keiner merkt, dass bei Ihnen etwas nicht stimmt. Wenn Sie all diese Kraft einmal in etwas anderes investieren, dann können Sie die Welt verändern.« Und nun, knapp fünf Jahre später, sitze ich hier und verändere die Welt. Stück für Stück, Wort für Wort. Denn es muss sich etwas ändern.
Eine neue Art der Normalität
An unserer Auffassung, unserem Umgang mit »normal« muss sich etwas ändern. Dieses Wort hat einen enorm großen Einfluss auf uns. Es sorgt dafür, dass wir uns mitunter nach Regeln richten, die nicht zu uns passen. Einerseits wollen wir normal sein, dazugehören, sozial nicht ausgeschlossen werden, mitreden können. Andererseits wollen wir auffallen, einzigartig sein, unverwechselbar. Individualität wird nicht nur in den sozialen Medien groß geschrieben.
Der Duden definiert normal als
1.der Norm entsprechend, vorschriftsmäßig,
2.so beschaffen, geartet, wie es sich die allgemeine Meinung als das Übliche, Richtige vorstellt.
Was in dieser Definition nicht drinsteht, ist, dass es so viele Ausprägungen dieser Begriffe wie Menschen auf der Erde gibt. Wir alle befinden uns an irgendeinem Punkt auf Skalen, die uns nach verschiedensten Merkmalen und Eigenschaften unterscheiden. Je nachdem, welche Eigenschaften wie gemessen werden, landen wir aber womöglich ganz woanders auf der Skala. Meist sind uns die Breiten, die verschiedenen Ausprägungen auf diesen Skalen gar nicht so bewusst. Aber wir gehen quasi automatisch davon aus, dass auch der Rest der Welt sich in einer ähnlichen Umgebung auf der Skala befindet.
Und ja, für einige Eigenschaften gilt auch etwas, das sich Normalverteilung nennt. Die meisten Menschen landen dabei irgendwo in der Mitte, die wenigsten an den Rändern. Dabei werden aber im Allgemeinen nur einzelne Eigenschaften betrachtet. Würde man nun alles, was uns Menschen ausmacht, kombinieren, zusammenwerfen und neu auswerten, sähe das Ergebnis wohl anders aus. Dann mischt sich eine wunderbare Sache namens Individualität ein, und am Ende landen wohl niemals zwei Menschen in allen Punkten am Ende auf der gleichen Stelle. Und das ist auch gut so. Selbst Zwillinge machen unterschiedliche Erfahrungen und haben somit vielleicht identische Körper, aber noch lange keine identischen Leben.
Wie verschieden normal sein kann, sieht man schon bei Dingen wie Nahrung, sauberem Wasser, Wohnen – was für uns in Europa »normal« ist, ist für Menschen auf anderen Kontinenten unvorstellbar, luxuriös oder auch kurios. Besuchen wir eine japanische Familie zu Hause, erleben wir ein ganz anderes »Normal« als bei einem Besuch unserer Verwandten im Schwarzwald.
Und genau wie für viele andere Merkmale gilt dieses breite Spektrum auch für unseren Charakter, unser Wesen, unsere Bedürfnisse und Meinungen – kurz: für unsere Psyche. Empfinden wir etwas als unnormal oder ungewöhnlich, so erweckt dies oft im ersten Moment Angst, Unsicherheit und somit eine abwehrende Haltung. Wir bleiben lieber beim Gewohnten und schieben Unbekanntes gerne erstmal beiseite.
Wir brauchen Hilfe, wenn wir etwas verstehen wollen, was für uns noch nicht normal ist. Wir brauchen jemanden, der es uns erklärt, damit wir es auf unseren Skalen einordnen, in unser Spektrum einsortieren können. Dies gilt besonders für Dinge, die wir nicht sehen, nicht physisch greifen können – wie eben psychische Krankheiten.
Ich glaube, dass kaum ein Mensch einen anderen absichtlich stigmatisiert, sondern dass fast immer Hilflosigkeit, Unsicherheit und Unwissen dahinterstecken. Es braucht jemanden, der dabei hilft, die Sache greifbar zu machen, indem er von seinen Erfahrungen erzählt, sein Wissen weitergibt. Und dann merken wir, dass wir mehr mit dem Thema zu tun haben, als uns anfangs vielleicht klar war. Oder wir sehen endlich, dass wir nicht so allein sind, wie wir lange dachten. Dass auch andere Menschen auf der »Normal-Skala« in ähnlichen Bereichen unterwegs sind wie wir.
Psychisch krank zu sein ist normaler, als wir denken. Und normal zu sein ist unnormaler, als wir es erwarten. Ein paar Fakten dazu:
Jeder dritte Deutsche hat mindestens einmal im Leben ein behandlungsbedürftiges psychisches Problem.
Mehr als 10 000 Menschen nehmen sich jedes Jahr in Deutschland das Leben – das bedeutet alle 53 Minuten ein Suizid.
Experten gehen davon aus, dass etwa alle 5 Minuten jemand versucht, sich das Leben zu nehmen.
Selbstmord steht auf Platz 2 der häufigsten Todesursachen in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen.
Der allgegenwärtige Konsum von Alkohol bringt dem Staat 3 Milliarden an Steuereinnahmen – die Folgen des Konsums kosten die Volkswirtschaft allerdings 40 Milliarden.
Jeder dritte Notarzteinsatz hat mit psychischen Krankheiten zu tun.
Psychische und Verhaltensstörungen sind nach Erkrankungen des Kreislaufsystems die teuerste Krankheitsklasse.
Etwa 80 Millionen Tage fehlen Arbeitnehmer aufgrund von psychischen Erkrankungen – damit sind sie die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit.
Mit diesen Zahlen will ich keine Angst einflößen, sondern vielmehr verständlich machen, wie groß das Problem ist, von dem wir hier reden.
Allein 5 Prozent der Menschen in Deutschland leiden an einer Major Depression, also einer schweren Depression. Das sind vier Millionen Menschen! 4 000 000. Für die gibt es aber kaum eine Lobby, keine regelmäßigen Spendensammlungen.
Nur mal zum Vergleich: Pro Jahr erkranken etwa 1800 Kinder in Deutschland an Krebs. Und jetzt bitte die Hand heben, wer noch nie an einem Stand vorbeigelaufen ist, an dem man für die kleinen Patienten spenden konnte. Oder der noch nie von jemandem gehört hat, der für krebskranke Kinder sammelt.
Ich muss es eigentlich nicht sagen, tue es aber trotzdem: Ja, der Vergleich ist vielleicht makaber. Und ja, ich finde Krebs auch unfassbar schlimm, nicht nur bei Kindern. Immerhin ist mein eigener Vater auch daran verstorben. Ich möchte nur verdeutlichen, wie absurd der Umgang mit psychischen Krankheiten in unserer Gesellschaft ist.
Gute Chancen
Weltweit sieht die Sache nicht viel besser aus. Die WHO spricht von 322 Millionen Menschen mit Depression. Und auch hier zum Vergleich: 35 Millionen Menschen leben mit Krebs. Insgesamt liegt Deutschland im Mittelfeld, wenn es um die Psyche geht, ob Depressionen oder Suizid. Es gibt keinen Beruf, keine Stadt, keinen Schulabschluss und auch keinen Kontostand, die uns helfen, von psychischen Problemen verschont zu bleiben. So sind auch bei den Ländern mit den höchsten Suizidraten sowohl Entwicklungs- als auch Schwellen- und Industrieländer vertreten. Es ist lediglich festzustellen, dass asiatische und osteuropäische Länder die Spitzenpositionen belegen.
Wenn es um die Häufigkeit von Krankheiten geht, so hört man immer wieder das Wort Prävalenz. Das ist nichts anderes als ein Fachbegriff für Krankheitshäufigkeit. Oder um es mit Wikipedia zu sagen: Prävalenz sagt aus, welcher Anteil der Menschen einer bestimmten Gruppe definierter Größe zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Krankheit erkrankt ist oder einen Risikofaktor aufweist. Einfacher gesagt: Hohe Prävalenz heißt »Die Chancen stehen gut«. In diesem Fall die Chance dafür, mindestens einmal im Leben selbst betroffen zu sein.
Ob direkt oder indirekt betroffen, all die Menschen hinter den genannten Zahlen haben Angehörige, sie haben Väter, Mütter, Söhne, Töchter, Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, Neffen, Nichten, Enkel, Großeltern, Freunde, Partner, Kollegen, Kameraden, Bekannte, Lehrer, Mitschüler, Vorgesetzte und Nachbarn. Es ist also kein besonderes Mathetalent vonnöten, um zu erkennen, dass die Chancen ziemlich gut stehen, selbst irgendwann mit dem Thema in Berührung zu kommen.
Wir wissen, dass unser Körper anfällig und nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Also kümmern wir uns um ihn. Wir gehen zur Vorsorge und zu Routine-Check-ups, putzen uns die Zähne, bewegen uns, achten darauf, nicht zu viel Butter aufs Brot zu schmieren, ernähren uns vegan oder auch nicht. Praktisch für jeden Teil unseres Körpers wissen wir, was richtig ist und wie wir auf ihn aufpassen können. (Was noch lange nicht heißt, dass wir uns genügend kümmern. Aber zumindest wissen wir theoretisch, was richtig beziehungsweise gesund wäre.)
Und auch um die Dinge in unserer Umgebung kümmern wir uns. Wir schützen unsere Smartphones mit Folien aus Diamantglas, gönnen dem Auto regelmäßig einen Besuch in der Werkstatt, und der Wasserkocher wird alle paar Wochen entkalkt. Und wenn wir etwas nicht allein können, dann suchen wir uns Hilfe. Wir wenden uns an einen Profi, der sich damit auskennt, ob es um unser Handy, unser Auto, unsere Waschmaschine geht oder darum, etwas Neues zu lernen oder in irgendeinem Bereich besser zu werden. Bei solchen Dingen einen Profi zu konsultieren, ist absolut »normal«.
Das alles wird ein bisschen anders, wenn es um das Innere unseres Kopfes geht. Da denken wir auf einmal, dass dieser alles ganz allein hinbekommt. Dass er weder Schutz, Pflege noch einen Fachmann braucht.
Wir gehen nicht zur Depressions-Vorsorge, zur Abhängigkeits-Früherkennung oder zur Gedanken-Spiegelung. Wir muten unseren Köpfen Dauerbeschallung, Stress, konstante Smartphone-Nutzung zu, gönnen ihm aber kaum Ruhe. Im Zweifel kürzen wir bei unserer eigenen Energie, beim Schlaf, bei Erholung – das Hirn wird es schon aushalten.
Kein ernstzunehmender Profi, auf welchem Gebiet auch immer, ist ganz allein zu dem geworden, was er ist. Ob Spitzensportler, Geigenvirtuose oder CEO – hinter ihm (oder besser: um ihn herum) stehen Trainer, Lehrer, Coaches und Therapeuten. Aber wir denken weiterhin, dass wir das alles schon allein hinbekommen. Und auch unsere Helden in Film und Fernsehen sind nur in den seltensten Fällen absolute Einzelkämpfer, die ohne Unterstützung von Profis durch ihre Geschichte kommen.
Ich schließe mich selbst nicht aus. Wie lange habe ich nach dem Motto gelebt: »Ich schaffe das allein! Ich bekomme das hin! Ich brauche keine Hilfe!« Genauso war es, und ich habe dadurch wertvolle Lebenszeit verloren. Und so geht es Tag für Tag vielen anderen Menschen.
Aber wir können daran etwas ändern. Wir zusammen, und auch jeder für sich. Indem wir das Thema Mental Health aus der Tabuecke herausholen. Wir können mit dem Thema »normal« umgehen und aufhören, dem Innenleben unseres Kopfes eine Sonderbehandlung zuteilwerden zu lassen.
Wenn sich an unserem Umgang etwas ändert, so tun wir nicht nur etwas für unsere eigene Gesundheit und die von den Menschen um uns herum. Wir verhindern Leid, retten Leben, sparen Geld, entlasten Einzelne und das System. Und das alles einfach nur, indem wir reden.
Und genau das will ich mit diesem Buch, mit meiner Geschichte erreichen: dass wir anfangen zu reden. Denn das hätte mir geholfen.
WIE KOMMT’S? – »DEPRESSION UMSTÄNDEHALBER ABZUGEBEN«
Nun wissen Sie, liebe Leser, also, wer hinter diesem Buch steckt und warum es sozusagen geschrieben werden musste. Was nun folgt, ist eine – soweit möglich – chronologisch angeordnete Reise durch unsere Köpfe. Und ganz besonders durch meinen.
Angefangen beim Ursprung, den Gründen und Auslösern für eine psychische Erkrankung über die verschiedenen Diagnosen, dem Unterschied zwischen »krank« und »gesund« weiter zu Therapien und dem richtigen Umgang. Als roter Faden, sozusagen als Reiseführer, wird meine eigene Geschichte dienen, anhand derer ich die verschiedenen Stationen erläutere.
Zum Einstieg widmen wir uns also der Frage (eigentlich sind es drei Fragen): Wer wird wann und warum psychisch krank? Nun, kurz gesagt: Es ist kompliziert, es gibt keine eindeutige Antwort. In der Fachsprache wird das als multifaktoriell bezeichnet. Es bedeutet schlicht, dass es mehrere Komponenten gibt, die einen Einfluss darauf haben, wer – ob – wann – wie krank wird. Das gilt für den Kopf ebenso wie für den Körper.
Es gibt nicht das eine Gen, den einen falschen Satz der Eltern, den einen Tag, das eine Ereignis, die eine Fernsehsendung, die krank machen, sondern es ist eine Kombination aus allen. Immerhin weiß man heute, dass es drei Hauptfaktoren gibt, die das Ganze beeinflussen: die Gene, das Umfeld und das Leben an sich.
Es liegt in der Familie
Fangen wir mit den Genen an, denn damit fängt ja auch das Leben an. Wir bekommen von unseren Eltern diese Grundausstattung mit auf den Weg, und so wie in manchen Familien gewisse Krebsarten oder Diabetes gehäuft vorkommen oder mehr Schlaganfälle auftreten als in anderen Familien, so gibt es auch für psychische Krankheiten eine genetische Veranlagung. Profis sprechen hier von Disposition oder Prädisposition.
Egal, welchen Begriff man dafür verwendet, es bedeutet das Gleiche: Manche von uns haben mehr Glück in der genetischen Lotterie gehabt als andere. Wenn ich bei meinen Schulprojekten vor der Klasse stehe und den Zusammenhang zwischen Genen und psychischen Krankheiten erklären möchte, dann klingt das meistens so:
Der eine hat von Geburt an quasi in Übergröße DEPRESSION auf seine Gene geschrieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ihn erwischen wird, ist also recht groß – wenn man nur die Gene berücksichtigt. Da er aber in einem tollen Umfeld aufwächst und das Leben es generell eher gut mit ihm meint, hat diese Depression keine Chance auszubrechen.
Der andere hat auf seinen Genen nur ganz klein Depression stehen, hat also eigentlich gute Chancen, ungeschoren davonzukommen. Leider wächst er jedoch in einem Umfeld auf, das ihm nicht wohlgesonnen ist, und auch das Leben legt ihm einige Steine in den Weg. Die genetisch bedingte kleine Depression hat unter diesen Umständen gute Chancen, ihm das Leben (zusätzlich) schwer zu machen.
Das ist sehr vereinfacht dargestellt und soll nur verdeutlichen, wie kompliziert die Zusammenhänge sind. Noch ist es der Wissenschaft nicht gelungen, eindeutig alle jene Gene zu bestimmen, die einen Einfluss darauf haben, wen welche psychische Krankheit treffen wird. Ob das eines Tages gelingen wird und welchen Einfluss dies auf Prävention, Verlauf und Behandlung haben wird, bleibt abzuwarten.
Die eigene Veranlagung zu kennen, die einzelnen Puzzleteile auszumachen, die bei einem vorliegen und die auf die eigene Biografie einen Einfluss hatten, kann genauso hilfreich sein wie die Suche im Äußeren. Und so habe auch ich in meiner Therapie nach und nach einige Puzzleteile gefunden, die mir zumindest teilweise erklären konnten, warum und wieso es bei mir so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Auch bei mir liegt der Anfang in den Genen. Heute weiß ich, dass es in meiner Familie Fälle von Depression und Spielsucht gab. Das erste Puzzleteil.
Unter diesen Umständen
Auch über die Gene hinaus hat die Familie einen großen Einfluss darauf, wie wir uns entwickeln. Auf körperlicher Ebene, aber auch auf geistiger. Werden unsere Bedürfnisse ernst- und wahrgenommen und befriedigt, schon in den ersten Lebensmonaten? Und auch bereits davor? Schon in den neun Monaten vor unserer Geburt werden entscheidende Weichen gestellt.
Sind Mutter und Kind ausreichend mit Nährstoffen versorgt? Gibt es Faktoren, die Stress verursachen und sich hormonell auf die werdende Mutter auswirken? Die Liste an Dingen, die uns quasi von der ersten Sekunde an beeinflussen, ist schier endlos: Krieg, Hunger, Flucht, Nährstoffmangel, Alkohol, Stress, Umwelteinflüsse.
Sind wir schließlich auf der Welt, wird unser Erleben von unzähligen Faktoren beeinflusst, die auf allerlei Ebenen auf uns einwirken, vor allem von den Erfahrungen, die wir mit anderen Menschen machen. Wie wird mit uns und miteinander umgegangen? Gibt es viel Verständnis, Zuneigung, Stabilität, Vertrauen, oder ist das Zusammenleben eher geprägt von Misstrauen, Abwertung, Instabilität und Unsicherheit? Werden wir, unsere Empfindungen und Gedanken ernst genommen und verstanden? Wird uns das Gefühl gegeben, geliebt, gebraucht, geschätzt, wahrgenommen und wertvoll zu sein? Oder wird uns das Gefühl gegeben, falsch, wertlos, schwach, unnütz zu sein? Dies muss nicht allein auf verbaler Ebene, also über Worte, geschehen. Viel mehr findet auf der Ebene des Verhaltens statt.
Besonders in den ersten drei Lebensjahren werden so manche Dinge »entschieden«, die uns dann ein Leben lang beeinflussen, dazu gehören unter anderem unser Selbstwert, unser Beziehungsverhalten und unser Vertrauen.
Das Umfeld besteht (zum Glück) aus mehr als nur der Familie. Wichtige – im positiven wie im negativen Sinne – Bezugspersonen können auch aus der Umgebung außerhalb des Familienkreises kommen. Die Nachbarin, die dem Kind die Aufmerksamkeit geben kann, die es zu Hause nicht bekommt; der Lehrer, der dem Kind etwas zutraut, ihm zeigt, dass es etwas erreichen kann – aber auch der Onkel, der das Kind missbraucht. So kann manches familiäre Defizit von einem validierenden Umfeld ausgeglichen werden, von einem invalidierenden allerdings auch beschädigt werden. Validieren bedeutet, frei gesprochen, dass man uns und unsere Bedürfnisse und Gedanken versteht und ernst nimmt – oder nicht.
Und wir gehen noch einen Schritt weiter, denn auch wie und wo und wann wir aufwachsen, hat einen großen Einfluss darauf, wie es uns geht. Dabei müssen die Zusammenhänge nicht immer so einfach sein, wie sie zunächst scheinen: Ein Flüchtlingskind, das in einem provisorischen Lager aufwächst, kann unter Umständen glücklicher ins Leben starten als das Kind wohlhabender Eltern, die kaum Zeit, aber dafür jede Menge Erwartungen und Ansprüche an ihren Nachwuchs stellen. Während das Kind im Flüchtlingslager – vereinfacht dargestellt – umgeben von Gleichaltrigen aufwächst und lernt, mit wenig glücklich zu sein, leidet das andere Kind möglicherweise an mangelndem Selbstwert und emotionaler Verwahrlosung.
Ich bin 1986 geboren, im Jahr des Atomreaktorunfalls von Tschernobyl. Ob das irgendetwas mit meinem Erleben zu tun hat, kann ich nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass der plötzliche Tod meines Onkels wenige Wochen vor meiner Geburt einen Einfluss auf mich beziehungsweise vor allem auf meine Mutter hatte. Innerhalb weniger Wochen hatte sie einen geliebten, wichtigen Menschen verloren und einen neuen dazubekommen. Wie schwierig das gewesen sein muss, kann ich mir nicht vorstellen. Dass solch eine Situation einen Menschen überfordert, kann ich mir jedoch vorstellen. Ein zweites Puzzleteil, das mit dem dritten im engen Zusammenhang steht.
Denn noch bevor ich meinen ersten Geburtstag feiern durfte, habe ich angefangen, Ohnmachtsanfälle zu bekommen. Einfach so, von jetzt auf gleich war ich wie ausgeschaltet. Keine Bewegung, kein Mucks – als hätte mich jemand ausgeknipst. Meine Eltern waren natürlich alarmiert, besorgt, und ab ging es zum Arzt. Und dann zum nächsten. Es wurde untersucht und versucht herauszufinden, was mit mir los sein könnte. Zwischenzeitlich gingen die Anfälle munter weiter.
Nachdem so gut wie alles untersucht worden war, was man untersuchen konnte, von Epilepsie bis zum Herzen, erhielten meine Eltern schließlich vom Arzt die Aussage: »Ihr Kind macht das mit Absicht. Es möchte Sie manipulieren. Lassen Sie sich das nicht gefallen.«
Heutzutage würde das so – hoffentlich – nicht nochmal passieren. Heute sind Ärzte aber auch weniger Halbgötter in Weiß, als sie es damals waren; das medizinische Wissen ist auch in der Allgemeinbevölkerung größer, es gibt das Internet, Google, Foren. Aber damals eben nicht. Und so blieb meinen Eltern quasi nichts übrig, als der Aussage des Mediziners Glauben zu schenken.
Und so war es irgendwann nichts Besonderes mehr, wenn ich meine Anfälle hatte. Ich wurde dann quasi aufs Bett geworfen, und man wartete ab, bis ich wieder zu mir kommen würde. Und es ging ziemlich lange so. Bis kurz vor meiner Einschulung war das beinahe unser tägliches Programm. Und wohl am entscheidendsten war die Tatsache, dass mir mehr oder weniger direkt vermittelt wurde, dass ich das »Arschlochkind« sei, das alle manipulieren und kontrollieren wollte. Ich bekam indirekt die Schuld daran, dass meine Brüder kein normales, gesundes Verhältnis zu mir aufbauen konnten.
Und diese Sichtweise habe ich natürlich übernommen – was blieb mir auch anderes übrig. Erst Jahre später in meiner Therapie habe ich gelernt, dass Boshaftigkeit nur eine Möglichkeit ist, mein Verhalten zu erklären. Die andere lautet: Überlebensstrategie. Das erkläre ich am besten mit den Worten meiner Therapeutin: »Frau de Marné, glauben Sie nicht, dass, wenn ein kleines Bündel Mensch, noch kein Jahr alt, keine andere Möglichkeit sieht, als sich komplett auszuschalten, dass da vielleicht eine ganz schön große Notsituation vorhanden gewesen sein könnte?« So hatte ich das noch nicht gesehen. Ergibt aber irgendwie Sinn.
Heute glaube ich, dass die schwierige Situation meiner Mutter während meiner Geburt dazu geführt hat, dass ich in den ersten Monaten meines Lebens manche Dinge, die ich dringend gebraucht hätte, nicht bekommen habe – auf emotionaler Ebene. Ich gebe meinen Eltern keine Schuld, sondern bin mir sicher, dass sie damals das in ihren Augen Bestmögliche getan und gegeben haben. Dass sie mir nicht schaden wollten. Auch aus den Gesprächen mit anderen Müttern weiß ich inzwischen, dass »das Beste« manchmal von außen sehr komisch aussehen kann, während es sich nach innen hin ganz anders anfühlt.
Was folgte, war eigentlich eine ziemlich normale Kindheit, mit Familienleben, Ausflügen, Dänemark-Urlauben, die in liebevoll geführten Fotoalben festgehalten wurden. Mit dem heutigen Wissen schaut man natürlich auch auf diese Zeiten mit einem anderen Blick. Mir fallen Dinge auf, die früher nicht weiter von Bedeutung waren, die ich heute als erste Ausläufer meiner Krankheit erkenne. Da wäre zum einen, dass ich schon immer dazu tendiert habe, etwas entweder zu lieben oder zu hassen. Da gab es wenig dazwischen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist typisch für die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Auch vom Gefühl, nie wirklich dazuzugehören, egal, wie beliebt man ist, berichten viele Betroffene. Als ob eine Glaswand zwischen mir und den anderen Kindern und generell anderen Menschen ist.
Was für ein Ereignis
Wir kommen also mit unseren Genen auf die Welt und haben ein spezifisches Umfeld. Aber ganz unabhängig davon macht das Leben mit uns, was es will. Das Leben und die Überraschungen, die schönen und die weniger schönen, die es für uns bereit hält, sind der dritte Faktor, der darüber bestimmt, wer und ob und wann jemand krank wird. Die Grenzen zwischen der »Umfeldkategorie« und dieser Kategorie sind teilweise fließend. Hierzu gehören prägende Lebensereignisse wie der Tod eines Angehörigen, Missbrauch, Krankheit, Unfälle, aber auch Umzüge, Mobbing sowie Umweltkatastrophen, Krieg und Flucht – wobei wir wieder beim Umfeld wären.
Es gibt auch objektiv schöne Dinge wie Heirat, die Geburt eines Kindes oder eine Beförderung, die das Leben auf den Kopf stellen können. Allen diesen Ereignissen ist gemein, dass sie uns aus der Balance werfen können. Auch wenn wir nicht hundertprozentig zufrieden sind, so arrangieren wir uns doch meistens mit dem, was ist, und lernen, damit umzugehen. Passiert nun etwas Einschneidendes, ob gut oder schlecht sei erstmal dahingestellt – so können die Dinge ins Wanken geraten. Und wir merken, dass unsere Strategien vielleicht nicht ganz so gut waren, wie wir gedacht oder gehofft hätten.
Oft sind es Ereignisse im beschriebenen Umfang, die eine akute psychische Krise auslösen. Es kann aber auch sein, dass dahinter ein schleichender Prozess steckt, dass sich die Depression über Jahre »anschleicht«, die Essstörung über Monate hin Anlauf nimmt und den passenden Moment »abwartet«, um uns dann aus der Bahn zu werfen und die Kontrolle zu übernehmen. Wenn wir schwach, ausgelaugt, gestresst sind, so haben es nicht nur Keime leichter, in unser Immunsystem einzudringen. Sondern auch psychischen Krankheiten wird weniger Widerstand entgegengesetzt, wenn sie sich in unserem Kopf einnisten.
Mein eigenes nächstes größeres Puzzleteil ereignete sich zu Beginn meiner Pubertät, als mein Vater eine Krebsdiagnose erhalten hat. Die Auskunft der Ärzte damals lautete, dass Patienten mit dieser Art Tumor selten länger als ein Jahr überlebten. Mein Vater blieb noch acht Jahre bei uns. 2006 ist er schließlich auf der Palliativstation eines großen Münchner Krankenhauses verstorben.
Während dieser Zeit hat der Krebs unser Leben natürlich ununterbrochen beeinflusst. Es gab gute, bessere und schlechte Phasen. Es gab zahlreiche Operationen, Klinik- und Reha-Aufenthalte. Nach einer dieser Operationen, die gut verlaufen war, flogen meine Eltern zwei Wochen lang in den Urlaub. Und was macht man als pubertierende Jugendliche, wenn die Eltern aus dem Haus sind? Richtig: Man schmeißt eine Party.
Auf diese Party kamen neben Freunden von mir und meinem Bruder auch Freunde dieser Freunde. Und einer dieser Freundesfreunde hat die »Gelegenheit« genutzt und mich vergewaltigt. In meinem Zuhause, in meinem eigenen Zimmer, in meinem eigenen Bett. Tata – das nächste Puzzleteil. Das war dann auch das Puzzleteil, um meine psychischen Probleme so richtig in Gang zu bringen.
Mit das Schlimmste damals für mich war, meinen Eltern erzählen zu müssen, was passiert ist. Ich wollte vor allem meiner Mutter nicht noch mehr Sorgen machen, als sie sowieso schon hatte. Am liebsten wäre mir gewesen, wenn es für immer ein Geheimnis geblieben wäre. Aber da ich am Tag nach der Party mit unserer Nachbarin ins Krankenhaus gefahren bin, um untersucht zu werden, war die Verschweige-Variante ausgeschlossen.
Als meine Eltern dann zurück waren, lief es nicht so, wie wir uns das vorher überlegt hatten, sondern meine Mutter fand ungeplant einen Brief der Klinik in der Post und wollte natürlich wissen, was es damit auf sich hat. Ab diesem Zeitpunkt versuchte ich, mein Umfeld davon zu überzeugen, dass ich den Vorfall locker weggesteckt habe. Was natürlich nicht der Fall war.
Und ich war nicht nur fest entschlossen, mit niemandem darüber zu reden. Sondern auch, das Thema mir selbst gegenüber zu ignorieren. Ich wollte nicht daran denken, nicht nachfühlen müssen, was passiert war. Und weil ich so überzeugt von dieser Variante war, hat sich wohl auch kaum jemand getraut, einmal nachzufragen. Flashbacks gab es natürlich trotzdem. Die Angst, ihm zufällig auf der Straße zu begegnen – München ist ja bekanntlich ein Dorf. Bis heute zucke ich zusammen, wenn die drei Buchstaben, die seinen Namen ergeben, irgendwo auftauchen.





























