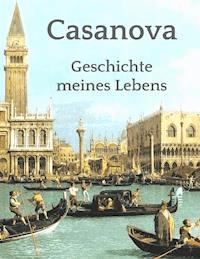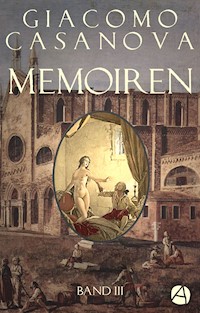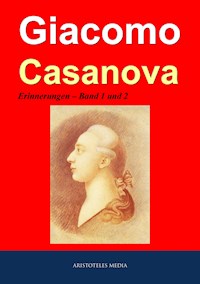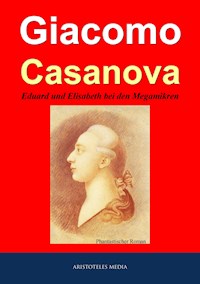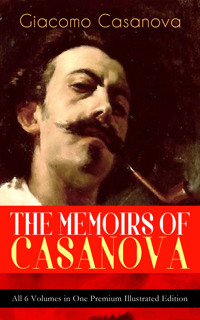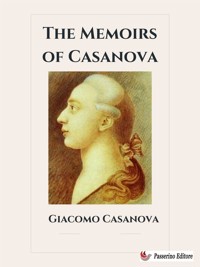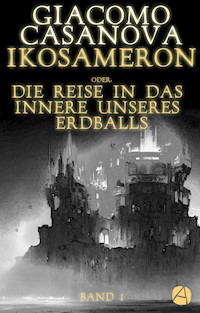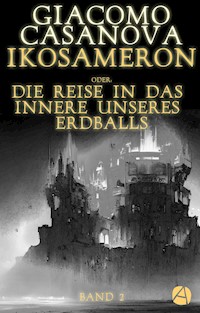3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Schöne Frauen sind für einen Mann genauso notwendig wie gutes Essen. Und wenn man auch mit einer Speise satt werden kann, so wünscht man sich doch verschiedene Formen.“ Europa im 18. Jahrhundert – eine schillernde und prächtige Zeit, in der ein junger Mann heranwächst, der zum Inbegriff des schamlosen Verführers werden soll. Als Sohn zweier Schauspieler wird Giacomo Casanova von seiner Großmutter in Venedig großgezogen. Früh zeigt sich, dass er alles lernen will, was Vergnügen bereitet. Als er alt genug ist, studiert der liebeshungrige junge Mann in Padua … und verbringt die Nächte in den Betten anmutiger Damen. Doch Italien ist ihm bald nicht mehr genug, er möchte die ganze Welt entdecken! Paris, London, Madrid: in jeder Stadt erobert Casanova die erlesensten Frauen und erlebt tabulose Abenteuer – immer auf der Suche nach pikanten Eroberungen, die seinen Ruf unsterblich machen … Die aufregendsten Erinnerungen des berühmtesten Liebhabers aller Zeiten: Lassen Sie sich verwöhnen und inspirieren! Jugendschutzhinweis: Im realen Leben dürfen Erotik und sexuelle Handlungen jeder Art ausschließlich zwischen gleichberechtigten Partnern im gegenseitigen Einvernehmen stattfinden. In diesem eBook werden fiktive erotische Phantasien geschildert, die in einigen Fällen weder den allgemeinen Moralvorstellungen noch den Gesetzen der Realität folgen. Der Inhalt dieses eBooks ist daher für Minderjährige nicht geeignet und das Lesen nur gestattet, wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch:
„Schöne Frauen sind für einen Mann genauso notwendig wie gutes Essen. Und wenn man auch mit einer Speise satt werden kann, so wünscht man sich doch verschiedene Formen.“
Europa im 18. Jahrhundert – eine schillernde und prächtige Zeit, in der ein junger Mann heranwächst, der zum Inbegriff des schamlosen Verführers werden soll. Als Sohn zweier Schauspieler wird Giacomo Casanova von seiner Großmutter in Venedig großgezogen. Früh zeigt sich, dass er alles lernen will, was Vergnügen bereitet. Als er alt genug ist, studiert der liebeshungrige junge Mann in Padua … und verbringt die Nächte in den Betten anmutiger Damen. Doch Italien ist ihm bald nicht mehr genug, er möchte die ganze Welt entdecken! Paris, London, Madrid: in jeder Stadt erobert Casanova die erlesensten Frauen und erlebt tabulose Abenteuer – immer auf der Suche nach pikanten Eroberungen, die seinen Ruf unsterblich machen …
Die aufregendsten Erinnerungen des berühmtesten Liebhabers aller Zeiten: Lassen Sie sich verwöhnen und inspirieren!
Über den Autor:
Giacomo Girolamo Casanova wurde 1725 als Kind einer Schauspielerin in Venedig geboren. Mit 17 Jahren erwarb er den Titel eines Doktors beider Rechte. Auf seinen zahlreichen Reisen durch die großen Metropolen Europas verdiente er seinen Lebensunterhalt als Gesandter, Alchemist, Glücksspieler und sogar als Geheimagent. In seinen weltbekannten Memoiren berichtet er von europäischen Höfen und Adeligen, von bedeutenden Personen seiner Zeit – und natürlich von Frauen: Innerhalb von 40 Jahren soll er 120 Liebesaffären gehabt haben. Casanova starb im Jahr 1798.
***
eBook-Lizenzausgabe 2016
Titel der Originalausgabe: Memoiren aus meinem Liebesleben
Copyright © der überarbeiteten Originalausgabe Helmut Werner
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Copyright © der eBook-Lizenzausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/OLJ Studio
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-689-8
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Casanova an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
www.instagram.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Casanova
Ich hatte sie alle – aus den Memoiren des Giacomo Casanova
dotbooks.
Einleitung
Giacomo Girolamo Casanova (1725–1798), Kind einer Schauspielerin aus Venedig, verbrachte ein unstetes Leben, das ihn durch alle großen Metropolen des damaligen Europas führte. Von Beruf ursprünglich Doktor beider Rechte, verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Gesandter, Alchemist, Glücksspieler und sogar als Geheimagent. Heute wäre nichts von Casanova bekannt, wenn er nicht zum Ende seines Lebens in Dux (im heutigen Tschechien) seine Memoiren verfasst hätte. Dieses 4000 Seiten umfassende Werk mit dem Titel Histoire de ma vie entfaltet vor dem Leser ein detailliertes, farbenprächtiges Panorama des höfischen Lebens im Rokoko. Der Sinnenmensch Casanova beschreibt darin auch ausführlich seine 120 Liebesaffären, die er innerhalb von 40 Jahren hatte. Oft reiste er nur in eine Stadt, um eine besonders attraktive Frau, die dort lebte, zu erobern. In der Regel werden die Sexabenteuer mit einem prächtigen Souper eingeleitet, den Casanova war auch ein großer Gourmet. Er drückt dies so aus: „Schöne Frauen sind für einen Mann genauso notwendig wie gutes Essen, und wenn man auch mit einer Speise satt werden kann, so wünscht man sich doch verschiedene Formen.“
Helmut Werner
Kapitel 1 Kinderjahre und erste Liebe.
Mein Vater, Cajetan Joseph Jakob Casanova, entstammte einer ursprünglich spanischen Familie. Er wurde seinen in Parma ansässigen Angehörigen durch die Reize einer Schauspielerin entrissen. Sie hieß Fragoletta und spielte die Soubretten. Verliebt, aber ohne Mittel, beschloß er, sich durch seine körperlichen Anlagen ein Auskommen zu verschaffen. Er fing an als Tänzer und spielte nach fünf Jahren in der Komödie. Seine Sitten zeichneten ihn aus, aber noch mehr seine Geistesgaben. Wankelmut und Eifersucht trennten ihn bald wieder von Fragoletta, und er trat zu Venedig in eine Schauspielergesellschaft, welche auf dem Theater S. Samuel spielte, als Mitglied ein. Hier wohnte ihm ein Schuhmacher gegenüber, Hieronymus Farusi, mit seiner Frau Marzia und einer einzigen Tochter Zanetta, einer vollkommenen Schönheit von sechzehn Jahren. Der junge Schauspieler verliebte sich in das Mädchen, wußte ihre Neigung zu erregen und entführte sie, denn ihre Eltern wollten sie keinem Schauspieler geben. Versehen mit den nötigen Bescheinigungen, begaben sich die Liebenden, begleitet von zwei Zeugen, zum Patriarchen von Venedig, und dieser machte sie zu Eheleuten. Zanettas Mutter brach in laute Klagen aus, und ihr Vater starb vor Kummer.
Ich ward als die Frucht dieser Ehe nach neun Monaten am 2. April des Jahres 1725 geboren. Als ich acht Jahre zählte, starb mein Vater im blühenden Alter von sechsunddreißig Jahren. Zwei Tage vor seinem Scheiden fühlte er sein Ende nahen. Er versammelte Weib und Kinder um sein Bett und empfahl uns den edlen Herren Grimani.
Nachdem er uns seinen Segen gegeben, verlangte er von unserer in Tränen zerfließenden Mutter einen Eid, daß sie keins ihrer Kinder für die Bühne erziehen wolle. Nie würde er sich ihr gewidmet haben, wenn eine unglückliche Leidenschaft ihn nicht dazu gezwungen hätte. Sie schwur diesen Eid, und die drei Patrizier übernahmen die Gewähr für seine Unverbrüchlichkeit. Umstände halfen unserer Mutter ihr Versprechen halten.
Baffo, ein Freund meines Vaters, berühmt als Verfasser unanständiger Gedichte, empfahl, mich in Padua auf die Schule zu schicken, und der Abbé Grimani übernahm es, mir durch einen Chemiker, den er in Padua kannte, eine Pension zu besorgen. Dieser Mann hieß Ottaviani und war zugleich Antiquar. In wenigen Tagen war die Pension gefunden, und am 2. April 1734, an dem Tage, mit dem ich mein neuntes Jahr erreicht hatte, ward ich auf der Brenta nach Padua gebracht. Man macht die kleine Reise in acht Stunden. Außer meiner Mutter begleiteten mich Grimani und Baffo.
Wir kamen zu Padua früh bei Ottaviani an, dessen Frau mich mit Liebkosungen überhäufte. Ich fand dort sechs bis sieben Kinder, und unter diesen ein Mädchen von acht Jahren, Marie, und ein anderes, Rosa, von sieben Jahren, anmutig wie Engel.
Ottaviani führte uns sogleich nach dem Hause, wo ich in Pension bleiben sollte. Es lag etwa fünfzig Schritt von dem seinigen entfernt bei St. Maria in der Parochie von St. Michael und gehörte einer alten Slawonierin, welche den ersten Stock an die Frau eines slawonischen Obersten Mida vermietet hatte. Man öffnete mein kleines Felleisen und übergab ihr das Verzeichnis von allen Stücken, die sich darin befanden. Dann wurden ihr sechs Zechinen als sechsmonatiger Vorschuß für meine Pension gezahlt. Sie sollte mich für diese geringe Summe in Kost nehmen, reinlich halten und in die Schule schicken. Man hörte nicht darauf, als sie sagte, dafür reichten sechs Zechinen nicht zu. Man umarmte mich, befahl mir, gehorsam zu sein, und ließ mich bei ihr zurück. Auf diese Weise entledigte man sich meiner. In dieser Pension erging es mir sehr schlecht, und es war eine Erlösung für mich, als, durch Vermittlung Baffos, meine Großmutter Marzia erschien und mich bei einem jungen Geistlichen namens Gozzi unterbrachte. Dessen Familie bestand aus seiner Mutter, einer Bäuerin, alt, häßlich und zänkisch; seinem Vater, einem Schuhmacher, der den ganzen Tag arbeitete und mit niemand sprach, selbst nicht bei Tische, und sich festtags betrank, und seiner dreizehnjährigen Schwester Bettina. Sie war hübsch, munter und eine starke Romanleserin. Mir hatte sie gleich, ich weiß nicht weshalb, gefallen, und sie war es, die allmählich die ersten Funken einer Leidenschaft in mein Herz warf, welche nachher meine herrschende wurde.
Mit dem Doktor zusammen besuchte ich in den Fasten 1736 meine Mutter in Venedig. Sie beabsichtigte nach Petersburg zu gehen und wollte mich gern noch vorher bei sich haben. Man war zufrieden mit mir, und der Doktor, der sich gegen meine Mutter verlegen und linkisch benahm, erntete Anerkennung. Sie wünschte, daß ich keine Perücke trage, sondern frisiert werde, und als wir abreisten, gab mir meine Mutter in einem Päckchen ein Geschenk für Bettina. Von Grimani erhielt ich fünf Zechinen zum Ankauf von Büchern. Acht Tage darauf reiste meine Mutter nach Petersburg.
In Padua hatte mein Lehrer nichts zu tun, als vier Monate hindurch täglich und bei jedem Anlaß von meiner Mutter zu sprechen. Bettina aber tat, als müsse sie sich meiner besonders annehmen, weil sie fünf Ellen schwarze Glanzseide und zehn Paar Handschuhe in dem Päckchen gefunden hatte. Meinen Haaren widmete sie so viel Sorge, daß ich in sechs Monaten die Perücke ablegte. Täglich kämmte sie mich, oft wenn ich noch im Bette war, weil sie behauptete, nicht Zeit zum Warten zu haben, bis ich angekleidet sei. Sie wusch mir Gesicht, Hals und Brust unter Liebkosungen, die ich für unschuldig hielt. Ich zürnte nur mit mir selbst, wenn sie mich beunruhigten. Wenn sie fertig war, gab sie mir die zärtlichsten Küsse und nannte mich ihr liebes Kind. Aber bei dem größten Verlangen wagte ich nicht, ihre Zärtlichkeiten zu erwidern. Es geschah erst, nachdem sie anfing, meine Schüchternheit lächerlich zu machen. Fühlte ich, daß sie mich zu weit trieb, so hörte ich auf, wendete mich im Bett nach einer andern Seite hin, tat, als suche ich etwas, und sie ging weg. Doch kaum hatte sie sich entfernt, als ich außer mir geriet, nicht den Trieben meiner Natur gefolgt zu sein, und erstaunte über Bettina, die das alles ohne weitere Folgen tun konnte, während ich die größte Mühe hatte, mich im Zaum zu hallen. Jedesmal nahm ich mir vor, mein Betragen zu ändern.
Anfang Herbst kamen drei Schüler zum Doktor, und einer von ihnen, Candiani, der fünfzehn Jahre alt war, schien mir in weniger als einem Monat sehr vertraut mit Bettina geworden zu sein. Diese Wahrnehmung erregte mir Empfindungen, die ich bisher nicht gekannt hatte und erst einige Jahre später entziffern lernte. Es war nicht Eifersucht noch Erbitterung, sondern eine edle Verachtung, die ich nicht glaubte unterdrücken zu dürfen. Candiani, unwissend, ohne Geist und Erziehung, der Sohn eines Pächters, mir in allem nachstehend, nur dem Alter der Reife näher, sollte mir vorgezogen werden! Mein erwachendes Selbstgefühl sagte mir, ich sei mehr als er. Ein Gefühl von Stolz und Verachtung ward laut gegen Bettina, die ich noch immer liebte. Ich zog mich zurück und ließ ihre Küsse unerwidert. Als ich ihr einst auf die Frage nach dem Grund meiner Veränderung sagte, ich hätte gar keinen Grund, erwiderte sie mir mit einer bedauernden Miene, ich sei auf Candiani eifersüchtig. Dieser Vorwurf schien mir eine erniedrigende Verleumdung. Ich antwortete, beide, sie und Candiani, wären einander gleich wert. Sie ging weg, zwar lächelnd, aber schon über den Plan brütend, der allein sie zu rächen imstande war.
Eines Morgens erschien sie an meinem Bett und brachte mir ein Paar weiße Strümpfe, die sie für mich gestrickt hatte. Sie bat mich, sie mir anpassen zu dürfen, behauptete, meine Füße seien unsauber, und begann sie zu waschen. Dabei geschah etwas, weswegen ich glaubte, ihre Vergebung erbitten zu müssen. Das hatte sie nicht erwartet, und nach kurzem Nachdenken sagte sie mit sanfter Stimme, alle Schuld komme auf sie. Es solle aber nicht wieder vorfallen. So ließ sie mich mit meinen Betrachtungen allein.
Sie marterten mich. Ich glaubte das Mädchen entehrt, das Vertrauen der Familie mißbraucht, die heiligen Gesetze der Gastfreundschaft entweiht und ein Verbrechen begangen zu haben, das nur eine Heirat gutmachen könnte, wenn anders sie sich sollte entschließen können, einen so frechen, ihrer ganz unwürdigen Menschen wie mich zu heiraten.
Diesen Betrachtungen folgte die tiefste Trauer, die täglich zunahm, weil Bettina nie mehr sich an meinem Bette zeigte. Anfangs schien mir das recht, und wenige Tage hätten meine Trauer in Liebe verwandelt, wäre durch ihr Betragen gegen Candiani nicht die Leidenschaft der Eifersucht in mir erregt worden. Doch habe ich sie deshalb gegen ihn keineswegs desselben Fehltritts schuldig geglaubt, den sie mit mir begangen.
Durch meine Betrachtungen überzeugt, sie habe sich mir freiwillig ergeben, schob ich es auf ihre Reue, wenn sie mein Bett mied. Das schmeichelte mir. So konnte ich sie für verliebt in mich halten. In diesen trüben Betrachtungen beschloß ich, ihr durch einen Brief Mut zu machen. Er war kurz und sollte nichts tun, als ihr Gemüt beruhigen. Mir schien der Brief ein Meisterstück und mehr als hinreichend, mir eine Anbetung zu erwecken, die mich über Candiani erheben müßte. Sie gab mir mündlich zur Antwort, sie würde morgen an mein Bett kommen, kam aber nicht. Ich war wütend und staunte, als sie mich mittags bei Tisch fragte, ob ich mich von ihr als Mädchen verkleiden lassen wollte, um so mit ihr zu unserm Nachbar, dem Arzt Olivo, auf einen Ball zu gehen, der in fünf oder sechs Tagen gegeben werden sollte. Alle fanden den Vorschlag reizend, und ich willigte ein. Ich hoffte auf eine Aussprache. Aber statt dessen ereignete sich eine wahre Tragikomödie. Ein alter wohlhabender Pate des Dr. Gozzi auf dem Lande glaubte, der Tod würde seinem langen Krankenlager ein Ende machen. Er schickte also einen Wagen zur Stadt, in dem Gozzi sogleich mit seinem Vater zu ihm hinausfahren sollte, um vor dem Tode die Seele des Sterbenden Gott zu empfehlen. Der alte Schuhmacher leerte eine Flasche Wein, zog sich seinen Sonntagsrock an und reiste mit seinem Sohn ab.
Viel zu ungeduldig, die Nacht des Balles abzuwarten, benutze ich dies, Bettina in einem günstigen Augenblick zu sagen, ich würde die Tür, welche aus meiner Kammer nach dem Korridor ging, offenlassen und sie, wenn alles eingeschlafen wäre, erwarten. Sie verspricht mir, zu kommen. Bis Mitternacht warte ich ohne große Beunruhigung; wie es aber zwei, drei, vier Uhr wird, und sie nicht erscheint, gerate ich in Wut. Es schneite große Flocken, doch mich verzehrte mehr die Hitze als der Frost. Eine Stunde vor Tagesanbruch endlich fasse ich den Entschluß, auf den Strümpfen, um den Hund nicht aufzuwecken, hinunterzugehen und mich unten auf die Treppe vier Stufen von der Tür zu begeben, die offenstehen mußte, wenn Bettina hinausgegangen war. Ich fand sie aber verschlossen. Das konnte nur von innen geschehen sein, und so denke ich, das Mädchen sei eingeschlafen. Um sie aufzuwecken, wäre ich gezwungen gewesen, zu klopfen, und dann hätte der Hund bellen können. Gequält von Kummer und zu keinem Entschluß fähig, bleibe ich auf der untersten Stufe. Niedergeschlagen, erstarrt, mit den Zähnen klappernd, beschließe ich kurz vor Tage, in mein Zimmer zurückzugehen.
Indem ich aufstehe, höre ich drinnen ein Geräusch, und weil ich es für gewiß halte, Bettina werde kommen, trete ich gegen die Tür. Sie öffnet sich, und statt ihrer sehe ich Candiani, der mir mit solcher Gewalt einen Fußtritt gegen den Leib versetzt, daß ich hinstürze und im Schnee versinke. Er schließt sich indessen in den Saal ein, wo sein Bett bei denen seiner Kameraden, der beiden Feltrini, stand.
Schnell stehe ich auf, um mich an Bettina zu rächen. Sie wäre auch in dem Augenblick meiner Wut nicht entgangen, aber die Tür blieb geschlossen. Heftig stoße ich mit dem Fuße dagegen, der Hund bellt, und ich eile in mein Zimmer, schließe zu und lege mich nieder, um Geist und Leib wieder ins Leben zu bringen, denn ich war mehr als tot.
Betrogen, erniedrigt, mißhandelt, ein Gegenstand der Verachtung für Candiani den Glücklichen, bringe ich drei Stunden zu, um über die schwärzesten Racheentwürfe zu brüten. In dieser Stimmung höre ich an meiner Kammertür die heisere Stimme von Bettinas Mutter, die mich bittet, hinunterzukommen, weil ihre Tochter im Sterben liege.
Aufgebracht, daß sie sterben soll, ehe ich sie umbringen kann, folge ich und finde das Mädchen im Bett ihres Vaters, von allen umgeben, halb angekleidet, in den furchtbarsten Krämpfen, indem sie sich nach rechts und links wirft. Sie krümmt sich und wälzt sich unter Fausthieben und Fußstößen, bald von diesem, bald von jenem, der sie festhalten will, sich mit den gewaltsamsten Anstrengungen losreißend. Ich wußte nicht, was ich denken sollte. Nach einer Stunde schläft Bettina ein.
In dem Augenblick erscheinen eine Hebamme und der Dr. Olivo. Jene nennt den Anfall hysterisch, dieser behauptet das Gegenteil, verordnet Ruhe und kalte Bäder. Ich lache, denn ich weiß, ihre nächtlichen Vergehungen oder Angst vor mir verursachten die Krankheit. Ich beschließe also, bis zu Gozzis Ankunft die Rache zu verschieben. Für Verstellung hielt ich Bettinas Krankheit nicht. Dazu schien ihr die Kraft zu fehlen.
Als ich durch ihr Zimmer nach dem meinigen gehe, sehe ich ihre Tasche auf dem Bett liegen, und Neugier führt meine Hand in sie. Ich finde einen Zettel, erkenne Candianis Schrift und gehe, verwundert über die Unvorsichtigkeit des Mädchens, in mein Zimmer, um dort das Blatt zu lesen. Ich glaubte, Bettina habe den Verstand verloren. Wie ward mir aber, als ich folgendes las: »Weil Dein Vater verreist, brauchst Du heut nicht wie sonst Deine Tür offenzulassen. Nach dem Essen gehe ich in Deine Kammer, Du findest mich dort.«
Eine kurze Überlegung, und die Lust zum Lachen wird Herr über mich. So gefoppt, glaubte ich von der Liebe geheilt zu sein. Candiani verdiente in meinen Augen Verzeihung, Bettina Verachtung. Ich wünschte mir Glück, für mein künftiges Leben solche Lektion erhalten zu haben, und gab Bettina recht, daß sie Candiani vorgezogen hatte. Er war fünfzehn Jahre alt, ich ein Kind.
Aber weil ich den Fußtritt von ihm nicht vergaß, sann ich unaufhörlich, ihm einen Streich zu spielen.
Abends kehrten der Doktor und sein Vater zurück. Candiani, in Angst vor meiner Rache, fragt mich, was meine Absicht sei, und entspringt schnell, als ich ihm mit dem Messer zu Leibe gehe. Dem Doktor die nichtswürdige Geschichte zu erzählen, war nie mein ernster Wille gewesen. Nur der Augenblick des Zorns konnte mir solchen Vorsatz eingeben.
Am andern Morgen unterbricht die Mutter des Doktors die Lehrstunden, um ihm nach einer langen Vorrede zu entdecken, daß sie Bettinas Krankheit für die Wirkungen der Zauberei einer Hexe halte. Darauf nahm er zu einem Priester seine Zuflucht, um der Schwester den Teufel auszutreiben. Die Neuheit dieses Geheimnisses erregte nun meine ganze Neugier. Alle schienen mir Narren oder Dummköpfe.
Als wir an das Bett traten, schien Bettina der Atem auszugehen, und die Beschwörungen des Bruders gaben ihn nicht wieder. Der Arzt Olivo überraschte ihn und fragte den Doktor, ob er nun überflüssig sei. Der Doktor verneinte, falls er den rechten Glauben habe. Da entfernte sich der Arzt, indem er Glauben nur für die Wunder des Evangeliums zu besitzen versicherte.
Gozzi aber ging in sein Zimmer, und ich, nun mit Bettina allein, sage ihr ins Ohr: »Fasse Mut, werde wieder gesund und sei meiner Verschwiegenheit gewiß.« Sie richtete den Kopf nach der andern Seite, ohne mir zu antworten, und blieb den Tag über ohne Krämpfe. Ich glaubte, sie geheilt zu haben, aber das Fieber griff ihr das Gehirn an. Sie sprach im Delirium lateinische und griechische Worte. Über die Art der Krankheit gab es nun keinen Zweifel mehr. Die Mutter ging weg und kam nach einer Stunde mit dem berühmtesten Geisterbanner aus Padua wieder. Es war ein sehr häßlicher Kapuziner: er hieß Bruder Prospero da Bovolenta.
Als Bettina ihn sah, goß sie mit lautem Lachen beißende Schimpfreden über ihn aus, die allen Anwesenden Spaß machten, denn nur der Teufel konnte den Mut haben, einen Kapuziner so zu behandeln. Dieser aber, als man ihn Dummkopf, Betrüger und Stänker nannte, schlug mit einem großen Kruzifix auf Bettina ein, indem er behauptete, daß er den Teufel prügele. Erst als sie ihm den Nachttopf an den Kopf zu werfen Miene machte, hielt er an, sie aber sagte:
»Wenn es der Teufel ist, dessen Worte dich Esel geärgert haben, so schlage ihn doch mit den deinigen; dagegen wenn ich es bin, so habe Respekt, du Flegel; mach daß du wegkommst.«
So blieb Pater Prospero ohne Wirkung, empfahl sich und versprach, einen kräftigeren Teufelsbanner zu schicken. Nachdem er weg war, brachte Bettina sechs Stunden in vollkommenster Ruhe zu und setzte uns alle in Verwunderung, als sie sich abends zu Tisch begab. Sie sagte ihren Eltern, daß sie vollkommen wohl sei, sprach mit ihrem Bruder und wandte sich an mich: weil morgen der Ball wäre, würde sie in der Frühe zu mir kommen, um mich als Mädchen anzuziehen. Ich dankte ihr und sagte, sie wäre recht krank gewesen, sie möchte sich schonen. Sie ging zu Bett, und wir blieben am Tisch, indem wir von nichts redeten als von ihr.
Als ich mich niederlegen wollte, fand ich einen Zettel in meiner Schlafmütze. Sobald ich den Doktor eingeschlafen sah, beantwortete ich ihn. Der empfangene Zettel lautete also: »Entweder gehst Du mit mir als Mädchen verkleidet auf den Ball, oder es soll einen Anblick geben, der Dir Tränen kostet.« Ich antwortete: »Ich gehe nicht auf den Ball, denn ich werde jede Gelegenheit vermeiden, mit Dir allein zu sein. Mir den verheißenen traurigen Anblick zu geben, traue ich Dir den Mut wohl zu. Aber schone mein Herz, ich liebe Dich wie meine Schwester. Ich habe Dir vergeben, liebe Bettina, und will alles vergessen. Ich lege einen Zettel bei, den Du Dich freuen wirst, wieder in Deinen Händen zu haben. Du siehst, was Du wagtest, als Du ihn in der Tasche auf Deinem Bett ließest. Daß ich Dir ihn wiedergebe, muß Dich von meiner Freundschaft überzeugen.«
Bettina mußte in Verzweiflung sein, solange sie nicht wußte, in wessen Hände ihr Brief an sie geraten war. Sie dieser Angst entziehen, war der größte Freundschaftsbeweis, den ich ihr geben konnte. Aber wenn meine Großmut ihr diesen Kummer nahm, gab sie ihr einen andern: sie war entdeckt. Candianis Brief bezeugte unzweideutig, daß sie ihn alle Nächte zu sich gelassen. Das Märchen, das sie erfunden haben mochte, mich zu hintergehen, verlor dadurch seine Wirkung. Auch in dieser Verlegenheit sollte sie nicht bleiben. Darum trete ich frühmorgens an ihr Bett und gebe ihr den Brief und meine Antwort.
Ihre Klugheit halte meine Achtung erworben. Ich konnte sie nicht mehr geringschätzen. Ich sah sie durch ihr Temperament verführt. Sie war mannstoll und deshalb zu bedauern. Ich glaubte nun alles im gehörigen Lichte zu sehen und faßte mich wie einer, der verständig und nicht verliebt ist. Sie mußte erröten, nicht ich. Nur ob auch die Feltrini, Candianis beide Kameraden, ihre Liebe genossen, trachtete ich noch zu erfahren.
Bettina spielte den ganzen Tag über die Lustige und zog sich abends zum Ball an, als plötzlich ein wirkliches oder nachgeahmtes Übelbefinden sie ins Bett trieb. Am andern Morgen ist das ganze Haus trostlos, weil der Teufel, von dem Bettina besessen war, ihr den Verstand zerrüttet hatte. Der Doktor sagte mir, ihr Irrereden enthielte so viele Lästerungen, daß sie durchaus besessen sein müsse. Dies bewog ihn, sie dem Pater Mancia zu übergeben, einem Dominikaner, der im Ruf stand, daß seine Kraft noch bei keinem behexten Mädchen versagt habe. Er erschien am folgenden Tage, als wir eben vom Essen aufstehen wollen. Der Doktor und die Familie führen ihn zum Bett der Kranken. Der Mönch hatte eine hohe majestätische Gestalt, er zählte etwa dreißig Jahre, hatte blondes Haar und blaue Augen. Seine Gesichtszüge unterschieden sich von denen des belvederischen Apoll nur dadurch, daß nicht Sieg und Stolz aus ihnen blickten. Er war blaß, aber um so mehr glänzte das Rot seiner Lippen, welche die schönsten Zähne sehen ließen. Er war weder mager noch fett. Die Trauer in seinem Gesicht erhöhte dessen Milde. Der langsame Gang und das schüchterne Aussehen verrieten die Demut seines Geistes. Bettina schlief bei unserm Eintritt oder tat so. Pater Mancia faßt einen Weihwedel und besprengt sie mit Weihwasser. Sie öffnet die Augen, sieht den Mönch an und schließt sie gleich wieder. Dann öffnet sie sie nochmals, sieht ihn fester an, legt sich auf den Rücken, läßt den Arm hingleiten und sinkt mit einer reizenden Neigung des Hauptes in einen Schlaf, der den lieblichsten Anblick gewährte.
Der Geisterbanner zieht sein Ritual und die Stola aus der Tasche; die Stola schlingt er sich um den Hals, einen Reliquienkasten aber setzt er der Eingeschlafenen auf die Brust. Nun bittet er mit der Miene eines Heiligen uns alle, niederzuknien und zu Gott zu beten, daß er ihn erkennen lasse, ob die Kranke besessen oder nur von einem körperlichen Leiden befallen sei. So ließ er uns eine halbe Stunde, während er stets mit leiser Stimme las. Während dieser ganzen Zeit blieb Bettina ruhig liegen.
Ihr Irrereden am andern Tage war prachtvoll. Kein Dichter erfindet Ähnliches. Die Erscheinung des schönen Beschwörers unterbrach sie nicht. Nachdem dieser eine Viertelstunde zugehört, sammelte er alle seine Kräfte und bat, daß wir uns entfernen möchten. Wir gehorchten, und die Tür blieb offen. Doch das war gleichgültig. Wer hätte gewagt hineinzugehen? Drei Stunden hindurch herrschte tiefste Stille. Gegen Mittag rief er uns, und wir traten ein. Bettina war traurig und ruhig, während der Mönch seine Sachen zusammennahm. Er ging, gab Hoffnung und bat den Doktor um Nachricht. Bettina genoß das Mittagessen im Bett; zum Abendbrot kam sie an den Tisch und war am folgenden Tage vernünftig. Aber bald wurde ich überzeugt, sie sei weder toll noch besessen.
Es war zwei Tage vor Mariä Reinigung, und wir pflegten in unserer Pfarrkirche das Abendmahl zu nehmen. Diesmal sollten wir in der Augustinerkirche beichten, bei den Dominikanern, die dort administrierten. Der Doktor sagte uns bei Tisch, er würde uns morgen hinführen, und die Mutter setzte hinzu: »Ihr müßt alle dem Pater Mancia beichten, damit ihr von einem so heiligen Manne die Absolution erhaltet. Ich werde mitgehen.« Candiani und die Feltrini willigten ein, ich schwieg. Mir mißfiel der ganze Vorschlag, aber ich verbarg es, obwohl ich ihn zu hintertreiben entschlossen war. Ich hielt streng meine Beichte, und sie falsch abzulegen, war mir unmöglich. Da ich aber den Beichtvater wählen konnte, so wäre ich nie so dumm gewesen, dem Pater Mancia zu beichten, was mir mit einem Mädchen begegnet war, in welchem er sogleich Bettina wiedererkennen mußte. Ich war überzeugt, Candiani würde ihm alles sagen, und das verdroß mich sehr.
Am andern Morgen kommt Bettina an mein Bett, bringt mir eine Weste und steckt mir diesen Brief zu: »Hasse mein Leben, nur achte meine Ehre und gönne mir ein wenig tiefersehnten Frieden. Keiner von euch darf morgen bei dem Pater Mancia beichten. Du allein kannst den Plan verhindern, und ich brauche Dir nicht erst die Mittel anzugeben. Ich werde sehen, ob es wahr ist, daß Du noch Freundschaft für mich hast.«
Unglaublich weh tat mir das Mädchen, als ich dies las, und ich antwortete: »Daß trotz der unverletzlichen Verschwiegenheit der Beichte Dich das Vorhaben Deiner Mutter ängstigen muß, begreife ich. Aber rechnest Du auf mich, es zu hintertreiben, und nicht auf Candiani, der es gebilligt hat? Ich kann Dir nur versprechen, für meine Person nicht daran teilzunehmen. Über Deinen Geliebten vermag ich nichts. Du mußt mit ihm sprechen.«
Ihre Antwort war: »Seit der Nacht, die mich unglücklich gemacht, habe ich kein Wort mit Candiani gesprochen, und er erhält kein Wort mehr von mir, auch wenn es mich wieder glücklich machen könnte. Nur Dir will ich mein Leben und meine Ehre verdanken.«
Bettina jede ihr willkommene Gefälligkeit zu erweisen entschlossen, sagte ich in dem Augenblick, wo wir uns niederlegen wollten, dem Doktor, mein Gewissen nötige mich, ihn zu bitten, daß er mir die Beichte beim Pater Mancia erlasse; doch dürfe ich keine Ausnahme von meinen Kameraden annehmen. Meine Gründe leuchteten ihm ein, und er würde uns alle nach St. Antonius führen, erwiderte er. Ich küßte seine Hand. Die Sache war fertig, und als Bettina zu Tisch kam, sah ich ihre Zufriedenheit. Eine Verletzung am Fuß nötigte mich am Nachmittag, zu Bett zu gehen, und während der Doktor mit meinen Kameraden sich in der Kirche befand, kam Bettina, die allein zu Hause geblieben war, zu mir und setzte sich auf mein Bett. Ich erwartete so etwas. Es erschien der Augenblick der großen Aussprache. Sie sagte zunächst, ich wäre hoffentlich nicht böse, daß sie mich sprechen wolle. »Nein,« erwiderte ich, »denn es verschafft mir die Gelegenheit, dir zu sagen, daß du sicher sein kannst. Ich bin dein Freund geworden, habe dir deine Schwächen vergeben und betrachte dich gerade so, wie du bist. Bezahle mich mit gleicher Münze, mit Wahrheit und Aufrichtigkeit, und laß alle Umwege. Du schreibst mir, du würdest nie mehr mit Candiani sprechen. Sollte ich die Ursache dieses Bruches sein, so glaube mir, daß es mich ärgert. Deine Ehre verlangt, daß du dich wieder versöhnst.«
»Alle deine Äußerungen«, erwiderte Bettina, »haben einen falschen Grund. Weder liebe ich Candiani, noch habe ich ihn jemals geliebt. Ich habe ihn gehaßt und hasse ihn, weil er meinen Haß verdient. Davon werde ich dich überzeugen, wenngleich der Anschein mich verdammt.«
Bettina weinte. Ihre Worte klangen glaubhaft und schmeichelten mir. Indes, ich hatte zu viel gesehen. Aber ich antwortete: »Gib mir zu, daß dein damaliges heftiges Feuer nur für den Augenblick brannte. Ein leichter Hauch hätte hingereicht, es zu dämpfen. Deine Tugend, die sich nur einen Augenblick von der Pflicht verirrte und die Herrschaft über deine verirrten Sinne sogleich wiedergewann, verdient einiges Lob. Du liebtest mich, verlorst auf einen Augenblick die Kraft des Widerstandes gegen meine Leiden, die ich dich kennen lehrte. Aber noch weiß ich nicht, wie jene Tugend dir so teuer sein konnte, da sie alle Nächte in Candianis Armen Schiffbruch litt.«
»Jetzt«, sprach sie mit jenem Blick, den die Sicherheit des Sieges gibt, »sind wir da, wohin ich dich haben wollte. Höre, was ich dich nie wissen lassen, nie dir sagen konnte. Denn du kamst nicht zu der Zusammenkunft, die ich aus keinem andern Grunde von dir verlangte, als dich von der Wahrheit zu unterrichten. Candiani war kaum acht Tage bei uns, als er mir seine Liebe erklärte. Ich erklärte ihm, ich kenne ihn zu wenig, und bat ihn, nicht mehr davon zu sprechen. Ich hielt ihn für beruhigt, merkte aber bald nachher, daß er es nicht war. Er bat mich nämlich, ihm die Haare zu ordnen. Als ich antwortete, ich habe nicht Zeit, sagte er, du seist glücklicher als er. ich lachte über den Vorwurf und über seinen Argwohn. Alle wußten, daß ich dich zu bedienen hatte. Vierzehn Tage nach jener meiner abschlägigen Antwort brachte ich eine Stunde mit dir in jener Tändelei zu. Ich war zufrieden, ich liebte dich, und ganz dem Verlangen meiner Natur, meiner Leidenschaft hingegeben, konnten keine Gewissensbisse mich beunruhigen. Die Zeit, bis ich dich am andern Morgen wiedersah, wurde mir unerträglich lang. Aber noch denselben Abend, gleich nach dem Nachtessen, brach die Stunde meiner Leiden an. Candiani spielte mir einen Zettel und einen Brief in die Hände, den ich in einer Vertiefung der Wand verbarg, um ihn dir, wenn Ort und Zeit es erlauben würden, zu zeigen.«
Sie übergab mir beides. So lautete der Zettel: »Entweder gönnst Du mir diese Nacht den Eintritt in Deine Kammer, indem Du die Tür gegen den Hof halb offen lassest, oder Du hast Dich zu besinnen, wie Du Dich morgen gegen den Doktor aus Händeln ziehen wirst, die er durch einen Brief erfahren soll, von dem ich die Abschrift beilege.«
Der Brief enthielt den Bericht eines schändlichen, wütenden Angebers und konnte verdrießliche Folgen nach sich ziehen. Er sagte dem Doktor, daß seine Schwester des Morgens mit mir verbotenen Umgang pflege, während er die Messe lese, und versprach ihm darüber Aufklärungen, die ihm allen Zweifel nehmen sollten.
»Ich überlegte,« fuhr Bettina fort, »was die Sache erforderte, und ich entschloß mich, das Ungeheuer anzuhören. Die Tür blieb halb offen, und ich erwartete ihn mit einem Stilett meines Vaters in der Tasche. Ich stand an der Tür, dort mit ihm zu sprechen, denn meine Kammer war nur durch eine Holz wand von der meines Vaters getrennt. Das leiseste Geräusch konnte ihn wecken. Auf meine erste Frage wegen der Verleumdung, von der der Brief sprach, den er meinem Vater zu geben drohte, erwiderte er, es sei keine Verleumdung. Er hätte durch ein Loch, das er in die Bretter des Bodens gerade über deinem Bette gemacht, alles selbst gesehen. Er schloß damit, es meiner Mutter und meinem Bruder zu entdecken, wenn ich ihm nicht dieselben Gefälligkeiten gewährte. Nachdem ich in meinem gerechten Zorn die schnödesten Beschimpfungen gegen ihn ausgestoßen und ihn einen schändlichen Spion und Verleumder genannt (denn er konnte nur Kindereien gesehen haben), schwor ich ihm endlich, daß er sich umsonst schmeichle, mich durch Drohungen zu den verlangten Gefälligkeiten zu verführen. Nun bat er mich tausendmal um Vergebung und stellte mir vor, daß ich seinen Schritt meiner Härte zuschreiben müsse. Er gestand zu, daß sein Brief vielleicht verleumderisch sei und daß er boshaft gehandelt habe. Ich hielt es für nötig, ihm zu sagen, daß er vielleicht in Zukunft meine Neigung gewinnen könne, und ihm zu versprechen, nie wieder in des Doktors Abwesenheit an dein Bett zu gehen. So entließ ich ihn zufrieden, ohne daß er einen einzigen Kuß von mir zu erbitten wagte; ich versprach ihm nur, daß wir uns ein andermal an demselben Orte sehen würden.
»Ich legte mich schlafen in Verzweiflung, denn ich bedachte, daß ich dich weder in der Abwesenheit meines Bruders sehen, noch den Grund davon sagen könne, der Folgen wegen. So gingen drei Wochen unter unglaublichen Leiden hin. Du drängtest mich, und ich mußte ausweichen. Wenigstens einmal wöchentlich mußte ich den Schurken an der Korridortür erwarten, um durch Worte seine Ungeduld zu dämpfen. Endlich auch von dir bedroht, beschloß ich, mein Märtyrertum zu enden. Ich schlug dir vor, in Mädchenkleidern auf den Ball zu gehen, wollte dir alles entdecken und dir die Sorge überlassen, der Not ein Ende zu machen. Der Ball mußte Candiani mißfallen, aber mein Entschluß war gefaßt. Du weißt, was den Strich durch die Rechnung machte. Meines Vaters Reise mit meinem Bruder führte euch beide auf denselben Gedanken. Ich hatte das Versprechen, zu dir zu kommen, gegeben, ehe ich Candianis Zettel erhalten. Er bat mich nicht um ein Beisammensein, sondern kündigte mir an, er werde mich in meiner Kammer erwarten. Zeit, ihm zu sagen, daß ich Gründe hätte, ihm diesen Gang zu verbieten, blieb mir so wenig, als dich zu benachrichtigen, ich würde erst nach Mitternacht zu dir kommen, wie es mein Vorsatz war. Ich hoffte gewiß, nach dem Geschwätz von einer Stunde den Unglücklichen in seine Kammer zurückzuschicken. Aber das Unternehmen, eine gemeinsame Flucht zu seinem Onkel nach Ferrara, das er ausgesonnen und mir mitteilen wollte, verlangte viel längere Zeit. Ich konnte ihn nicht zum Weggehen bringen. Ich mußte ihn hören und die ganze Nacht hindurch seine Gegenwart ertragen. Konnte ich erraten, daß du dem Wind und Schnee ausgesetzt draußen wartetest? Wir waren beide zu bedauern; freilich du mehr als ich. Man sagt, ich sei behext und von bösen Geistern besessen. Ich weiß nichts davon, aber wenn es wahr ist, bin ich das unglücklichste Mädchen auf der Welt.« Nun schwieg sie und ließ den Tränen und Seufzern ihren Lauf.
Was sie mir erzählte, war möglich, aber nicht sehr glaubhaft, und ich hatte hinlängliche Besinnung. Ihre Tränen jedoch bewegten mich. Ich glaubte weder an Candianis Mäßigung noch an Bettinas Geduld, noch an eine Unterredung von sieben Stunden über den angegebenen Gegenstand. Und doch gewährte es mir ein gewisses Behagen, alle die falsche Münze, die mir geboten wurde, für bares Geld zu nehmen.
Nachdem sie ihre Tränen getrocknet, richtete sie ihre schönen Augen auf mich und hoffte, schon die ersten Anzeichen ihres Sieges in meinem Gesicht lesen zu können; aber sie erstaunte, als ich einen Punkt berührte, den sie in ihrer Apologie künstlich übergangen hatte.
»Wie denn, liebe Bettina,« sagte ich, »deine Erzählung hat mich gerührt, nur deine Krämpfe und Wahnsinnsanfälle kann ich deshalb nicht für natürlich halten, denn du hast sie während des Beschwörens immer gar zu sehr bei gelegener Zeit blicken lassen, obgleich du mit vielem Bedacht behauptet hast, hierüber Zweifel zu hegen.« Nach diesen Worten sah sie mich fünf bis sechs Minuten lang verstummend und fest an, dann senkte sie ihre schönen Augen und begann zu weinen. »Ich gedachte,« sprach sie dann, »die verlorenen Rechte auf dein Herz wiederzugewinnen. Aber ich bin dir gleichgültig. Fahre fort, mich mit Härte zu behandeln, fahre fort, wahrhafte Leiden, die du verursacht hast und jetzt auch noch vermehrst, für Erfindung zu halten. Du wirst es zu spät bereuen und dich nicht glücklich in deiner Reue fühlen.« Sie ging, und ich, der eins wie das andere bei ihr für möglich hielt, fing selbst an zu weinen. Ich rief sie zurück und sagte ihr, sie habe nur ein Mittel, meine Zärtlichkeit wiederzugewinnen. Sie müsse einen Monat ohne Krämpfe zubringen und die Hilfe des schönen Paters Mancia entbehrlich machen. »Das hängt nicht von mir ab«, sagte sie. »Aber was willst du mit dem Worte ›schön‹ sagen? Solltest du vermuten …?« – »Keineswegs, keineswegs! Ich vermute nichts. Ich müßte eifersüchtig sein, um irgend etwas zu vermuten. Aber der Vorzug, den deine Teufel den Beschwörungen des schönen Dominikaners vor denen des garstigen Kapuziners geben, gestattet Auslegungen, die dir nicht zur Ehre gereichen. Dennoch richte dich ein, wie dir es beliebt.«
Sie ging, und nach einer Viertelstunde kamen alle nach Hause. Nach dem Abendessen sagte mir die Magd aus freien Stücken, Bettina habe sich unter starkem Fieberschauer in ihr Bett gelegt, das sie in die Küche neben das ihrer Mutter habe stellen lassen. Das Fieber konnte sehr leicht einen natürlichen Grund haben, aber ich zog ihn in Zweifel.
Am andern Tage, als sie der Arzt Olivo in starkem Fieber fand, sagte er dem Doktor, sie würde verworren sprechen, aber das sei Folge des Fiebers und nicht der bösen Geister. Wirklich blieb Bettina den ganzen Tag über im Delirieren, und der Doktor, dem die Worte des Arztes eingeleuchtet hatten, ließ seine Mutter reden, ohne nach dem Pater zu schicken. Das Fieber nahm am dritten Tage noch mehr zu, und Flecke auf der Haut ließen die Blattern vermuten, die am vierten Tage ausbrachen. Gleich wurden Candiani und die beiden Feltrini, welche diese Krankheit noch nicht gehabt, umquartiert. Ich, für den keine Gefahr war, blieb allein mit ihr. Die arme Bettina ward so von ihrem Ausschlag bedeckt, daß am sechsten Tage nirgends mehr eine Spur ihrer Haut zu sehen war.
Am neunten Tage kam der Pfarrer, um ihr die Absolution und heilige Ölung zu geben; denn, sagte er, man müsse sie der Hand Gottes überlassen. Am zehnten und elften Tage war man jeden Augenblick ihres Todes gewärtig. Die Pocken, die reif und schwarz geworden, eiterten und verpesteten die Luft. Niemand blieb bei dem armen Geschöpf. Nur ich, den ihr Zustand untröstlich machte, harrte aus. In dieser furchtbaren Lage flößte sie mir alle jene Zärtlichkeit ein. die ich ihr nach ihrer Heilung bezeigt habe.
Am dreizehnten Tage, nachdem das Fieber entwichen, beunruhigte sie ein unerträgliches Jucken, das durch nichts geheilt werden konnte. Es halfen nur jene mächtigen Worte, die ich ihr täglich wiederholte: »Bedenke, Bettina, daß du wieder gesund wirst, und wenn du dich kratzest, dies dein Gesicht so sehr entstellen muß, daß niemand mehr dich ansehen kann!« Alle Ärzte der Welt mögen versuchen, eine wirksamere Arznei gegen das Kratzen bei einem Mädchen zu ersinnen, die weiß, daß sie schön gewesen, und fürchten muß, ihre Reize einzubüßen, wenn sie sich kratzt.
Endlich schlug Bettina ihre schönen Augen wieder auf, man ließ sie das Bett wechseln und brachte sie in ihr Zimmer. Ein Geschwür am Halse hielt die Kranke noch bis Ostern fest. Mir impften sich acht bis zehn Blattern ein, von denen drei die unauslöschlichen Spuren in meinem Gesicht zurückließen. Bei Bettina gereichten sie mir zur Ehre. Sie erkannte nun, daß nur ich ihrer Zärtlichkeit wert war. Ihre Haut blieb mit roten Flecken überdeckt, die erst nach einem Jahre verschwanden. Sie hat mich in der Folge, ohne sich zu verstellen, geliebt, und ich erwiderte ihre Liebe, ohne jene Blume zu brechen, die das Schicksal, vom Vorurteil unterstützt, der Ehe aufbewahrt hat. Aber welch trauriger Ehe! Sie heiratete nach zwei Jahren einen Schuhmacher namens Pigozzo, einen nichtswürdigen Schurken, der sie arm und unglücklich machte. Ihr Bruder mußte sich ihrer annehmen. Als ich sie vor achtzehn Jahren besuchte, fand ich sie alt, krank und sterbend. Sie gab im Jahre 1Z76, vierundzwanzig Stunden nach meiner Ankunft, ihren Geist auf.
Kapitel 2 Die kleine Lucie.
Einen Sommer lang beschäftigte mich die Liebe zu Angela, einer Nichte des Pfarrers Tosello, dem ich zu meiner geistlichen Ausbildung zugeteilt war. Sie war spröde, und es verdroß mich, daß sie so karg mit ihren Liebkosungen blieb. Hitzig wie ich war in der Liebe, brauchte ich ein Mädchen wie Bettina. Die unterhielt die Flamme, ohne sie auszulöschen. Angela war die Nachgiebigkeit selbst, aber auch nichts weiter. Die Liebe zu ihr verzehrte mich dergestalt, daß ich mager zu werden anfing, und wenn ich sie am Stickrahmen mit leidenschaftlichen Klagen bestürmte, so machten diese auf ihre beiden Freundinnen, zwei Schwestern, die an ihrer Seite saßen, größeren Eindruck als auf sie. Wären meine Augen nicht völlig durch die Grausame benommen gewesen, so hätte ich zweifellos gesehen, daß die Freundinnen sie an Schönheit und Herz übertrafen. Aber meine verzauberten Augen sahen nur sie. Ihr koste die Zurückhaltung so viel wie mir – diese Versicherung war die höchste Gunst, die sie mir gewährte.
So nahte der Herbst heran, und ein Brief der Gräfin Montreal rief mich nach ihrem Landgute Pasean. Eine glänzende Gesellschaft sollte sich dort versammeln, und zu den Erwarteten gehörte die ebenso schöne als geistvolle Tochter der Gräfin. Eine Hornhaut über ihrem einen Auge bemerkte man kaum, so sehr fesselte die Schönheit des andern.
Die Heiterkeit in Pasean war allgemein, und ich erhöhte sie; denn Angela, meinem Sinn entrückt, quälte mich nicht. Ich bewohnte ein hübsches Zimmer im Erdgeschoß, das auf den Garten hinausging, und wußte nichts von meiner Nachbarschaft. Welche Überraschung daher, als ich am Morgen die Augen aufschlage und das reizendste Geschöpf vor mir steht und mir den Kaffee bringt: ein vierzehnjähriges Mädchen, reif, als zählte sie siebzehn, mit weißer Haut, feurigen Augen und in reizender Unordnung sie umflatternden schwarzen Haaren. Sie war im bloßen Hemd, und das leicht zugeschnürte Röckchen ließ das Bein mehr denn zur Hälfte sehen. Froh und ungezwungen, als wären wir lange Bekannte, sah sie mich an und fragte, wie ich mit meinem Bett zufrieden gewesen. »Außerordentlich! – Aber gewiß hast du es auch gemacht, schönes Kind! Wer bist du denn?« – »Lucie, des Vogts Tochter. Vierzehn Jahre bin ich alt und habe weder Bruder noch Schwester. Schön, daß Sie ohne Bedienten sind. Nun warte ich Ihnen auf, und Sie sollen mit mir zufrieden sein.«
Der Anfang entzückt mich. Ich richte mich auf. Gleich langt sie zum Schlafrock und wirft ihn mir über. Tausenderlei, was ich nicht verstehe, plaudert ihr reizender Mund dabei, und ich trinke meinen Kaffee. War sie guter Dinge, so wurde ich von ihrer Schönheit hingerissen. Es war unmöglich, ihr zu widerstehen. Indes hat sich das holde Kind auf das Fußende meines Bettes niedergesetzt und entschuldigte diese Freiheit mit einem Lächeln, welches alles ausdrückte. Noch halte ich die Tasse gegen den Mund, und Vater und Mutter treten ins Zimmer. Lucie sieht beide mit einem Blick an, als wolle sie sagen, sie habe ein Recht zu ihrem Platze und sei keineswegs gesonnen, ihn zu verlassen. Die Eltern aber machen ihr einen gelinden Vorwurf und bitten mich tausendmal in ihrem Namen um Verzeihung. Damit verscheuchen sie Lucie, die an ihre Arbeit geht. Sie loben mir das Mädchen, nennen sie ihr einziges geliebtes Kind, den Trost ihres Alters. Nur über einen Fehler beklagen sie sich, sie sei noch zu jung. Reizender Mangel!
Nachdem wir so eine Weile gesprochen haben, kommt Lucie wieder, lachend vom Kopf bis zum Fuß. Sie hat sich gewaschen, die Haare geordnet, Schuhe und Strümpfe angezogen.
Am folgenden Tage habe ich nach dem Erwachen nichts eiliger zu tun, als zu klingeln, und Lucie erscheint vor mir gerade wie das erstemal. Ihr ganzes Wesen ist ein einziger Glanz unter dem Firnis der Güte und Unschuld. Nur begriff ich nicht, wie sie bei ihrer Klugheit und Ehrbarkeit gar nicht daran dachte, daß sie sich, wie sie kam, mir nicht zeigen durfte, ohne mich in Glut zu setzen. Da sie in gewissen Scherzen, dachte ich, keineswegs zurückhaltend ist, wird sie es überhaupt nicht sein, und sie soll sich überzeugen, daß ich ihr nicht Unrecht tue. Ich beschloß, mir Licht zu verschaffen. Ich streife an die Grenze der Leichtfertigkeit, und fast unwillkürlich zieht sie sich errötend zurück. Ich eilte, sie von neuem ruhig und sicher zu machen. Um nicht zuviel zu wagen, beschloß ich, am nächsten Morgen ihr die Zunge zu lösen. Nachdem ich meinen Kaffee getrunken, benutze ich eine ihrer Äußerungen, ihr zu sagen, daß es kalt sei und sie weniger frieren würde, wenn auch sie sich mit meiner Bettdecke einhüllen wolle.
»Werde ich Ihnen auch nicht beschwerlich sein?« »Keineswegs. Aber deine Mutter möchte kommen und erzürnt sein.«
»Sie wird nichts Arges denken.«
»So komm! Aber weißt du auch, was wir wagen?« »Wohl weiß ich es. Aber Sie sind ein Mensch, dem man trauen darf, und was mehr ist: ein Geistlicher.« »Komm! Doch verschließ erst die Tür.«
»Nicht doch, man möchte wer weiß was denken.«
Nun kam sie zu mir und erzählte mir eine lange Geschichte, von der ich nichts verstand. Ihre Sicherheit, die gewiß nicht gemacht war, verwirrte mich so, daß ich mich geschämt haben würde, sie zu mißbrauchen.
Aber nach zehn oder elf Tagen mußte ich abbrechen, wenn ich keinen Frevel verüben wollte. Ich beschloß das erstere. Aber wie? Wie einem Mädchen widerstehen, die mit Tagesanbruch, kaum bekleidet, mir entgegenlief, mich fragte, wie ich geschlafen, und mir die Worte in den Mund legte. Ich wandte mich ab, und sie warf mir lächelnd vor, wie ich Furcht hegen könne, da sie selbst keine habe. Auf eine lächerliche Weise erwiderte ich, sie irre, wenn sie mich für furchtsam halte; sie sei ja nur ein Kind. Aber sie meinte, der Unterschied von zwei Jahren mache nicht viel aus.
Ganze Nächte stand nun Lucie vor mir, und ich war traurig über den gefaßten Entschluß, sie am nächsten Morgen zum letzten Male zu sehen.
Kaum bricht er an, so erscheint sie glänzend, strahlend, lächelnd, mit gelöstem Haar und offenen Armen, wird aber plötzlich traurig und unruhig, als sie mich bleich, traurig und niedergeschlagen sieht. »Was ist Ihnen?« ruft sie.
»Ich habe nicht schlafen können.«
»Weshalb?«
»Weil ich Ihnen etwas sagen muß, was mich bekümmert, aber mir Ihre Achtung erwerben wird.«
»Meine Achtung erwerben? Dann muß es Sie vielmehr vergnügt machen. Wie kommt es, daß Sie zu mir heut wie zu einer vornehmen Person sprechen, da Sie mich gestern mit du angeredet haben? Was habe ich Ihnen getan, Herr Abbé? Ich werde Ihren Kaffee holen, und wenn Sie ihn getrunken haben, müssen Sie mir alles sagen. Ich bin ungeduldig.«
So geht sie und kommt mit dem Kaffee wieder. Ich trinke ihn und bin ernst. Ihre Possen machen mich lachen, und sie freut sich darüber. Dann setzt sie das Geschirr weg, schließt, weil es zieht, die Tür, und weil sie nicht ein Wort von dem verlieren will, was ich ihr zu sagen habe, bittet sie mich, ihr Platz im Bett zu machen. Ich tue es ohne alle Besorgnis, denn ich komme mir wie tot vor.
Treu schildere ich ihr den Zustand, in den ihre Reize mich versetzt haben, und die Qualen, die es mich kostet, ihr die Beweise meiner Zärtlichkeit zu verbergen. Ich gestehe ihr, daß, weil mein verliebtes Herz nicht länger widerstehen könne, ich sie bitten müsse, nicht ferner zu mir zu kommen. Ein stummer Augenblick folgt, dann sagt sie mir mit traurigem Tone, meine Tränen täten ihr weh, und sie hätte nie eine Ahnung gehabt, daß sie je deren Ursache werden könne. »Ihre ganze Rede«, sagt sie, »hat mich belehrt, daß Sie mir sehr gut sind. Aber ich begreife nicht, wie Ihnen Ihre Liebe so viel Unruhe erwecken kann, da sie mir eine unendliche Freude bereitet. Sollte es möglich sein, daß Sie geboren wären, um nicht zu lieben? Ich will alles tun, was Sie verlangen, nur eins nicht: sogar wenn es Ihre Heilung hindern sollte, kann ich nicht aufhören, Sie zu lieben. Müssen Sie aber, um gesund zu werden, mich zu lieben aufhören, dann tun Sie alles, was Sie können, dazu. Ich will Sie lieber ohne Liebe am Leben als tot vor Liebe sehen. Aber versuchen Sie ein anderes Mittel. Das, was Sie mir genannt, tut mir weh. Denken Sie nach. Nennen Sie mir ein anderes und setzen Sie Vertrauen in Lucie.«