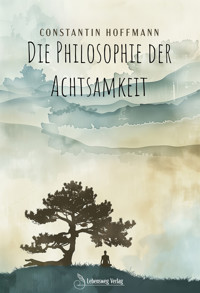Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von 1961 bis 1989 galt die innerdeutsche Grenze als die am schärfsten bewachte überhaupt. Für die meisten in der DDR blieb sie eine unüberwindbare, doch einige, die alles daran setzten, in die Freiheit, in den Westen zu gelangen, ließen sie schließlich hinter sich. Manche flüchteten abenteuerlich, einige nahmen es mit den Behörden auf und setzten mit Courage ihre Ausreise durch, andere mussten aus Gefängnissen freigekauft werden. Hoffmanns Berichte sind beredter Beweis des ungebrochenen Freiheitswillens von ehemaligen und zurückgekehrten Hallensern, vom Tierarzt über den Rechtsmediziner, die Lehrerin, den Krankenpfleger, über den Kellner bis zum Diakon. Sie sind Beweis, dass ein Volk sich seine Rechte nicht auf Dauer vorenthalten lässt und dass es keine allumfassende Unterdrückung geben kann. Sie sind Beweis, dass Widerstand möglich und vonnöten ist. Die sorgfältig recherchierten und durch zahlreiche Schwarzweißfotos illustrierten Fluchtgeschichten sind authentische und packende Reportagen aus einer Zeit, als echte Freiheit nur durch Mut und Fantasie zu erlangen war. Sie schlagen aber auch den Bogen bis in die Gegenwart und erzählen vom Leben der Protagonisten in der Bundesrepublik bzw. im wiedervereinigten Deutschland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
3., unveränderte Taschenbuchauflage 2024
© 2009 mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Birte Janzen
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
ISBN 978-3-96311-977-4
Inhalt
Vorwort
Blitzschnell verschwand er im Kofferraum
Zu viel für die Ehre eines Mannes
Wenn es nicht so traurig wäre …
Alles hing vom Wetter ab
Erst der eine Bruder, dann der andere
Natürlich helfe ich dir raus!
Ich gehe, aber nur unter Protest!
Eine verhängnisvolle Hochzeit
Die haben sogar die Sonne
Sie kommen hier nie raus!
Zuvor hat er sich etwas Mut angetrunken
Mit unserem Kind macht ihr das nicht!
Wo wollt ihr wirklich hin?
Vorwort
In der DDR träumten viele schon in der Jugend vom Alter. Warum? Weil nur alte Menschen das Land verlassen durften. Da es immer zu wenig Arbeitskräfte gab, machten die Genossen von der ewig regierenden Staatspartei SED eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung auf: Wer arbeiten kann, muss bleiben, wer nicht, darf gehen. Ausnahmen bestätigten die Regel.
Meine Entlassung aus dem System war für den 30. September 2021 vorgesehen. Mit 65 Jahren würde ich zum ersten Mal Paris sehen, die Alpen, das Mittelmeer und die west-lichen Bezirke der geteilten Stadt Berlin. Die Rolling Stones wären dann schon im Himmel, oder in der Hölle. Egal. Ich hätte sie jedenfalls niemals live erlebt.
Ich war 19, als ich für mich entschied: „Mit mir macht ihr das nicht. Ich muss hier raus.“ Mit 24 war ich frei. Seitdem fragten mich immer wieder Leute erstaunt: „Wie hast du denn das hingekriegt?“ Und wenn sie die Geschichte gehört hatten, sagten sie: „Mensch, das musst du aufschreiben!“ – „Ach“, antwortete ich, „da kenne ich ganz andere Storys, von Freunden und Bekannten, die sind noch viel schärfer.“ Alle lebten einst, so wie ich, in Halle an der Saale oder in der Region. Ich fragte sie und sie waren bereit, ihre Geschichten zu erzählen. So entstand dieses Buch.
In der DDR lebten in den Jahren ihres Bestehens im Durchschnitt rund 17 Millionen Menschen. Viele konnten dem Sozialismus in den Farben der DDR nichts abgewinnen und wären lieber heute als morgen nach Westdeutschland übergesiedelt. Das wusste die Regierung und ließ deshalb die Grenze schwer bewachen. Im sogenannten Todesstreifen wurde auf Flüchtlinge geschossen. Ein Schlupfloch war zunächst noch Berlin, weil dort die westlichen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges ein Wörtchen mitzureden hatten. Doch am 13. August 1961 bauten die Genossen mit Rückendeckung der sowjetischen Besatzungsmacht die Mauer. Der Westen hielt still. Bis dahin waren rund 2,7 Millionen Menschen aus der DDR geflüchtet.1 Bis zu ihrem Ende verließen noch einmal fast eine Million Ostdeutsche die DDR,2 davon rund 300.000 ungenehmigt.3 Zehntausende riskierten ihr Leben, um freizukommen. Zwischen 1961 und 1988 überwanden 40.101 Menschen die Sperranlagen zur Bundesrepublik und Westberlin.4 Gut 70.000 schafften es über andere sozialistische Länder. Einige zehntausend kehrten von Besuchsreisen in die Bundesrepublik nicht zurück.5
DDR-Grenze um Westberlin, 1986. © Erhard Kranz
Wie viele DDR-Bürger ihr Leben bei der Flucht verloren, ist bis heute unklar. Die „Arbeitsgemeinschaft 13. August“ sprach im Jahr 2008 von 1.303 Toten. Die „Gedenkstätte Berliner Mauer“ ging im selben Jahr davon aus, dass 600 bis 800 Menschen bei Fluchtversuchen erschossen wurden, ertranken oder auf andere Art und Weise im Zusammenhang mit dem DDR-Grenzregime starben. Direkt an der Berliner Mauer fanden mindestens 136 Menschen den Tod, teilte das Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam im Jahr 2008 mit. Dass es bis heute keine klare Bilanz der Opfer gibt, liegt vor allem daran, dass die Grenztruppen und das Ministerium für Staatssicherheit diese Todesfälle, wo immer möglich, verheimlichten und verschleierten; selbst gegenüber Familienangehörigen.6
Wer bei der Flucht gefangen wurde, kam ins Gefängnis. Zwischen 1961 und Ende 1988 weisen DDR-Statistiken rund 110.000 Verfahren wegen ungesetzlichen Grenzübertritts aus. Mehr als 71.000 Personen wurden verurteilt.7 Die westdeutsche Regierung ließ sich angesichts dieses Elends auf einen umstrittenen Handel ein. Sie kaufte politische Häftlinge aus ostdeutschen Gefängnissen gegen Geld, später gegen Waren und Rohstoffe frei. Vermittler war der Ostberliner Rechtsanwalt Wolfgang Vogel. Er genoss das Vertrauen beider Seiten und trug wesentlich dazu bei, dass bis zum Mauerfall 33.755 politische Gefangene auf diesem Weg in den Westen gelangten. Der Durchschnittspreis lag zwischen 40.000 D-Mark in den 1960er Jahren bis rund 96.000 D-Mark in den 1980er Jahren. Auch Familienzusammenführungen für mehr als 215.000 DDR-Bürger organisierte Rechtsanwalt Vogel. Die westdeutsche Regierung ließ sich Freikauf und Ausreise insgesamt rund 3,5 Milliarden D-Mark kosten, also rund 1,75 Milliarden Euro.8
Ehemaliges DDR-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen. Heute Gedenkstätte. © Constantin Hoffmann
Nach der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) im Jahr 1975, an der auch die DDR teilnahm und bei der sie sich verpflichtete, die Menschenrechte zu achten, musste sich die SED zunehmend mit Ausreiseantragstel lern befassen. Bis zum 30. Juni 1989 summierte sich ihre Zahl auf rund 626.000. Um Druck aus dem Kessel zu nehmen, durften immer mal einige Tausend Leute das Land verlassen. In der Regel nach langen, nervenaufreibenden Kämpfen mit den Genossen und oft in der Angst, nicht im Westen, sondern im Gefängnis zu landen. Bis einschließlich Juni 1989 wurden 172.600 Anträge genehmigt.9
Am 9. November 1989 war plötzlich alles vorbei. Hunderttausende DDR-Bürger stürmten die Mauer. Überwältigt von der eigenen Courage bahnten sie sich den Weg in den Westen, vorbei an ihren fassungslosen Bewachern. Die Zahl der Übersiedler explodierte. Am Jahresende 1989 wurden 343.854 Menschen gezählt, die der DDR in nur zwölf Monaten den Rücken gekehrt hatten.10 Bei der ersten freien Wahl in der Geschichte der DDR im Jahr 1990 wurde die SED abgewählt. Haushoch gewannen jene Parteien, die ein schnelles Ende der DDR und die Wiedervereinigung Deutschlands versprochen hatten. Die Wahlbeteiligung lag bei über 93 Prozent.
Enttäuschungen konnten nach der unglaublichen Euphorie der Selbstbefreiung nicht ausbleiben. Bei einigen Zeitgenossen, die einst schimpfend vor Geschäften Schlange standen und abends sehnsüchtig Westfernsehen schauten, scheint die DDR inzwischen mit jedem Tag, den sie tot ist, schöner zu werden. Klar hatte sie gute Seiten, die voreilig verworfen wurden. Pfiffige Ideen, wie zum Beispiel die Gemeindeschwestern, kommen wieder. Aber inzwischen wird die DDR hier und da regelrecht verkitscht. So funktioniert das mensch liche Gehirn nun einmal, versuche ich mir dieses Phänomen zu erklären. Von der Gegenwart nimmt es gern die schlechteren Seiten wahr, von der Vergangenheit die guten. Doch Verklärung kann dazu führen, dass bei der Suche nach einer besseren Gesellschaft alte Fehler wiederholt werden. Hat die nächste Generation das verdient? Einiges, was nicht wieder an Menschen ausprobiert werden sollte, steht in diesem Buch.
Wolfgang Gerdes war als Zeitzeuge in die Schulklasse seiner Tochter in Berlin eingeladen. Er erzählte, warum er einst unbedingt aus der DDR herauswollte, wie seine Flucht scheiterte, was er im Gefängnis erlebte, wie er freigekauft wurde und sein neues Leben begann. Am Ende stellte er erstaunt fest: Die interessantesten Nachfragen kamen von den jungen Türkinnen. Sie lebten ebenfalls in einer Zwangssituation, kulturell, in ihren Familien. Von Wolfgang wollten sie ganz genau wissen, wie er es geschafft hatte, sich aus seiner Zwangslage zu befreien. Auch seine Geschichte steht in diesem Buch.
1 Stefan Wolle: Aufbruch in die Stagnation – Die DDR in den sechziger Jahren. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2005, S 19.
2 Rainer Eckert: Was stimmt? DDR – Die wichtigsten Antworten. Verlag Herder. Freiburg 2007, S. 94.
3 Die Vergessenen Opfer der Mauer. Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, S. 27.
4 Hans-Hermann Hertle: Die Berliner Mauer. Monument des Kalten Krieges. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2007, S. 57.
5 Die vergessenen Opfer der Mauer. Flucht und Inhaftierung in Deutsch land 1961–1989. Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, S. 31.
6 Hans-Hermann Hertle/Gerhard Sälter: Die Todesopfer an Mauer und Grenze. Probleme einer Bilanz des DDR-Grenzregimes. Deutschland Archiv 39/2008.
7 Angaben des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam, Hans-Hermann Hertle, 2008.
8 Hans-Hermann Hertle: Die Berliner Mauer. Monument des Kalten Krieges. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2007, S. 117.
9 Stefan Wolle: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971–1989. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 1999, S. 285.
10 Deutschland – Von der Teilung zur Einheit. Presse- und Informa tionsamt der Bundesregierung. Berlin 1998, S. 107.
Blitzschnell verschwand er im Kofferraum
Manfred Kleiber, 1974 geflüchtet, damals 33 Jahre alt
Den Zeitpunkt seiner Flucht zwischen Weihnachten 1974 und Neujahr hatte Manfred bewusst gewählt. Es war neblig trüb und schon um 16 Uhr dunkel. Kaum jemand arbeitete, kaum jemand war auf der Straße. Die DDR schien noch grauer als sonst. Auch die Grenzer würden von der allgemeinen Stimmung der letzten Tage des Jahres erfasst werden, dachte sich der 33-jährige Rechtsmediziner. Seinen Wartburg stellte er auf dem Parkplatz vor dem halleschen Hauptbahnhof ab. Den Schlüssel steckte er ein. Er hätte den Wagen auch vorher verkaufen können, was ihm in der chronisch unterversorgten DDR noch ein kleines Vermögen gebracht hätte. Doch Manfred hatte Sorge, dass dadurch die Staatssicherheit auf ihn aufmerksam würde. Wenn jemand wie er sein Auto abgab, ohne ein anderes anzuschaffen, hätte das schon ein Hinweis auf eine geplante Flucht sein können.
Er war im Begriff, die DDR im Kofferraum eines westdeutschen Autos zu verlassen, das im Transit von der Bundesrepublik nach Westberlin unterwegs war. 1972 hatten die beiden deutschen Staaten das sogenannte Transitabkommen in Kraft gesetzt; danach entfielen die oft schikanierenden und zeitraubenden Kontrollen an der DDR-Grenze, nur in begründeten Ausnahmefällen wurden Fahrzeuge inspiziert. Die Bundesregierung zahlte im Gegenzug der DDR Hunderte Millionen D-Mark pro Jahr. In den ersten Jahren nutzten immer wieder sozialismusmüde Menschen die neue Regelung zur Flucht. Später wurden deshalb die Rastplätze im Osten überwacht und an den Grenzübergängen wurde Röntgentechnik bereitgehalten. Dass Manfred nun am Bahnhof stand, entschlossen, der DDR den Rücken zu kehren, war keine Kurzschlussreaktion. Es war für ihn das logische Ende einer jahrelangen, anstrengenden Entwicklung.
Manfred Kleibers Eltern waren mehr oder weniger treue DDR-Bürger. Der Vater hatte eine Anstellung als Prokurist in einem staatlichen Arzneimittelbetrieb in Halle und war SED-Mitglied. Aus dem Krieg hatte er eine prosozialistische Überzeugung mitgebracht. Manfred beschreibt ihn als duldsamen, friedfertigen Menschen, der der Propaganda glaubte, dass nur die Sozialisten den Frieden in der Welt zu sichern vermochten. Die anderen, das waren die Kriegstreiber. Der Sohn hielt seinen Vater in diesem Zusammenhang schon früh für viel zu gutgläubig. Trotz der SED-Mitgliedschaft des Vaters pflegte die Familie auch christliche Werte. Manfred ging nicht zu den Jungen Pionieren, sondern in die Christenlehre. Erst in der Oberschule trat er in die Freie Deutsche Jugend (FDJ) ein. „Aus opportunistischen Gründen“, sagt er. Sein Vater starb, als er 17 war, und die Mutter musste sich als Heimarbeiterin zu der bescheidenen Witwenrente etwas hinzuverdienen. Sie lebten in sehr einfachen finanziellen Verhältnissen.
Um die Zulassung zum Medizinstudium 1960 musste Manfred bis zuletzt fürchten, da man Arbeiterkindern den Vorzug gab; sein Vater aber Angestellter gewesen war. Da half es auch nicht, dass dieser einst in der SED gewesen war. Doch dann profitierte Manfred ausgerechnet von der Flucht einer Arztfamilie. Kinder von Medizinern wurden zu dieser Zeit ebenfalls bei der Studienplatzvergabe begünstigt. Diese Ausnahme machten die Genossen aus der Not heraus, denn oft waren Ärzte aus der DDR geflüchtet, weil ihre Kinder im Osten nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten durften. Kurz vor Semesterbeginn hatte wieder eine solche Familie aus Halle die Flucht ergriffen. Manfred bekam den frei gewordenen Medizinstudienplatz.
Manfred Kleiber
Zu einem Stipendium führte allerdings kein Weg. Wieder hieß es, Manfreds Vater sei Angestellter gewesen, kein Arbeiter. Manfred schrieb unterwürfige Gesuche an den Dekan der Martin-Luther-Universität, in denen er um ein begrenztes Arbeitsstipendium bat, auch weil er Schuhwerk für den Winter brauchte. Abgelehnt. Der Verweis, dass sein Vater gestorben und seine Mutter seit einigen Jahren Heimarbeiterin sei, nützte nichts. „Seine soziale Herkunft kann man nicht ändern“, hieß es lapidar im Ablehnungsschreiben. Zugleich erlebte Manfred, dass Kinder von akademisch gebildeten Führungskräften der „bewaffneten Organe“ die für Arbeiterkinder vorgesehenen Vergünstigungen bekamen. Da spielte es keine Rolle, ob der Vater Major der Nationalen Volksarmee oder Offizier bei der Polizei war, also an der Potsdamer Akademie oder anderswo studiert hatte. Die Kinder galten als aus der Arbeiterklasse stammend. Trotz dieser Erfahrungen schob Manfred Gedanken beiseite, in den Westen zu gehen. Er wollte seine Mutter nicht allein lassen und führte sein Studium auch unter materiell ungünstigen Bedingungen zu Ende.
Je wacher und geistig selbständiger er wurde, desto mehr durchschaute er die Indoktrinierung durch die FDJ und die allgegenwärtige Propaganda. Natürlich hörte er die westlichen Radiostationen, schaute Westfernsehen. Selbständiges Denken hatte ihm auch eine mutige Geschichtslehrerin an der Schule beigebracht. Sie vermittelte zwar das offizielle marxistisch-leninistische Geschichtsbild, verstand es jedoch, durch geschickte Fragen oder Formulierungen zwischen den Zeilen die Schüler kritikfähig zu machen. Bald nachdem Manfred sein Studium begonnen hatte, ließen ihn Ereignisse an der Universität sehr nachdenklich werden. Mehrere Professoren hatten sich mit einem Bittbrief höflich an die SED-Führung gewandt. Darin ging es unter anderem darum, dass an der Universität Russisch als Hauptfremdsprache gelehrt wurde, erst in zweiter Linie die anderen Wissenschaftssprachen. Für Manfred, der erst am Anfang seines Studiums stand, war so etwas natürlich von Belang. Er und seine Kommilitonen wollten weiter Englisch und Französisch lernen – und das nicht nur nebenher an der Volkshochschule. Aber die Bitte fand kein Gehör. Dafür wurden die Professoren auf Anweisung von DDR-Staats- und Parteichef Ulbricht persönlich gemaßregelt. Einige mussten ihre Posten räumen. Ulbricht hatte ihnen besonders übel genommen, dass sie sich auch öffentlich gegen Maßnahmen der SED gewandt hatten. Überall witterten die Genossen „Konterrevolution“.
Wie misstrauisch der Staat gegenüber den Bürgern war, erlebte Manfred auch bei einer Party seines Freundes, Wasja Götze. Der Künstler hatte in den 60er Jahren in seinem Haus und im Garten eine Bilderausstellung organisiert und diese im Überschwang der Jugend „Erste hallesche Hofgalerie“ genannt. Etwa fünfzig Leute vergnügten sich mit der Kunst und bei Jazzmusik. Plötzlich erschien ein Staatsanwalt mit Polizisten: „Das ist eine illegale Veranstaltung, die ist nicht angemeldet.“ Das Treffen wurde aufgelöst und Wasja Götze, der auch kein Stipendium erhielt, zu einer Geldstrafe verurteilt. Daraufhin ging in den folgenden Tagen im Freundes- und Bekanntenkreis eine Sammelliste für den Maler herum. Auf der entdeckte Manfred auch den Namen des berühmten Chirurgen Professor Schober. Noch heute ist er stolz, mit ihm auf dieser Liste gestanden zu haben; seine 3,50 Mark neben den 35 Mark vom Professor.
Manchmal erfuhr Manfred davon, dass Leuten die Flucht aus der DDR gelungen war. Eines Tages war auch sein Doktorvater weg. Dieser besaß einen slowakischen Pass und durfte ins westliche Ausland reisen. Er ging nach New York und war später Lehrstuhlinhaber in Stockholm. Die Studenten vermissten ihn sehr, sein Hörsaal war immer voll gewesen. So hatte er zum Beispiel nach der Ermordung von US-Präsident Kennedy über dessen Obduktion berichtet. Dabei gewesen war er nicht, aber er hatte Zugriff auf die aktuelle amerikanische Literatur. Unter vier Augen hatte der Professor auch keinen Hehl aus seiner demokratischen und daher antikommunistischen Grundhaltung gemacht.
Manfred wollte auch die Welt sehen. So oft es ging, fuhr er in Länder, in die DDR-Bürger reisen durften: nach Ungarn, Rumänien, in die Tschechoslowakei. Bei Aufenthalten in Prag 1966 und 1967 erlebte er die Entwicklung zu einem, wie es hieß, „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. Der angehende Mediziner war begeistert von der Tschechoslowakei unter Alexander Dubček. Der kommunistische Parteivorsitzende hatte politische und wirtschaftliche Reformen eingeleitet und die Zensur aufgehoben. In Prager Kinos liefen Westfilme in Originalsprache, es gab westliche Literatur, Zeitungen und Schallplatten zu kaufen. In der DDR war an solche Freiheiten nicht zu denken. In Prag gab es noch etwas anderes, für den Sozialismus Unerhörtes, und zwar Stripteaselokale. Die waren allerdings viel zu teuer, als dass der ostdeutsche Student seiner Neugier hätte freien Lauf lassen können. Doch es war für ihn auch ein Ausdruck von Freiheit, von Leben. Im August 1968 machte die Sowjetunion dem Traum ein jähes Ende, Truppen marschierten ein. Dubček wurde abgesetzt und der willfährige Gustáv Husák ins Amt gehievt. Auch in diesem Sommer fuhr Manfred nach Prag. Die offenen Proteste waren schon vorbei, aber er sah, dass die Prager Bürger viele Verkehrsschilder abmontiert oder immer mit dem gleichen Namen übermalt hatten: „Ul. Svoboda“ – „Straße der Freiheit“. Das sollte die Besatzer verwirren. Die Familie, bei der er übernachtete, warnte ihn eindringlich davor, in die Stadt zu gehen, es habe Todesopfer gegeben. Aber er ließ sich nicht abhalten und erlebte, wie Tschechen hinter russischen Soldaten ausspuckten. „Vor 24 Jahren waren hier die Nazis“, dachte sich der junge Ostdeutsche. „Und nun werden die Menschen schon wieder von übermächtigen Nachbarn daran gehindert, so zu leben, wie sie wollen.“ Nach der Niederschlagung des „Prager Frühlings“ war Manfred klar, dass DDR-Machthaber Ulbricht Oberwasser hatte. Und genau von diesem Zeitpunkt an wusste er: Die DDR war nicht sein Land. Aber wie rauskommen, wie die Mauer überwinden? Bald bemerkte er in seiner Umgebung, dass er mit diesem Gedanken nicht allein war.
Anfang der 70er Jahre herrschte eine eigenartig prickelnde Atmosphäre in der Universitätsklinik Halle – und nicht nur dort. Wenn Manfred am Montag früh zum Dienst erschien, wurde gefragt: „Sind noch alle da?“ Dann hieß es: „Ja, bei uns schon, aber aus der Pathologie fehlen zwei. Aus dem Institut nebenan sind auch einige weg.“ Nach dem Urlaub lautete die wichtigste Frage ähnlich: „Na, ist Müller wiedergekommen und was ist mit Meier?“ Den fehlenden Leuten war meist die Flucht aus der DDR gelungen oder sie saßen im Gefängnis. Zwei Fachkräfte, die geschnappt wurden, tauchten nach wenigen Wochen wieder in der Klinik auf. Man hätte ihnen verziehen, sagten sie, die Genossen trauten ihnen. Aber die anderen Mitarbeiter wurden den beiden gegenüber sehr vorsichtig, glaubten doch alle, sie seien von der Staatssicherheit umgedreht und zum Bespitzeln ihrer eigenen Kollegen eingesetzt worden.
Jetzt wollte auch Manfred mit einem Freund einen Weg aus der DDR suchen. Sie fuhren mit dem Auto in die Tschechoslowakei und dort so nahe wie möglich an der Grenze zu Österreich entlang. Angeblich sollte die Bewachung hier nicht ganz so scharf sein wie an der Grenze zur Bundesrepublik. Die Freunde hatten sich regelrechte Szenarien ausgedacht, wollten nachts das Auto mit Benzin überschütten, anzünden und davonrennen. Dann würden die Grenzer zu dem Wagen laufen und sie könnten einige Hundert Meter weiter ungestört den Stacheldraht überwinden. Aber es blieb ein Traum. Bald darauf standen sie in Rumänien an der Donau und schauten nach Jugoslawien hinüber. Sie dachten daran, nachts über den Fluss zu schwimmen. Einen Tag lang beobachteten sie das Gelände und sahen keinen Grenzposten. Abends erzählten sie einem Rumäniendeutschen, bei dessen Familie sie übernachteten und mit dem sie offen sprechen konnten, von ihrem Plan. Der warnte sie: „Jungs, wenn ihr da rüberkommt, liefern die Serben euch aus. Die bekommen Fangprämien von der DDR. Oder habt ihr Geld und könnt sie bestechen?“ Die jungen Männer hatten von solchen Fluchten gehört. Aber da standen Westdeutsche, die wegen ihrer harten D-Mark gern gesehen waren, im Wohnmobil auf der jugoslawischen Seite. Dort wurden die Flüchtlinge eingekleidet und zur westdeutschen Botschaft nach Belgrad gefahren. Von dort konnten sie mit bundesdeutschen Pässen das Land in Richtung Westen verlassen. Jugoslawien kreierte einen etwas freieren Sozialismus. Machthaber Tito gefiel sich in einer Sonderrolle und wollte es sich mit dem Westen nicht verscherzen. Deshalb ließ die DDR ihre Bürger dort in der Regel auch nicht hin. So fuhren Manfred und sein Freund wieder heim.
In diesem Sommer wurden sie am Graebsee bei Halle auf einen Freund aufmerksam. Er war etwas älter als sie, und sie staunten, wie er fast täglich wagemutig von der höchsten Klippe in den See sprang. Sie dachten, er wollte den Mädchen imponieren. Später erfuhren sie jedoch, dass er auf einer Reise vom DDR-Urlauberschiff „Völkerfreundschaft“ gesprungen war. Sein Onkel, ein Schnellbootkommandant der Bundesmarine, war zum verabredeten Zeitpunkt an der richtigen Stelle in der Ostsee und hat den Flüchtling an Bord genommen.
Solche lebensbedrohlichen Sachen schieden für Manfred aus. Er kümmerte sich erst mal weiter um sein berufliches Fortkommen als Rechtsmediziner, promovierte und hatte auch Spaß an der Arbeit. Aber 1974 ereilte ihn, was in der Regel auf jeden DDR-Akademiker zukam, wenn er für eine wissenschaftliche Universitätskarriere geeignet war: die Forderung nach gesellschaftlichem Engagement. Eigentlich wollte er von diesen Dingen nichts wissen. Einmal hatte er schon um des lieben Friedens willen nachgegeben. In der DDR wetteiferten die „sozialistischen Brigaden“ und „Kollektive“ immer wieder um irgendwelche Ehrentitel und vor allem um die damit verbundenen Prämien. Eines Tages bekam sein Kollektiv eine Prämie nicht, weil Manfred als Einziger nicht in der Gewerkschaft war. Diese Organisation hatte er nie ernst genommen, weil die überwiegende Mehrheit der Funktionäre der herrschenden SED angehörten und treu den „Klassen- und Parteiauftrag“ erfüllten – im Zweifel gegen die Interessen der Mitglieder. Aber seinen Kollegen zuliebe trat Manfred dann doch in die Gewerkschaft ein und, weil er gerade dabei war, auch gleich noch in die „Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft“. Doch von ihm wurde mehr verlangt. Sein Chef bat ihn eines Tages zu sich und erklärte ihm sehr freundlich: „Sie haben gute Ansätze, in der Wissenschaft etwas zu werden. Die Parteileitung der Universität hat mich deshalb beauftragt, Ihnen anzutragen, Mitglied der Partei der Arbeiterklasse zu werden. Wenn Sie ihren Weg machen wollen, dann gehört gesellschaftliches Engagement dazu.“ Aus deren Sicht war das eine Ehre, dass sie ihn aufforderten, als Arzt in die Arbeiterpartei einzutreten. Manfred antwortete hinhaltend.
Kurze Zeit später geschah noch etwas, das ihm deutlich machte, dass er schleunigst aus der DDR herausmusste. Die Freundin seiner Freundin war mit einem offiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit liiert. Das wusste Manfred. Eines Tages holte er seine Freundin von dem Paar ab und sie plauderten noch etwas in der Wohnung. Dabei sagte der Stasimann ganz freundschaftlich zu ihm: „Mensch, Sie sind doch Gerichtsmediziner, solche Leute wie Sie können wir gut gebrauchen. Überlegen Sie sich doch mal, ob Sie nicht bei uns anfangen wollen.“ Manfred erschrak, zeigte es aber nicht und antwortete wieder hinhaltend. Er sah es als zweiten Warnschuss kurz hintereinander und dachte sich: „Wenn du jetzt nicht machst, was du die ganzen Jahre schon wolltest, dann musst du demnächst Farbe bekennen und denen ganz offen sagen: ‚Ihr könnt mich mal.‘ Und dann bist du weg vom Fenster.“
Aber wie flüchten? Von Fluchthilfe hatte er gehört. Doch seine Westverwandten konnten nicht in Vorkasse gehen und einen Fluchthelfer bezahlen. Da half ihm ein Bekannter, ein ausländischer Student, der einige Zeit in Halle studiert hatte, inzwischen im Westen lebte und hin- und herreisen durfte. In der Nacht vor der Flucht vertraute sich Manfred einem Freund an, der ebenfalls Arzt war. Ihn bat er, sich um seine Mutter zu kümmern. Mit der lebte Manfred selbst als Doktor noch in einer Zweizimmerwohnung zusammen. Eine eigene Wohnung bekam er nicht, auch ein Grund, weshalb er dem Sozialismus wenig abgewinnen konnte. Wenn die Mutter nach seiner Flucht in ein Altersheim müsste, sollte der Freund mit Bestechungsgeld dafür sorgen, dass sie nicht in das in der Beesener Straße kommt, wo es Fünf- und Achtbettsäle gab. Von dort hatten sie in der Gerichtsmedizin monatlich einen Selbstmord auf dem Tisch. Er gab dem Freund Geld, das er in Vorbereitung auf die Flucht jahrelang in kleinen Beträgen vom Konto abgehoben und zu Hause aufbewahrt hatte. Er wusste, die Sparkassen meldeten den Sicherheitsbehörden, wenn jemand größere Beträge vom Konto abhob oder ein gut gefülltes Konto sogar schloss. Wer das tat, wurde überprüft. Seiner Mutter die Flucht anzukündigen ging nicht. Das hätte sie aufgeregt und später in Schwierigkeiten gebracht, beim unausweichlichen Verhör. Einige Tage vor der Flucht erzählte er ihr, dass er den Jahreswechsel an der Ostsee verbringen würde.
Am 27. Dezember 1974 kaufte er, nachdem er sein Auto am Bahnhof geparkt hatte, eine Fahrkarte nach Peißen, nahe der Autobahn. Die kostete 60 Pfennige, das weiß er noch genau. Der Zug brauchte nur eine Viertelstunde. Er stieg aus, weit und breit war in der Dämmerung kein Mensch zu sehen. Er lief durch den Ort und sah auch den 450er Mercedes wie verabredet stehen. Der Wagen war nicht abgeschlossen, niemand saß drin. Er sah sich noch einmal um, dann öffnete er den Kofferraum und war blitzschnell darin verschwunden. Er hatte einen Mantel an, seinen Ausweis und seine Approbation dabei und wartete still. Ihm ging durch den Kopf: „Wenn sie dich schnappen, bekommst du schlimmstenfalls 13 Jahre Knast.“ Er hatte von einem Arzt gehört, der nach einer missglückten Flucht zu so vielen Jahren verurteilt worden war. Gegen die Unruhe hatte er „Faustan“ eingesteckt, im Volksmund „Leck-mich-Pillen“ genannt. Diese hatte er in ein Fläschchen umgefüllt, auf dessen Etikett zu lesen war: „Medikament gegen Gallenkolik“. So ein Medikament, hoffte er, würden die Genossen ihm im Falle eines Verhörs nicht wegnehmen, weil denen ein Opfer mit Schmerzanfällen ja auch nicht so recht gewesen wäre. Er nahm vorsorglich einige der kleinen grünen Pillen.
Nach einer gewissen Zeit hörte er Schritte, jemand stieg ein und fuhr los. Dann eine Stimme: „Sind Sie da?“ – „Eine weibliche Stimme“, dachte er verdutzt und antwortete: „Ja.“ Die Frau sagte: „Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles im Plan. Geht es Ihnen gut, frieren Sie? In ein paar Stunden sind wir da.“ Nach zwei Stunden sagte die Frau: „Wir nähern uns jetzt dem Grenzübergang. Verhalten Sie sich ruhig, machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles gutgehen.“ Er hörte die Aufforderung des Grenzers, die Papiere abzugeben und sandte Stoßgebete zum Himmel. Jeden Moment rechnete er damit, dass es hieß: „Machen Sie den Kofferraum auf.“ Höchste Anspannung. Ohne das Beruhigungsmittel hätte er das Ganze wohl nicht durchstanden. Das Auto setzte sich wieder in Bewegung, hielt erneut, die Frau bekam ihre Papiere zurück. Langsam ging es weiter.
DDR-Grenzkontrollpunkt Drewitz, Richtung Westberlin, 1990. © Constantin Hoffmann
Manfred ahnte nicht, was da draußen ablief. Er war ja noch nie durch so eine Kontrolle gefahren. Dann gab die Fahrerin auf einmal Gas und rief euphorisch: „Jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei, ich halte gleich an, haben Sie noch Geduld. Geht’s Ihnen gut? Einen Moment noch.“ Dann plötzlich scharfes Bremsen. Die Ecke wird er nie vergessen: Wenn man hinter Dreilinden von der Autobahn in Richtung Zehlendorf abfährt, gleich die nächste Straße rechts hinein. Das Erste, was er sah, als der Kofferraum geöffnet wurde, war eine Litfaßsäule, von einer Straßenlaterne beschienen, daneben eine junge Frau. Dieser fiel er um den Hals und küsste sie links und rechts. Aber schnell hatte er sich von der Aufregung wieder erholt. Die Frau, deren Namen er bis heute nicht weiß, brachte ihn noch zu Freunden, dann sah er sie nie wieder. Es dauerte eine Zeit, ehe er das alles fassen konnte.
Am nächsten Morgen setzte sich Manfred schon früh ans Telefon und begann sich die Finger wund zu wählen. Es gab damals nicht viele Leitungen über die Grenze. Er wollte einen Kollegen in Halle erreichen, einen Arzt in der Nervenklinik. Irgendwann im Laufe des Vormittags klappte es. Manfred bat ihn, bei seiner Mutter vorbeizuschauen und ihr zu sagen, dass ihr Sohn jetzt im Westen ist. Er machte den Kollegen noch darauf aufmerksam, dass man ihm einen Strick daraus drehen könnte, wenn er die Nachricht überbringt, ohne es vorher der Polizei zu melden. Aber von der sollte seine Mutter es nicht zuerst erfahren. Der Kollege könnte außerdem gleich helfen, falls die Mutter die Nachricht doch nicht so gut verkraften würde, wie er es erwartete. Von wo genau er anrief, sagte Manfred nicht. Er wollte seinen Fluchtweg verschleiern, um nicht die Leute zu gefährden, die ihm geholfen hatten. Der Kollege fragte noch einmal: „Du machst auch keinen Quatsch?“ Der Anrufer aus dem Westen versicherte: „Ich bin klar und nüchtern.“ Es war alles nicht leicht gewesen für den Kollegen, aber er hat es getan. Seinem Chef auf der Station musste der Kollege von diesem Telefongespräch ebenfalls berichten. Anrufe aus dem Westen im Dienst waren meldepflichtig. Der Chef informierte dann Manfreds Vorgesetzten und dieser die DDR-Behörden. Dem Fahrer des Instituts, mit dem Manfred per du war, schickte er eine Neujahrskarte, die er in München einstecken ließ: „Wenn jemand fragen sollte, warum ich abgehauen bin, mir hat es immer so gezogen in deinem ollen Wolga.“ Beschimpfungen, Schuldzuweisung, Entschuldigungen, die andere Flüchtlinge oft hinterließen, waren nicht seine Sache. Aus den Stasiakten geht hervor, dass sie seine Flucht auch nicht zu rekonstruieren vermochten. Von seiner Mutter erhielt er bald telefonisch gute Nachrichten. „Sie ist zwar traurig, aber sie versteht dich“, erzählte der Freund, dem er das Geld gegeben hatte. Ihn hatte Manfred bewusst nicht als Ersten gebeten, die Nachricht seiner Flucht zu überbringen, um zu vermeiden, dass die Staatssicherheit auf ihn aufmerksam wird. Später gelang es dem Freund tatsächlich, mithilfe des Geldes die Mutter in einem annehmbaren Altersheim unterzubringen.
In den folgenden Tagen organisierte Manfred sein neues Leben in Westberlin. Bei aller Freude hatte er in der geteilten Stadt aber immer ein mulmiges Gefühl auf der Straße. Freunde warnten ihn: „Steige nie in die S-Bahn, die wird von Ostberlin verwaltet. Wenn dich da welche festhalten, kann dir die Westberliner Polizei nicht helfen.“ Dass die Staatssicherheit schon Leute aus dem Westen in den Osten verschleppt hatte, war bekannt. Zudem hatte er aus Halle gehört, dass die Staatssicherheit seinetwegen ganz schön in Aufregung geraten war. Nur wenige Tage nach seiner Flucht bekam das Institut für Gerichtsmedizin eine neue Schließanlage, die schon seit Jahren bestellt war. Denn die Staatssicherheit vermisste zwei Schlüssel, die sie auch bei der Durchsuchung der Wohnung von Manfreds Mutter nicht gefunden hatten. Die Genossen malten sich wohl aus, dass eventuell die CIA über Manfred Zugang zum Institut erhielt. Er hatte allerdings selbst keine Ahnung, wo die Schlüssel abgeblieben waren. Die Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes im Auffanglager Marienfelde sprachen ihn auch nicht darauf an. Es war allerdings doch eine so interessante Angelegenheit, dass sich die Befragung über mehrere Tage erstreckte. Manfred vermutet, dass unterschiedliche Abteilungen etwas wissen wollten. Einmal wurden er und ein weiterer Flüchtling nach Berlin-Dahlem gefahren, in einem großen Wagen, der ihm imponierte, mit einem schwarzen GI am Steuer. Bei dieser Fahrt durch Westberlin, mit dem Ziel CIA, kam sich Manfred tatsächlich wie ein Verräter vor. So nachhaltig hatte die DDR-Propaganda auch auf ihn gewirkt. Die Amerikaner wollten wissen, ob er Raketentransporte auf den Straßen gesehen habe. Da musste er passen. Sie wussten, dass er beruflich mit der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft zu tun hatte. Sie kannten auch Namen von Staatsanwälten. Die Befragung dauerte nicht lange. Es gab Essen und Zigaretten.
Eine Arbeit zu finden war nicht leicht für den Flüchtling aus dem Osten. Rechtsmediziner wurden in Westberlin zu diesem Zeitpunkt nicht gerade gesucht. Da entsann sich Manfred seines Doktorvaters. Vielleicht konnte der ihm helfen. Auf der Suche nach dessen Adresse in Schweden nahm Manfred Kontakt mit dem Institut für Rechtsmedizin in Hamburg auf. Dort lud man ihn ein. Er flog hin. Über der DDR hatte er ein komisches Gefühl. Er dachte: „Wenn wir jetzt notlanden müssen, dann ist es aus. Dann war alles umsonst.“ Dieses Gefühl begleitete ihn noch lange auf Flügen von und nach Westberlin. Manchmal hatte er auch Alpträume von seiner Gefangennahme. Später fuhr er einmal mit einem Kollegen in dessen Auto durch Schleswig-Holstein und war eingeschlafen, als der Wagen plötzlich hielt. Manfred wachte auf und es durchzuckte ihn: „Uniformen.“ Wieder sah er sich für Sekunden im DDR-Gefängnis. Aber es waren westdeutsche Beamte, die den Verkehr umleiteten. Die Hamburger Kollegen boten der Fachkraft aus Halle eine Stelle an der Universität an, die er gerne annahm. Sein neuer Chef vermietete ihm eine kleine Eigentumswohnung. Die ersten Monate konnte er dort so-gar mietfrei wohnen. Er arbeitete begeistert. Mit Eingang des ersten Gehalts begann er, die Kosten seiner Flucht zurückzuzahlen, das waren einige Zehntausend Mark. Bei den Behörden in Westberlin hatte er wohlmeinende Ratschläge bekommen: „Zahlen Sie nicht, nehmen Sie sich einen Anwalt. Das sind nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch unanständige Geschäfte. Das ist Ausnutzen einer Zwangslage.“ Aber er fühlte sich dem Bekannten doch sehr verpflichtet, der ihn aus der DDR herausholen ließ. Und so hielt er sein Geld zusammen. Er erinnert sich noch gut, wie er am Anfang in Hamburg bei einem Italiener Spaghetti Bolognese und ein Bier bestellte und bei der Rechnung baff war. Er dachte: „Das wirst du dir so schnell nicht wieder leisten.“ Aber es pegelte sich alles ein. Im Institut wurde er sehr nett aufgenommen und regelrecht herumgereicht. Jeder war neugierig auf einen jungen Mann, der es geschafft hatte, aus der DDR zu flüchten. Dabei traf Manfred auch auf Edelkommunisten, Angehörige der 68er-Bewegung, Akademiker, die ihm sagten: „Doktor, wir verstehen, dass Sie diesen Sozialismus verlassen haben, aber glauben Sie uns, Sie sind auf ein sinkendes Schiff aufgesprungen.“ Das waren Leute, die es gut mit ihm meinten und er hat auch darüber nachgedacht. Andere Leute schenkten ihm den gebrauchten Mercedes ihrer Kinder, die als Entwicklungshelfer nach Afrika gegangen waren. Seine Mutter sah Manfred noch zwei Mal, als sie zu Besuch im Westen war. Allerdings hatte sie jeweils eine Reise zu ihrer Cousine im Ruhrgebiet beantragt, weil sie fürchtete, die Genossen würden sie sonst nicht hinauslassen. Und tatsächlich, im Jahr 1981 wurde ihr plötzlich auch eine Reise zu ihrer Cousine verboten. Ohne Begründung. Einen Tag später erlitt sie einen Schlaganfall und verstarb wenig später. Manfred vermutet einen Zusammenhang. Die Beerdigung musste ohne ihn stattfinden.
Bis 1983 traute sich Manfred nicht, über die Transitwege nach Westberlin zu fahren. Aber dann ereignete sich ein Vorfall, nach dem er es doch wagte. Ein Gastwirt aus Bremen hatte sich, auch wenn es verboten war, auf der Transitstrecke mit DDR-Verwandten getroffen und ihnen kleine Geschenke überreicht: Kaffee, Strumpfhosen und Ähnliches. Das hatten Stasileute beobachtet und an den Grenzposten gemeldet, woraufhin der Mann besonders gründlich kontrolliert wurde. Während der Visitation erlitt der Bremer Gastwirt einen Herzinfarkt und verstarb. Allerdings wies das Gesicht blaue Flecke auf. Die DDR-Behörden erklärten, der Mann sei infolge des Infarkts im Kontrollraum gegen eine Heizung gefallen. Die Wellen in den Westmedien schlugen hoch. War der Mann von brutalen Grenzern geprügelt worden? Der Leichnam wurde nach Hamburg übergeführt und ausgerechnet von Manfred obduziert. Schläge konnte er nicht beweisen, sie jedoch auch nicht völlig ausschließen. Der Vorfall führte zu großen innerdeutschen Spannungen, sodass die DDR-Behörden sich genötigt sahen, den angeblichen Sturz gegen den Heizkörper nachzustellen. Dazu fuhr Manfreds Hamburger Chef zum Ort des Geschehens an die Grenze. Auch das DDR-Fernsehen war dabei. Im Interview der Nachrichtensendung „Aktuelle Kamera“ verwies Manfreds Chef auf seinen Assistenten, der die Obduktion vorgenommen hatte. Der sei ein sehr guter Mann. Auch der anwesende DDR-Vertreter, Professor Prokop, dessen Prüfling Manfred gewesen war, fand lobende Worte. Er kenne den Assistenten und vertraue dessen