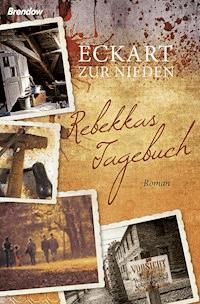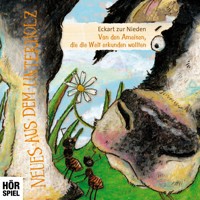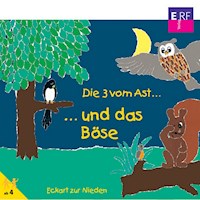Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Augenzeugen berichten auf eine ganz andere Weise als diejenigen, die eine Nachricht nur aus zweiter Hand weitergeben. In diesem Buch kommen siebzehn Männer und Frauen zu Wort, die den außergewöhnlichen Menschen Jesus persönlich erlebt haben. Sie erzählen von ihren Begegnungen mit ihm, von den Momenten, in denen ihr Leben durch seine Worte, Taten und die Begegnung mit ihm in Bewegung gesetzt wurde. Jede Geschichte ist einzigartig und zeigt, wie tief die Begegnung mit Jesus das Leben dieser Menschen verändert hat. Von der ersten Überraschung und Faszination bis hin zu den weitreichenden Folgen, die diese Begegnungen für sie und ihre Gemeinschaften hatten – diese Zeugnisse aus der Zeit des Neuen Testaments bieten einen persönlichen und lebendigen Blick auf das Leben und Wirken Jesu und auf das, was es für die Menschen von damals wie für uns heute bedeutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich war Augenzeuge
Menschen der Bibel begegnen Jesus
Eckart zur Nieden
Impressum
© 2016 Folgen Verlag, Bruchsal
Autor: Eckart zur Nieden
Lektorat: Mark Rehfuss, Schwäbisch Gmünd
ISBN: 978-3-944187-61-7
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Der Gelehrte aus Mesopotamien (Matthäus 2)
Der Gelähmte mit seinen Freunden (Lukas 5)
Der Standortoffizier aus der Garnison Kapernaum (Lukas 7)
Die Halbweltdame mit der veränderten Haltung (Lukas 7)
Der Unentschlossene vom See Genezareth (Matthäus 8)
Der Pastor mit der todkranken Tochter (Lukas 8)
Der Ratsherr und sein diskreter Besuch (Johannes 3)
Der Pflegefall aus dem Siechenhaus (Johannes 5)
Der Vater mit seinem Sorgenkind (Markus 9)
Der Leprakranke und seine neun Leidensgenossen (Lukas 17)
Die Lebedame oder das Ende der Unmoral (Johannes 8)
Der Blinde aus der Palmenstadt (Lukas 18)
Der Steuerinspektor und seine Kletterpartie (Lukas 19)
Der Wachbeamte mit dem delikaten Auftrag (Johannes 18)
Der römische Offizier und das Exekutionskommando (Lukas 23)
Die Anhängerin aus dem Dorf Magdala (Johannes 20)
Der nächtliche Wanderer und sein Freund (Lukas 24)
Der Gelehrte aus Mesopotamien
Noch heute sehe ich mich in der Erinnerung auf dem Kamel hocken, am Sattelknauf festgeklammert, mit diesem flauen Gefühl im Magen von der ewigen Schaukelei, aber den Blick fest nach oben gerichtet. Nacht für Nacht ritten wir so durch die Wüste.
Nicht nur, um der größten Hitze zu entgehen, reisten wir nachts, sondern vor allem deshalb, um den Stern nicht aus den Augen zu verlieren, der ja die Ursache dieser Expedition war.
Sie müssen wissen, dass wir den Nachthimmel nicht nur beobachten, sondern auch deuten. Seit alter Zeit halten wir an der Tradition fest, dass zwischen dem Lauf der Gestirne und dem Geschehen auf der Erde ein Zusammenhang besteht. Genaues wissen wir in diesen Fragen zwar nicht, aber es gehört zum Wesen des Menschen, dass sein Wissen immer bruchstückhaft und ungenau bleibt. Auch wer das weiß, wird nicht aufhören zu suchen. Erst recht nicht, wenn er forschender Wissenschaftler ist.
Als wir den Stern entdeckt hatten, war das eine wissenschaftliche Sensation. Nächtelang standen wir auf dem Turm und schauten und maßen und diskutierten. Das war eine Aufregung in Fachkreisen! So etwas hatte es noch nie gegeben, solange unsere Fakultät ihre Forschungen anstellte!
Der neue Stern erschien in einer Konstellation, die auf zweierlei hindeutete: auf das Volk der Juden und auf die Geburt eines Königs. Hinzu kam, dass man in jener Zeit viel davon sprach, aus dem Volk der Juden sollte ein mächtiger Herrscher hervorgehen. Wir Sternkundigen wussten besonders viel über die Erwartung, denn wir konnten sie mit der Überlieferung der Juden in Verbindung bringen. Sie wissen sicher, dass sie ein paar hundert Jahre vorher als Gefangene in Babel waren. Als Kyrus sie freiließ, blieben viele da und prägten mit ihrem Glauben zu einem gewissen Teil auch unsere Kultur. Einer ihrer geistigen Führer, Daniel, war damals Rektor unserer Universität. Aus dieser Zeit stammte die Tradition, dass ein großer jüdischer König erwartet wurde. Die Propheten dieses Volkes sollen ihn schon vor langer Zeit angekündigt haben.
Eines Tages fassten wir also den Entschluss, mit einer Abordnung namhafter Wissenschaftler hinzureisen und der Sache auf den Grund zu gehen. Auf diese Weise kam es zu diesem endlos scheinenden Ritt durch die nächtliche Einsamkeit. Mir tut heute noch der Rücken und dessen Verlängerung weh, wenn ich daran denke. Doch, Spaß beiseite – es war ja eine ernste wissenschaftliche Untersuchungskommission, die da durch die Wüste schaukelte. Und das Objekt, das es zu untersuchen galt, faszinierte uns alle ungeheuer.
Neugier und Spannung ließen uns alle Strapazen unwichtig erscheinen. Was würden wir wohl antreffen? Einen kleinen Prinzen, der im Palast geboren und mit einem rauschenden Fest begrüßt wurde? Oder einen Knaben aus einem anderen vornehmen Haus, der erst später König werden sollte? Dann freilich dürfte von seinem Genius noch nicht viel zu sehen sein. Denn wenn wir annahmen, dass er bei Erscheinen des Sterns geboren wurde, konnte er jetzt kaum über ein Jahr alt sein.
Damaskus ließen wir rechts liegen und kamen von Nordosten her ins Land der Juden. Wir konnten uns in der aramäischen Handelssprache ganz gut verständigen und fragten uns bis nach Jerusalem durch.
Kennen Sie Jerusalem? Nicht so imponierend wie Babel, erst recht nicht wie Rom. Aber es wirkt auch nicht provinziell. Das kommt durch die beherrschende Lage auf dem Höhenzug und vor allem durch den imponierenden Bau des Tempels. Lachen Sie mich nicht aus, aber ich dachte zunächst, das sei der Königspalast. Eine riesige Anlage mit Hallen und Arkaden und in der Mitte der gewaltige Quader des Tempels mit vergoldeten Zinnen. Dagegen nahm sich die Burg gleich nebenan schon bescheidener aus, wenn sie auch mit ihren vier mächtigen Ecktürmen durchaus imponieren konnte. Aber diese Burg war der Sitz des römischen Statthalters. Erst an dritter Stelle kam der vergleichsweise bescheidene Palast des Königs. Der König hätte das gern anders gehabt, wie wir bald merkten, aber er konnte nicht an den tatsächlichen Machtverhältnissen vorbei, die sich in den Bauten widerspiegelten: erst die Religion, das fromme Judentum, Synhedrium, Hohepriester usw., dann die römische Besatzung mit der äußeren Gewalt, aber ohne Einfluss auf Denken und Fühlen der Menschen. Und erst dann kam der König Herodes. Wenn die Römer ihn nicht gestützt hätten, wäre er längst hinweggefegt worden, denn er war im Volk verhasst. Er war kein reiner Jude; es floss edomitisches Blut in seinen Adern. Zwar versuchte er, sich beliebt zu machen so hatte er z. B. den Tempel vergolden lassen, aber man verzieh ihm seine Grausamkeiten nicht. Die Familie der Makkabäer, die vor ihm regiert hatte, rottete er grausam aus, und dann begann er aus krankhafter Eifersucht sogar in seiner Familie einen nach dem anderen zu ermorden.
Ich hoffe, ich langweile Sie nicht mit dieser Schilderung der politischen Verhältnisse jener Zeit. Sie sollten sie kennen, um das Folgende zu verstehen. Wir nämlich wussten zu wenig, und es hätte fast ein tragisches Ende genommen, als wir so ahnungslos in diese hochbrisante Situation hineinstolperten und nach einem neuen König fragten.
Nachträglich muss ich wirklich zugeben, dass wir uns ausgesprochen naiv benommen haben. Wenn ein neuer König geboren wurde – so meinten wir –, müsste er auch im Palast zu suchen sein. Das einzige, was bei uns leise Zweifel aufkommen ließ, war die Enttäuschung, dass der König nicht der unumschränkte und anerkannte Herrscher zu sein schien, der einem noch größeren Sohn den Weg in ein goldenes Zeitalter hätte bereiten können.
Dass Herodes ein wahnsinniger Despot war, erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand. Wir hatten das mitbekommen, wenn wir gelegentlich in einer Karawanserei eingekehrt waren. Aber Wahnsinn und Genius liegen ja sehr eng beieinander. Seine krankhafte Machtbesessenheit war kein Beweis gegen seine Genialität, so dass er den Beinamen »der Große« in einem gewissen Sinn zu Recht trug. Nur – ob aus solch einem Haus der neue große Herrscher kommen sollte?
Da wir’s aber nicht besser wussten, fragten wir uns bis zum Königspalast durch. Als wir, von einer neugierigen Gafferschar verfolgt, am Tor ankamen und unser Anliegen vortrugen, ging zunächst ein großes Flüstern bei den Bediensteten los. Als dann offenbar ein allerhöchster Befehl eingetroffen war, begann eine rege Betriebsamkeit. Man lud uns herein, kümmerte sich um die Reittiere, gab uns Gelegenheit, uns frisch zu machen und führte uns schließlich in den Audienzsaal.
Herodes empfing uns ausgesprochen freundlich. Von einem Tyrannen hatte er gar nichts an sich. Heimlich taten wir Abbitte für unsere negativen Vorstellungen. Wir hatten ja keine Ahnung, was in ihm vorging, keine Ahnung, dass er jeden Konkurrenten für den Thron ermorden ließ; keine Ahnung, dass erst kürzlich ein solches Massaker stattgefunden hatte; keine Ahnung, dass inzwischen die ganze Stadt, durch Gerücht von unserem Anliegen informiert, bereits zitterte, was für Grausamkeiten er sich nun einfallen lassen würde.
Nein, ein Sohn sei ihm in den letzten Jahren nicht mehr geboren worden, bedauerte Herodes, da könne er nicht helfen. Aber er wisse wohl, dass es diese Prophetie auf einen großen König Israels gebe, und wenn wir nun diese Erscheinung beobachtet hätten, dann müsse man das durchaus ernstnehmen. Er wäre ja der erste, der sich freute, wenn die politische Verwirrung endlich ein Ende nähme. Ja, er wolle sich persönlich darum kümmern, dass wir die nötigen Informationen erhielten. Wir sollten es uns nur bequem machen und uns in der Zimmerflucht wie zu Hause fühlen, die die Diener uns zeigen würden. Noch an diesem Abend wolle er geeignete Schritte unternehmen … usw.
Wir waren gerührt über soviel Freundlichkeit und zogen uns in die Gästezimmer zurück. Erfreut beobachteten wir, wie sofort die Boten aus dem Hof hasteten. Bereits kurze Zeit später setzte eine Bewegung in die andere Richtung ein: die Gerufenen eilten herbei.
Vornehme Herren, wie man an der Kleidung erkennen konnte, Priester und Gelehrte. O ja, er schien sein Volk in Zucht zu haben, dieser Herodes. Wenn er rief, mussten die Herren eilen, und zwar in großer Zahl. Die Auskunft, die er brauchte, hätte ihm vielleicht auch ein einziger Sachkundiger geben können. Aber das genügte ihm nicht. Alle mussten her, wenn der König sie brauchte. Nun, uns konnte das nur recht sein.
Kaum hatten wir uns gestärkt mit dem, was man uns auftischte, wurden wir wieder zum König geladen. Er strahlte über das ganze Gesicht, als er uns händereibend erzählte, seine Nachforschungen hätten Erfolg gehabt.
Wann denn der Stern erschienen wäre, wollte er wissen. Und ob man daraus den Schluss ziehen könne, dass der zukünftige Herrscher jetzt gut ein Jahr alt sein müsse? Natürlich wussten wir das auch nicht genau und sagten ihm das. Aber er war schon zufrieden.
Er sei in der glücklichen Lage, uns sogar den genauen Ort nennen zu können, in dem das Kind nach den alten Prophezeiungen geboren werden sollte: Bethlehem. Nur eine Reitstunde von hier entfernt, in südlicher Richtung. Wir könnten es gar nicht verfehlen. Und wenn wir das Kind gefunden hätten, schärfte er uns ein, sollten wir eiligst zu ihm zurückkommen und darüber berichten. Er wolle dann der erste sein, der dem neuen Herrscher huldige.
Wir waren glücklich, so schnell ans Ziel zu kommen. Unserer Absicht, noch in dieser Nacht hinzureiten, wenn es so nah war, wurde nichts in den Weg gelegt. Im Gegenteil, Herodes ermunterte uns dazu noch. So freundlich und ausgesucht höflich schickte er uns auf den Weg, dass ich mich in den Straßen Jerusalems dabei ertappte, wie ich mich umsah, ob er uns vom Palastfenster aus nicht noch nachwinkte.
Die naheliegende Frage, warum denn niemand mit uns ritt, kam uns gar nicht. Wenn Herodes soviel Wert auf die Bekanntschaft dieses Kindes legte, und wenn die Gelehrten es so genau wussten … Warum schickten sie uns dann allein auf den unbekannten nächtlichen Weg? Aber, wie gesagt, dieser Gedanke hatte in unseren erwartungsfrohen Herzen keinen Platz.
Noch glücklicher wurden wir, als wir nun wieder den Stern erblickten. In der letzten Zeit war er nicht mehr zu sehen gewesen. Jetzt aber stand er wieder klar und leuchtend über uns, nein, genauer, über dem Dorf, dessen Silhouette sich auf dem Höhenzug gegen den Nachthimmel abhob. Das musste Bethlehem sein. Wo aber sollten wir nun nach dem Kind suchen? Ob der Gott, der unseren bisherigen Weg so zielsicher geführt hatte, auch auf den nächsten Schritten helfen würde?
Plötzlich hatten wir den Eindruck, dass der Stern unmittelbar über einem bestimmten Haus stand, das sich am Hang über uns erhob. Ob dort unser Ziel war? Nun, fragen mussten wir irgendwo. Warum also nicht hier? Wir stiegen von unseren Kamelen.
Während wir hinaufgingen, verstärkte sich der Eindruck immer mehr, dass der Stern auf dieses Haus hinwies. In froher Spannung machten wir uns bemerkbar, und zwängten uns in die bescheidene Hütte.
Ein Mann trat uns entgegen und grüßte uns. Wir wollten den neugeborenen König sehen, sagten wir. Wir seien von weither gekommen, um ihm zu huldigen. Erst als die Worte heraus waren, kam mir das Seltsame an dieser Situation zu Bewusstsein. Wenn das nun nicht die richtige Adresse war? Wir brachen hier mitten in der Nacht in ein friedliches Heim ein und suchten in einer kleinen Hütte einen zukünftigen großen Herrscher. So betrachtet geradezu absurd!
Aber zu meinem eigenen Erstaunen wunderte sich der Mann gar nicht. Er rief seine Frau heran. Sie trat ins Licht unserer Lampen und begrüßte uns. Mit Maria stellte ihr Mann sie uns vor. Er selber hieß Josef.
Ja, und? Die Hauptperson?
Der Junge war von unserm Lärm aufgeweckt worden. Seine Mutter ging zurück und nahm ihn zu sich. Scheu schmiegte er sich an. Dieses Kind …?
Ich gestehe, ich war etwas verwirrt von all dem Erlebten. Noch hatte ich in meiner Vorstellung das Bild eines von Ammen und Leibwachen umstellten Prinzen. Das machte es mir schwer, in dieser Ärmlichkeit den Anbruch eines neuen Zeitalters zu erkennen. Aber meine Freunde taten sich nicht so schwer. Sie fielen auf ihre Knie nieder und huldigten dem Kind, das mit großen verständnislosen Augen auf diese Szenerie blickte. Da schloss auch ich mich an, sprach die Huldigungsformeln, die man bei uns einem König entgegenbringt, und überreichte … ach, nein, die Geschenke waren ja noch draußen.
Einer von uns holte die Goldkassette, die Dosen mit Myrrhe und Weihrauch, während wir anderen uns etwas verlegen von den Knien erhoben und wortlos herumstanden. Es herrschte eine merkwürdige Atmosphäre, die aus Erhabenheit und Lächerlichkeit gemischt zu sein schien. Während wir so zwischen freudigem Glauben und zaghaftem Zweifel, zwischen dem Genuss einer historischen Stunde und der Qual peinlicher Verlegenheit hin- und hergerissen wurden, behielten nur die beiden Eltern eine schlichte Würde.
Mir fiel jetzt auf, dass sie über unsere Huldigungen gar nicht erstaunt waren. Offenbar wussten sie, was mit ihrem Kind einmal geschehen sollte. Woher? Verstanden sie auch etwas von den Sternen? Oder hatte der Gott, der uns auf unsere Weise von dem Kind wissen ließ, ihnen auf andere Weise seine Pläne bekanntgemacht?
Noch lange saßen wir in dieser Nacht zusammen, und wir hatten reichlich Gelegenheit, all die Fragen zu stellen. Erstaunliche Dinge erzählten uns die beiden. Von Engeln berichteten sie, von himmlischen Heeren, die bei der Geburt erschienen waren, von einem Gottesboten sogar, der die Geburt des Knaben ankündigte, ehe Josef seine Frau geheiratet hatte. Von erstaunlichen Prophezeiungen verschiedener Gottesmänner und -frauen.
Aber warum wunderten wir uns darüber? War nicht unsere Reise im Grunde eine genauso geheimnisvoll von Gott geleitete Sache? Zur Erforschung einer astronomischen Erscheinung waren wir aufgebrochen und nun hatten wir die Erscheinung des Gottessohnes entdeckt. Wir wollten herauskriegen, ob die Himmelskörper zu den Menschen der Erde eine Beziehung haben. Nun stellten wir fest, dass der Herr des Himmels eine Beziehung zu ihnen aufgenommen hatte. Ja, dass er selbst ein Mensch auf dieser Erde geworden war. Wie das alles zu erklären war und was es zu bedeuten hatte, daran würden wir noch lange zu überlegen haben. Auf jeden Fall bedeutete es, dass der Gott der Juden, von dem wir ja recht wenig wussten, der wahre Gott sein musste. Er war lebendig und nicht nur über Israel Herr, sondern über die ganze Welt, einschließlich Babel und Rom. Vielleicht würde dieses Kind, das inzwischen wieder friedlich in seinem Bettchen schlief, diese Wahrheit einmal aller Welt klarmachen.
Endlich machten wir uns ein einfaches Lager und legten uns nieder. Lange konnte ich trotz meiner Müdigkeit nicht schlafen, weil all die Ereignisse dieses Tages, besonders die der letzten Stunden, noch einmal durch meine Gedanken gingen. Am frühen Morgen muss ich dann doch eingeschlafen sein; denn als ich von den Bewegungen und Geräuschen der anderen erwachte, stand die Sonne bereits am Himmel.
Die Freunde rüsteten bereits zum Aufbruch. Wir sollten nicht zu Herodes zurückkehren, hatte einer geträumt. Also redete der Gott der Juden jetzt auch zu uns durch Träume!
Mir war es recht, dass wir Herodes aus dem Weg gehen sollten, verdichtete sich doch nach allem, was wir gehört hatten, die Vermutung, dass er nichts Gutes plante.
Wir verabschiedeten uns von der Familie mit allen guten Wünschen. Aber ob sie unsere Wünsche nötig hatten? Ein anderer würde auf sie achtgeben, da war ich ganz sicher. Froh machten wir uns auf den Weg – froh, weil Gott unser Leben unter seine Führung genommen hatte, ohne dass wir das gesucht, ja, ohne dass wir es anfangs überhaupt gemerkt hatten. Er hatte sich offenbart, er hatte gehandelt – an uns und nun auch an aller Welt.
Der Gelähmte mit seinen Freunden
Begegnung – das klingt so, als wenn man vor einen anderen hintritt und sich mit ihm unterhält. Eine Begegnung mit Jesus war das bei mir sicher auch, aber weder bin ich vor ihn hingetreten, noch habe ich mich mit ihm unterhalten.
Alles, was mit mir passierte, musste ich über mich ergehen lassen. Ich konnte nicht viel dazu beitragen. So was hat man ja nicht sehr gerne. Viel lieber ist man aktiv. Aber mir blieb nichts anderes übrig, als alles untätig mit mir geschehen zu lassen.
Wissen Sie, was Gicht ist? Ich hatte sie in ihrer schlimmsten Form. Keine Bewegung – wenn ich dazu überhaupt in der Lage war – konnte ich ohne Schmerzen machen. Meistens lag ich nur steif auf meinem Bett und versuchte, nicht an die Qualen zu denken, die ich auch ohne Bewegung hatte. Sämtliche Gelenke taten mir entsetzlich weh. Eine Hoffnung auf Besserung gab es nicht.
Man denkt viel über sein Leben nach, wenn man so jahrelang an sein Lager gefesselt ist. Was soll man auch anderes tun als nachdenken? Einzig, dass man sich von Zeit zu Zeit mit Verwandten und Freunden unterhalten kann. Aber die haben ja auch nicht immer Zeit. Sie müssen schließlich ihrer Arbeit nachgehen. Was heißt müssen – sie dürfen! Wie gern würde ich arbeiten, etwas Sinnvolles tun, etwas, das die Kraft und die Gedanken in Anspruch nimmt, das anderen nützt, auf das man stolz sein kann, wenn es fertig ist. Aber das war mir versagt. Ich lag nur stocksteif da und musste mich bedienen lassen. Und musste grübeln.
Wie das so ist bei einem langen Leidensweg, da gibt es Höhen und Tiefen. Es gab Zeiten, in denen ich die Schwere meines Schicksals nicht so schwer empfand und dankbar war, dass ich Menschen hatte, die mich versorgten. Zeiten, in denen ich Trost empfand, der mich zwar bei weitem noch nicht froh machte, der mir aber doch half, meine Last zu tragen. Aber dann gab es auch Zeiten, in denen sich ein schreckliches Dunkel auf meine Seele legte, in denen ich einen untergründigen Hass empfand gegen alles und jeden. Gegen die, denen es unverdientermaßen besser ging, und gegen mich selbst. Gegen die, die kamen, um zu trösten weil ich nicht getröstet werden wollte und gegen die, die mich nicht besuchten weil sie offenbar mein Elend nicht gebührend zur Kenntnis nahmen. Gegen die, die für alle meine Worte und Launen liebevoll Verständnis hatten, oder wenigstens so taten, und gegen die, die mir ausgesprochen oder unausgesprochen Vorwürfe machten.
Ja, die Vorwürfe das ist so ein Thema für sich. Es gab genug Leute, die mir deutlich zu verstehen gaben, was sie von meiner Krankheit hielten: Das konnte doch nur die Strafe für meinen schlechten Lebenswandel sein.
War es so? Natürlich ärgerte ich mich über solche Vorhaltungen, aber manchmal zwang ich mich, nüchtern darüber nachzudenken.
Ja, ich hatte Schuld auf mich geladen. Das musste ich zugeben. Ich will sie Ihnen nicht im Einzelnen schildern. So was behält man ja lieber für sich. Aber dass ich gesündigt habe, kann jeder wissen. Oft quälte mich der Gedanke daran mehr als die Gicht in meinen Knien.
Aber konnte die Krankheit Strafe für meine Sünde sein? Mussten dann nicht viele andere auch von Gott geschlagen werden, wenn er so konkret auf die Schuld der Menschen antwortet? Konnte die einfache Gleichung wirklich stimmen: Frommes Leben gleich Wohlstand, gottloses Verhalten gleich Krankheit und Elend? Müsste es dann nicht vielen anderen erst recht elend gehen, die noch mehr gesündigt hatten?
Aber wer kann schon beurteilen, wer mehr und wer weniger sündigt. Nein, die fatale Gleichung der Hochnäsigen stimmt sicher nicht oder nicht so. Aber heißt das, dass ich über meine Vergangenheit ruhig sein konnte? Ich hatte viel zu viel Zeit, über all das zu grübeln, als dass ich mich mit einigen scheinbar logischen Gedankengängen zufriedengeben konnte. Immer und immer wieder brachen die Fragen auf, wie eitrige Wunden. Wenn der gerechte Richter im Himmel andere nicht für ihre Untaten strafte – hieß das, dass er mich auch nicht strafen durfte? Wer kann sagen, ob die Maßstäbe für Gerechtigkeit, die wir Menschen erstellen, auch für Gott verbindlich sind? Und wenn …
Ach, was soll’s! Diese Grübeleien ohne Ende! Selbstvorwürfe und Entschuldigungen ohne verbindliche Auskunft über die Wahrheit. Ich musste diese Gedanken gewaltsam abbrechen, um mich darin nicht zu verirren wie in einem Labyrinth. Die Verzweiflung wäre nur noch größer geworden.
Eines Tages kommen meine Freunde hereingestürmt. Vier Mann hoch. Es müsse schnell gehen. Sie wollen mich zu Jesus bringen. Jesus? Wer das denn sei, will ich verständlicherweise wissen. Und was ich dort solle?
Jesus wäre ein Wanderprediger aus Nazareth, der schon viele Kranke gesund gemacht hätte, und im Übrigen wäre jetzt nicht viel Zeit zu diskutieren, sonst verpassten wir ihn am Ende. Ich solle mich festhalten. Es ginge los.
Festhalten ist gut! Ich und festhalten! Aber mein Protest fällt schwach aus. Ich bin es gewöhnt, mit mir machen zu lassen, was andere für richtig halten.
Sie heben mich mitsamt meinem Lager auf. Jeder an einer Ecke der Matte. Es schaukelt und schmerzt. Aber ich verbeiße einen Schrei und lasse mich von der Begeisterung der vier mitreißen.
Unentwegt reden sie, während sie mich im qualvollen Eilschritt durch die Gassen schleppen. Gerade hätte er einen Aussätzigen gesund gemacht. Alle hätten es gesehen, und erst neulich sei in Kapernaum …
Und einer hat einen Onkel, der hätte erzählt …
Und vom Nachbardorf hörte man …
Und wenn es stimmte, was das Gerücht …
Und das könnte doch nicht alles erfunden sein …
Ihre Zuversicht steckt mich an. Zu lange habe ich ohne Hoffnung gelitten, um nicht diesen schwachen Hoffnungs-schimmer begierig aufzunehmen. Wenn nur die Schmerzen nicht wären, die mir bei jedem Stoß durch den ganzen Körper zucken. Aber gleich müssen wir da sein, sagen sie. Noch ein Stück.
Und dann die Enttäuschung! Er ist zwar noch da, dieser Jesus. Aber die anderen wissen das auch. Eine große Traube Menschen umlagert den Eingang des Hauses.
Können wir bitte mal durch? Bitte, geht doch etwas auseinander! So rückt doch mal zur Seite! Wir müssen da hinein! Seht ihr denn nicht, dass wir hier einen Kranken haben!
Aber alles Bitten und Schimpfen ist umsonst. Die Menschenmasse stellt sich stur. Da könnte jeder kommen. Wir waren zuerst da! Ruhe, wir verstehen nichts von seinen Worten!
Wie ein angestochener Wassersack sinkt meine Hoffnung in sich zusammen. Was kann man da noch tun? Warten, bis er herauskommt? Dann wird er sicher wieder von vielen umlagert sein, die stärker sind als ich in meiner Hilflosigkeit. Ihm nachreisen? Unmöglich! Einen längeren Weg als den, den ich gerade unter Qualen zurückgelegt habe, halte ich nicht durch.
Einer meiner Freunde hat eine Idee: Durchs Dach! Wahnsinn, denken wir erst. Wir können doch nicht … Aber warum denn nicht? Ist nicht meine Gesundheit mehr wert als ein Dach? Na also! Wir können es ja nachher wieder reparieren!
Aber wie soll ich da hinaufkommen?, wage ich einzuwenden. Das soll ich mal ihre Sorge sein lassen, meint der Freund, der bei mir zurückbleibt, während die anderen davonrennen, um Werkzeuge und Stricke zu holen. Kurz darauf sind sie wieder da. Ihr Schwung reißt mich mit. Ihr fester Glaube, dass das alles nicht sinnlos ist, gibt mir Mut.
Mut brauche ich auch, denn jetzt beginnt der schwierigste Teil des Unternehmens.
Die Stricke werden an den Enden meiner Matte befestigt. Die Freunde steigen hinauf und beginnen zu ziehen. Rasender Schmerz durchläuft meinen ganzen Körper. Aber jetzt nicht aufgeben, zwinge ich mich zu denken. Jetzt nicht schlappmachen!
Unter entsetzlichen Qualen werde ich über die Kante gezogen. Dann liege ich auf dem flachen Dach. Eine kleine Pause gönnen sie mir, während sie sich in der Mitte des Daches zu schaffen machen. Es staubt, Lehmbrocken und Holzstücke fliegen zur Seite. Die wuchtigen Schläge der Werkzeuge lassen den Boden erzittern, auf dem ich liege. Dann sind sie fertig. Es hat nicht lange gedauert. Sie schleppen mich über das Loch und lassen mich behutsam hinunter. Es ist ein merkwürdiges Gefühl. Ich rede nicht von den Schmerzen in allen Gliedern, auch nicht von der Furcht zu rutschen, wenn sie die Seile ungleichmäßig herunterlassen. Ich rede auch nicht von den erstaunten und neugierigen Blicken der Leute da unten, von ihren spottenden und ärgerlichen Rufen. Ich meine diese Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung, die mir den Atem abschnürt. Was für ein Augenblick! Möglicherweise kann in wenigen Minuten das jahrelange Elend beendet sein.
Kann Jesus helfen? Wird er es tun, wenn er es kann? Oder wird er mich wegen meiner Sünde zurückweisen? Die Fragen beklemmen mich so, dass mir das Ungewöhnliche, ja das Komische dieser Situation gar nicht zum Bewusstsein kommt.
Die Freunde haben gut geschätzt. Zwischen dem Prediger und seinen Zuhörern komme ich herunter. Einige müssen ein wenig zur Seite rücken, dann lande ich auf dem Fußboden.
Ja, und jetzt?
Ich sehe mich um. Auf der einen Seite Gemurmel. Dicht an dicht stehen sie da. Worte des Unwillens, auch einige des Mitleids. Viele Augen sind auf mich gerichtet. Ich sehe Pharisäer unter der Menge und Theologen. Sie sind an ihrer Kleidung erkennbar. Haben die es denn nötig?
Und auf der anderen Seite?
Da steht Jesus. Ja, das muss er sein. Ich habe sofort den Eindruck, dass nur er es sein kann. Mit einem freundlichen Blick sieht er mich an. Wohlwollen und Güte lese ich darin, ja, so etwas wie Zufriedenheit. Oder täusche ich mich nur, weil ich so hohe Erwartungen habe?
Aber nein, es muss wohl so sein, dass er sich freut. Von mir fällt eine Last, als ich das feststelle. Nicht über mich freut er sich, da ist nicht viel Erfreuliches dran, aber über meine Freunde und das Zutrauen, dass sie zu ihm haben. Wie ein Vater sich über das Vertrauen seiner Kinder freut, die mit ihren Sorgen zu ihm kommen.
Gespannt blicken alle auf ihn. Die Theologen, die neugierige Menge, die Begleiter von Jesus, die hinter ihm stehen, meine Freunde, deren Köpfe vor dem Stück Himmel über uns sichtbar sind. Und natürlich ich. Was wird er tun? »Mein Sohn«, sagt er, und ich sauge jedes Wort von seinen Lippen. »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.«
Meine Sünden? Das habe ich nicht erwartet. Aber es enttäuscht mich nicht. Was habe ich denn erwartet? Dass ich gesund werde natürlich. Aber kann er mich denn gesund machen, wo ich doch gesündigt habe? Kann ich denn erwarten, dass er über alle meine Schuld stillschweigend hinweggeht? Hätte ich nicht vielmehr erwarten müssen, dass er mich verurteilt, dass dieser heilige Mann mich in Grund und Boden richtet? Ist nicht gemessen daran schon sein freundlicher Blick Gnade? Ist nicht die Vergebung meiner Sünde unendlich mehr, als ich billigerweise hätte erwarten können? Und bedeutet nicht, mit Gott in Ordnung sein, dass man auch alles Leid viel besser ertragen kann? Wenn ich unter Schmerzen meiner Gicht, aber mit befreitem Gewissen nach Hause getragen werden soll – bedeutet das nicht, dass ich dann unvorstellbar reicher bin als vorher? Diese Gedanken gehen mir durch den Kopf.
Ich atme auf. Ich fange an, mich zu freuen.
Aber da ist das Murren der Leute. Einzelne Worte dringen an mein Ohr und ersticken den aufkeimenden Jubel. »Sünden vergeben? Das kann nur Gott.«
Das ist wahr! Das kann nur Gott! Schuld durchstreichen kann nur der, vor dem man schuldig geworden ist. Ich bin doch vor Gott schuldig geworden, nicht vor dem Mann aus Nazareth. Ihm habe ich doch nichts getan. Wieso sagt er dann, dass er Sünde vergibt?
Will er damit etwa sagen, dass er für Gott spricht? Aber wie kann ein Mensch so etwas für sich in Anspruch nehmen? Oder ist er mehr als ein normaler Mensch?
Die Fragen überstürzen sich in meinen Gedanken.
Jesus antwortet: »Was ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben! oder: Stehe auf und gehe?«
Was leichter ist? Wie ist das gemeint? Natürlich ist es leichter, jemanden gesund zu machen. Das können manche, aber Sünden vergeben, dass kann nur Gott selber. Oder der, den er dazu bevollmächtigt. Aber, wie lässt sich so eine Bevollmächtigung nachprüfen? Eben – darauf will er hinaus. »Was ist leichter zu sagen …?« Sagen kann man viel. Man kann auch unschwer sagen, deine Sünden sind dir vergeben, wenn man nicht beweisen muss, dass Gott dahintersteht. Aber, »stehe auf« zu einem Kranken zu sagen – das ist unmöglich, wenn man nicht ganz sicher ist, dass Gott dazu steht. Denn das ist nachprüfbar. Da blamiert man sich, wenn es nicht »klappt«, oder man wird sogar wegen Gotteslästerung gesteinigt.
Er will doch nicht etwa sagen …?
Jetzt spricht er weiter: »Ihr sollt sehen, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben.« Dann wendet er sich mir zu. »Stehe auf und gehe!«
Stehe auf und gehe! Das sagt er einfach so! Aber ich kann doch nicht! Oder doch? Vielleicht … Wenn er es sagt! Wenn er wagt, mich vor allen Leuten dazu aufzufordern, dann muss er doch sicher sein, dass Gott ein Wunder tut!
Ohne dass mich ein überlegter Entschluss antreibt, richte ich mich auf. Ja, ich richte mich auf! Ich stütze die Arme auf, ich knie, ich stehe, ich mache einen Schritt, noch einen! Meine steifen Gelenke sind geschmeidig wie bei einem Kind! Kein Schmerz jagt mehr durch meine Glieder! Dass es so etwas gibt! Dass ich das erleben darf!
Jubel bricht aus mir heraus. Ich kann mich kaum noch zurückhalten. Ich muss ihm danken. Ich muss Jesus anbeten! Anbeten? Darf man einen Menschen anbeten, wie man es Gott schuldig ist? Und hat er nicht selbst gesagt, dass er ein Sohn der Menschen ist?
Ja, aber er ist auch der Sohn Gottes. Er hat bewiesen, dass er in göttlicher Vollmacht handelt. Ich will ihn anbeten. Wie reich hat er mich beschenkt! Mein Gewissen hat er gereinigt und meinen Körper gesund gemacht! Freunde, lobt mit mir Jesus! Ich laufe, seht ihr’s? Ich brauche die Matte nicht mehr. Ihr könnt sie hochziehen. Das geht nicht? Warum nicht?
Sie haben die Seilenden bereits heruntergeworfen, ehe ich gesund war. Aber sie wussten nicht … Nein, aber sie glaubten. Sie waren sicher, dass Jesus helfen würde. Und da hat er auch geholfen.
Wenn ich nur immer solch einen Glauben hätte!
Die Theologen sind verstummt, erschüttert. Die anderen reden aufgeregt durcheinander. Meine Freunde rufen begeistert durchs Loch im Dach. Die Schüler von Jesus strahlen und sehen dabei fast stolz aus, so, als hätten sie mich gesund gemacht.
Und Jesus selbst? Mir fällt auf, dass meine Gedanken eben mehr um ihn gekreist sind, als um meine wunderbare Heilung. Aber das ist doch nicht erstaunlich. Solch einen Menschensohn hat es noch nie gegeben. Er ist einmalig im wahrsten Sinn des Wortes. Er ist der einzige Gott in Person. Gott in Gestalt eines Menschen. Wie könnte er sonst so wunderbar heilen, nur durch ein Wort! Und wie könnte er sonst Heil, Vergebung, Rettung, Erlösung nur durch sein Wort bringen!
Der Standortoffizier aus der Garnison Kapernaum
Ich bin es gewöhnt, Berichte zu geben. Aber hier? Es handelt sich hierbei nicht um einen militärischen Bericht für den Vorgesetzten. Die Sache ist etwas schwieriger zu schildern als strategische Pläne und taktische Unternehmungen. Obwohl da eine gewisse Ähnlichkeit … naja, dazu kommen wir noch.
Zunächst muss ich meinen Standort nennen. In Kapernaum am See Tiberias bin ich stationiert. Dort steht eine Garnison von römischen Legionären. Die Grenze zu Syrien ist nah.
Ich bin schon lange dort. Muss sagen, dass ich gerne hier in Palästina bin. Es hätte mich ja auch nach Afrika verschlagen können oder nach Gallien oder irgendwo an den Rhein, wo ich mich dann unter Varus mit dem Cherusker Arminius und seinen Germanen hätte herumschlagen müssen. Dann wäre ich sicher nicht sehr alt geworden.
Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich gerne hier bin. Es ist der Glaube dieser Juden, der mich anzieht. Mal ehrlich, glauben Sie etwa an Mars und Jupiter und wie die alle heißen? Daran glaubt übrigens fast niemand mehr in Rom. Aber was dann?
Sehen Sie, hier im Land beten sie einen Gott an, der ganz anders ist. Da gibt es keinen dichtbevölkerten Götterhimmel, sondern einen einzigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ist das nicht viel einleuchtender?
Nun, wenn eine Idee bestechend ist, muss sie noch nicht unbedingt wahr sein. Immerhin reichte das, was ich über diese Religion hörte, um bei mir ein großes Vertrauen zu wecken. Ich befasste mich also gründlich mit der Lehre der Juden, ließ mir von ihren Rabbis vieles erklären und begann schließlich tatsächlich an diesen einen unsichtbaren Gott zu glauben.
Je mehr ich die Verbindung zu den frommen Juden suchte, desto fester wurde ich in diesem Glauben. Und je mehr ich in dem Glauben wuchs, desto intensiver suchte ich den Kontakt zu diesen Menschen, desto mehr schätzte ich sie.
Als ich ihnen beim Bau ihrer Synagoge ein bisschen unter die Arme griff, was sollte ich sonst Sinnvolles mit meinem reichlichen Sold machen, da entstand fast so etwas wie Freundschaft zwischen den Juden und ihrem Besatzer. Zumindest aber großer gegenseitiger Respekt.
Es gehört zum Standard eines römischen Offiziers, dass er sich einige Sklaven hält, die sich um seinen Haushalt kümmern. Auch ich hatte einen Sklaven, den ich aber mehr als Freund, denn als Diener ansah. Er war mir treu ergeben, und ich schätzte ihn sehr. Das muss ich vorausschicken, weil er in dem Ereignis, das ich berichten will, noch eine Rolle spielte.
Man redete in letzter Zeit viel von Jesus aus Nazareth. Er zog durch das Land und predigte überall. Ganz neuartige Dinge sage er, hieß es. Sogar Kranke sollte er gesund gemacht haben. Nicht nur mal einen, dass man meinen könnte, es wäre ein Zufall. Nein, es war eine ganze Anzahl von Fällen bekannt, wo er nachweislich Kranke wirklich gesund gemacht hatte.
Ich hätte gern in dieser Sache noch ausführlicher recherchiert, aber das war nicht möglich. Einmal hielt mich meine militärische Pflicht in Kapernaum fest, zum anderen musste ich mich sehr zurückhalten, wenn ich beobachten wollte. Ein römischer Offizier kann nicht nur unbeachtet zusehen. Wo er auftaucht, nimmt er Einfluss auf den Gang der Dinge, ob er will oder nicht. Außerdem wollte ich meine Freunde nicht in Verlegenheit bringen. Ich besuchte ja auch ihre Synagoge nicht. Sie haben das nicht gern. Man muss das respektieren, ohne beleidigt zu sein. Wenn sie in ihren kultischen Angelegenheiten einen Unterschied zwischen sich und den Heiden machen, heißt das ja nicht, dass ein solcher Heide nicht auch ihren Gott anbeten könnte. Dass ich, anstatt mit meiner Macht aufzutrumpfen, hier zurückhaltend war, erwarb mir ihre Anerkennung noch mehr.
Natürlich dachten meine Untergebenen in diesen Dingen zumeist anders. Ich merkte wohl, dass sie sich heimlich lustig machten über meine innere Einstellung und über meine Zurückhaltung gegenüber den Leuten im Land. Aber das machte mir nicht viel aus. Ich denke, ein gewisses Maß an Achtung gegenüber dem Wesen und Denken unterworfener Völker steht auch einem römischen Offizier gut an. Man muss kein kulturverachtendes, martialisches Raubein sein, um als guter Soldat zu gelten.
Doch das nur nebenbei. Ich wollte von der Begegnung erzählen, die eigentlich gar keine Begegnung war.
Mein Sklave war krank geworden. Schon lange hatte er mit der Gicht zu tun. Nun aber war es so schlimm geworden, dass er es vor Schmerzen kaum aushielt. Oder war noch eine andere Krankheit dazugekommen? Die Ärzte wussten es nicht und konnten ihm auch nicht helfen. Es sah so aus, als müsste er sterben. Mir tat er sehr leid. Wie gesagt – ich hatte ihn gern. Was ich hätte tun können, um ihm zu helfen, wollte ich tun. Aber was?
Da kam, gerade als die Krankheit ihren krisenhaften Höhepunkt erreichte, das Gerücht nach Kapernaum, Jesus sei nicht weit. Er habe auf einem Berg in der Nähe eine große Menge von Menschen um sich gesammelt, erzählte man mir. Auch Leute von Kapernaum seien dabei.
Wenn ich mich beeilte, und wenn er eine längere Rede hielt …
Mein Entschluss stand fest: Ich wollte ihn um Hilfe bitten. Wenn das alles stimmte, was man mir von ihm erzählt hatte – und offensichtlich stimmte es –, dann konnte er auch meinen Sklaven gesund machen. Aber ich selbst konnte nicht gut hingehen, warum, das habe ich eben erklärt. Und außerdem – wäre es nicht besser, jemand aus seinem eigenen Volk bat ihn um Hilfe?
Schnell suchte ich einige meiner Freunde auf, die Ältesten der jüdischen Gemeinde. Ich sagte ihnen, was ich dachte. Ja, meinten sie, Jesus würde sicher helfen können. Ja, und sie wollten auch hingehen und ihn darum bitten. Nach allem, was ich für sie getan hätte.
Es waren qualvolle Stunden, die ich nun wartend am Bett des Patienten verbrachte. Stunden des Leides und doch der Hoffnung. Mein Sklave krümmte sich vor Schmerzen. Er sah aus, als liege er im Todeskampf. Wenn die Hilfe nur nicht zu spät kam!
Dann die erlösende Nachricht: Jesus wollte kommen. Er sei schon unterwegs. Erlösend? Nein, so froh mich die Meldung auch machte, sie erlöste mich noch nicht von der Angst um meinen Knecht.
Während ich zitternd dasaß und wartete, gingen meine Gedanken weiter. Wenn Jesus wirklich der war, für den ihn viele hielten … Nein, so wollte ich nicht mehr sprechen. Er war es! Er war der von Gott Gesandte! Was musste denn noch passieren, dass die Menschen an ihn glauben sollten? Mochten die spitzfindigen Theologen in diesem Land so manches Haar in der Suppe finden, weil der Messias sich nicht bequemte, genauso zu sein, wie sie ihn sich vorstellten. Ich war für klare Verhältnisse. Ich bin Soldat und kein Diplomat. Entweder ja oder nein. Entweder war Jesus der von Gott Gesandte – und dann mit allen Konsequenzen. Oder er war es nicht. Dazwischen hatte ich mich zu entscheiden.
Dass Jesus seine Hilfe zugesagt und sein Kommen angekündigt hatte, gab für mich den Ausschlag. Jetzt wusste ich, dass er im Auftrag des einen Gottes handelte. Das bedeutete, dass er unumschränkte Macht besaß, auch gegenüber der Krankheit.
Hoffentlich kam er nicht zu spät. Aber, war das nicht schon wieder Dummheit, so etwas zu befürchten? War es denn denkbar, dass der Gesandte Gottes vor einem Problem kapitulieren musste, weil er unglücklicherweise ein paar Minuten zu spät kam? Er konnte doch auch aus der Ferne seine Macht beweisen.
Das brachte mich auf einen Gedanken. Sicher war es ihm unangenehm, das Haus eines Heiden zu betreten. Dass er dazu bereit war, freute mich natürlich. Aber ich hatte gelernt, die Gefühle der Juden zu akzeptieren. Konnte er nicht von da, wo er war, meinen Sklaven gesund machen? Lag denn etwa seine Macht in einer äußeren Handlung, oder nicht vielmehr in einem machtvollen Wort?
Die Frage stellen, hieß sie beantworten. Mit der militärisch schnellen Entschlossenheit, die man mir anerzogen hatte, rief ich auch schon einige meiner Freunde herbei. Geht schnell dem Rabbi Jesus entgegen, bat ich sie. Sagt ihm, ich sei es als Heide nicht wert, dass er unter mein Dach komme. Er soll nur ein Wort sprechen, so wird mein Sklave augenblicklich gesund. Hat er nicht die Macht dazu? Meine Freunde nickten, obwohl sie etwas unsicher waren. Aber sie mussten mir recht geben. Ich war es gewöhnt, in Befehlsstrukturen zu denken. Wenn ich eine Order erließ, war es ganz selbstverständlich, dass sie befolgt wurde. Da gab es in unserer Armee kein Wenn und Aber. Wenn ich jemanden herbeizitierte, hatte er zu erscheinen und zwar sofort. Wenn ich jemanden schickte, hatte er zu springen. Da gab es keine Entschuldigungen und keine Ausreden. Sollte der Gott, dem Himmel und Erde untertan sind – sollte sein Beauftragter nicht die gleiche Macht haben? Sollte es ihm nicht genauso möglich sein, den Mächten der Krankheit zu gebieten? Konnte es da überhaupt einen Zweifel geben?
Die Freunde eilten davon.
Sie waren noch nicht lange fort, da beobachtete ich, wie eine Bewegung durch den verkrümmten Körper meines Burschen ging. Seine Muskeln entkrampften sich. Er lag ruhiger. In sein Gesicht kehrte Farbe zurück. Dann schlug er die Augen auf, sah mich lächelnd und befreit an, machte sie wieder zu und fiel in einen tiefen Schlaf.
Ich jubelte. Ich wusste es, ehe ich Bericht bekam: Jesus hatte das erbetene Machtwort gesprochen.
Es dauerte nicht lange, da kamen meine Freunde zurück. Sie berichteten, dass sie alles gesagt hätten, was ich ihnen auftrug. Und Jesus habe meine Zuversicht gerühmt und gesagt, in Israel habe er solchen Glauben nicht gefunden. Glauben? Was heißt hier Glauben? Lagen die Dinge nicht völlig klar? Ich habe doch nur nüchtern gedacht und Konsequenzen gezogen. Wenn diese nüchterne Einschätzung der Macht Jesu Glaube ist – nun gut, dann will ich gerne von mir sagen, dass ich gläubig bin.
Aber warum rede ich von mir. Er hat ihn doch gesund gemacht. Er hat das entscheidende Wort gesprochen. Er ist zu rühmen, Jesus aus Nazareth. Mehr: Jesus, der Beauftragte Gottes. Ein Offizier, hinter dem nicht die Macht einer Armee oder eines Kaisers stand, sondern die unbegrenzte Macht des einen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat und sie erhält.
Bei aller Freude finde ich es nun doch ein wenig schade, dass ich ihm nicht persönlich begegnet bin. Gern hätte ich ihn persönlich gesehen. Aber was soll’s – ich bin ihm auch so begegnet. Ich habe ihn besser kennengelernt als viele, die ihn sehen und anfassen konnten. Ich habe nicht nur den Menschen, sondern den Gottesboten erlebt und dabei den, der ihn gesandt hat.
Die Halbweltdame mit der veränderten Haltung
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Unentschlossene vom See Genezareth
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Pastor mit der todkranken Tochter
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Ratsherr und sein diskreter Besuch
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Pflegefall aus dem Siechenhaus
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Vater mit seinem Sorgenkind
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Leprakranke und seine neun Leidensgenossen
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Die Lebedame oder das Ende der Unmoral
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Blinde aus der Palmenstadt
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Steuerinspektor und seine Kletterpartie
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Wachbeamte mit dem delikaten Auftrag
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der römische Offizier und das Exekutionskommando
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Die Anhängerin aus dem Dorf Magdala
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der nächtliche Wanderer und sein Freund
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Unsere Empfehlungen
Eckart zur Nieden: Brandstiftung in Eschenrode
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-59-4
Zwei Häuser sind in Eschenrode angezündet worden. Die Fragen „Wer stekct dahinter?“ und „Was geht hier eigentlich vor?“ bewegen den jungen Gemeindepfarrer, denn jedesmal kam ein Mensch dabei ums Leben. Immer deutlicher führt die Spur zu einem Mann, der erst vor einigen Tagen in sein Heimatdorf zurückgekehrt ist. Dreißig Jahre hatte er es nicht mehr gesehen – so ist er erschüttert über die Veränderungen, die er mit seinen Wunschvorstellungen nicht zusammenbringen kann.
Dieser merkwürdige Zeitgenosse bringt in das feste Dorfgefüge Unruhe – allerdings heilsame Unruhe, die in der Erzählung dramatisch gesteigert wird. Die Frage, um die es im Grund geht und die auch das ganze Dorf aufrüttelt, ist die nach dem Halt im Wandel der Zeit, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Woher und Wohin und Wofür.
Klaus Berger: Der verkehrte Jesus
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-09-9
In einer Zeit, in der immer lauter nach dem Dialog mit den Religionen für die Christen gerufen wird, werden diese sich auch mit neuen, vielfarbigen Jesusbildern auseinandersetzen müssen. Nach seinem Vortrag zu dem Thema: »Jesus aus Nazareth« meldete sich eine Zuhörerin und dankte Heinz Zähmt - »Jetzt weiß ich, wer Jesus ist!«, sagte sie. Hat sie durch den Vortrag Jesus, den Sohn Gottes, eine Person der Trinität und den Retter der Menschheit kennengelernt? Nein - nur den Zahrntschen Jesus!
Wer ist Jesus, wer ist er für mich? Diese Frage ist wichtig und deren Beantwortung lebensentscheidend. Sie ist auch wichtig, wenn man die Bücher von Franz Alt (»Jesus - der erste neue Mann«), Gerald Massadie (»Ein Mensch namens Jesus«) und Günther Schiwy (»Der kosmische Jesus«) liest, ohne nun ihrem Jesusbild auf den Leim zu gehen. Denn sie alle zeigen ihr subjektives Bild von Jesus, wobei nur sie selbst durchscheinen, Jesus aber in seiner eigentlichen Wesensart übertüncht wird. Vier Jesusbilder (aus der Theologie, der Literatur, der Journalistik und dem New Age) - Beispiele für Ansichten über Jesus. Ihnen wird die Selbstaussage Jesu entgegenzuhalten sein, wie sie in seinen Ich-bin-Worten vorliegt.
Klaus Rudolf Berger, geb. 1954 in Solingen, verheiratet und Vater von fünf Kindern, studierte Germanistik, Biologie und Philosophie. Seit 1986 leitet er in der Stiftung Eben-Ezer, einer diakonischen Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, in Lemgo, die Aus-, Fort- und Weiterbildung.
John Bunyan: Die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-958930-05-6
Dieses eBook enthält die vollständige Ausgabe der Pilgerreise von John Bunyan. Als Grundlage diente eine deutsche Übersetzung von 1859, die für diese Ausgabe überarbeitet und der neuen Rechtschreibung angepasst wurde. Zusätzlich enthält sie die Zeichnungen aus der ursprünglichen Ausgabe.
Das Besondere an diesem eBook sind die verknüpften Bibelstellen und den Fußnoten. Insgesamt sind es über 500 Fußnoten mit ca. 1000 Bibelstellen, die direkt im eBook aufgerufen und gelesen werden können. Diese zahlreichen biblischen Verweise führten Charles Spurgeon zu folgender Aussage über John Bunyan:
Dieser Mann ist eine lebende Bibel! Wo immer du ihn auch anzapfst, wirst du feststellen: Sein Blut ist Biblin, die Essenz der Bibel selbst. Er kann nicht sprechen, ohne ein Bibelwort zu zitieren, denn seine Seele ist voll des Wortes Gottes.