
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst?
An ihrer internationalen Privatschule hat Alice Sun sich immer schon unsichtbar gefühlt als einzige Stipendiatin zwischen all den Sprösslingen der Reichen und Schönen von Peking. Doch dann bemerkt sie, dass sie tatsächlich unsichtbar werden kann.
Als ihre Eltern sich trotz Stipendium die Schulgebühren nicht länger leisten können, entwickelt Alice einen Plan, ihr neues Talent zu Geld zu machen. Leider braucht sie dafür ausgerechnet die Hilfe von Henry Li, dem Musterschüler schlechthin und damit ihrem größten Rivalen. Er entwickelt für sie eine App, über die ihre Mitschülerinnen und Mitschüler Alice anonym für Aufträge buchen können, bei denen es ziemlich hilfreich ist, unsichtbar zu sein. Während Alice so manches skandalöse Geheimnis aufdeckt und Henry immer weniger nervt, werden die Aufträge immer fragwürdiger und sie muss entscheiden, wie weit sie wirklich gehen will.
Eine bezaubernde Rivals-to-Lovers-Romance mit einem Hauch Magie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ann Liang
If You Could See the Sun
Aus dem amerikanischen Englisch von Doris Attwood
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 der deutschsprachigen Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
IFYOUCOULDSEETHESUN copyright © 2022 by Ann Liang
All rights reserved
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel:
»If You Could See the Sun«
bei Inkyard Press, Toronto, Canada
Übersetzung: Doris Attwood
Coverkonzeption: Kathrin Schüler
skn · Herstellung: AW
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31197-1V002
www.cbj-verlag.de
Für meine wundervollen Eltern, die dieses Buch nicht lesen dürfen.
Und für meine kleine Schwester Alyssa, die möchte, dass alle wissen, wie großartig sie ist.
Kapitel 1
Meine Eltern führen mich stets nur aus einem von drei Gründen zum Essen aus. Erstens: Jemand ist tot – was angesichts unserer über neunzig Mitglieder starken WeChat-Familiengruppe öfter passiert, als man meinen würde. Zweitens: Jemand hat Geburtstag. Oder drittens: Sie haben mir etwas Lebensveränderndes zu verkünden.
Manchmal ist es auch eine Kombination aus Gründen, zum Beispiel, als meine Urgroßtante am Morgen meines zwölften Geburtstags verstarb und meine Eltern beschlossen, mir bei einer Schüssel gebratener Nudeln zu eröffnen, sie wollten mich aufs Internat schicken, oder genauer gesagt: auf die Airington International Boarding School.
Jetzt ist allerdings August, die erdrückende Sommerhitze selbst in dem klimatisierten Restaurant greifbar, und niemand im engeren Familienkreis hat in diesem Monat Geburtstag. Womit, natürlich, nur noch zwei weitere Möglichkeiten bleiben …
Der bange Knoten in meinem Magen zieht sich noch enger zusammen. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, um nicht direkt wieder durch die Glastür nach draußen zu rennen. Bezeichnet mich von mir aus als Schwächling, aber ich bin wirklich nicht in der Lage, mit schlechten Nachrichten klarzukommen, wie auch immer sie ausfallen mögen.
Vor allem nicht heute.
»Alice, warum siehst du denn so nervös aus?«, fragt Mama, während uns eine nicht lächelnde, in ein Qipao gekleidete Kellnerin zu unseren Plätzen ganz hinten in der Ecke führt.
Wir quetschen uns zuerst an einem überfüllten Tisch voller älterer Leute vorbei, die sich einen rosa Kuchen in Form eines Pfirsichs teilen, dann an einem zweiten, an dem offenbar ein Firmenessen stattfindet, mit in steifen Hemden heftig schwitzenden Männern und sich weißen Puder auf die Wangen tupfenden Frauen. Ein paar von ihnen drehen sich um und starren mich an, als sie meine Uniform bemerken. Ich kann nicht sagen, ob es daran liegt, dass sie das auf der Brusttasche meines Blazers prangende Tigerwappen erkennen, oder daran, dass das Design im Vergleich zu den Trainingsanzügen der örtlichen Schulen unglaublich protzig wirkt.
»Ich bin nicht nervös«, erwidere ich und setze mich zwischen sie und Baba. »Mein Gesicht sieht immer so aus.« Das ist nicht direkt gelogen. Meine Tante scherzt gerne, falls ich mich jemals an einem Tatort wiederfände, wäre ich die Erste, die verhaftet werden würde, allein aufgrund meines Gesichtsausdrucks und meiner Körpersprache. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so schreckhaft ist wie du, meinte sie. Du musst in deinem früheren Leben eine Maus gewesen sein.
Damals habe ich ihr den Vergleich übel genommen, aber jetzt komme ich mir doch wie eine Maus vor – eine Maus, die gleich geradewegs in eine Falle tappen wird.
Mama streckt sich und reicht mir die laminierte Speisekarte. Das durch das nahe Fenster hereinströmende Licht fällt dabei auf ihre knochigen Hände. Es lässt die seilartige weiße Narbe, die über ihre Handfläche verläuft, noch stärker hervortreten. Das Brennen allzu vertrauter Schuldgefühle steigt in mir auf, flackert wie eine Flamme.
»Haizi«, holt Mama mich wieder zurück. »Was willst du essen?«
»Oh. Ähm, mir ist alles recht«, antworte ich und wende schnell den Blick ab.
Baba bricht seine hölzernen Einmal-Essstäbchen mit einem lauten Knacken auseinander. »Kinder heutzutage wissen gar nicht, was für Glück sie haben«, sagt er und reibt die Essstäbchen aneinander, um sämtliche Splitter zu entfernen, bevor er mir hilft, dasselbe zu tun. »Wachsen alle in Honigtopf auf. Weißt du, was ich in deinem Alter esse? Süßkartoffel. Jeden Tag Süßkartoffel.«
Während er zu einer detaillierteren Beschreibung des täglichen Lebens in den ländlichen Dörfern in Henan ansetzt, winkt Mama die Kellnerin herbei und rattert eine Bestellliste herunter, die klingt, als würde das komplette Restaurant davon satt werden.
»Ma«, protestiere ich und ziehe das Wort auf Mandarin in die Länge. »Wir brauchen nicht …«
»Doch, du schon«, unterbricht sie mich bestimmt. »Du wirst immer ganz dünn, wenn Schule wieder anfängt. Ganz schlecht für deinen Körper.«
Widerwillig unterdrücke ich den Drang, mit den Augen zu rollen. Vor noch nicht mal zehn Minuten hat sie eine Bemerkung dazu fallen lassen, meine Wangen wären in den Sommerferien deutlich runder geworden. Nur bei ihrer Logik ist es möglich, gleichzeitig zu moppelig und gefährlich unterernährt zu sein.
Als Mama endlich mit Bestellen fertig ist, wechseln sie und Baba einen Blick und wenden sich dann mit so ernsten Mienen wieder mir zu, dass ich mit dem Ersten rausplatze, was mir in den Sinn kommt: »Geht’s … geht’s Grandpa gut?«
Mama kneift ihre dünnen Augenbrauen zusammen, was ihre strengen Gesichtszüge noch stärker unterstreicht. »Natürlich. Warum fragst du das?«
»N…nur so. Vergiss es.« Ich erlaube mir ein leises, erleichtertes Seufzen, aber meine Muskeln bleiben angespannt, als wollte ich mich gegen einen Schlag wappnen. »Okay, was auch immer ihr für schlechte Neuigkeiten habt, können wir es bitte schnell hinter uns bringen? Die Preisverleihung beginnt in einer Stunde, und falls ich einen Nervenzusammenbruch erleide, brauche ich mindestens zwanzig Minuten, um mich wieder zu erholen, bevor ich diese Bühne betrete.«
Baba blinzelt irritiert. »Preisverleihung? Welche Preisverleihung?«
Meine Besorgnis weicht für einen Moment Frustration. »Die Preisverleihung, für die Jahrgangsbesten.«
Er starrt mich nur weiter mit leerer Miene an.
»Komm schon, Ba. Ich hab sie diesen Sommer mindestens fünfzigmal erwähnt.«
Das ist nur minimal übertrieben. So traurig es klingt, diese flüchtigen Momente im Glanz des hell leuchtenden Lichts der Aula sind das Einzige, worauf ich mich in den vergangenen paar Monaten wirklich gefreut habe.
Selbst wenn ich sie mit Henry Li teilen muss.
Wie immer habe ich, wenn ich seinen Namen nur denke, diesen scharfen, bitteren Geschmack im Mund, wie Gift. Gott, ich hasse ihn. Ich hasse ihn und seine Porzellanhaut, seine makellose Uniform und seine demonstrative Gelassenheit, die ebenso unerreichbar und grenzenlos ist wie die stetig wachsende Liste seiner Errungenschaften. Ich hasse es, wie die Leute ihn anschauen und sehen, selbst wenn er vollkommen still ist und mit gesenktem Kopf an seinem Pult arbeitet.
Ich hasse ihn schon, seit er vor vier Jahren in die Schule stolziert kam, brandneu und alles überstrahlend. Am Ende des ersten Tages hatte er mich mit sage und schreibe zweieinhalb Punkten in unserem Geschichtstest geschlagen und alle kannten seinen Namen.
Allein bei dem Gedanken daran juckt es mich in den Fingern.
Baba runzelt die Stirn, sieht Mama nach Bestätigung suchend an. »Sollen wir da hingehen, zu dieser – dieser Verleihung?«
»Sie ist nur für Schülerinnen und Schüler«, erinnere ich ihn, obwohl es nicht immer so war. Die Schule beschloss, die Sache in eine privatere Veranstaltung zu verwandeln, nachdem Krystal Lam, die sehr berühmte Mutter einer Klassenkameradin, bei der Verleihung auftauchte und aus Versehen die Paparazzi gleich mit reinbrachte. Noch Tage später kursierten auf Weibo unzählige Fotos aus unserer Aula.
»Wie dem auch sei, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie Preise verleihen und …«
»Ja, ja, du redest von nichts anderem als von Preisen«, unterbricht Mama mich ungeduldig. »Und was ist dir wichtig, hm? Bringt deine Schule dir nicht richtige Werte bei? Familie sollte zuerst kommen, dann Gesundheit, dann für den Ruhestand sparen, dann – hörst du zu?«
Es bleibt mir erspart, sie anlügen zu müssen, weil unser Essen serviert wird.
In den schickeren Pekingente-Restaurants – Quanjude, zum Beispiel –, in denen die anderen aus meiner Klasse regelmäßig speisen, ohne dass vorher jemand sterben muss, bringen die Köche die gebratene Ente immer auf einem Tablett herein und tranchieren sie direkt am Tisch. Es grenzt schon fast an eine Show: Die knusprige, glasierte Haut wird von der glänzenden Klinge durchtrennt und enthüllt das zarte Fleisch und das brutzelnde Öl darunter.
Hier serviert uns die Kellnerin jedoch nur eine ganze, in große Stücke zerlegte Ente, mit Kopf und allem Drum und Dran.
Mama muss den Ausdruck auf meinem Gesicht sehen, denn sie seufzt und dreht die Ente von mir weg, während sie irgendwas von wegen meiner westlichen Empfindlichkeiten murmelt.
Weitere Gerichte treffen ein, eins nach dem anderen: mit Essig beträufelte und gehacktem Knoblauch verfeinerte Gurken, knusprig ausgebackene, dünnschichtige Frühlingszwiebelpfannkuchen, weicher, in goldbrauner Soße schwimmender Tofu und klebrige, dünn mit Zucker bestäubte Reiskuchen. Ich kann sehen, wie Mama das Essen bereits mit ihren scharfsichtigen braunen Augen abschätzt und höchstwahrscheinlich kalkuliert, wie viele weitere Mahlzeiten sie und Baba aus den Resten zubereiten können.
Ich zwinge mich zu warten, bis Mama und Baba ein paar Happen von ihrem Essen probiert haben, bevor ich nachhake: »Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ihr zwei wolltet mir irgendwas Wichtiges sagen …«
Zur Antwort trinkt Baba einen ausgedehnten Schluck von seinem noch immer dampfenden Jasmintee und spült die Flüssigkeit in seinem Mund hin und her, als hätte er alle Zeit der Welt. Mama scherzt manchmal, ich käme in jeglicher Hinsicht nach Baba – von seinem eckigen Kiefer, den geraden Augenbrauen und der dunkleren Haut bis hin zu seiner starrköpfigen, perfektionistischen Seite. Von seiner Geduld habe ich jedoch eindeutig nichts geerbt.
»Baba«, dränge ich und versuche mein Bestes, weiter respektvoll zu klingen.
Er hebt eine Hand und leert den Rest seines Tees, bevor er endlich den Mund aufmacht, um zu sprechen. »Ah. Ja. Nun, deine Mama und ich dachten … Willst du gern auf andere Schule gehen?«
»Moment mal. Was?« Meine Stimme klingt zu laut und zu schrill, schneidet durch die Geräuschkulisse des Restaurants und bricht schließlich fiepsend, wie bei einem vorpubertären Jungen. Die Firmenangestellten am Nebentisch halten mitten im Anstoßen inne und werfen mir missbilligende Blicke zu. »Was?«, wiederhole ich, flüsternd diesmal, meine Wangen glühend.
»Vielleicht gehst du auf örtliche Schule, wie deine Cousins und Cousinen«, fügt Mama hinzu und legt mit einem Lächeln ein perfekt portioniertes Stück Pekingente auf meinem Teller ab. Es ist ein Lächeln, bei dem sofort Alarmglocken in meinem Kopf läuten. Die Art von Lächeln, die Zahnärzte dir schenken, kurz bevor sie dir deine Zähne rausreißen. »Oder wir lassen dich zurück nach Amerika. Du kennst meine Freundin, Tante Shen? Die mit dem netten Sohn – dem Arzt?«
Ich nicke langsam, so als wären nicht zwei Drittel der Kinder ihrer Freundinnen bereits zukünftige Ärztinnen und Ärzte.
»Sie sagt, gibt eine sehr schöne staatliche Schule in Maine, in der Nähe von ihrem Haus. Vielleicht wenn du in ihrem Restaurant hilfst, darfst du bei ihr wohnen …«
»Ich verstehe das nicht«, unterbreche ich sie, weil ich einfach nicht anders kann. Ich spüre dieses flaue Gefühl der Übelkeit im Magen, wie damals, als ich beim Sportfest in der Schule zu schnell gerannt bin, nur um Henry zu schlagen, und mich beinahe auf dem Rasen übergeben musste. »Ich bin … Was stimmt denn nicht mit der Airington?«
Baba wirkt ein wenig verdutzt über meine Reaktion. »Ich dachte, du hasst die Airington«, erwidert er, zu Mandarin wechselnd.
»Ich habe nie gesagt, dass ich sie hasse …«
»Einmal hast du das Logo der Schule ausgedruckt und einen ganzen Nachmittag damit verbracht, mit deinem Stift darauf einzustechen.«
»Na gut, dann war ich am Anfang vielleicht nicht ihr größter Fan«, räume ich ein und lege meine Essstäbchen auf der Plastiktischdecke ab. Meine Finger zittern ein wenig. »Aber das war vor fünf Jahren. Jetzt wissen alle, wer ich bin. Ich hab mir einen Ruf erarbeitet – einen guten. Die Lehrerinnen und Lehrer mögen mich – ich meine: Sie mögen mich wirklich –, und die meisten aus meiner Klasse halten mich für schlau und interessieren sich tatsächlich für das, was ich zu sagen habe …« Doch mit jedem Wort, das über meine Lippen sprudelt, wird die Miene meiner Eltern grimmiger, und das flaue Gefühl verschärft sich zu eiskalter Angst. Trotzdem mache ich in meiner Verzweiflung weiter. »Und ich hab ein Stipendium, schon vergessen? Das einzige in der ganzen Schule. Wäre es nicht die reinste Verschwendung, wenn ich einfach gehen …«
»Du hast ein halbes Stipendium«, korrigiert Mama mich.
»Na ja, mehr bieten sie schließlich nicht an …« Und dann trifft es mich wie ein Schlag. Es ist so offensichtlich, dass ich über meine eigene Begriffsstutzigkeit nur staunen kann. Warum sonst sollten meine Eltern so plötzlich vorschlagen, mich von der Schule zu nehmen, nachdem sie jahrelang so unermüdlich dafür gearbeitet haben, mich dorthin schicken zu können?
»Geht es … geht es hier um die Schulgebühren?«, frage ich mit leiser Stimme, damit niemand ringsum es hören kann.
Zuerst sagt Mama nichts, fummelt nur an dem losen Knopf an ihrer langweiligen geblümten Bluse herum – noch so ein Billigkauf aus dem Supermarkt, ihrem neuen Lieblingsklamottenladen, nachdem der Yaxiu-Markt in ein lebloses Einkaufszentrum für überteuerte Markenimitationen verwandelt wurde.
»Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen«, antwortet sie schließlich.
Was Ja bedeutet.
Ich lasse mich auf meinem Stuhl zurücksinken und versuche angestrengt, mich wieder zu sammeln. Es ist nicht so, als wüsste ich nicht, dass wir sparen müssen, und das nun schon seit einer Weile – seit Babas alte Druckerei dichtgemacht hat und Mamas Spätschichten im Xiehe-Krankenhaus gekürzt wurden. Aber Mama und Baba waren schon immer sehr gut darin, das wahre Ausmaß ihrer Sorgen zu verstecken und all meine Bedenken mit einem Winken und einem »Konzentrier du dich einfach auf die Schule« oder »Du albernes Kind, sieht es vielleicht aus, als würden wir dich verhungern lassen?« abzutun.
Ich schaue die beiden über den Tisch hinweg an, schaue sie wirklich an und sehe die vereinzelten grauen Haare an Babas Schläfen, die müden Falten unter Mamas Augen, die langen Arbeitstage, die ihren Tribut fordern, während ich völlig behütet in meiner kleinen Airington-Blase dahindümple. Scham rumort in meinem Magen. Wie viel leichter wäre ihr Leben, wenn sie nicht jedes Jahr die zusätzlichen 165 000 RMB aufbringen müssten?
»Was, ähm, steht noch mal zur Auswahl?«, höre ich mich fragen. »Örtliche Schule in Peking oder eine staatliche Schule in Maine?«
Offensichtliche Erleichterung huscht über Mamas Gesicht. Sie tunkt das nächste Stück Pekingente in ein Schälchen mit dicker schwarzer Soße, wickelt es zusammen mit zwei Gurkenscheiben – ohne Zwiebeln, genauso, wie ich es mag – in einen papierdünnen Pfannkuchen und legt es auf meinen Teller. »Ja, ja. Beides ist gut.«
Ich kaue auf meiner Unterlippe herum. Ehrlich gesagt ist keine der beiden Optionen gut. Auf eine örtliche chinesische Schule zu gehen, bedeutet, ich muss das Gao Kao ablegen, mit die schwerste Aufnahmeprüfung fürs College – und das wäre sie auch, wenn sie mir nicht durch meine Chinesischkenntnisse auf Grundschulniveau zusätzlich erschwert würde. Und was Maine angeht: Alles, was ich darüber weiß, ist, dass es der am wenigsten diverse Bundesstaat der USA ist. Außerdem beschränkt sich mein Wissen über die SATs mehr oder weniger auf das, was ich in Highschool-Dramen auf Netflix gesehen habe. Außerdem sind die Chancen, dass mich eine staatliche Schule mit meinem IB-Kurs fortfahren lässt, verschwindend gering.
»Wir müssen nicht jetzt gleich entscheiden«, fügt Mama hastig hinzu. »Dein Baba und ich haben schon dein erstes Halbjahr in der Airington bezahlt. Du kannst Lehrer fragen, deine Freunde, ein bisschen drüber nachdenken, und dann sprechen wir noch mal. Okay?«
»Ja«, antworte ich, obwohl ich mich alles andere als okay fühle. »Klingt super.«
Baba klopft mit den Knöcheln auf den Tisch und Mama und ich erschrecken beide. »Aiya, zu viel Reden beim Essen.« Er zeigt mit seinen Essstäbchen auf die Teller zwischen uns. »Gerichte werden schon kalt.«
Während ich wieder zu meinen eigenen Essstäbchen greife, beginnen die älteren Gäste am Nebentisch, die chinesische Version von »Happy Birthday« zu singen, laut und schief. »Zhuni shengri kuaile … Zhuni shengri kuaile …« Die alte Nainai, die in der Mitte sitzt, nickt begeistert und klatscht im Takt mit, ein breites, zahnloses Grinsen im Gesicht.
Wenigstens eine verlässt dieses Restaurant in besserer Stimmung, als sie es betreten hat.
Schweißperlen rinnen fast sofort von meiner Stirn, als wir nach draußen gehen. Die Kinder in Kalifornien damals haben sich ständig über die Hitze beschwert, aber die Sommer in Peking sind erdrückend, gnadenlos, der spärliche Schatten dank der entlang der Straßen gepflanzten Wutong-Bäume bietet oft die einzige Abkühlung.
Im Augenblick ist es so heiß, dass ich kaum atmen kann. Oder vielleicht ist das auch nur die einsetzende Panik.
»Haizi, wir gehen«, ruft Mama mir zu. Kleine Plastiktüten mit den Resten baumeln von ihrem Ellenbogen, vollgestopft mit allem – und ich meine allem –, was vom Mittagessen noch übrig war. Sie hat sogar die Entenknochen eingepackt.
Ich winke ihr zu. Atme aus. Bringe ein Nicken und ein Lächeln zustande, als Mama noch einmal kurz stehen bleibt, um mir zum Abschied ihre üblichen Ratschläge mit auf den Weg zu geben: Schlaf nicht länger als bis elf, sonst stirbst du; trink kein kaltes Wasser, sonst stirbst du; pass auf dem Weg zur Schule auf Kinderschänder auf; iss Ingwer; denk dran, jeden Tag die Luftqualität zu checken …
Dann trotten die beiden zur nächsten U-Bahn-Station davon, Mamas zierliche Gestalt und Babas großer, eckiger Körper schon bald von der Menge verschluckt, und ich stehe plötzlich ganz allein da.
Ein schrecklicher Druck baut sich in meiner Kehle auf.
Nein. Ich kann nicht weinen. Nicht hier, nicht jetzt. Nicht, wenn ich gleich noch an einer Preisverleihung teilnehmen soll – der vielleicht letzten Preisverleihung meines Lebens.
Ich zwinge mich, mich zu bewegen, mich auf meine Umgebung zu konzentrieren – alles, um meine Gedanken aus diesem schwarzen Loch der Sorgen in meinem Kopf zu reißen.
Eine Ansammlung von Wolkenkratzern erhebt sich in der Ferne, nichts als Glas und Stahl und ungenierter Luxus, ihre schmal zulaufenden Spitzen in den wässrig blauen Himmel ragend. Wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich sogar die berühmte Silhouette des CCTV-Hauptsitzes sehen. Alle nennen das Gebäude aufgrund seiner Form nur »die riesige Unterhose«, obwohl Mina Huang – deren Dad es anscheinend entworfen hat – in den vergangenen fünf Jahren ebenso verzweifelt wie erfolglos versucht hat, alle davon abzuhalten.
Mein Handy brummt in meiner Rocktasche, und ich weiß, ohne einen Blick darauf zu werfen, dass es keine Nachricht ist – ist es nie –, sondern eine Erinnerung: nur noch zwanzig Minuten bis zum Beginn der Schulversammlung. Ich zwinge mich, schneller zu gehen, vorbei an den sich schlängelnden, von Rikschas, Händlern und kleinen gelben Fahrrädern verstopften Gassen, den unzähligen Lebensmittelläden, Nudellokalen und blinkenden Neonschildern mit kalligrafischen chinesischen Schriftzeichen, die ich alle nur verschwommen wahrnehme.
Der Verkehr und die Menge dünnen aus, als ich mich der Third Ring Road nähere. Dort sind alle möglichen Leute unterwegs: Onkel mit Beinahe-Glatze, die sich mit Strohfächern kühlen, eine Zigarette in ihrem Mundwinkel baumelnd, das Hemd halb hochgeschoben und der sonnenverbrannte Bauch entblößt, die perfekte Illustration von Ist-mir-scheißegal; alte Tanten, die entschlossenen Schrittes in Richtung Freiluftmarkt marschieren, ihre geblümten Einkaufs-Trolleys hinter sich herziehend; eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die sich riesige Becher Bubble Tea und gebratene Süßkartoffeln teilen, Stapel mit Hausaufgabenheften auf einem Hocker zwischen sich aufgeschlagen, die karierten Seiten in der Brise flatternd.
Im Vorbeigehen höre ich, wie einer der Schüler einen anderen in dramatischem Flüsterton und mit starkem Pekinger Akzent fragt: »Alter, hast du das gesehen?«
»Was gesehen?«, fragt ein Mädchen.
Ich gehe weiter, den Blick nach vorne gerichtet, und gebe mir alle Mühe, so auszusehen, als könnte ich nicht hören, was sie sagen. Aber sie nehmen wahrscheinlich sowieso an, dass ich kein Chinesisch verstehe: Mir wurde von Einheimischen immer wieder erklärt, ich hätte dieses ausländische Auftreten, oder qizhi, was immer zur Hölle das auch bedeuten soll.
»Sie geht auf diese Schule. Diese Sängerin aus Hongkong – wie heißt sie noch mal? Krystal Lam? – schickt ihre Tochter auch dorthin, und der Geschäftsführer von SYS auch … Warte, ich check das schnell bei Baidu …«
»Wocao!«, stößt das Mädchen ein paar Sekunden später aus. Ich kann praktisch spüren, wie sich ihr Blick in meinen Hinterkopf bohrt. Mein Gesicht beginnt zu glühen. »330 000 RMB für ein Jahr? Was unterrichten die da? Wie man jemand aus dem Königshaus verführt?« Sie verstummt einen Moment. »Aber ist das nicht eine internationale Schule? Ich dachte, die wären nur für weiße Schülerinnen und Schüler.«
»Was weißt du schon?«, schnaubt der erste Junge. »Die meisten internationalen Kids haben einfach nur ausländische Pässe. Ist ganz leicht, wenn man reich und in Übersee geboren ist.«
Das stimmt überhaupt nicht: Ich wurde hier in Peking geboren und bin mit meinen Eltern erst nach Kalifornien gezogen, als ich sieben war. Und was das Reichsein angeht … Nein. Aber was auch immer. Ich werde sicher nicht noch mal zurückgehen und ihn korrigieren. Außerdem musste ich meine Lebensgeschichte irgendwelchen Wildfremden schon oft genug erzählen, um zu wissen, dass es manchmal deutlich leichter ist, sie einfach annehmen zu lassen, was sie wollen.
Ohne darauf zu warten, dass die Ampel umspringt – niemand hier achtet wirklich auf sie –, überquere ich die Straße, froh, ein wenig mehr Distanz zwischen mich und den Rest ihrer Unterhaltung bringen zu können. Dann erstelle ich im Kopf schnell eine To-do-Liste.
Das funktioniert für mich immer am besten, wenn ich von irgendwas überwältigt oder frustriert bin: kurzfristige Ziele. Überwindbare Hindernisse. Dinge, die innerhalb meiner Kontrolle liegen. Zum Beispiel:
Erstens, es durch die komplette Preisverleihung schaffen, ohne Henry Li von der Bühne zu schubsen.
Zweitens, den Chinesisch-Aufsatz früher abgeben – meine letzte Chance, bei Wei Laoshi Eindruck zu schinden.
Drittens, vor dem Mittagessen den Lehrplan für den Geschichtskurs lesen.
Viertens, zu Maine und den nächstgelegenen staatlichen Schulen in Peking recherchieren und herausfinden, welche – falls überhaupt eine – die höchste Wahrscheinlichkeit für zukünftigen Erfolg bietet, ohne einen Nervenzusammenbruch zu erleiden und/oder auf irgendwas einzuschlagen.
Seht ihr? Alles total machbar.
»Bist du sicher, dass du hier zur Schule gehst?«
Der Wachmann kneift seine buschigen Augenbrauen zusammen und starrt mich von der anderen Seite des schmiedeeisernen Schultors an.
Ich schlucke meinen Frust hinunter. Wir spielen das jedes Mal durch, ungeachtet der Tatsache, dass ich die Schuluniform trage oder mich heute Morgen schon mal angemeldet habe, um meine Sachen wieder auf mein Wohnheimzimmer zu bringen. Vielleicht würde es mich nicht so sehr nerven, wenn ich nicht persönlich Zeugin geworden wäre, wie derselbe Wachmann Henry Li mit einem breiten Grinsen einfach durchwinkte, ohne Fragen zu stellen. Leute wie Henry müssen wahrscheinlich noch nicht mal einen Ausweis mit sich rumtragen, weil ihr Gesicht und ihr Name als Bestätigung genügen.
»Ja, ich bin mir sicher«, erwidere ich und wische mir mit dem Blazerärmel den Schweiß von der Stirn. »Wenn Sie mich bitte reinlassen könnten, shushu …«
»Name?«, unterbricht er mich und holt ein teuer aussehendes Tablet hervor, um meine Daten zu erfassen. Seit unsere Schule vor ein paar Jahren beschloss, komplett papierfrei zu werden, kennt das Ausmaß neu eingeführter unnötiger Technologie keine Grenzen. Selbst die Speisekarten in der Cafeteria gibt’s nur noch digital.
»Mein chinesischer Name ist Sun Yan. Englischer Name Alice Sun.«
»Welche Klasse?«
»Zwölfte Klasse.«
»Schülerausweis?« Er muss den Ausdruck auf meinem Gesicht sehen, denn sein Stirnrunzeln vertieft sich noch mehr. »Xiao pengyou, wenn du keinen Schülerausweis hast …«
»N…nein, nein, das ist es nicht … Okay, sehen Sie, ich hab ihn hier«, grummle ich, angle die Karte aus meiner Tasche und halte sie hoch, damit er sie begutachten kann. Wir haben die Fotos für die Schülerausweise letztes Jahr während der Prüfungswochen machen lassen – mit dem Ergebnis, dass ich auf meinem aussehe wie irgendetwas, das gerade aus einem Gully gekrochen ist: Mein normalerweise glänzend schwarzer Pferdeschwanz glich nach einer Woche Verzicht auf Haarewaschen, um mehr Zeit zum Lernen zu haben, einer einzigen fettigen Katastrophe, und mein Gesicht war von Stressflecken übersät, während sich unter meinen verquollenen Augen fette dunkle Ringe zeigten.
Ich schwöre, ich kann sehen, wie der Wachmann beim Anblick meines Fotos leicht die Augenbrauen hochzieht, aber wenigstens öffnet sich ein paar Sekunden später knarrend das Tor, bis die mächtigen Flügel vor den beiden steinernen Löwen anhalten, die mit wachsamem Blick auf die Straße hinausblicken. Ich sammle den letzten Rest meiner Würde ein, bedanke mich bei dem Mann und eile hinein.
Wer auch immer das Schulgelände der Airington entworfen hat, wollte dabei ganz eindeutig östliche und westliche, alte und moderne architektonische Elemente miteinander verschmelzen lassen. Deshalb sind am Haupteingang flache, breite Fliesen verlegt, wie die in der Verbotenen Stadt, und tiefer auf dem Gelände befinden sich künstlich angelegte chinesische Gärten inklusive Koi-Teichen und Stufenpagoden mit zinnoberroten Schrägdächern, während die Gebäude an sich elegante, vom Boden bis zur Decke reichende Fenster und sich über grüne Rasenstreifen spannende Glasbrücken zieren.
Aber wenn ich ehrlich bin, sieht es eher aus, als hätte hier jemand eins von diesen im alten China spielenden Kostümdramen gedreht und vergessen, den Set hinterher wieder aufzuräumen.
Es hilft auch nicht, dass alles so weitläufig ist. Man braucht fast zehn Minuten, um über den Schulhof, um das Naturwissenschaftsgebäude herum und in die Aula zu rennen, und als ich dort ankomme, wimmelt es in dem riesigen, hell erleuchteten Saal bereits von Schülerinnen und Schülern.
Aufgeregte Stimmen hallen rauschend von den Wänden wider, wie Wellen am Strand. Der Lärmpegel ist noch höher als sonst, weil alle durcheinandererzählen, was sie im Sommer erlebt haben. Ich muss ihnen nicht zuhören, um die Details zu kennen – man konnte alles bei Instagram sehen, von Rainie Lams Bikinifotos in irgendeiner Villa, in der die Kardashians mal übernachtet haben, bis hin zu Chanel Caos unzähligen Selfies mit diversen Filtern auf der neuen Jacht ihrer Eltern.
Während die Lautstärke ihren Höhepunkt erreicht, lasse ich den Blick auf der Suche nach einem freien Platz durch den Saal schweifen – oder um genau zu sein: nach Leuten, neben die ich mich setzen kann. Ich habe zwar zu allen ein recht freundschaftliches Verhältnis, aber auch wir sind hier in soziale Kategorien unterteilt, die sich nach allem Möglichen richten, angefangen bei unserer Muttersprache – Englisch und Mandarin sind die häufigsten, gefolgt von Koreanisch, Japanisch und Kantonesisch – bis hin zu der Frage, wie oft man schon etwas erreicht hat, das beeindruckend genug war, um im monatlichen Newsletter der Schule Erwähnung zu finden. Ich schätze, es ist die beste Version der Meritokratie, die man an einem Ort wie diesem nun mal erwarten kann – abgesehen von der Tatsache, dass Henry Li in seinen vier Jahren hier bereits fünfzehnmal im Newsletter erwähnt wurde.
Nicht, dass ich mitzählen würde oder so.
»Alice!«
Ich hebe den Blick und sehe meine Zimmergenossin, Chanel, die mir aus einer der mittleren Reihen zuwinkt. Sie ist hübsch, auf diese Taobao-Model-Art: spitzes Kinn, blasse, gläserne Haut, absichtlich zerzauste Air Bangs, eine Taille vom Umfang meines Oberschenkels und Doppellider, die vor zwei Sommern definitiv noch nicht da waren. Ihre Mum, Coco Cao, ist Model – sie hatte erst letztes Jahr eine Fotoserie in der Vogue China, und ihr Gesicht war so ziemlich an jedem Zeitungsstand der Stadt zu sehen –, und ihrem Dad gehört eine Kette edler, überall in Peking und Schanghai verteilter Nachtclubs.
Das ist allerdings so ziemlich alles, was ich über sie weiß. Als wir damals in der siebten Klasse unsere Wohnheimzimmer bezogen, hatte ich im Stillen gehofft, wir würden beste Freundinnen werden. Und für eine Weile sah es auch ganz danach aus. Wir gingen jeden Morgen zusammen zum Frühstück in die Cafeteria und warteten nach dem Unterricht an den Spinden aufeinander. Doch irgendwann lud sie mich ein, mit ihr und ihren reichen Fuerdai-Freunden im Sanlitun Village oder in Guomao shoppen zu gehen, wo die Designertaschen vermutlich mehr kosten als die komplette Wohnung meiner Eltern. Nachdem ich zum dritten Mal mit irgendeiner gestammelten Ausrede dankend abgelehnt hatte, hörte sie einfach auf, mich zu fragen.
Trotzdem ist es nicht so, als würden wir uns nicht verstehen, und neben ihr ist auch noch ein Platz frei …
Ich steuere darauf zu und hoffe, man merkt mir nicht an, wie unbehaglich ich mich fühle. »Kann ich mich hier hinsetzen?«
Sie blinzelt mich an, eindeutig ein wenig verdutzt. Dass sie mir zugewinkt hat, war reine Höflichkeit, keine Einladung. Doch dann lächelt sie zu meiner Erleichterung, und ihre perfekten porzellanweißen Veneers leuchten beinahe, als das Licht in der Aula langsam gedimmt wird. »Ja, klar.«
Ich habe mich kaum niedergelassen, als der Vertrauenslehrer der Oberstufe und unser Geschichtslehrer, Mr Murphy, die Bühne betritt, ein Mikrofon in der Hand. Er ist einer der vielen amerikanischen Expats an unserer Schule: Englisch-Abschluss an einer renommierten, aber keiner Ivy-League-Universität, chinesische Frau, zwei Kinder, kam wahrscheinlich wegen einer kleineren Midlife-Crisis nach China und blieb dann wegen der guten Bezahlung hier.
Er tippt zweimal ans Mikrofon und sorgt damit für ein grässlich kreischendes Dröhnen, bei dem alle zusammenzucken.
»Hallo, hallo«, sagt er in die darauffolgende Stille. »Willkommen zur ersten Versammlung dieses Schuljahrs – und zu einer ganz besonderen noch dazu, wie ihr euch vielleicht erinnert …«
Ich setze mich ein wenig aufrechter hin, obwohl ich weiß, dass die Preise erst ganz am Ende verliehen werden.
Zuerst müssen wir noch eine ausgedehnte Runde Selbstbeweihräucherung über uns ergehen lassen.
Mr Murphy gibt ein Handzeichen, und der Projektor geht an, woraufhin sich der Bildschirm hinter ihm mit vertrauten Namen, Zahlen und Uni-Logos mit hohem Wiedererkennungswert füllt: Annahmequoten.
Laut der PowerPoint wurden im vergangenen Jahr über 50 Prozent der Abschlussklasse an einer Ivy-League- oder Oxbridge-Universität angenommen.
Staunendes Murmeln ist in der Aula zu hören – vermutlich von den diesjährigen Neulingen. Alle anderen sind bereits daran gewöhnt und zwar ebenfalls beeindruckt, aber nicht mehr ehrfürchtig. Außerdem hatte die Abschlussklasse im Jahr zuvor eine noch höhere Quote.
Mr Murphy schwadroniert gefühlt jahrelang irgendwas von Erfolg in allen Bereichen und einer Verpflichtung zu Exzellenz. Dann verkündet er, wer heute noch auftreten wird, und alle sind sofort wieder aufmerksam, als Rainie Lams Name fällt. Irgendjemand jubelt sogar.
Rainie stolziert von ohrenbetäubendem Applaus begleitet auf die Bühne, und ich kann das leichte Ziehen in meiner Brust – halb Bewunderung, halb Neid – nicht ignorieren. Es ist genau wie damals im Kindergarten, wenn eins der Kinder ein brandneues Spielzeug mitbrachte, auf das man selbst schon seit Wochen ein Auge geworfen hatte.
Als Rainie sich am Klavier niederlässt und der Scheinwerfer über ihr einen leuchtend goldenen Heiligenschein auf sie wirft, sieht sie genauso aus wie ihre Mutter, Krystal Lam. Wie ein richtiger Hongkonger Star, der schon überall auf der Welt auf Tour war. Und das muss sie auch selbst wissen, denn sie wirft ihr glänzendes mahagonibraunes Haar zurück, als wäre sie in einer Pantene-Werbung, und zwinkert der Menge zu. Genau genommen ist es uns gar nicht erlaubt, uns die Haare zu färben, aber Rainie ging in dieser Sache strategisch vor. Vergangenes Jahr hat sie ihr Haar alle zwei Wochen nach und nach eine Schattierung heller gefärbt, damit die Lehrerinnen und Lehrer die Veränderung nicht bemerkten. Ihre Hingabe ist beinahe bewundernswert. Andererseits ist es vermutlich leicht, strategisch vorzugehen, wenn man die Zeit und das nötige Kleingeld dazu hat.
Nachdem auch der letzte Jubel endlich verebbt ist, macht Rainie den Mund auf und beginnt zu singen, und natürlich ist es eine der neuesten Singles von JJ Lin. Eine schamlose Anspielung auf die Tatsache, dass er letzten November Gast bei einem der Konzerte ihrer Mutter war.
Nach ihr betritt Peter Oh die Bühne und gibt einen seiner eigenen Raps zum Besten. Bei jedem anderen würden sich wahrscheinlich alle im Saal fremdschämen und auf ihren Plätzen kichern, aber Peter ist gut. Richtig gut. Es kursieren Gerüchte, er hätte bereits einen Deal mit irgendeinem asiatischen Hip-Hop-Label in der Tasche, obwohl genauso wahrscheinlich ist, dass er die Position seines Dads bei Longfeng Oil erben wird.
Weitere Darbietungen folgen: ein Geigenwunderkind aus der Stufe unter uns, eine professionell ausgebildete asiatisch-australische Opernsängerin, die schon mal im Sydney Opera House aufgetreten ist, und eine Guzheng-Spielerin in traditionellem chinesischem Gewand.
Dann, endlich, bin ich an der Reihe.
Das Klavier wird in irgendeine dunkle Ecke hinter dem Vorhang gerollt und die PowerPoint-Folie wechselt. Die Worte Preis für die Jahrgangsbesten leuchten in fetten Buchstaben auf dem Bildschirm auf. Mir geht ein bisschen das Herz auf.
Diese Preisverleihungen sind wirklich nicht besonders spannend. Man teilt uns schon Monate im Voraus mit, ob wir einen Preis bekommen, und abgesehen von der achten Klasse, als ich in meine Chinesisch-Prüfung verhauen habe, weil ich eine üble Lebensmittelvergiftung hatte, haben Henry und ich uns den Jahrgangsbestenpreis jedes Jahr geteilt, seit er an der Schule ist. Man sollte meinen, ich hätte mich inzwischen daran gewöhnt und es würde mich vielleicht ein bisschen weniger kümmern, aber das Gegenteil ist der Fall. Nun, da ich auf eine Erfolgssträhne zurückblicken kann und einen Ruf zu verteidigen habe, steht umso mehr auf dem Spiel, und es ist ein umso berauschenderes Gefühl, zu gewinnen.
Nach allem, was man sagt, ist es ein bisschen so, wie den Menschen zu küssen, den man liebt – nicht, dass ich darüber wirklich irgendwas wüsste. Aber es fühlt sich jedes Mal wieder an wie das erste Mal.
»Alice Sun«, dröhnt Mr Murphy ins Mikrofon.
Aller Augen richten sich auf mich, als ich mich langsam von meinem Stuhl erhebe. Es brandet kein begeisterter Jubel auf, nicht wie bei Rainie, aber wenigstens schauen sie her. Wenigstens können sie mich sehen.
Ich streiche meine Uniform glatt, gehe zur Bühne und passe auf, unterwegs nicht zu stolpern. Als Mr Murphy vor mir steht, meine Hand schüttelt und mich ins Scheinwerferlicht führt, fangen alle an zu klatschen.
Ernsthaft, ich würde zusammenschrumpeln oder auf der Stelle sterben wollen, falls ich jemals glauben würde, die Leute würden hinter meinem Rücken über mich urteilen oder irgendwelchen Scheiß erzählen. Aber das hier, diese Art von positiver Aufmerksamkeit, während mein vollständiger Name auf einem Bildschirm erstrahlt und Applaus wie Paukenschläge durch den Raum hallt? Es würde mir nicht das Geringste ausmachen, mich bis in alle Ewigkeit in diesem Moment zu sonnen.
Doch der Moment dauert kaum ein paar Sekunden, weil Mr Murphy dann Henry Lis Namen ruft und mit einem Mal aller Aufmerksamkeit abgelenkt wird. Neu justiert. Auch der Applaus wird deutlich – schmerzlich – lauter.
Ich folge ihren Blicken, und mir krampft sich der Magen zusammen, als ich ihn in der ersten Reihe aufstehen sehe.
Es ist wahrhaftig eine der größten Ungerechtigkeiten des Lebens – natürlich abgesehen von Jugendarbeitslosigkeit und Steuern und alldem –, dass Henry Li so aussehen darf, wie er aussieht. Im Gegensatz zum Rest von uns scheint er diese peinlich-unbeholfene mittlere Pubertätsphase komplett übersprungen und sein süßes Image des Kumon-Vorzeigekinds Ende letzten Jahres praktisch über Nacht abgeschüttelt zu haben. Jetzt, mit seinem kantigen Profil, der schlanken Figur und dem dichten, welligen schwarzen Haar, das irgendwie immer perfekt in seine dunklen Augenbrauen fällt, könnte er ebenso gut als Idol-Nachwuchs wie als Erbe des zweitgrößten Technologie-Start-ups in China durchgehen.
Seine Bewegungen sind geschmeidig, aber zielstrebig, als er mit einem einzigen Schritt die Bühne betritt, diesen Ausdruck gelinden Interesses, den ich so sehr hasse, in seinem schrecklichen wunderschönen Gesicht.
Als könnte er meine Gedanken hören, richtet er den Blick auf mich. Das bohrende, brennende Gefühl in meinem Magen wird messerscharf.
Mr Murphy stellt sich vor mich. »Herzlichen Glückwunsch, Henry«, gratuliert er und lacht dann laut. »Diese ganzen Auszeichnungen müssen dir ja schon langsam langweilig werden, was?«
Henry schenkt ihm zur Antwort nur ein knappes, höfliches Lächeln.
Ich zwinge mich, ebenfalls zu lächeln, obwohl ich die Zähne so fest zusammenbeiße, dass mir der Kiefer wehtut. Obwohl Henry sich furchtbar dicht neben mich setzt und nur fünf Zentimeter Platz zwischen uns lässt, was mich noch mehr nervt. Obwohl sich meine Muskeln, wie immer in seiner Gegenwart, unwillkürlich anspannen, als er sich zu mir lehnt, die unausgesprochene Grenze überschreitet und so leise flüstert, dass nur ich es hören kann: »Herzlichen Glückwunsch, Alice. Ich hatte schon Angst, du schaffst es dieses Jahr nicht.«
Wer internationale Schulen besucht, endet meist mit einem verwässerten amerikanischen Akzent, aber Henrys hat einen eindeutig britischen Einschlag. Anfangs dachte ich, er folgt nur einem Schritt-für-Schritt-Tutorial, wie man der prätentiöseste Mensch der Welt wird, aber nach ein wenig Stalking – nein, Recherche – fand ich heraus, dass er tatsächlich zwei Jahre lang eine Grundschule in England besucht hatte. Und auch nicht nur irgendeine Grundschule, sondern dieselbe Grundschule wie der Sohn des Premierministers. Es existiert sogar ein Foto von den beiden zusammen im Reitstall der Schule, mit breitem Grinsen und geröteten Wangen, während jemand im Hintergrund Pferdeäpfel schippt.
Henrys Akzent lenkt mich so sehr ab, dass ich eine volle Minute brauche, um seine Beleidigung überhaupt zu registrieren.
Ich weiß, dass er von unserer letzten Chemieprüfung spricht. Er erreichte dabei wie üblich die volle Punktzahl, während ich einen Punkt einbüßte, nur weil ich eine besonders komplizierte Redox-Gleichung zu hastig bearbeitet hatte. Wenn die beiden Zusatzaufgaben am Ende nicht gewesen wären, die ich perfekt abliefern konnte, hätte ich mir meine Gesamtnote versaut.
Einen Moment lang kann ich mich nicht entscheiden, was ich mehr hasse: Redox-Gleichungen oder ihn.
Dann sehe ich das eingebildete Grinsen, das um seine Mundwinkel zuckt, und mir fällt mit frisch aufflammender Abneigung wieder ein, wie wir zum ersten Mal gemeinsam hier auf der Bühne standen. Ich hatte mein Bestes versucht, mich zivilisiert zu verhalten – ihm sogar ein Kompliment gemacht, weil er bei der Geschichtsklausur besser abgeschnitten hatte als ich. Aber er setzte nur denselben selbstgefälligen Ausdruck auf, der mich auch jetzt so wütend macht, zuckte kurz mit den Schultern und sagte: Die Klausur war easy.
Ich beiße die Zähne noch fester zusammen.
Mit größter Anstrengung ermahne ich mich selbst, dass ich mir vorhin ein Ziel gesetzt habe: davon Abstand nehmen, Henry von der Bühne zu schubsen. Obwohl es sehr, sehr befriedigend wäre. Obwohl er seit knapp einem halben Jahrzehnt wie ein Fluch in meinem Leben ist, es total verdient hätte und mich immer noch mit diesem lächerlichen schiefen Grinsen anguckt …
Nein. Halt dich zurück.
Wir müssen sowieso bleiben, wo wir sind, weil ein Fotograf nach vorne eilt, um ein Foto fürs Jahrbuch zu knipsen.
Dann trifft mich plötzlich die Erkenntnis, wie ein Eimer eiskaltes Wasser: Wenn das Jahrbuch erscheint, werde ich hier nicht mehr zur Schule gehen. Und nicht nur das: Ich werde auch meinen Abschluss nicht in dieser Aula machen, meinen Namen nicht in der Liste der Ivy-League-Zusagen lesen, nicht mit einer strahlenden Zukunft vor mir ein letztes Mal durch das Schultor spazieren.
Ich spüre, wie das Lächeln auf meinem Gesicht erstarrt und zu zerbrechen droht. Ich blinzle zu hastig. Aus dem Augenwinkel nehme ich den Schulslogan wahr – Airingtonbedeutet zu Hause –, in riesigen Buchstaben auf ein aufgehängtes Banner gedruckt. Aber die Airington ist nicht zu Hause, oder sie ist für jemanden wie mich nicht nur ein Zuhause. Die Airington ist eine Leiter. Die einzige Leiter, über die meine Eltern aus ihrer tristen Wohnung am Stadtrand von Peking aufsteigen und die mir zu einem siebenstelligen Jahresgehalt verhelfen könnte, die es mir jemals ermöglichen könnte, jemandem wie Henry Li auf einer großen, hochglanzpolierten Bühne wie dieser wirklich auf Augenhöhe zu begegnen.
Wie zur Hölle soll ich ohne sie ganz nach oben klettern?
Dies ist die Frage, die an meinen Nerven nagt wie eine ausgehungerte Ratte, als ich wie in Trance zu meinem Platz zurückkehre. Und sie ist der Grund, warum ich Mr Chens anerkennendes Nicken, Chanels Lächeln oder die geflüsterten Glückwünsche meiner Klassenkameradinnen und -kameraden kaum registriere.
Der Rest der Veranstaltung vergeht im Schneckentempo, und ich sitze so lange reglos da, mein Körper wie erstarrt, während mein Verstand in rasendem Tempo weiterrattert, dass mir irgendwann ganz kalt wird, trotz der erdrückenden Sommerhitze.
Ich zittere tatsächlich, als Mr Murphy uns für heute entlässt, und als ich mich dem Meer der zu den Türen hinausströmenden Schülerinnen und Schüler anschließe, kommt einem kleinen Teil meines Gehirns der Gedanke, dass es vielleicht nicht normal sein könnte, dass mir so kalt ist.
Bevor ich jedoch checken kann, ob ich vielleicht Fieber habe oder so, räuspert sich jemand hinter mir. Es klingt seltsam förmlich, so als würde sich die Person darauf vorbereiten, eine Rede zu halten.
Ich wirble herum. Es ist Henry.
Natürlich.
Für einen langen Moment starrt er mich nur an, den Kopf zur Seite geneigt, abschätzend. Es lässt sich unmöglich sagen, was er denkt. Dann macht er einen Schritt auf mich zu und murmelt mit diesem britischen Akzent, der mich so rasend macht: »Du siehst nicht besonders gut aus.«
Die Wut kocht in mir hoch.
Jetzt reicht’s.
»Beleidigen wir jetzt schon mein Äußeres?«, frage ich. Meine Stimme klingt schrill, selbst für meine eigenen Ohren, und einige der an uns Vorbeidrängenden drehen sich um und werfen uns neugierige Blicke zu.
»Was?« Henrys Augen weiten sich ein wenig und ein winziger Anflug von Verwirrung stört die präzise Symmetrie seiner Züge. »Nein, ich meine nur …« Dann scheint er etwas auf meinem Gesicht zu erkennen – etwas Gemeines, Angespanntes –, denn seine eigene Miene verhärtet sich. Er steckt die Hände in die Hosentaschen und wendet den Blick ab. »Weißt du, was? Vergiss es.«
Mir wird ganz flau im Magen, als ich seinen plötzlich so emotionslosen Tonfall höre, und ich hasse ihn dafür, hasse mich selbst noch mehr für meine Reaktion. Es gibt mindestens zwanzigtausend wichtigere Dinge, über die ich mir Sorgen machen sollte, als darüber, was Henry Li von mir hält.
Dinge wie die Kälte, die sich weiter unter meiner Haut ausbreitet.
Ich wirble wieder herum und renne zur Tür hinaus, auf den mit Kunstrasen bedeckten Schulhof. Ich hatte erwartet, mich in der Sonne besser zu fühlen, aber mein Zittern wird nur noch heftiger und die Kälte kriecht bis in meine Zehen hinunter.
Definitiv nicht normal.
Dann, ohne Vorwarnung, kracht etwas gegen meinen Rücken.
Ich habe noch nicht mal Zeit, einen Schrei auszustoßen, und knalle mit voller Wucht auf die Knie. Ein Schmerz schießt durch mich hindurch und das steife künstliche Gras bohrt sich in meine wunden Handflächen.
Ich zucke zusammen und hebe gerade noch rechtzeitig den Blick, um zu erkennen, dass der Schuldige nicht etwas ist, sondern jemand. Jemand, der wie ein Stier gebaut und doppelt so groß ist wie ich.
Andrew She.
Ich warte darauf, dass er mir aufhilft – sich wenigstens bei mir entschuldigt –, aber er runzelt nur die Stirn, während er das Gleichgewicht wiederfindet, schaut einfach über mich hinweg und wendet sich zum Gehen.
Verwirrung und Empörung ringen in meinem Kopf miteinander. Wir sprechen hier schließlich von Andrew She – dem Jungen, der jeden seiner Sätze mit »Tut mir leid« oder »Glaub ich« oder »Vielleicht« polstert, der vor dem Rest der Klasse keinen Ton rauskriegt, ohne knallrot anzulaufen, der immer der Erste ist, der den Lehrern einen guten Morgen wünscht, und der von jedem in unserer Stufe gnadenlos für seine übertriebene Höflichkeit gehänselt wird.
Doch als ich mich zu den getönten Glastüren umdrehe, um mich selbst auf Verletzungen zu überprüfen, verschwinden sämtliche Gedanken an Andrew She und grundlegende Manieren aus meinem Kopf. Mein Herz hämmert in rasendem Tempo gegen meine Rippen – ein lauter, wilder Rhythmus aus das-kann-nicht-passieren-das-kann-nicht-passieren …
Denn in den Türen kann ich alles wie in einem Spiegel sehen: die die Basketballfelder flutenden Schülerinnen und Schüler, die rings um das Naturwissenschaftsgebäude gepflanzten smaragdgrünen Bambushaine, den in der Ferne in den Himmel hinaufflatternden Schwarm Sperlinge …
Alles, außer mich selbst.
Kapitel 2
Mein erster Gedanke ist weniger ein richtiger Gedanke als ein einzelnes Wort, das mit Sch beginnt.
Mein zweiter Gedanke ist: Wie soll ich so meinen Chinesisch-Aufsatz abliefern?
Langsam kapiere ich, was Mama damit gemeint hat, ich müsste ernsthaft über meine Prioritäten nachdenken.
Während ich auf die leere Stelle in der Glasscheibe starre – die Stelle, an der eigentlich ich zu sehen sein sollte –, rauscht ein Wirbelsturm aus Tausenden Fragen und Möglichkeiten durch meinen Kopf, wie ein Schwarm aufgescheuchter, wild mit den Flügeln flatternder Vögel, nichts als schiere Kraft ohne Richtung. Das muss ein Traum sein, rede ich mir selbst gut zu. Doch obwohl ich die Worte mehrfach wiederhole, glaube ich sie nicht. Meine Träume sind nie so lebendig. Ich kann noch immer die Gewürze und das Kokosnusscurry aus der Schul-Cafeteria riechen, spüre den kühlen, glatten Stoff meines Rocks auf meinem Oberschenkel und wie die Spitzen meines Pferdeschwanzes meinen schweißbedeckten Nacken kitzeln.
Ich stoße mich zitternd vom Boden ab. Meine Knie brennen höllisch, und ich bin mir der kleinen Blutstropfen, die aus meinen Handflächen quellen, vage bewusst, aber sie sind im Moment meine geringste Sorge. Ich versuche zu atmen, mich wieder zu beruhigen.
Es funktioniert nicht. Da ist dieses leise Brummen in meinen Ohren, und meine Atmung ist zu schnell, zu flach und abgehackt.
Doch durch diese Wolke der Panik steigt Gereiztheit in mir auf. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit zu hyperventilieren.
Was ich brauche, sind Antworten.
Oder noch besser: Was ich brauche, ist eine weitere Liste. Ein eindeutiger Aktionsplan, zum Beispiel:
Erstens: herausfinden, warum zur Hölle ich mein eigenes Spiegelbild nicht sehen kann, als wäre ich eine Vampirin in einem Film aus den frühen 2000ern.
Zweitens: meinen Hausaufgabenplan für den Nachmittag den Ergebnissen entsprechend anpassen.
Drittens …
Während ich mir auf der Suche nach einem dritten Punkt das Hirn zermartere, kommt mir der Gedanke, dass ich vielleicht einfach halluziniere, mich womöglich im Frühstadium irgendeiner psychischen Erkrankung befinde – es würde zumindest auch die seltsame Kälteepisode von vorhin erklären – und vermutlich die Schulkrankenschwester aufsuchen sollte.
Doch auf dem Weg dorthin kriecht das Gefühl, dass hier irgendetwas total falsch läuft, tief in meine Knochen. Noch mehr Schülerinnen und Schüler rempeln mich an, während ihre Blicke über mein Gesicht gleiten, als wäre ich gar nicht da. Nachdem mir die fünfte Person auf den Fuß trampelt und nur mit einem verdutzten Blick Richtung Boden darauf reagiert, meldet sich ein ebenso bizarrer wie schrecklicher Gedanke.
Nur um ihn zu testen, renne ich zum nächstbesten Schüler in meinem Blickfeld und fuchtle mit einer Hand vor seiner Nase herum.
Nichts.
Noch nicht mal ein Blinzeln.
Mein Herz hämmert so heftig, dass ich Angst habe, es könnte aus meinem Brustkorb schießen.
Ich wedle noch mal mit der Hand, hoffe wider jede Vernunft, dass ich mich trotz allem irre, aber er starrt einfach nur geradeaus.
Was bedeutet, es hat sich entweder die ganze Schule gegen mich verschworen und sämtliche Oberflächen auf dem Gelände manipuliert, um den aufwendigsten Streich aller Zeiten abzuziehen, oder …
Oder ich bin unsichtbar.
Was sich direkt als einen Hauch unpraktischer erweist, als ich es mir vorgestellt hätte.
Ich husche zur Seite, damit der Typ mich nicht doch noch umrennt, und flüchte mich in den Schutz einer nahen Eiche. In meinem Kopf dreht sich alles. Es hat keinen Sinn, die Krankenschwester aufzusuchen, wenn sie mich noch nicht mal sehen kann. Aber vielleicht – ganz bestimmt – kann mir jemand anders helfen. Jemand, der mir glauben wird und dem eine Lösung einfällt – oder falls nicht, der mich wenigstens tröstet. Mir sagt, dass alles gut werden wird.
Ich gehe alle Leute durch, die ich kenne – und das Ergebnis ist die harte, schmerzhafte Wahrheit: Ich habe zwar zu allen hier ein freundschaftliches Verhältnis … bin aber mit niemandem wirklich befreundet.
Dies klingt exakt nach der Art von Erkenntnis, die mindestens eine Stunde gründlicher Selbstanalyse nach sich ziehen sollte. Und unter anderen Umständen würde sie das wahrscheinlich auch. Doch der Rausch aus Angst und Adrenalin, der in meinen Adern pulsiert, lässt mich nicht zur Ruhe kommen, während ich bereits diverse weitere Möglichkeiten abwäge und mein Bestes versuche dahinterzukommen, wie mein nächster Schritt aussehen sollte.
Ich pflege also keine engen Beziehungen, auf die ich mich in einer persönlichen, möglicherweise übernatürlichen Krise verlassen kann. Na schön. Von mir aus. Ich kann diese Sache auch ganz objektiv angehen. Sie wie eine Zusatzaufgabe in einer Klausur behandeln, bei der es ausschließlich darauf ankommt, die richtige Antwort zu finden.
Gut. Objektiv betrachtet gibt es hier in der Schule eine Person, die sich als nützlich erweisen könnte. Eine Person, die zum Vergnügen irgendwelche obskuren akademischen Journale liest, ein Praktikum bei der NASA gemacht und noch nicht mal mit der Wimper gezuckt hat, als irgendein Würdenträger aus Nordkorea an der Airington auftauchte. Eine Person, die womöglich tatsächlich gelassen bleiben würde und kompetent genug wäre, dieser ganzen beschissenen Situation auf den Grund zu gehen.
Und falls er doch keine Ahnung hat, was mit mir passiert … Nun, dann wird mir dies wenigstens die Befriedigung des Wissens bescheren, dass es ein Rätsel gibt, das Henry Li nicht lösen kann.
Bevor mein Stolz meine Logik einholen und mir erklären kann, warum das hier eine ganz miese Idee ist, marschiere ich direkt auf das Gebäude zu, dem ich mich ansonsten noch nicht mal genähert, ganz davon zu schweigen, dass ich es absichtlich betreten hätte.
Wenige Minuten später starre ich zu den Worten hinauf, die in geschwungener Kalligrafie über der zinnoberroten Eingangstür prangen: Mengzi-Haus
Ich atme tief durch. Schaue mich um, um mich zu vergewissern, dass mich wirklich niemand sieht. Dann stoße ich die Tür auf und gehe hinein.
Die vier Wohnheime auf dem Schulgelände sind alle nach Philosophen aus dem alten China benannt: Konfuzius, Mengzi, Laozi und Mozi. Es klingt total nobel – bis man mal kurz darüber nachdenkt, wie viele hormongesteuerte Teenager wahrscheinlich schon im Konfuzius-Haus miteinander rumgemacht haben.
Mengzi ist mit Abstand das schickste Gebäude von allen. Die Korridore sind breit und makellos, so als würden sie stündlich von den ayis der Schule gereinigt, während die Wände in tiefem Meeresblau gehalten und mit eingerahmten Tintengemälden von Vögeln und ausschweifenden Landschaften dekoriert sind. Wenn die über sämtlichen Türen stehenden Namen nicht wären, könnte der Bau glatt als Fünfsternehotel durchgehen.
Ich brauche nicht lange, um Henrys Zimmer zu finden. Seine Eltern haben dieses Gebäude schließlich gespendet, weshalb die Schule auch zu dem Schluss kam, es sei nur fair, ihm das einzige Einzelzimmer am Ende des Flurs zuzuteilen.
Zu meiner Überraschung steht seine Tür halb offen. Ich dachte immer, er gehört zu diesen superprivaten Leuten, die nur das Nötigste von sich preisgeben. Vorsichtig mache ich noch einen Schritt vorwärts und bleibe in der Tür stehen, von dem plötzlichen, unerklärlichen Drang erfasst, mir das Haar glatt zu streichen.
Dann fällt mir jedoch wieder ein, warum ich hier bin, und hysterisches Lachen blubbert aus mir heraus.
Bevor ich doch noch den Mut verlieren oder die wahre Absurdität meines Vorhabens wirklich begreifen kann, schlüpfe ich ins Zimmer.
Und erstarre.
Ich bin mir nicht sicher, was genau ich zu sehen erwartet hatte. Vielleicht, wie Henry entspannt auf riesigen Geldhaufen lümmelt, eine seiner zahlreichen glänzenden Trophäen poliert oder seine geradezu lächerlich reine Haut mit einem aus gemahlenen Diamanten und dem Blut von Gastarbeitern hergestellten Peeling behandelt. So was in der Art eben.
Doch stattdessen sitzt er am Schreibtisch, seine dunklen Augenbrauen konzentriert zusammengekniffen, während er auf seinem Laptop tippt. Der oberste Knopf seines weißen Schuluniformhemds ist offen, seine Ärmel sind hochgekrempelt und enthüllen die schlanken Muskeln in seinen Armen. Weiches Nachmittagslicht strömt durch das offene Fenster neben ihm herein und taucht seine perfekten Züge in Gold. Und als wäre diese ganze Szene nicht schon filmreif genug, weht auch noch eine sanfte Brise herein, und er fährt sich mit den Fingern durchs Haar, als wäre das hier ein gottverdammtes K-Pop-Video.
Während ich ihn mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu anglotze, greift Henry nach der Dose White-Rabbit-Milchbonbons neben seinem Laptop. Wickelt mit seinen schlanken Fingern ein Bonbon aus dem blau-weißen Papier aus und steckt es sich in den Mund. Seine Augen schließen sich für einen Moment mit einem Flattern.
Dann erinnert mich eine leise Stimme in meinem Hinterkopf daran, dass ich nicht den ganzen Weg hierhergekommen bin, um Henry Li dabei zuzusehen, wie er ein Kaubonbon isst.
Nicht sicher, wie ich sonst weiter vorgehen soll, räuspere ich mich und sage: »Henry.«
Er reagiert nicht. Schaut noch nicht mal auf.
Panik rauscht durch meine Adern, und ich fange an, mich zu fragen, ob andere Leute mich vielleicht auch nicht mehr hören können – als wäre unsichtbar zu sein nicht schon schwer genug. Doch dann bemerke ich, dass er AirPods drin hat. Ich schleiche mich näher, um einen Blick auf seine Spotify-Playlist zu werfen, beinahe sicher, dass sie nur aus weißem Rauschen oder klassischer Orchestermusik besteht, muss jedoch feststellen, dass stattdessen Taylor Swifts neuestes Album läuft.
Ich will gerade eine Bemerkung dazu machen, doch dann fällt mein Blick auf das an seinen Schreibtisch geklebte laminierte Foto – und die Tatsache, dass Henry Li heimlich zu Tay Tay abgeht, verblasst im Vergleich dazu völlig.
Es ist ein Foto von uns beiden.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass es durch ein paar Werbeanzeigen für die Schule huschte. Es wurde bei der Preisverleihung vor drei Jahren aufgenommen, als ich noch diesen lächerlichen Seitenpony hatte, der mein halbes Gesicht verdeckte. Auf dem Foto macht Henry sein typisches Gesicht: dieser Ausdruck höflichen Interesses, der mich so rasend macht, so als hätte er was Besseres zu tun, als dort rumzustehen und noch mehr Applaus und renommierte Auszeichnungen einzuheimsen. Aber was mich noch rasender macht, ist die Tatsache, dass dem wahrscheinlich auch so ist. Ich starre neben ihm direkt in die Kamera, meine Schultern angespannt, die Arme steif an meinen Seiten. Mein Lächeln wirkt total gezwungen, und es ist echt ein Wunder, dass der Fotograf uns nicht erklärt hat, er müsse noch mal ein Bild knipsen.
Ich habe keine Ahnung, warum Henry es überhaupt hat, außer als eindeutigen Beweis dafür, dass ich absolut unfähig bin, auf Fotos besser auszusehen als er.
Plötzlich spannt Henry sich an. Zieht seine AirPods raus. Wirbelt auf seinem Stuhl herum und lässt den Blick durch den Raum schweifen. Ich brauche eine Sekunde, um zu kapieren, dass ich mich zu weit vorgelehnt und aus Versehen seine Schulter gestreift habe.
Na, ich schätze, das ist eine Möglichkeit, seine Aufmerksamkeit zu erregen.
»Okay«, beginne ich, und er erschrickt und reißt den Kopf herum, als er meine Stimme hört. »Okay, bitte flipp jetzt nicht aus oder so, aber … hier ist Alice. Du, ähm, kannst mich im Moment bloß nicht sehen. Ich verspreche dir, ich erkläre es dir später, aber ich bin direkt neben dir.« Ich nehme den Stoff seines linken Ärmels zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehe daran, ganz sanft, nur um es ihm zu beweisen. Er erstarrt komplett.
»Alice?«, fragt er, und ich hasse es, dass mein Name aus seinem Mund so viel nobler klingt. So elegant. »Soll das ein Witz sein oder so?«
Zur Antwort ziehe ich ein bisschen fester an seinem Ärmel und beobachte die Folge der Emotionen, die wie Schatten über sein Gesicht huschen: Schock, Unsicherheit, Angst, Skepsis, sogar ein Anflug von Genervtheit. Sein Kiefermuskel spannt sich an.
Doch schon im nächsten Moment sitzt – unglaublich, aber wahr – seine übliche Maske der Gelassenheit wieder an ihrem Platz.
»Wie … eigenartig«, sagt er nach langem Schweigen.
Ich rolle mit den Augen angesichts dieser unfassbaren Untertreibung, bis mir wieder einfällt, dass er mich natürlich nicht sehen kann.
Großartig. Ich kann ihn noch nicht mal angemessen verhöhnen.
»Es ist mehr als eigenartig«, erwidere ich. »Ich sollte … Ich meine, das hier sollte unmöglich sein.«
Henry atmet tief durch. Schüttelt den Kopf. Sein Blick sucht mich erneut, bleibt jedoch an irgendeiner willkürlichen Stelle über meinem Schlüsselbein hängen. »Aber ich hab dich vor nicht mal einer halben Stunde noch gesehen …«
Hitze steigt bei der Erinnerung an unsere letzte Begegnung in mir auf. Ich zwinge sie nieder. »Tja, in einer halben Stunde kann sich eine Menge ändern.«
»Richtig«, bestätigt er, zieht das Wort in die Länge. Dann schüttelt er wieder den Kopf. »Okay, wie genau ist denn das«, er macht eine Geste in meine ungefähre Richtung, »passiert?«
Um ehrlich zu sein, dachte ich, er würde mir die ganze Sache viel schwerer machen – zumindest wissen wollen, warum ich hierher gekommen bin, ausgerechnet. Aber er klappt nur seinen Laptop zu und schiebt ihn ein Stück nach hinten, wodurch er – absichtlich oder aus Versehen – das Foto von uns verdeckt, während er darauf wartet, dass ich ihm antworte.
Also tue ich es.
Ich gehe noch einmal alles durch, von der kurzen Kälteepisode bis zu Andrew She, der mich umgerannt hat, wobei ich darauf achte, kein einziges Detail auszulassen, das als Hinweis darauf dienen könnte, was zur Hölle hier los ist. Nun, alles bis auf das Treffen mit meinen Eltern vor der Schulversammlung. Niemand in der Schule weiß über meine familiäre Situation Bescheid, und ich gedenke es auch dabei zu belassen.
Als ich fertig bin, lehnt Henry sich plötzlich vor, seine Hände im Schoß gefaltet, seine dunklen Augen nachdenklich. »Weißt du, was?«
»Was?«, frage ich und versuche, nicht zu hoffnungsvoll zu klingen. Ich erwarte etwas Tiefschürfendes, Wissenschaftliches, einen Bezug zu einem seit Kurzem auftretenden gesellschaftlichen Phänomen, von dem ich bloß noch nichts gelesen haben. Aber was ihm stattdessen über die Lippen kommt, ist …
»Das erinnert mich alles total an Der Herr der Ringe.«
»Was?«
»Na ja, dass du unsichtbar bist …«
»Ja, nein, das hab ich schon verstanden«, stammle ich. »Aber wie … Warum … Okay. Warte mal kurz. Seit wann stehst du bitte auf High Fantasy?«
Er richtet sich auf seinem Stuhl auf. »In ein paar Jahren«, erklärt er mir, und es klingt sofort nach einer seiner sehr weitschweifigen Antworten auf eine ganz direkte Frage, »werde ich der Geschäftsführer des größten Technologie-Start-ups in ganz China sein …«
»Zweitgrößten«, korrigiere ich ihn automatisch. »Nicht lügen. Das stand erst vor einer Woche im Wall Street Journal.«

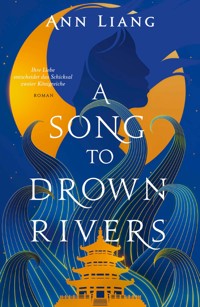














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












