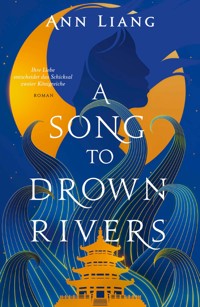
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihre Schönheit hat die Macht, ein Königreich zu stürzen – doch ihr Herz kann sie nicht beschützen »A Song to Drown Rivers« ist ein epischer und dramatischer historischer Liebesroman um eine große Liebe, die zwei Königreiche zerstören könnte. China um das Jahr 500. Für die Menschen in Xishis Dorf ist die bezaubernde Schönheit der jungen Frau ein Segen, der ihrer Familie Wohlstand bringen wird. Doch Fanli, der Berater des Königs, sieht sehr viel mehr in ihr: Er bietet Xishi an, sie zur Spionin auszubilden. Denn der Herrscher des verfeindeten Nachbarkönigreichs Wu ist bekannt dafür, eine Schwäche für schöne Frauen zu haben. Xishi kann die Klinge werden, die ihn mit einem Stich ins Herz zu Fall bringt. Xishi, die bei einem Angriff von Wu-Soldaten ihre Schwester verloren hat, ist ebenso fasziniert von Fanli wie von den Möglichkeiten, die er ihr bietet. Sie lernt von ihm alles, was sie für ihre Mission braucht – vor allem zu lügen und ihre wahren Gefühle zu verbergen. Nur einander können Fanli und Xishi nicht täuschen. Als sie schließlich an den Hof von Wu gelangt, steigt die anmutige Xishi schnell in der Gunst des feindlichen Herrschers auf. Doch mit jedem Tag wächst die Gefahr, enttarnt zu werden. Und das würde nicht nur ihren eigenen Tod bedeuten, sondern auch den des Mannes, den sie liebt … Episch, dramatisch und wunderschön – eine große, zeitlose Liebesgeschichte vor dem Hintergrund einer chinesischen Legende Für ihren Liebesroman hat sich die chinesische Autorin Ann Liang von der Legende von Xi Shi inspirieren lassen, einer der Vier Schönheiten des antiken Chinas. Sie erzählt meisterhaft eine feministische Neuinterpretation um die legendäre Spionin Xishi, deren Liebe ein ganzes Königreich bedroht. »Umwerfend und herzzerreißend.« Chloe Gong, SPIEGEL-Bestsellerautorin von Welch grausame Gnade
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ann Liang
A Song to Drown Rivers
Ihre Liebe entscheidet das Schicksal zweier Königreiche
Aus dem amerikanischen Englisch von Michelle Gyo
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Zu lange schon leidet das Volk der jungen Xishi unter dem Krieg mit dem Nachbarkönigreich Wu. Da bietet Fanli, der Berater ihres Königs, Xishi eine einzigartige Chance: Er will sie zur Spionin ausbilden und aus ihrer Schönheit die Klinge formen, die den König von Wu mit einem Stich ins Herz zu Fall bringt. Xishi lernt zu lügen und ihre wahren Gefühle zu verbergen – nur einander können Fanli und Xishi nicht täuschen. Als sie schließlich an den Hof von Wu gelangt, steigt die anmutige Xishi schnell in der Gunst des feindlichen Herrschers auf. Doch mit jedem Tag wächst die Gefahr, enttarnt zu werden. Und das würde nicht nur ihren eigenen Tod bedeuten, sondern auch den des Mannes, den sie liebt …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.bramblebooks.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Bild
Danksagung
Für Kathleen Rushall, für dein Vertrauen und deinen Rat
Kapitel 1
An dem Tag, als ich geboren wurde, stießen die Wildgänse vom Himmel herab, und die Fische sanken auf den Grund des Teichs und vergaßen zu schwimmen, so sagte man. Sogar die Lotusblüten in unseren Gärten bebten und wandten die Köpfe ab, so sehr schämten sie sich über das Verblassen ihres Liebreizes in meiner Gegenwart. Diese Geschichten kamen mir immer lächerlich übertrieben vor, doch sie alle zeigten eins: Meine Schönheit war übernatürlich, sie überstieg selbst die von der Natur gegebenen Grenzen. Und sie zeigten auch, dass sich Schönheit und Zerstörung nicht so sehr unterscheiden.
Deshalb bestand meine Mutter darauf, dass ich mein Gesicht bedeckte, wenn ich das Haus verließ.
»Du darfst nicht auffallen, Xishi«, warnte sie und hielt mir den Schleier entgegen. Er kräuselte sich leise, schimmernd im Licht der Mittagssonne, der Saum leuchtend weiß. »Das ist gefährlich für ein Mädchen wie dich.«
Ein Mädchen wie mich.
Diese Worte meinten tausenderlei Dinge, und ich versuchte, nicht darüber nachzudenken, obwohl sie alte Erinnerungen in mir heraufbeschworen. Gackernde Dorftantchen mit roten Wangen, die uns früher besucht und mich bestaunt hatten. Sie ist so hübsch, hatte eine geseufzt. Eine so außerordentliche Schönheit – sie besitzt die Macht, Königreiche zu stürzen und Städte zu Fall zu bringen. Es war als Kompliment gedacht. Eine andere hatte mich ihrem Sohn vorstellen wollen, der dreimal so alt war wie ich, als Holzfäller arbeitete wie mein Vater und dessen Miene mich an einen bitteren Kürbis erinnerte.
»Komm her«, sagte Mutter.
Ich trat vor und ließ mir den Schleier um den Kopf legen, spürte, wie ihre dünnen, schwieligen Finger – erschöpft vom Waschen der Rohseide am Tag und vom Schrubben verrosteter Woks am Abend – an den Bändern nestelten. Der Stoff fiel weich über meine Nase, meine Lippen, mein Kinn, kühl gegen die schwüle Sommerhitze. Ich sollte wohl Dankbarkeit empfinden, weil sie den Wunsch hegte, mich vor fremden Blicken zu schützen. Zhengdans Mutter schleifte sie praktisch hinaus auf die Straßen und führte allen vor, wie gut sie aussah. Und es funktionierte. Sieben Männer aus unserem Dorf hatten bereits auf ihrer Schwelle gestanden und mit großzügigen Gaben um ihre Hand angehalten. Das hatte Zhengdan mir spätabends erzählt, die Lippen angewidert verzogen, die Hand unter meiner zur Faust geballt.
»Ich komme zurück, ehe es dunkel wird«, versprach ich Mutter, die sich schon viel früher Sorgen machen würde, das wusste ich, obwohl der Fluss nicht weit weg war von unserer Hütte im Westen des Dorfs und ich den gleichen Weg schon zahllose Male zurückgelegt hatte.
Doch manchmal verschwanden Mädchen wie ich. Obwohl verschwinden ein zu freundliches Wort dafür war. Die Wahrheit war hässlicher: Sie wurden gestohlen, abgeschlachtet, verkauft. Von Männern gehandelt wie kostbares Porzellan. In diesen Zeiten traf das besonders zu, da die Kriegsverletzungen in unserem Königreich noch frisch waren, die Wu unserem Volk im Nacken saßen und unsere verbliebenen Soldaten zu müde und zu weit verstreut waren, als dass man sie mit trivialen Angelegenheiten wie verschwundenen Mädchen belästigen konnte.
»Komm zurück, so schnell du kannst«, drängte Mutter und drückte mir einen grob geflochtenen Bambuskorb mit einem Stapel Seidenballen in die Arme.
Ich lief durchs Dorf, allein und wachsam. Der lange Schleier kitzelte meine Wange, und bald klebte er daran, feucht vom Schweiß, doch er dämpfte die weniger angenehmen Gerüche nach Ziegenfell, Unrat und rohem Fisch. Um mich herum lagen die meisten Häuser noch in Ruinen, mit klaffenden Löchern wie Stichwunden in den Mauern oder zersprungenen Steinbrocken, die wie Schädel in den Gärten herumlagen. Die Erde zeigte noch die schwarzen Spuren von dem Tag, an dem die Wu-Soldaten gekommen waren, mit lodernden Feuern, die Schwerter schwingend, das Blut unserer Leute von ihren Händen tropfend. Der Vorfall war mir noch deutlich im Gedächtnis, eher eine Plage als eine Erinnerung. Nachts meinte ich manchmal, Geister über den staubgelben Pfaden zu sehen. All die Dorfbewohner, die nicht überlebt hatten.
Rechts von mir knarrte eine Tür, das Geräusch holte mich zurück in die Gegenwart. Stimmen drangen durch den Spalt nach draußen. Ein Mann hustete zähen Schleim hoch. Ich lief schneller, den Korb fest an meine Brust gedrückt.
Wie immer hörte ich den Fluss, bevor ich ihn sah. Das ruhig fließende Wasser ein Lied, in das sich der Ruf der Gänse hinter den Bäumen mischte, der blausüße Duft eine Erleichterung. Dann teilten sich die Ulmen, boten mir einen unverstellten, atemberaubenden Blick auf das Flussufer, das Gras, das sich in der Brise wiegte, die glatten Kiesel am Ufer, weiß-grau getupft wie Wachteleier. Die Stelle war leer, nur ich war da – und darüber freute ich mich. Schon immer hatte ich den Klang der Einsamkeit, die Ruhe meines Atems genossen. Oft, wenn ich in Gegenwart von anderen war und ihre Blicke auf mir spürte, hatte ich das seltsame, unangenehme Gefühl, dass mein Gesicht und mein Körper nicht mir gehörten. Als wäre ich nur dazu geschaffen worden, ihnen mit meinem Anblick Vergnügen zu bereiten.
Langsam entrollte ich den ersten Seidenballen und tauchte ihn ins kühle Flusswasser. Einmal, zweimal, noch mal. Dann wrang ich ihn aus, und das Wasser floss in Strömen an meinen Handgelenken hinab. Diese Arbeit wirkte trügerisch leicht, war aber schwerer, als die meisten ahnten. Ungewaschen war die Seide rau auf meiner Haut, brachte mir rosafarbene Bläschen ein; nass war sie so schwer, dass sie meine Arme herabzog wie Schafsfelle. Immer wieder hielt ich inne, machte kurze Pausen, um wieder zu Atem zu kommen und meine Muskeln zu lockern. Die weiche Haut über meinem Herzen mit einer Hand zu massieren. Die seltsameren Geschichten besagten, dass meine Mutter an genau diesem Fluss Seide gewaschen hatte, als eine Perle sie streifte. Bald darauf soll sie mit mir schwanger geworden sein. Diesen Geschichten zufolge bin ich kein menschliches Wesen, sondern eine Kreatur aus den Mythen, doch immerhin würde das meine von klein auf angegriffene Gesundheit erklären, den Schmerz in meiner Brust, der gelegentlich nachließ, jedoch nie ganz verschwand. Hin und wieder stellte ich mir vor, dass ein Riss durch mein Herz verlief, einer, den ich nicht flicken konnte, ganz gleich, was ich auch versuchte.
Jetzt wurde der Schmerz schlimmer. Ich zuckte zusammen, runzelte die Augenbrauen, legte die Seide mit einem Platschen ab. Versuchte auszuatmen. Es nutzte nichts, gegen den Schmerz anzukämpfen, wenn er kam; ich konnte nur darauf hoffen, dass er wieder verging. Immer noch drückte ich die Hand auf meine Brust, da hörte ich in der Ferne einen Schrei.
Wie von einem Kind.
Susu, war mein erster Gedanke, aber das war närrisch.
Ich richtete mich auf und kniff die Augen zusammen, mein Herz pochend vor Schmerz und Angst. Zwei Gestalten näherten sich am Ufer – ein gertenschlankes Mädchen, gefolgt von einem sehr viel größeren Mann. Bei seinem Anblick gefror mir das Blut. Sein schwarzes Haar war auf traditionelle Wu-Art kurz geschnitten.
Monster.
Ein Feind aus Fleisch und Blut. Hier in Zhuji, in unserem Dorf. An unserem Fluss.
»Hilf mir, bitte«, weinte das Mädchen, als ihre großen Augen mich erblickten. Sie hatte höchstens einen Tierkreislauf erlebt – war so alt, wie Susu heute wäre, hätte sie die Chance auf ein Leben bekommen. Als sie ihre mageren Arme hob, sah ich die violetten Abdrücke, die ihre sonnenverbrannte Haut zierten. Sie wirkten frisch.
Das Mädchen und sein Verfolger waren jetzt nur noch einige Meter entfernt. Dann weniger.
Tu etwas. Die Worte drängten sich in meinen Geist, schienen aber wie losgelöst, als würden sie von jemand anderem gedacht. Meine Hände waren noch nass vom Fluss, kalter Schlick klebte unter meinen Nägeln. Meine Zähne klapperten. Ich sah mich um, nach etwas – jemandem –, aber da war nur gelbes Sonnenlicht, das sich auf dem Wasser spiegelte, Gänse, die am Horizont aufstiegen, und die zerknitterte Seide im Korb.
Das Mädchen stolperte mit dem Kopf voran, ihre Knie prallten auf die Kiesel. Das Geräusch fuhr mir selbst in die Knochen, und ich spürte einen Schmerz, der nicht meiner war. Ein Schrei entfuhr ihren Lippen, aber in meinen Ohren verwandelte er sich in den Schrei eines anderen Kinds. Ein vertrauter Schrei, schrill vor Panik und Verwirrung. Jemand, der mich mehr brauchte als alles andere.
Susu. Nein, geh nicht raus, wir müssen in unserem Versteck bleiben.
Hör auf mich.
Komm zurück.
Für einen Augenblick schien sich die Zeit zu zerteilen, und ich sah meine kleine Schwester, ihre großen Augen, ihr weiches Gesicht, das aus allem Reinen und Guten auf der Welt bestand. Ich sah, wie das Schwert ihre Seite durchbohrte. Sah sie stürzen …
»Hilfe!«
Eilig wollte das Mädchen wieder aufstehen, aber der Mann ragte so riesig über ihr auf wie das Urwesen Pangu, das in den alten Mythen als Weltachse im Mittelpunkt von Himmel und Erde steht, und sein Schatten verdeckte die Sonne. Bedrohlich näherte er sich ihr, und sein Stiefel stampfte auf den Saum ihrer fadenscheinigen Tunika. Nagelte sie am Boden fest wie ein Pfeil im Flügel eines Vogels.
»Kleine Diebin«, fauchte er, sein Wu-Akzent deutlich in seinen Worten, den zwischen den Zähnen zerquetschten Silben. »Dachtest du wirklich, du könntest die Birne unter meinen Augen klauen und damit durchkommen?«
Das Gesicht des Mädchens war so weiß und starr wie Knochen, aber die Augen schienen von innen heraus zu lodern, als es sich seinem Angreifer zuwandte. »Es war nur eine Birne.«
»Sie gehört mir. Das alles hier«, sagte der Mann und zeigte auf unser Dorf und die Umgebung, auf die ansteigenden blauen Berge, die Hauptstadt, das ganze Königreich von Yue, »gehört jetzt uns. Vergiss das nicht.«
Das Mädchen antwortete mit einer Reihe so unflätiger Flüche, dass ich mich nur wundern konnte, wo sie diese gelernt hatte …
»Das reicht«, bellte der Mann und zog sein Schwert.
Das scharfe, metallische Sirren zerteilte alle anderen Geräusche. Ich hatte gehört, dass die Wu Meister der Metallkunde wären, so wie wir; dass ihre Schwerter so scharf wären, dass sie Fels durchschnitten und sogar nach Jahrhunderten noch scharf waren. Mit großer Verzweiflung erkannte ich jetzt, dass es stimmte. Die Klinge leuchtete in der Luft, spaltete die Sonne mit ihrer tödlichen Spitze. Ein rascher Hieb, und sie würde Knochen spalten.
Ich riss mich aus meiner entsetzten Benommenheit. Wieder war da der Gedanke, lauter diesmal: Tu etwas. Rette sie.
Versag nicht noch einmal.
Hektisch tasteten meine Finger über den Boden und schlossen sich um einen Stein. Nicht größer als ein Ei, aber schwer, mit unebener Kante. Der Mann sah mich nicht an; sein Blick galt einzig dem sich zusammenkauernden Mädchen. Im Bruchteil der Sekunde, bevor das Schwert herabschwang, warf ich den Stein nach ihm. Was ich zu erreichen hoffte, weiß ich nicht. Gern würde ich glauben, dass mir der Sinn nicht nach Mord gestanden hatte, dass ich ihn nur hatte ablenken wollen. Doch als der Stein die Nase des Mannes mit einem lauten Knirsch traf, er rückwärtstaumelte, aufschrie, die Hände ans Gesicht hob …
Spürte ich, wie Befriedigung in mir aufzuckte, das gebe ich zu.
Und doch wurde sie rasch ersetzt von aufsteigender Angst. Der Mann hatte seine ganze Aufmerksamkeit mir zugewandt, und selbst wenn ich keinen Mord im Sinn gehabt hatte, so konnte ich doch sehen, dass er darauf aus war. Sein Kinn war voll Blut, und als er einen Schritt auf mich zumachte, rann noch mehr Blut aus seiner Nase und in seinen Mund. Er wandte sich ab und spuckte aus. Wischte sich das Gesicht mit dem linken Ärmel ab. In seiner rechten Hand glänzte das Schwert, war auf mich gerichtet.
»Im Königreich der Wu«, sagte er, »gibt es eine Redensart über jene, die sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern: Sie sterben oft einen unerfreulichen Tod.«
Meine Kehle zog sich zusammen.
Da wusste ich, mit einer Gewissheit, die tief in meinen Knochen sang, dass ich hier an diesem Flussufer, wo das Wasser auf den Himmel traf und meine Mutter keinen Kilometer entfernt darauf wartete, dass ich nach Hause kam, sterben würde. Die Schritte des Mannes knirschten auf dem Kies, kamen näher. In meiner Panik wandte sich mein Geist absurden Gedanken zu, formulierte hilflose, halbe Proteste. Dass ich zu jung wäre, dass ich doch sicherlich nichts so Schlimmes getan hätte, dass ich dies verdiente, selbst wenn ich nicht immer meinen Reis aufaß oder meine Laken faltete; dass ich mich erst noch verlieben, das Meer sehen, das Gebiet außerhalb meines Dorfs erkunden wollte.
Und doch hörte das große Universum all meine Proteste nicht. Ich warf noch einen Stein nach dem Mann, voller Verzweiflung, aber jetzt rechnete er damit. Er wich ihm mit Leichtigkeit aus, wie dem nächsten auch, seine Lippen verzogen sich, zeigten geschwärzte Zähne. Wieder hob er sein Schwert. Ich spürte das kühle Metall, als hätte es bereits meine Seele gefordert, mein Fleisch geküsst.
Nein, dachte ich unsinnig. Noch nicht, noch nicht, noch nicht …
Ein greller Blitz vor meinen Augen.
Das Klirren von Metall auf Metall. Ich blinzelte. Ein ungewöhnlicher Luftzug erfasste meinen Schleier, und es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was geschehen war. Ein anderes Schwert war vorgezuckt und hatte die Waffe des Mannes von ihrer Bahn abgelenkt, bevor sie mich treffen konnte. Aber woher war dieses andere Schwert gekommen?
Ich drehte mich um und erblickte die Antwort. Eine große, schlanke Gestalt schritt mit der unheimlichen Eleganz eines Luchses über das Ufer. Die Sonne stand hell hinter ihm, die Gesichtszüge verschwammen im Gegenlicht. Ich fragte mich leise, ob er vom Himmel gesandt worden war, ein Krieger aus den Legenden – oder ob ich vielleicht schon tot war und mir diesen Anblick erträumte.
Aber nein, er war echt. Nichts hatte sich je echter angefühlt in meinem Leben. Ich schmeckte das Salz des Flusses, das sich mit dem Blut mischte, weil ich mir zu fest auf die Zunge gebissen hatte. Dann drehte sich die Gestalt um ein paar Grad, und das Licht fiel anders, beschien sein Gesicht. Überrascht erkannte ich, dass es das Gesicht eines jungen Mannes war, und ein wunderschön vornehmes noch dazu. Die Kanten waren klar, rein und harmonisch, der natürliche Schwung seiner Lippen beinahe arrogant; zusammengenommen war es einschüchternd, wenn man ihn länger musterte.
»Wer bist du denn?«, rief der Wu, doch seine Frage gurgelte rau, vom Blut gedämpft. »Woher kommt ihr nur immer wieder her?«
»Du hast kein Recht, mich anzusprechen«, erwiderte der Fremde ruhig. Seine Stimme war wie sein Auftreten: kalt und still, aber so, wie eine stumpfe Scheide eine tödliche Klinge enthält.
Das Gesicht des Wu verzog sich. Er stürzte zu seinem Schwert, das ins Gras geschleudert worden war, und stach wild nach dem Fremden.
»Passt auf!«, schrie ich.
Das hätte ich nicht zu sagen brauchen. Der Fremde kreuzte die leeren Hände hinter dem Rücken und wich ruhig dem Schwung des Schwerts aus. Seine Miene veränderte sich nicht. Sie behielt ihren kalten Ausdruck bei, die Augen dunkel und klug, die Mundwinkel verächtlich hochgezogen, als wäre das alles bloß eine lästige Unannehmlichkeit.
Die flinke Bewegung brachte seinen Angreifer aus dem Gleichgewicht. Die Arme des Mannes ruderten heftig, sein Körper taumelte, folgte dem ins Leere gegangenen Hieb. Mit dem Schwertgriff fing er sich wieder, keuchend, und versuchte es erneut, zielte diesmal direkt auf den entblößten Hals des Fremden. Aber kaum hatte er seine Haltung verändert, tat es der Fremde ebenso; eine kaum wahrnehmbare Bewegung, eine, die einem entging, wenn man nur blinzelte. Und so ging es weiter, hin und her. Der Wu griff an, sprang vor, stürmte los wie ein wütender Bulle, bis er knallrot war im Gesicht; und der Fremde trat anmutig zur Seite, wich aus, duckte sich, ohne auch nur eine Hand zu heben.
»Wer bist du?«, wiederholte der Wu, aber in seinem Ton schwang jetzt echte Angst mit.
Der Fremde antwortete nicht. Stattdessen hob er das Bein ein wenig, gerade als der Wu wieder auf ihn zustürmte. Mit einem lärmenden Krach ging er auf alle viere zu Boden, und sein Schwert flog ihm aus den Fingern. Bevor er auch nur versuchen konnte, es wieder zu greifen, schritt der Fremde hinüber, hob das Schwert mit zwei schlanken Fingern auf und warf es beiläufig in die Tiefen des Flusses. Das Wasser kräuselte sich kurz, dann beruhigte es sich wieder.
In der Stille war nur das raue, frustrierte Grunzen des geschlagenen Mannes zu hören.
»Geh«, sagte der Fremde kühl, drehte sich mit einem Rascheln seines Gewands um. »Sonst fliegt als Nächstes deine Leiche ins Wasser.«
Da erbleichte der Mann – vor sich hin fluchend, die Nase rot triefend –, kam taumelnd auf die Füße und floh, verschwand hinter dem Ulmenwäldchen ohne einen Blick zurück. Nachdem seine Schritte in der Ferne verklungen waren, sah der Fremde mich endlich an. Von Nahem war er sogar noch beeindruckender, seine Schönheit so eindringlich, dass sie verstörend wirkte, der klare Blick seiner schwarzen Augen so durchdringend, dass ich nicht wegsehen konnte.
»Seid Ihr verletzt?«, fragte er. Seine Stimme klang jetzt sanfter als bei dem Wu, aber nicht wärmer.
Ich richtete mich zu voller Größe auf – doch selbst so reichte mein Kopf nur bis an seine Schultern – und tastete mich gedanklich nach Wunden ab. Da waren keine, außer dem leisen Stechen in meinen Handflächen, mit denen ich den Stein gepackt hatte. Selbst das Ziehen in meiner Brust war verschwunden, als wäre es nie da gewesen.
»Nein«, erwiderte ich langsam, glättete meinen Schleier. Dann erinnerte ich mich an sein Schwert. Es hatte sich mit der Spitze in die Erde gegraben, die Klinge noch fast vollständig zu sehen, aus glänzend poliertem Silber mit einem Diamantmuster auf Vorder- und Rückseite und kleinen Jadestücken im Heft. Es waren auch Worte in die Klinge geätzt. Ich las sie, während ich das Schwert herauszog: Der Geist zerstört; das Herz verschlingt. Sie lösten etwas in mir aus, wie wenn man langsam an einer Guqin-Saite zupfte, aber ich konnte nicht sagen, warum.
»Ich danke Euch für – alles«, sagte ich und reichte ihm das Schwert recht ungeschickt auf ausgestreckten Händen. Ich wusste nicht, ob das richtig war. Er war sichtlich von adliger Herkunft, seine Gewänder allein mehr wert als ein Dutzend unserer besten Wasserbüffel.
Er schob das Schwert mit einer silbrig glänzenden, geschmeidigen Bewegung in die Scheide. »Das war nichts.« Es klang nicht höflich, sondern als würde er nur eine Tatsache festhalten.
»Ich sollte mich revanchieren«, beharrte ich, stand aufrechter da. »Ich schulde Euch ein Leben.«
Seine Lippen verzogen sich, als fragte er sich, was ich ihm wohl geben könnte, das er nicht schon besaß. »Das wird nicht nötig sein«, erwiderte er. »Es reicht, einen Mann aus Wu gedemütigt zu haben.« Er schwieg, legte den Kopf schief. »Habt Ihr ihm die Nase gebrochen?«
Ich dachte kurz daran zu lügen, die Rolle der großäugigen unschuldigen jungen Schönheit zu spielen, wie es die meisten von mir erwarteten. Aber etwas drängte mich, zu nicken.
Jetzt gingen seine Mundwinkel noch weiter in die Höhe, wurden zum Anflug eines Lächelns. »Beeindruckend.« Dann glitt sein Blick zu dem kleinen Mädchen, das immer noch da lag, wo es hingefallen war, der Mund vor Schreck noch offen. »Seid ihr miteinander verwandt?«
Ich verspürte einen Stich. Wie sehr ich wünschte, es wäre so. Wie sehr ich wünschte, ich könnte immer noch auf einen Menschen deuten und ihn Schwester nennen.
»Ich weiß nicht, wer sie ist«, gab ich zu, ging zu ihr, worauf der Fremde mir folgte. »Sie schien Hilfe zu brauchen.«
»Und doch habt Ihr sie gerettet«, sagte er mit einem Hauch Überraschung. Etwas verriet mir, dass er selten überrascht war, und ein merkwürdiger Stolz glomm in meiner Brust auf, weil ich nun wusste, dass ich etwas Unerwartetes getan hatte.
»Ihr habt mich gerettet«, sagte ich. »Und wir kennen einander nicht.«
»Ja, aber ich war sicher, dass ich mich nicht in Gefahr begebe. Eure Interessen zu schützen, konnte meinen nicht schaden.« Er warf mir einen Seitenblick zu, doch ich tat, als bemerkte ich es nicht. »Es ist etwas ganz anderes, jemandem zu helfen, wenn es einen selbst in Gefahr bringt.«
Ich öffnete den Mund, wollte antworten, aber da meldete sich das Mädchen zu Wort.
»Ist … ist der böse Mann wirklich weg?«
»Das ist er. Aber steh noch nicht auf«, sagte ich hastig, als ich sah, wie sie mühsam hochkommen wollte. Ich hockte mich hin und untersuchte ihre Wunden. Die Prellungen waren schrecklich blaulila, wie eine überreife Pflaume, und sie hatte sich beim Stolpern an mehreren Stellen die Haut aufgeschürft. Es war schwierig zu erkennen, wie viele der dunklen Flecken auf ihrer Tunika von Blut rührten oder vom Schlamm. Dann lenkte ich meine Aufmerksamkeit auf ihre kleinen Hände und zuckte zusammen. Ihre Nägel waren sauber herausgerissen, sodass nur kleine Kreise aus wundem Fleisch übrig waren. Diese Verletzungen waren älter. Und es sah nicht nach einem Unfall aus. »Was … ist mit dir passiert?«, flüsterte ich und schluckte die Galle hinunter. »Wo sind deine Eltern?«
»Sie sind tot.« Das sagte sie so teilnahmslos, als rezitiere sie ein Gedicht, das schon lange seine Bedeutung verloren hatte.
»Tot?«
»Getötet«, ergänzte sie und starrte auf den glitzernden Fluss.
»Von wem?«
»Von wem wohl? Den Monstern aus Wu. Ich konnte fliehen, während sie von den Schreien meiner Mutter abgelenkt waren. Ich wollte nicht weg«, sagte sie, fast als fühlte sie sich schuldig, als glaubte sie, wir würden sie verurteilen, weil sie überlebt hatte. »Aber ich bin nicht geblieben, habe nicht gewartet, bis sie mir auch die Kehle durchschneiden. So hätte es sich meine Mutter gewünscht.«
Gut, wollte ich sagen, und der Schmerz in mir wurde heftiger. Du musstest fliehen. Du musstest tun, was immer du tun musstest, um ihnen zu entkommen. Denn wenn deine Mutter überlebt hätte und du gestorben wärest, würde sie den Rest ihrer Tage unvorstellbare Schmerzen erleiden, weinen, bis ihre Stimme rau wäre. Sie würde sich durchs Haus schleppen, als hätte ihr jemand ein Stück ihrer Seele entrissen. Es ist das grausamste Schicksal, das die Grauhaarigen erleiden können, wenn sie die Dunkelhaarigen beerdigen.
Das wusste ich.
»Du hast das Richtige getan«, sagte der Fremde.
Seine Züge waren jetzt angespannt, und ich dachte kurz, unter seinem eisigen Teint eine Spur von Verbitterung zu erkennen.
»Wie ist dein Name?«
»Wuyuan«, flüsterte sie.
»Wuyuan, ich verstehe.« Er nannte seinen Namen nicht, noch ging er in die Knie, so wie ich, aber er zog einen Schlauch mit Wasser und ein sauberes Taschentuch aus dem Gewand und wandte sich an mich. »Ihre Verletzungen werden sich wahrscheinlich entzünden, wenn man sie nicht versorgt. Habt Ihr Erfahrung mit dem Säubern von Wunden?«
»Ja«, erwiderte ich und nahm alles entgegen. Auf das Tuch waren zwei Fische gestickt, die einander in einem Lotusteich umkreisten, die Seide war von feinster Qualität, wundervoll weich. Es kam mir falsch vor, sie mit Blut zu beflecken, aber ihn schien es nicht zu kümmern. »Das könnte brennen«, sagte ich zu Wuyuan und glättete das Taschentuch.
Sie nickte nur, ihr Blick ruhte immer noch auf dem Fluss. Das war nicht die Reaktion, die ein normales Kind auf Schmerz zeigen sollte. Andererseits, vielleicht konnte man auch gar keine normalen Kinder aufziehen in diesem Zeitalter des Kriegs. Als ich ihre blutigen Handflächen abtupfte, spürte ich den Hass auf die Wu in mir. Es war kein Ende der Unruhen in unserem Königreich in Sicht, seit die Armeen der Wu Kuaiji erobert hatten, und jetzt wuchs eine Generation elternloser Kinder heran, die den Schmerz besser kannten als Frieden.
Ich rechnete damit, dass der Fremde ging, aber er stand nur da und sah mir zu. Es war ein seltsames Gefühl. Wenige schenkten mir je Aufmerksamkeit, wenn mein Gesicht bedeckt war, und noch weniger sahen mich an, als sähen sie mich wirklich; nicht die glatte, hübsche Oberfläche, sondern die Dornen darunter.
»Ihr seid nicht hier aus der Gegend, oder?«, fragte ich, ohne zu ihm aufzusehen.
»Wie kommt Ihr darauf?« Sein milder Tonfall machte es schwierig zu unterscheiden, ob er die Frage ernst meinte.
Zur Sicherheit antwortete ich trotzdem. »Das … Auftreten. Die Haltung. Sie sind anders als bei den Männern aus der Gegend.«
»Ach ja? Und wie trete ich auf?«
Jetzt sah ich zu ihm auf, zu dem Schwert in der geschnitzten Scheide und dem sattfarbenen Gewand, das fest um seine Taille gewickelt war, der elegante Dutt, zu dem sein rabenschwarzes Haar oben auf dem Kopf frisiert war, die Quasten und die Jade, die von seinem Gürtel herabhingen. »Würdevoll«, sagte ich schließlich. »Ihr tretet auf wie jemand, der wichtig ist. Vielleicht seid Ihr ein Adliger. Oder ein reisender Gelehrter. Oder ein Anführer beim Militär … Ihr kämpft so gut.« Ich wollte, dass er mich korrigierte, meine Mutmaßungen bestätigte, aber er lächelte nur sanft und erwiderte nichts.
Als ich Wuyuans Verletzungen, so gut es ging, behandelt hatte, legte er einen Beutel in ihre Hände. Das leise Klingeln darin verriet mir, dass er mit Münzen gefüllt war.
Wuyuan starrte mit großen Augen darauf, und ihr Schreck spiegelte meinen wider. »Was …«
»Kauf dir Essen und neue Kleider«, sagte er. »Aber achte darauf, dass du nicht alles ausgibst. Hebe die Hälfte der Münzen auf und kauf davon unreife Pflaumen zum niedrigsten Preis, den du findest – ich schlage den Markt drei Kilometer südlich von hier vor, den Fluss hinab. Lagere sie an einem vor der Sonne geschützten Ort. Drei Tage später wird der Preis für Pflaumen dramatisch steigen. Dann verkaufe die Pflaumen wieder zum dreifachen Preis. Hast du mich verstanden?«
Wuyuan nickte, auch wenn sie jetzt mit offenem Mund gaffte, als wäre sie unsicher, ob der junge Mann vor ihr ein Sterblicher oder ein Gott war. Ich selbst war mir nicht mehr sicher. »Ja.«
»Gut.«
Woher wisst Ihr das?, wollte ich ihn fragen. Wie konnte er nur vorhersagen, wie die Preise in drei Tagen aussehen würden? Und er klang sich dessen so sicher. Aber er hatte sein Gewand glatt gestrichen und entfernte sich schon von uns am Flussufer entlang.
Ohne nachzudenken, rannte ich ihm hinterher.
»Wartet …« Ich beeilte mich, den besten Seidenballen aus meinem Korb zu nehmen, und überreichte ihm den Stoff. »Bitte, nehmt das.«
Er wurde langsamer, neigte den Kopf. »Wofür?«
Ich deutete hinab auf den Saum seines Gewands. Da war ein winziger Riss, wo er an einem Felsen hängen geblieben sein musste während des Kampfs gegen den Wu. »Um das zu flicken. Oder ein neues Gewand anzufertigen. Und wenn nicht«, sagte ich lauter, als es schien, als würde er protestieren wollen, »dann nehmt es als Zeichen meines Danks. Ich weiß, es ist kein angemessener Tausch: ein Ballen Seide für ein Leben. Aber vielleicht könnt Ihr Euch so besser an mich erinnern.«
»Ich brauche keine Seide, um mich an Euch zu erinnern«, sagte er so leise, dass ich ihn kaum verstand, senkte aber ein wenig den Kopf und nahm meine Gabe an. »So es das Schicksal will, begegnen wir einander wieder.«
Ich blickte ihm nach, die Sonne brannte herab auf die messergerade Linie seiner Schultern, bis seine Silhouette nur noch ein Fleck am fernen Horizont war. Und sobald er außer Sicht war, krampfte sich meine Brust zusammen, und ich keuchte auf, meine Finger tasteten nutzlos nach dem Kragen meines Gewands. Der Schmerz war wieder da.
Als ich nach Hause kam, erwähnte ich meine Begegnung mit dem Tod nicht, und auch nicht meine seltsame Begegnung mit dem jungen Mann. Ich wusste, dass sich meine Eltern entsetzliche Sorgen machen würden wegen Ersterem, und mehr noch wegen Letzterem. Außerdem wirkte alles wie ein Traum in dem alten, vertrauten Licht meines Heims, weniger ein Haus als eine Hütte, mit gestampften Lehmwänden und niedrigem strohgedeckten Dach. Würden sie mir überhaupt glauben, wenn ich von einem schönen, rätselhaften Fremden erzählte, der ein Duell gegen einen bewaffneten Mann gewonnen hatte, ohne einen Finger zu rühren, der das Auf und Ab des Markts in der Zukunft vorhersagen konnte, der sich hielt und sprach wie jemand, der in einem Palast aufgezogen worden war? Ich glaubte es mir selbst kaum, und ich war dort gewesen. Ich hatte ihn gesehen.
Also holte ich die gewaschene Seide, reinigte die Tische und bereitete das Abendessen zu. Unser Bohnenvorrat war karg und unser Reisvorrat noch karger; als ich die Menge herausnahm, die man für einen Topf Brei benötigte, schabte meine Kelle über den Gefäßboden. Ich ignorierte das sorgenvolle Kneifen in meinem Magen. Morgen würde ich die doppelte Menge Seide waschen, damit wir mehr auf den Markt bringen und verkaufen konnten. Das würde reichen. Das musste reichen. Und wenn uns die ausging …
Ich durchtrennte diesen Gedanken, bevor er wachsen konnte. Ich hatte gelernt, in Tagen zu denken, im Abstand zwischen zwei Mahlzeiten, von Sonnenauf- zu Sonnenuntergang. Manchmal schien es, als wäre das alles, was mein Leben war, alles, was es je sein könnte: eine Wiederholung von zum Überleben nötigen Aufgaben, bis ich älter wurde und meine Zeit ablief. Doch es war merkwürdig – wann immer ich versuchte, mich selbst als alte Frau zu sehen, so gelang es mir nicht. Es war, als würde ich das Ende eines Flusses klar erkennen wollen; sobald ich es versuchte, verschwamm das Bild, und es wurde dunkel.
»Brauchst du Hilfe?«
Das Gesicht meines Vaters in der Tür, braun gebrannt von der Sonne. Er war nicht alt, glaubte ich, aber sein Haar wurde bereits grau, und sein Körper war gebückt von der Last dicker Baumstämme und riesiger Äxte.
»Nein, Vater«, sagte ich. Er bot immer seine Hilfe an, und das immer aufrichtig, und doch half er am Ende nie. Vielleicht, weil es schwerer wäre, ihm die Aufgabe beizubringen, als sie einfach selbst zu erledigen; ich bezweifelte, dass er auch nur wusste, wie man Wasser kochte. Aber er war immer noch besser als einige der anderen Väter, die ihre Kinder schlugen, weil sie nicht schnell genug kochten oder einfach, um ihre Wut an jemandem auszulassen, der sich nicht wehren konnte.
»Nun gut.« Ich lauschte ihm, wie er durch das Zimmer schlurfte, das tiefe Ein- und Ausatmen, als er sich in seinen Sessel setzte, und bald darauf sein leises, brummendes Schnarchen. Und dann kochte das Wasser, die grünen Bohnen stiegen an die Oberfläche, platzten auf. Ich rührte darin, so, wie es mich meine Mutter gelehrt hatte, und ihre Mutter vor ihr.
Nach dem Abendessen saß ich am Fenster, die Knie an die Brust gezogen, mit den Armen umschlungen, und starrte hinaus. Obwohl die Hütten selbst nicht viel hermachten, kaum mehr waren als eine hässliche Erinnerung an die Gewalt, die unseren Teil des Königreichs getroffen hatte, hatten sich alle Bäume und Wildblumen und Berge in satten Blau- und Grüntonen gefärbt. Üppiges Gras wuchs über den Stellen, an denen Leichen zum Verrotten liegen gelassen worden waren, damals, als nicht genug Dorfbewohner übrig gewesen waren, um die Toten zu begraben. Schmetterlinge tanzten von einem Zweig zum anderen, wo früher einmal Blut die Blätter gefärbt hatte.
Die Natur war schneller geheilt als wir.
Eine warme Brise schwebte herein und strich seufzend über meine Haut. Zu dieser Tageszeit wirkte die dämmrige Luft, als halte sie den Atem an, warte nur darauf, dass die Dunkelheit herabsank. Ich wartete auch – aber auf was, wusste ich noch nicht.
Kapitel 2
Früh am nächsten Morgen, der Himmel war noch in schläfriges Rosa getaucht, ertönte ein Klopfen an der Tür.
Das war höchst ungewöhnlich. Viele Dorfbewohner fanden, die einfachste und wirksamste Art der Kommunikation bestehe darin, im Vorbeilaufen laut zu rufen; manche spazierten auch ohne Vorwarnung herein, bewaffnet entweder mit einer Bitte oder ein wenig Klatsch und Tratsch. Mein Puls pochte schneller. War es ein Beamter? Würde es einen weiteren Krieg geben? War etwas Schreckliches passiert?
Meine Mutter war vor mir an der Tür, den Morgenrock hastig über das weiße Hausgewand geworfen wie einen Umhang, rieb sie sich noch den Schlaf aus den müden Augen. Als sie die Tür öffnete, unterdrückte ich ein Keuchen.
Dort stand, vor unserem zerfallenden, jahrzehntealten Haus, der junge Mann von gestern. Meine Erinnerung wurde seiner Schönheit nicht gerecht, so, wie Schmerz in der Gegenwart immer am schlimmsten ist. Er hatte sein Gewand gewechselt und trug jetzt eins in einem dunkleren, düstereren Farbton, und sein Haar war straffer zurückgebunden, betonte die feinen Kanten seines Kiefers und der Wangenknochen. Er sah … anders aus. Älter. Obwohl er bei unserem ersten Treffen mir gegenüber nicht warmherzig war, so war seine Haltung doch einigermaßen entspannt gewesen, sein Betragen von einer leisen Spur der Erheiterung durchdrungen. Jetzt war all das fort. Ich sah keine Empfindung in diesen intelligenten, pechschwarzen Augen, nichts, was ahnen ließ, warum er hier war.
Und doch ließ der Schmerz in meiner Brust, der beim Aufwachen sonst immer am schlimmsten war, nach.
»Guten Morgen«, sagte er zu meiner Mutter, verbeugte sich tief. »Ich hoffe, ich dränge mich nicht auf.«
»Ich … nein«, antwortete meine Mutter, aber ich spürte ihre leise Beunruhigung. »Entschuldigt, aber Ihr seid …?«
»Fanli«, erwiderte er und richtete sich auf. »Politischer und militärischer Berater von König Goujian von Yue.«
Dieses Mal konnte ich meine Überraschung nicht unterdrücken. Fanli. Aber natürlich – ich hätte es wissen müssen. Alle Geschichten rühmten ihn: der junge Berater mit einem Geist, der schärfer war als jede Klinge, und von einer Schönheit feiner als Jade. Er hatte es geschafft, den König zu beeindrucken, als er noch ein Junge war, und dann war er rasch aufgestiegen und zu einem der engsten Vertrauten von König Goujian geworden. Es gab bereits Volksweisen über ihn, Gedichte, die seinen Namen priesen. In den Augen der Yue war er unbestechlich. Der letzte reine Mensch unter dem Himmel. Man sagte über ihn, er besäße keine der unstillbaren Bedürfnisse und niederen Sehnsüchte des gemeinen Volks; er war einer der wenigen, die den Staat wahrhaftig über sich selbst stellten.
»Oh!« Mit der Verspätung eines Herzschlags sank meine Mutter in einen ungeschickten Knicks. So selten wagten sich Adlige in unser Dorf, dass sie sich auf keine Sitten berufen konnte, es gab nichts, was uns auf das hier vorbereitet hätte. »Wir fühlen uns geehrt … höchst geehrt, Euch hier zu haben …«
Fanlis Blick ging über ihre Schulter hinweg zu mir, aber darin stand kein Funken Wiedererkennen. Nur eine ruhige, gemessene Neugier. Da fiel mir ein, dass er mich unmöglich erkennen konnte; er hatte mich am Fluss nur mit dem Schleier gesehen. Doch dann ergab sein Besuch noch weniger Sinn. Was wollte er hier?
»Ist dies das Mädchen, das man Xishi nennt?«, fragte er.
Meine Mutter hielt inne, dann nickte sie mit neuer Wachsamkeit. »Ja. Meine Tochter.«
Er hatte den Blick nicht von mir gewandt, und jetzt sprach er nur zu mir. »Sie hatten recht«, sagte er ruhig, musterte mich mit stiller, glühender Intensität. »Ihr seid wirklich wunderschön.« Es klang nicht nach einem Kompliment, dazu gedacht, zu schmeicheln und zu bezaubern, sondern eher wie eine nüchterne Feststellung.
Ich schwieg, hatte mich noch nicht erholt von meinem Schreck. Und mir fiel sowieso keine passende Erwiderung ein. Den Menschen gefällt selbstvergessene Schönheit immer besser, die, die sich ihrer eigenen Macht nicht bewusst ist, die leicht errötet und sprachlos ist angesichts der Bewunderung von Fremden, die weich ist und zurückhaltend und der es gerade so an Selbstbewusstsein mangelt, dass sie es in der Betrachtung von Männern sucht. Mein ganzes Leben lang hatten mir die gleichen Leute immer und immer wieder gesagt, wie hinreißend ich sei. Wie sollte ich das aber nicht wissen? Das wäre ja, als würde man aufwachsen, ohne zu wissen, dass man groß war.
»Sucht Ihr etwas?«, fragte Mutter und trat zwischen uns, legte schützend eine Hand auf meine Ellenbeuge. Sie drückte sie einmal, leicht. Es war unser Zeichen, ihre Art, mir zu sagen, dass alles gut würde.
»Ich fürchte, das ist eine recht lange Geschichte«, sagte Fanli und unterbrach endlich unseren Blickkontakt. Es fühlte sich an, als wäre ein Faden plötzlich zerrissen. »Darf ich hereinkommen?«
Ich sah meine Mutter zögern, aber natürlich konnte sie ihm das nicht verwehren. Er arbeitete für den König – den König. Und des Königs Wunsch war Befehl.
»Gewiss, Xishi, führe ihn hinein«, sagte sie und ging davon. »Ich koche Tee.«
Tatsächlich war der Platz begrenzt, wo ich ihn hinführen konnte. Nach nur wenigen Schritten hielten wir am Tisch inne, er strich die Rückseite seines Gewands glatt, zupfte die weiten Ärmel zurecht und ließ sich elegant auf einen unserer niedrigen Stühle sinken. Ich setzte mich ihm gegenüber. Die Stille lag schwer zwischen uns. Sie verlieh allem Klarheit. Ich hörte, wie meine Mutter in dem anderen Zimmer Teeblätter in die Kanne schabte – sie würde den teuren Tee verwenden, den wir für das Mondfest aufgespart hatten –, und zischte dabei meinem Vater etwas zu, leise und unverständlich. Dann traten die beiden zusammen heraus, meine Mutter trug die dampfende Kanne aus Ton auf einem Tablett, und mein Vater mit einem leicht benommenen Gesichtsausdruck, als wisse er nicht, ob er wirklich wach wäre.
»Ich danke Euch«, sagte Fanli, als meine Mutter seine Teetasse füllte und der üppige, dunkelgrüne Duft der Blätter die Luft mit Süße erfüllte. Die Tasse war meine, aber wir hatten nur die drei. »Der Grund für mein Kommen ist … ich wurde von König Goujian ausgesandt, eine Braut von unvergleichlicher Schönheit zu finden.«
Mein Puls hämmerte wilder. Braut. Ein Wort, das ich seit meiner Kindheit immer wieder gehört hatte, doch hier, den Berater des Königs mir gegenüber, die goldene Sonne vor unserem Fenster aufsteigend, schien es eine neue Bedeutung zu gewinnen.
Mutter und Vater wechselten einen Blick. »Für … für Euch?«, fragte Mutter, runzelte die Stirn. »Sicher gibt es doch bereits viele Frauen, die Euch heiraten möchten, warum muss es …«
»Nein, Ihr missversteht mich«, sagte Fanli, stellte seinen Tee ab. »Die Braut ist für König Fuchai im Königreich Wu bestimmt, als Tribut von Yue. Und nach langer Suche denke ich, Xishi wäre die perfekte Kandidatin.«
Ich stieß ein leises Geräusch aus: Schock, Zorn oder Angst, ich wusste es nicht. In meinem Magen rumorte es bei der bloßen Erwähnung des Namens. Fuchai war berüchtigt dafür, dass er dem Wein und den Frauen zusprach; man erzählte sich, er habe jedes Bordell in der Hauptstadt von Wu besucht, und dass er sein persönliches Vergnügen ernster nahm als die Staatsangelegenheiten. Und doch hatte er unsere Armeen vernichtet, unseren König besiegt. Er war der Feind meines Volks, die Ursache unseres Leids.
Seinetwegen waren die Soldaten gekommen.
Seinetwegen war Susu tot.
»Was?«, platzte ich heraus. »Aber er ist schrecklich.«
Beim Klang meiner Stimme sah Fanli mich mit einer neuen Emotion an. Da war es, das Wiedererkennen, aber zu spät. Etwas wie Kummer, sogar Bedauern, flackerte über seine Züge, bevor er sich wieder sammelte. All das innerhalb von Sekunden. Ich bezweifelte, dass ein Zuschauer die Veränderung auch nur bemerkt hätte, so flüchtig war sie.
»Es ist gewiss keine angenehme Mission«, fuhr er fort, als wäre nichts geschehen. Nur seine Stimme klang beherrschter. »Aber Ihr würdet nur dem Namen nach eine Braut sein. In Wirklichkeit wäret Ihr eine Spionin – unsere Spionin. Ihr würdet ihn von seinen Pflichten ablenken und für uns Einfluss auf ihn nehmen, während Ihr zugleich wichtige Informationen im Palast sammelt. Kurz gesagt, wäret Ihr ein wesentlicher Teil unseres Plans, Rache an den Wu zu üben und sie ein für alle Mal zu schlagen.«
Fassungslose Stille legte sich über das Zimmer.
Fanlis Miene war düster, die Hände um die Teetasse gelegt, der weiße Dampf schwebte durch die Luft wie Geister. Er sah vollkommen ernst drein.
»Das ist …« Ein Lachen entrang sich mir, als mir die schiere Absurdität der ganzen Situation klar wurde. »Vergebt mir, aber das ist lächerlich. Ich kann keinen König heiraten. Ich habe noch nie zuvor jemanden geheiratet. Ich habe noch nie die Grenzen meines Dorfs verlassen. Ich weiß nicht, wie man anständig knickst; oder isst, was immer man bei Königen isst …«
»Ihr würdet zehn Wochen lang gründlich ausgebildet«, sagte er, als hätte er mit dieser Reaktion gerechnet. »Ich persönlich werde den Unterricht überwachen, um sicherzugehen, dass alles nach Plan verläuft. Unter meiner Anleitung werdet Ihr mehr als nur bereit sein, wenn ich Euch zum Palast in Wu geleite. Glaubt mir.«
Ein Kloß bildete sich in meiner Kehle. Das Zimmer schien plötzlich zu klein, der Duft des Tees zu stark, zu berauschend. Ich konnte nicht denken.
»Sie ist doch nur ein Mädchen«, sagte meine Mutter, schüttelte den Kopf. Ihre Stimme zitterte. Sie lehnte nur selten etwas ab, ganz zu schweigen von der Bitte eines Königs; das kam Verrat gefährlich nahe. Aber sie ließ mich nicht im Stich. »Diese Ehe – diese Mission – gibt es wirklich niemanden, der besser geeignet ist?«
»Der Plan sieht vor, zwei Tribute zu schicken«, erwiderte Fanli. »Eine Konkubine und eine Palastdame als ihre Begleitung. Ich habe schon eine andere Kandidatin aus Eurem Dorf gefunden, von der ich denke, dass sie für die Rolle der Letzteren passt. Aber um ehrlich zu sein … seit ich mich auf die Suche gemacht habe nach dieser Braut, habe ich zahllose Orte besucht und viele wunderschöne Frauen gesehen. So elegant wie Schwäne und mit lerchengleichen Stimmen. Und doch verblassen sie neben Xishi, so wie die Sterne neben dem Mond. Der Klatsch der Dorfbewohner führte mich hierher, aber jetzt, da ich sie mit eigenen Augen gesehen habe, weiß ich, dass es unbestreitbar wahr ist: Xishi ist eine Schönheit, für Legenden bestimmt. Unsere Chancen auf Erfolg stehen nur dann gut genug, wenn sie nach Wu geht.«
»Und wenn ich Erfolg habe?«, flüsterte ich.
Sein Blick begegnete meinem, und einen Moment lang hörte alles andere auf zu existieren. Der traurige Ruf der Gänse, das Rascheln der Bäume. Alles schien zusammenzuschrumpfen, bis auf uns beide. Ein Schauder durchfuhr meinen Körper, als wüsste ich bereits tief in meinem Inneren um die Bedeutung dessen, was als Nächstes kam. »Wenn Ihr Erfolg habt, Xishi«, sagte er ruhig, »werdet Ihr die Retterin unseres Königreichs sein. Ihr werdet den Verlauf der Geschichte verändern.«
Keuchend rannte ich hinaus in den Garten.
Obwohl die Luft warm war, das Blau des Himmels sich aufhellte, grub sich die Kälte nur tiefer in meine Knochen. Mir war schwindlig. Meine Knie gaben nach. Allein hier draußen versuchte ich, mir die Zukunft auszumalen, die Fanli für mich ausgemalt hatte, eine mit goldenen Hallen und zinnoberroten Gewändern und Geheimnissen – aber viel weiter reichte meine Fantasie nicht. Ich kannte doch nur das leise Lied des Flusses, die Lotusblüten, die auf dem Teich vor meinen Füßen blühten.
Fest schloss ich die Augen, legte den Kopf an die harte Hauswand. Mein Atem ging flach. Doch seine Worte ließen mich nicht los. Legende. Königreich. Geschichte. Das waren neue Begriffe in meinem Wortschatz. Sie klangen bedeutsam, solide. Ich rollte sie auf meiner Zunge hin und her, sie schmeckten scharf, nach Metall und Blut. Sie waren so anders als das, was ich sonst hörte: wunderschön. Dieser alte Segen, dieser müde Fluch. So schwach und vergänglich, so schnell verblüht wie die Pflaumenblüten, die mitten im Winter verwelkten. Und dann entrang sich meinen Lippen ein sanftes, stilles, ungläubiges Lachen, als ich darüber nachdachte.
Die Dorftanten hatten immer gesagt, dass meine Schönheit mein Schicksal bestimmen würde. Ich bezweifelte, dass irgendjemand dabei an so etwas gedacht hatte.
Hinter mir erklangen Schritte.
Ich spannte mich an. Sie waren zu leise für meinen Vater und zu langsam für meine Mutter.
»Ich habe mich noch nicht entschieden«, rief ich.
»Ich weiß«, erwiderte Fanli sanft. Er trat vor, und das Licht fiel auf die verschlungenen blauen Fäden seines Gewands, die scharfen Kanten seines Gesichts. »Ich weiß, es ist viel verlangt.«
»Es ist mein gesamtes Leben«, sagte ich unwillkürlich. Vielleicht war es unklug, diese Dinge laut auszusprechen, besonders vor ihm. Ich fuhr dennoch fort. »Es würde alles verändern.«
»Ich weiß«, sagte er wieder, blieb zwei Schritte von mir entfernt stehen, auch wenn ich nicht wusste, was ihn dort hielt. Anstand? Höflichkeit? Rücksichtnahme auf meine Gefühle? Oder hielt er einfach von jedem Abstand?
»Was ist mit meinen Eltern? Wenn ich gehe, wer wird sich dann um sie kümmern?« Ohne dass ich es bemerkt hätte, bohrten meine Nägel rote Halbmonde in meine Handflächen. Mühsam bog ich die Finger auseinander, verbarg sie hinter meinem Rücken. »Ich bin ihr einziges Kind.« Die Worte zerkratzten mir die Kehle. Das einzige Kind, das noch übrig ist, wäre treffender, aber das würde zu sehr wehtun. Und ich wusste nicht, ob ich mich überhaupt noch als die Schwester eines anderen Menschen ansah. Ein solcher Begriff war ein Band, das einen mit einem anderen verknüpfte, zwei Teile eines Ganzen meinte. Ohne Susu war das Band erschlafft; der Begriff ohne Bedeutung.
»Darüber braucht Ihr Euch nicht zu sorgen. Ich kümmere mich darum, dass sie einen stattlichen Ausgleich erhalten, ihnen Kleidung und Nahrung zur Verfügung gestellt wird, solange sie leben; sie werden keinen Tag mehr arbeiten müssen, es sei denn, sie wünschen es so.«
»Wirklich?«, fragte ich, wagte kaum, das zu glauben.
Doch sein Blick war klar, ohne Arglist. »Ich gebe Euch mein Wort.«
»Ich fürchte, das Wort eines Mannes reicht nicht. Ich würde ein schriftliches Dokument vorziehen, mit dem Siegel des Königs darauf, in dem alles festgehalten wird, was Ihr versprochen habt.«
Wieder war es mir gelungen, ihn zu überraschen. »Wenn Ihr das gern möchtet«, sagte er langsam. »Das kann alles arrangiert werden. Solange Ihr geht.«
Ich musste zugeben: Es war verlockend. Es war so verlockend, aber …
»Ich werde Euch nicht versprechen, dass die Mission leicht wird. Im Gegenteil, sie wird in höchstem Maße herausfordernd, von gefährlich ganz zu schweigen. Ihr werdet Eure Familie zurücklassen müssen. Ihr werdet Euch rasch an die Sitten der königlichen Familie und der Adligen, allesamt Wölfe im Schafspelz, gewöhnen müssen. Das Leben in einem Dorf wie Eurem ist einfach; alles spielt sich vor Euren Augen ab. Im Palast geschieht alles im Schatten. In einem Moment lächelt einen jemand an, im nächsten könnte er einen erdolchen. Und natürlich …« Jetzt klang er knapp, ernst. »Natürlich ist da noch die Angelegenheit mit dem König selbst.«
Ich atmete schwer aus, Gänsehaut überzog meinen Körper. Ja, dachte ich. Diese eine kleine Angelegenheit.
»Ihr werdet das Bett mit ihm teilen«, sagte er, die Miene kühl und gefasst, als würde er über irgendwelche Staatsangelegenheiten sprechen. Was, wie ich annahm, auf eine gewisse Art genau das war, worum es hier ging. Politik und Macht, das Gegenteil von Romantik. »Ihr werdet ihn verzaubern müssen, bis ihm nichts auf der Welt wichtiger ist als Ihr. Er ist kein Mann von hoher Moral, und noch nie zuvor hat er nur einem einzigen Menschen seine Hingabe geschenkt.«
»Und Ihr glaubt wirklich, dass ich das kann?«, fragte ich, wandte den Kopf ein wenig, um seinem Blick zu begegnen. »Ich habe noch nie zuvor versucht, einen Mann zu verzaubern. Nicht absichtlich.«
»Ich bezweifle, dass Ihr so etwas tun müsstet.«
»Ich wurde noch nicht einmal geküsst«, gestand ich.
Jetzt schwieg er. Räusperte sich. Er hatte so offen von Verführung gesprochen, ohne jede Spur von Gefühl, und doch stieg ihm nun eine schüchterne Röte ins Gesicht. Zum ersten Mal sah ich, dass wir etwa gleich alt sein mussten.
Gegen meinen Willen musste ich lächeln. Mit plötzlichem Wagemut sagte ich: »Und Ihr sagt, dass Ihr mir beibringt, wie man den König verhext. Könntet Ihr mir wirklich helfen?«
Seine linke Hand ballte sich, eine leichte, gedankenlose Geste, halb verborgen vom Ärmel seines Gewands. »Da irrt Ihr Euch.«
»Worin?«
»Wenn Ihr der Mission zustimmt, helfe nicht ich Euch. Sondern Ihr helft mir.«
Ich starrte ihn an, meine Heiterkeit verpuffte, mein Puls schlug schneller in meinen Adern.
»Ich bin derjenige, der Euch braucht.« Es klang wie ein folgenschweres Geständnis. »Ich bin derjenige, der den Plan Seiner Majestät unterbreitet hat, der für die Organisation dieser Mission verantwortlich ist. Ohne Euch versage ich.«
Ich kaute auf der Innenseite meiner Wange, wusste nicht, was ich davon halten sollte. Von alldem. Viele Leute hatten gezeigt, wie sehr sie mich wollten: mein Gesicht, meine Schönheit, meine Gesellschaft. Aber niemand hatte mich je zuvor wirklich gebraucht.
Um uns herum erwachte das Dorf langsam; das Glucksen kleiner Kinder, das Schwappen des Wassers am Brunnen, das Flüstern des getrockneten Getreides, das Klatschen von Strohsandalen auf Matsch. Für die Dorfbewohner war es nur ein weiterer Morgen, einer von Tausenden. Aber für mich könnte dieser Morgen mein letzter sein.
Als würde er meine Gedanken lesen, sagte Fanli: »Ich sage Euch all das nicht, um Euch in irgendeine Richtung zu lenken. Manche ziehen vielleicht die Bequemlichkeit von Lügen dem harten Stoß der Wahrheit vor, aber ich möchte von Anfang an offen zu Euch sein, selbst wenn das Bild, das ich so male, nicht immer hübsch ist.«
»Was, wenn ich Nein sagen würde?«
»Ich würde gehen«, antwortete er sofort, »und Euch nie wieder behelligen. Eure Entscheidung wird kein Nachspiel haben.«
Kein direktes Nachspiel, korrigierte ich ihn im Geiste, neigte das Kinn aufwärts zum gelben Sonnenschein. Denn wenn der Plan keinen Erfolg hatte, würde der König von Wu unbesiegt bleiben, geschützt in seinem Reichtum, in seinem Palast, während die Menschen in Yue Tag um Tag litten und schwächer wurden, in beständiger Angst lebten vor einem weiteren Krieg. Ich prägte mir den Anblick der großen grünen Ulmen ein, die reifen Maulbeeren, die wie kleine rote Juwelen an den Bäumen glänzten, die Holzspielzeuge, die auf dem gepflasterten Pfad verteilt lagen, die Hufabdrücke im Dreck. All die Zeugnisse eines hart erkämpften Lebens. All das hatte die erste Schlacht überstanden. Aber würde es die nächste überstehen? Oder die danach?
Ich dachte an Wuyuan, die Haut schmerzlich straff über den Knochen, der raue, rosafarbene Grind, wo einmal ihre Fingernägel gewesen waren. Ich dachte an meine Eltern im Haus, die älter und gebrechlicher wurden; die Sehkraft meiner Mutter ließ bereits nach, obwohl sie das niemals zugeben würde, und mein Vater hatte sich nie von seinem Sturz im Wald erholt. Ich dachte an ihre Gesichter, als sie Susu zusammengesunken auf dem Boden gefunden hatten, das raue Schluchzen meiner Mutter, als wäre etwas in ihr zersprungen.
Und ich dachte an die Susu davor, ihr süßes Lächeln, die Taschen voller Beeren, die Augen voller Licht.
Letzten Endes lief es darauf hinaus: ein Königreich oder mein Glück.
Und wie viele Menschen unter dem Himmel durften Glück schon wirklich erfahren? Glück war eine Beilage, wie die süßen Klebreisküchlein, die Mutter zu den Festen machte, oder die Bällchen mit fetter Sesampaste darin. Aber Rache – die war das Salz des Lebens. Nötig. Unverzichtbar.
»Es ist eine schwere Entscheidung«, sagte Fanli neben mir. »Aber es ist an Euch, sie zu treffen.«
»Lasst mich noch etwas darüber nachdenken«, sagte ich, obwohl sich mir die Antwort bereits offenbart hatte. Die Antwort war schon immer da gewesen, als wäre sie über die Skripte der Geschichte gekritzelt worden. Jetzt machte ich mir nur noch etwas vor, stemmte mich gegen die Zeit. »Ich gebe Euch bis Mitternacht Antwort.«
»Dann warte ich auf Euch an den Osttoren, wo der Fluss verläuft. Der Ort, an dem wir uns zum ersten Mal begegneten.«
Es war das erste Mal, dass er unsere Begegnung vom Vortag erwähnte, und sie flackerte zwischen uns auf wie ein Geheimnis, eine stille Flamme. Sein Blick lag schwer auf meinem, dunkel und abschätzend. Und doch spürte ich in dem Augenblick, in dem er gegangen war, das Fehlen seines Gewichts. »Sucht mich dort auf.«
Den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch dachte ich darüber nach. Es war unmöglich, an irgendetwas anderes zu denken.
Meine Mutter sagte sehr wenig, doch die Trauer in ihren Augen, dass sie mich länger umarmte als je zuvor, die Hände sanft trotz der Schwielen, verrieten mir, dass auch sie meine Antwort wohl kannte. Was sagte man darüber, dass Mütter einen sechsten Sinn hätten? Manchmal schien sie mein Herz zu kennen, noch bevor ich das tat.
»Ich wünschte, ich könnte dich für immer beschützen«, flüsterte sie, und ich hörte das Unausgesprochene, den frischen Schmerz darin. Aber das kann ich nicht. »Meine Tochter … Ich will nicht noch ein Kind verlieren.«
Ich spürte ein scharfes, bitteres Gefühl in meiner Brust.
»Und deine Gesundheit«, fuhr sie fort, ihre Stimme ruhig, obwohl ihre Lippen bebten. »Du warst immer so zerbrechlich. Was, wenn …«
»Ich bin nicht so zerbrechlich, wie du denkst«, sagte ich, und es stimmte. Mein ganzes Leben lang, seit dieser unerklärliche Schmerz in meinem Herzen aufgeflammt war, war ich beschützt und wie eine kostbare Vase behandelt worden, die unter der leichtesten Berührung zerspringen könnte. Doch selbst wenn ich mich nicht von diesem Schmerz befreien konnte, so konnte ich mit ihm leben. Man konnte mit fast allem leben, solange man etwas hatte, für das man lebte.
Meine Mutter legte mir eine warme Hand auf den Hinterkopf, sagte aber nichts. Sie sah mich nur lange an in der Stille, als wollte sie sich meine Gesichtszüge einprägen. Dann kehrte sie zu ihrer Arbeit zurück.
Fanli hatte das Haus bereits verlassen. Der Tee war jetzt fast kalt, die Blätter auf den Grund gesunken, das Wasser zu einem trüben, bitteren Grün nachgedunkelt. Alle Becher waren noch voll. Eine Verschwendung.
Vielleicht hätte ich meine verbleibende Zeit damit zugebracht, durch das Haus zu wandern wie ein Geist, mich abwechselnd mit Bildern von König Fuchai geängstigt – jemand mit Zähnen wie Hauer und brutalen Händen und einem gierigen, blutgetränkten Grinsen – und versucht, mich mit den Bildern eines gefallenen Wu-Königreichs zu trösten, ihre Flagge unter den Füßen unserer Soldaten zertrampelt, während sie zu einem ungehinderten Sieg einmarschierten. Doch nicht lange, nachdem meine Eltern sich ins Bett zurückgezogen hatten, rief eine vertraute Stimme von draußen.
»Xishi-jiejie! Xishi-jie, war er auch bei dir?«
Zhengdan stürmte, ohne stehen zu bleiben, durch die Tür, ihr Gewand flatterte hinter ihr her. In ihrer Eile hatte sich ihr schwarzes Haar aus dem kunstvollen Knoten gelöst; mit einem ungeduldigen Fauchen riss sie die Holznadeln heraus, sodass es ihr lose über den Rücken fiel. Zwei Farbtupfer leuchteten auf ihren Wangen, und ihre Stimme war eindringlich. Ich brauchte mehrere Sekunden, um ihre Frage zu verstehen.
»Wer? Du meinst nicht den … Berater?«
»Ich wusste es«, sagte sie und schüttelte den Kopf. Ihre Miene war eigenartig; dramatisch und triumphierend zugleich. »Wenn er hierherkam auf der Suche nach einer großen Schönheit, so konnte er natürlich nicht gehen, ohne dich aufzusuchen.«
»Warte.« Ich setzte mich auf den nächsten Schemel; oder besser gesagt, meine Knie gaben nach, der Schock drückte mich herab wie ein echtes Gewicht. Sie blieb stehen, die Hände auf den Hüften. »Du warst das andere Mädchen, von dem er gesprochen hat? Hast du … hast du eingewilligt? Gehst du als Palastdame?«
»Welche bessere Wahl habe ich?«, höhnte sie. »Meine Mutter wollte mich an diesen alten Mann Lidan verheiraten – du weißt schon, der, der schon kahl wird und die ganze Zeit nach Fisch stinkt. Lieber werde ich eine Palastdame als seine Frau.«
Nicht zum ersten Mal bewunderte ich das Wesen meiner Freundin. Alle sprachen von ihrer Anmut – besonders ihre Brauen, die schlank waren und geschwungen wie Weidenblätter, und jedes Gefühl ausdrückten, das sie nicht laut aussprach –, aber sie übersahen die kleineren, bedeutenderen Züge. Sie vergaßen, dass sie eine Räuberbande vertrieben hatte, die unser Dorf hatte überfallen wollen, dass sie einen der Räuber so übel verletzt hatte mit einem stumpfen Hackebeil, dass er wimmernd davongehumpelt war; dass sie es auch gewesen war, sie allein, die die Dorfpferde ausgebildet, die Hauptstraße repariert, den Fuchs erlegt, der die Zäune überwunden und die Hälfte unserer Hennen gefressen hatte. Das erste Mal, dass ich sie je hatte weinen sehen, war, als sie dem Tier das Genick gebrochen hatte.
»Hast du der Bitte des Beraters zugestimmt?«, fragte sie und zog die berühmten, zarten Brauen hoch.
»Nein. Noch nicht.«
»Noch nicht«, wiederholte sie. Dann hockte sie sich mit verblüffender Grimmigkeit neben mich und ergriff meine Hand. Ihre Fingerspitzen waren voller alter und neuer Blasen; nicht vom Saubermachen und Kochen, wie man vielleicht angenommen hätte, sondern von den Schwertübungen, die sie insgeheim durchführte. »Überdenke es gut, Xishi-jie. Die Mission ist – es ist gefährlich …«
»Und doch gehst du«, sagte ich. »Hast du keine Angst?«
Ihr Kinn schob sich vor. »Natürlich nicht.«
Aber ich wusste, dass sie log. So, wie ich wusste, dass sie zu stolz war, das zuzugeben.
Er war mir schrecklich vertraut, dieser dunkle, stählerne Ausdruck in ihren Augen. Früh am Morgen, auf dem Höhepunkt des Kriegs, hatte ich sie mit ihrem Vater vor ihrem Haus gesehen. Sie hatte seine alte Rüstung getragen, sein Schwert hinter sich hergeschleift, die Zähne zusammengepresst, so anstrengend war es. Das Bild wäre beinahe drollig gewesen, der Helm so groß, dass er ihr immer wieder über die Augen rutschte. Ihr Vater hatte laut aufgelacht und ihr sanft mit beiden Händen den Helm vom Kopf genommen.
Geh nicht zurück aufs Schlachtfeld, hatte sie gebettelt, sich auf die Zehenspitzen gestellt und versucht, ihm den Helm wieder wegzunehmen. Es hatte nichts genutzt; sie war nur halb so groß wie er. Lass mich an deiner statt kämpfen.
Es ist meine Pflicht, hatte er erwidert. Die Himmel haben etwas anderes für dich im Sinn, Zhengdan. Das fühle ich.
Ihre Augen hatten wild aufgeleuchtet, aber am Ende hatte sie zugesehen, wie er gegangen war. Danach hatte ich sie jeden Morgen draußen stehen sehen, mit kerzengeradem Rücken, die Miene hoffnungsvoll, nervös dem Horizont zugewandt.
Zwei Jahre später war, an genau dieser Stelle, ein grimmig dreinblickender Beamter dahergekommen, den blutverschmierten Helm ihres Vaters in Händen. Es war die höchste Ehre, die einem Soldaten zuteilwerden konnte, hörte ich den Offizier sagen. Seinen letzten Kampf hatte er gegen den General des Wu-Königreichs selbst gefochten. General Ma.
Als ich jetzt zu ihr hinübersah, war es, als würde die Vergangenheit wieder zu uns zurückkehren. Oder vielleicht hatte uns die Vergangenheit auch nie verlassen.
»Ich komme mit dir«, sagte ich. Die Worte hallten klar durch den kleinen Raum, und ich hörte die Überzeugung in meiner eigenen Stimme. Die Luft schien sich an meiner Haut zu kräuseln, und der Wind draußen prallte plötzlich gegen das Fensterpapier, als wüssten selbst die Himmel von meiner Entscheidung. War es die richtige? Das konnte ich nicht sagen. Vielleicht war es nicht wichtig. Beide Entscheidungen bedeuteten Leid; ich hatte nur die eine Sorte Leid vor der anderen gewählt.
Zhengdan kannte mich schon mein ganzes Leben. Sie machte keine weiteren Versuche, mich davon abzubringen. Es wäre sinnlos, was immer sie sagte. »Wenn es deine Mission ist, den König zu verführen, dann wird es meine Mission sein, dich zu beschützen.« Sie griff noch einmal nach meiner Hand, und ihr Blick flammte in der Dunkelheit.
»Wir werden uns beide beschützen«, korrigierte ich sie. »Wir kommen zusammen aus dem Palast zurück, gesund und munter.«
Sie schenkte mir ein schwaches Lächeln, sagte aber nichts.
»Versprich es mir«, drängte ich.





























