
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Das Mädchen von nebenan, eine kleine Notlüge und die Fake-Lovestory zu einem Schauspielstar
Als Elizas Essay über ihre rauschende Liebesbeziehung viral geht, ist sie über Nacht sowas wie berühmt. Nur blöd, dass alles frei erfunden ist, und es den Freund, um den sie jetzt sämtliche Mädchen beneiden, überhaupt nicht gibt. Zu einem richtigen Problem wird das allerdings erst, als ein absolutes Trendmagazin ihr eine eigene Kolumne anbietet. Auf einmal scheint Elizas allergrößter Traum in Reichweite. Sofern sie es schafft, die Lüge aufrechtzuerhalten. Doch zum Glück hat Eliza die rettende Lösung: Ein Fake-Boyfriend muss her! Und dafür hat sie auch schon den perfekten Kandidaten. Caz Song, Mädchenschwarm an ihrer Schule. Model. Schauspielstar. Und aktuell verfolgt von einem kleinen Image-Problem, das eine romantische Liebesbeziehung leicht aus dem Weg räumen könnte.
Eine Fake-Beziehung der Extraklasse mit Schauplatz in Peking – für alle Fans von Jenny Han
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ann Liang
Aus dem amerikanischen Englisch von Doris Attwood
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Ann Liang
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»This Time It’s Real« bei Scholastic Press, einem Imprint von Scholastic Inc., New York
Aus dem Englischen von Doris Attwood
Covergestaltung: Kathrin Schüler
Coverillustration: Shutterstock.com (Moremar, neuralsuperstudio, Incomible, andik76, Jellicle)
skn · Herstellung: AJ
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30385-3V001
www.cbj-verlag.de
FÜRALLEZYNISCHEN, DIEINSGEHEIMNOCHIMMERANDIELIEBEGLAUBEN
Kapitel 1
Ich will gerade in meine Schuluniform schlüpfen, als ich den an meinem Schlafzimmer vorbeischwebenden Mann bemerke.
Nein, schweben ist nicht das richtige Wort, wird mir klar, als ich näher herangehe, den Karorock zerknittert in der Hand, während mein Puls in meinen Ohren rast. Er baumelt. Sein Körper hängt an zwei Metallseilen, die gefährlich dünn aussehen, wenn man bedenkt, dass wir uns hier im achtundzwanzigsten Stockwerk befinden und die sommerliche Brise seit Mittag besonders kräftig bläst und Staub und Blätter zu einem Minitornado aufwirbelt.
Ich schüttle den Kopf, völlig fassungslos, warum sich jemand freiwillig in eine derartige Lage bringen sollte. Was ist das – irgendein neuer Extremsport? Das Initiationsritual einer Gang?
Eine Midlife-Crisis?
Der Mann ertappt mich dabei, wie ich ihn anstarre, und winkt mir kurz fröhlich zu, als wäre er nicht nur ein fehlerhaftes Drahtseil, einen gelösten Knoten oder einen besonders aggressiven Vogel davon entfernt, an der Gebäudefassade hinunterzustürzen. Dann, genauso beiläufig, zieht er einen nassen Lappen aus seiner Tasche und fängt an, das Glas zwischen uns zu schrubben, wobei er überall Spuren aus weißem Schaum hinterlässt.
Richtig. Natürlich.
Meine Wangen beginnen zu glühen. Ich war so lange Zeit nicht mehr in China, dass ich völlig vergessen habe, wie Hochhausfenster geputzt werden – genauso, wie ich vergessen habe, wie die U-Bahn funktioniert oder dass man kein Toilettenpapier runterspülen soll oder nur in bestimmten Geschäften feilschen kann, ohne pleite oder knickrig rüberzukommen. Hinzu kommen außerdem all die Dinge, die sich in den zwölf Jahren verändert haben, in denen meine Familie und ich in Übersee gelebt haben, Dinge, die ich gar nicht erst lernen konnte. Wie zum Beispiel, dass die Leute hier einfach kein Bargeld mehr benutzen.
Das ist kein Witz. Als ich neulich versucht habe, einer Kellnerin einen alten Hundert-Yuan-Schein zu geben, hat sie mich mit offenem Mund angestarrt, als wäre ich mit einer Zeitmaschine direkt aus dem siebzehnten Jahrhundert angereist.
»Äh, hallo? Eliza? Bist du noch da?«
Ich stolpere beinahe über die Ecke meines Betts, weil ich so hastig zu meinem Laptop stürze, der auf zwei Kartons mit der Aufschrift ELIZASNICHTSOWICHTIGERKRAM steht – Kartons, die auszupacken ich noch keine Zeit hatte, im Gegensatz zu dem Karton mit der Aufschrift ELIZASSUPERWICHTIGERKRAM. Ma findet, ich könnte durchaus ein wenig spezifischer bei meiner Beschriftung sein, aber es kann niemand behaupten, ich hätte nicht mein ganz eigenes funktionierendes System.
»E-li-za?« Zoes Stimme – schmerzhaft vertraut, selbst aus dem Bildschirm – wird lauter.
»Ich bin hier, ich bin hier«, rufe ich zurück.
»Oh, gut, weil ich hier im wahrsten Sinne des Wortes gegen eine weiße Wand rede. Apropos … wirst du dein Zimmer auch irgendwann mal dekorieren, Süße? Du wohnst jetzt schon seit, was, drei Monaten da und es sieht immer noch aus wie in einem Hotel. Ich meine, wie in einem netten Hotel, sicher, aber …«
»Es ist eine bewusste künstlerische Entscheidung, okay? Du weißt schon, Minimalismus und so.«
Sie schnaubt höhnisch. Ich bin eine ziemlich gute Bullshitterin, aber Zoe hat leider ein ziemlich gutes Märchenradar. »Ach wirklich? Ist es das?«
»Vielleicht«, lüge ich und drehe den Laptop zu mir herum. Eine Hälfte des Bildschirms nehmen ein persönlicher Aufsatz für meinen Englischkurs und – zu Recherchezwecken – ungefähr eine Milliarde Tabs zum Thema »Wie schreibe ich eine Kussszene?« ein. Die andere Hälfte erfüllt das wunderschöne, grinsende Gesicht meiner besten Freundin.
Zoe Sato-Meyer sitzt in ihrer Küche, ihre Lieblings-Tweedjacke über ihren schmalen Schultern hängend, die dunklen Wellen zu einem hohen Pferdeschwanz geglättet und dank der Lampen über ihr von einem Heiligenschein umgeben, wie ein sehr stylisher siebzehnjähriger Engel. Die rabenschwarzen Fenster hinter ihr und die Schüssel mit Instantnudeln auf der Küchentheke – ihre Vorstellung eines kleinen Snacks vor dem Schlafengehen – sind der einzige Hinweis darauf, dass sie zu irgendeiner unchristlichen Uhrzeit mitten in der Nacht in L. A. mit mir plaudert.
»O mein Gott.« Ihr Blick fällt auf mein abgetragenes gepunktetes Sweatshirt, als ich meine Laptopkamera justiere. »Ich kann nicht glauben, dass du dieses Ding immer noch hast. Hast du das nicht schon in der achten Klasse getragen oder so?«
»Was denn? Es ist bequem«, verteidige ich mich, was im Prinzip der Wahrheit entspricht. Aber ich schätze, es entspricht ebenso der Wahrheit, dass dieses hässliche, ausgefranste Sweatshirt eine der wenigen Konstanten durch sechs verschiedene Länder und zwölf verschiedene Schulen war.
»Okay, okay.« Zoe hebt pseudokapitulierend beide Hände. »Mach du ruhig dein Ding. Aber, ähm, trotzdem: Solltest du dich nicht langsam umziehen? Es sei denn, du hast vor, das zum Elternsprechtag zu tragen …«
Mein Blick fällt wieder auf den Rock in meiner Hand, auf das noch immer fremd wirkende Wappen der WESTBRIDGEINTERNATIONALSCHOOLOFBEIJING, das in das steife, kunststoffartige Material eingestickt ist. Ein Knoten bildet sich in meinem Magen. »Ja, nein«, murmle ich. »Ich sollte mich definitiv umziehen.«
Der Fensterputzer ist immer noch da, deshalb ziehe ich die Vorhänge zu, aber erst, nachdem ich einen flüchtigen Blick auf den weitläufigen Apartmentkomplex unter uns geworfen habe. Für einen Ort namens Bluelake bieten die akkuraten Gebäudereihen und gepflegten Gärten ziemlich wenig Blaues, dafür aber jede Menge Grün: den künstlich angelegten See im Herzen der Anlage mit seinen benachbarten Lotusteichen, die riesigen Minigolf- und Tennisplätze in Parkplatznähe, das saftige, die Kieswege säumende Gras und natürlich die Gingkos. Als wir eingezogen sind, erinnerte mich die ganze Gegend an ein schickes Ferienresort, was irgendwie passt. Schließlich werden wir hier nicht länger bleiben als ein Jahr.
Während ich in meine Uniform schlüpfe, schnipst Zoe mit den Fingern und sagt: »Warte, so leicht kommst du mir nicht davon. Erklär mir noch mal, warum du einen Aufsatz über deinen nicht existierenden Freund schreibst?«
»Ich schreibe ihn nicht. Ich hab ihn schon geschrieben«, korrigiere ich sie und ziehe mir die Bluse über den Kopf. »Ich hab ihn bereits abgegeben. Und es war auch nicht so, dass ich eine Geschichte über mein Liebesleben erfinden wollte, ich wusste nur nicht, was ich sonst schreiben sollte …« Ich verstumme kurz, um eine Strähne meines langen, tintenschwarzen Haars aus einem der Blusenknöpfe zu befreien. »Das Ding ist heute Abend fällig und zählt zu unserer Gesamtnote, also … du weißt schon. Ich musste ein bisschen kreativ werden.«
Zoe schnaubt schon wieder, diesmal so laut, dass ihr Mikrofon rauscht. »Dir ist schon klar, dass du persönliche Aufsätze nicht erfinden solltest, oder?«
»Nein!«, erwidere ich trocken. »Persönliche Aufsätze sollten persönlich sein? Das ist mir total neu. Ich bin geschockt. Mein ganzes Leben ist eine Lüge.«
Die Wahrheit ist, ich habe mich entschieden, meinen ernsthaften Sachaufsatz in etwas zu verwandeln, das man im Prinzip als Viertausend-Wörter-Romanze bezeichnen könnte, eben weil er so persönlich sein soll. Das Thema an sich ist schon schlimm genug, inspiriert von diesem schmalzigen Buch, das wir in der ersten Schulwoche gelesen haben: In Als die Nachtigallen wieder sangen heißt es, Lucy und Taylor hätten ihre eigene »Geheimsprache«, die niemand sonst kennt. Mit wem teilst du eine Geheimsprache? Wie hat sie sich entwickelt? Was bedeutet dir diese Person?
Trotzdem hätte ich mir natürlich auch sagen können: »Augen zu und durch«, und eine nur ganz leicht ausgeschmückte Abhandlung über meine Eltern, meine kleine Schwester oder Zoe schreiben können … nur, dass wir unsere fertigen Essays als Teil des Westbridge-School-Blogs posten müssen. Sprich: auf einer sehr öffentlichen Plattform, auf der alle aus meiner Klasse – die mich nur als »die Neue« oder »die, die neulich aus den Staaten hergezogen ist« kennen – ihn lesen und kommentieren können.
Und auf gar keinen Fall teile ich irgendwelche Details über meine engsten persönlichen Beziehungen mit irgendwem. Selbst die erfundenen Details sind peinlich genug: Zum Beispiel, dass ich angeblich die Linien auf der Handfläche meines fiktiven Freunds mit einem Finger nachgefahren, ihm im Dunkeln Geheimnisse zugeflüstert und ihm erklärt habe, er würde die Welt für mich bedeuten, sich wie Zuhause anfühlen.
»… noch nicht mal im Entferntesten Sorgen, die anderen in deiner Schule könnten, ich weiß auch nicht, es lesen und neugierig auf deinen Freund werden?«, fragt Zoe.
»Ich hab alles im Griff«, versichere ich ihr, während ich die Vorhänge wieder öffne. Sofort flutet Licht den Raum, erhellt die winzigen Staubpartikel, die vor meinem nun wieder leeren Fenster vorbeischweben. »Ich habe keinen Namen erwähnt, deshalb kann auch niemand versuchen, ihn zu stalken. Außerdem hab ich behauptet, ich wäre diesem fiktiven Kerl vor drei Monaten begegnet, als ich mit meiner Familie auf Wohnungssuche war, was nach einer ziemlich plausiblen Kennenlerngeschichte klingt – süß, ohne zu enthüllen, auf welche Schule er vielleicht geht. Und da unsere Beziehung noch relativ frisch und alles ein bisschen kompliziert ist, wollen wir fürs Erste alles ganz privat halten. Siehst du?« Ich trete wieder vor die Kamera und fuchtle ausladend mit den Armen herum, als wäre mein kompletter Essay in leuchtenden Buchstaben für Zoe in die Luft geschrieben. »Bombensicher.«
»Wow.« Sie schnappt nach Luft. »Wow. Ich meine, all diese Mühe«, sagt Zoe und klingt gleichzeitig frustriert und beeindruckt, »nur, damit du nichts Echtes schreiben musst?«
»Das war der Plan.«
Es folgt eine kurze Stille, nur durchbrochen von Zoes Nudelschlürfen und dumpfen Schritten vor meinem Zimmer. Schließlich seufzt Zoe und fragt mich mit für meinen Geschmack viel zu besorgtem Tonfall: »Kommst du in deiner neuen Schule einigermaßen klar, Süße? Ich meine, hast du dich … schon eingewöhnt?«
»Was?« Ich spüre, wie ich mich sofort versteife und meine Muskeln sich anspannen, als würde ich einen Schlag erwarten. »Warum – warum fragst du mich das?«
»Keine Ahnung.« Zoe zuckt mit einer Schulter und ihr Pferdeschwanz hüpft bei der Bewegung. »Nur so ein … Gefühl.«
Ich werde vor einer Antwort gerettet, als Ma vom anderen Ende des Flurs nach mir ruft, in einer Lautstärke, die normalerweise Such- und Rettungseinsätzen vorbehalten sein sollte. »Ai-Ai! Der Fahrer ist hier!«
Ai-Ai ist mein chinesischer Spitzname und bedeutet, wörtlich übersetzt, Liebe. Von erfundenen Beziehungen mal abgesehen, kann ich nicht behaupten, ich wäre ihm bislang gerecht geworden.
»Ich komme!«, brülle ich zurück und wende mich dann wieder dem Bildschirm zu. »Ich nehme an, du hast das gehört?«
Zoe grinst und ich entspanne mich ein wenig, erleichtert, dass das offene Gespräch, das sie allem Anschein nach mit mir führen wollte, damit beendet ist. »Ja, ich glaube, das hat der ganze Planet gehört. Grüß deine Mom schön von mir«, fügt sie hinzu.
»Mach ich.« Bevor ich den Laptop zuklappe, forme ich total kitschig ein Herz mit den Händen, was ich vor irgendwem anders nie im Leben tun würde. »Du fehlst mir.«
Zoe wirft mir zur Antwort einen dramatischen Handkuss zu und ich lache. »Du fehlst mir auch.«
Der harte Knoten in meinem Magen löst sich ein wenig bei den vertrauten Worten. Seit ich vor zwei Jahren aus L. A. weggezogen bin, haben wir jede einzelne Unterhaltung so beendet, ganz gleich, wie beschäftigt oder wie müde wir waren, wie kurz das Gespräch war oder wie lange es dauert, bis wir wieder miteinander reden können.
Du fehlst mir.
Es ist zwar nicht so gut wie die Übernachtungspartys, die wir immer bei ihr zu Hause veranstaltet haben, wenn wir uns im Schlafanzug auf ihrer Couch breitgemacht und irgendeine Netflixserie auf ihrem Laptop geguckt haben, einen Teller der selbst gemachten Reisbällchen ihrer Mom zwischen uns balancierend. Und es ist auch nicht annähernd so gut wie unsere Wochenendausflüge an den Strand, unsere Haut von der kalifornischen Sonne erwärmt, während die Brise unser salzig zerzaustes Haar flattern ließ. Natürlich ist es das nicht.
Aber für den Moment ist dieses kleine, simple Ritual genug.
Weil es nur uns gehört.
Unser Fahrer hat den Wagen direkt vor unserem Apartmentgebäude geparkt, im gesprenkelten Schatten einer Weide.
Theoretisch ist Li Shushu weniger unser Fahrer als Mas Fahrer – einer der zahlreichen Vorteile, wenn man die Geschäftsführerin einer angesehenen globalen Consultingfirma ist und nur ein Teil des damit einhergehenden »Tut mir leid, dass wir Sie fast jedes Jahr bitten müssen, Ihr Leben zu entwurzeln!«-Pakets –, weshalb er auch direkt auf sie zueilt und sie zuerst begrüßt.
»Yu Nüshi«, sagt er und öffnet mit einer tiefen Verbeugung die Tür für sie. Madame Yu.
Ich fühle mich bei dieser speziellen Art der Behandlung immer unwohl, auch wenn ich nicht genau sagen kann, warum, und obwohl sie nicht mir direkt zuteil wird. Ma lächelt ihn jedoch nur durch ihre Sonnenbrille an und lässt sich anmutig auf den Beifahrersitz sinken. Wenn man sie jetzt so sieht, mit ihrer blassen, makellosen Haut, dem maßgeschneiderten Blazer und ihrem akkuraten Bob, würde man nie auf die Idee kommen, sie könnte zusammen mit sechs Geschwistern in einer armen chinesischen Stadt auf dem Land aufgewachsen sein, wo sie um jeden Bissen kämpfen musste.
Wir anderen lassen uns in der üblichen Reihenfolge auf dem Rücksitz nieder: ich und Ba an den Fenstern, meine neun Jahre alte kleine Schwester, Emily, in die Mitte gequetscht.
»Zur Schule?«, vergewissert Li Shushu sich in langsamem, übermäßig betontem Mandarin, während er den Motor anlässt, der Geruch von neuem Leder und Benzindämpfen schwer in dem geschlossenen Raum. Er kennt mich jetzt schon lange genug, um zu wissen, wie es um meine Chinesischkenntnisse bestellt ist.
»Zur Schule«, bestätige ich und tue mein Bestes, das Stechen in meiner Magengegend zu ignorieren. Ich hasse die Westbridge ohnehin schon, aber ganz egal, auf welcher Schule, die Elternsprechtage sind immer das Schlimmste. Wenn die Tatsache nicht wäre, dass Emily auf dieselbe Schule geht wie ich und ihr Sprechtag ebenfalls heute Abend stattfindet, hätte ich mir eine brillante Ausrede einfallen lassen, damit wir alle zu Hause bleiben können.
Aber jetzt ist es zu spät, um noch irgendetwas zu unternehmen.
Ich lehne mich auf meinem Platz zurück und presse die Wange an das kühle, glatte Glas, während ich zusehe, wie unser Apartmentkomplex immer kleiner wird, bis er schließlich ganz verschwindet, ersetzt durch die heranrauschende Innenstadtkulisse.
Seit wir wieder hierhergezogen sind, habe ich den Großteil unserer Autofahrten so ans Fenster geklebt verbracht und versucht, das krasse Auf und Ab der Pekinger Skyline zu verinnerlichen, das Labyrinth aus Kreuzungen und Ringstraßen, die grellen Ansammlungen von Dumpling-Lokalen und vollgepackten Lebensmittelläden.
Ich habe versucht, mir alles einzuprägen – versucht, mich zu erinnern.
Irgendwie verblüfft es mich, wie irreführend die Fotos sind, die man von Peking sieht. Sie zeigen die Stadt entweder als smogbelastete, postapokalyptische Welt voller verhärmter Menschen mit steinernen Mienen und Atemschutzmasken oder lassen sie aussehen, als wäre sie einem teuren Science-Fiction-Film entsprungen, mit modernen Wolkenkratzern und funkelnden Lichtern, triefend vor Luxus.
Fotos zeigen jedoch nur selten die wahre Energie dieser Stadt, den Vorwärtsdrang, der hier allem zugrunde liegt, wie eine unsichtbare Strömung. Alle scheinen hier nach mehr zu drängen, zu greifen, zu streben, ständig in Bewegung, von einem Ort zum nächsten. Sei es nun der Typ von irgendeinem Lieferservice, der sich hinter uns durch den Verkehr schlängelt, Dutzende Take-away-Boxen auf sein Fahrrad geschnallt, oder die Geschäftsfrau im Mercedes links von uns, die irgendjemandem hektisch tippend eine Nachricht schickt.
Meine Aufmerksamkeit wird abgelenkt, als der Song eines berühmten chinesischen Rappers aus dem Radio dröhnt. Im Rückspiegel sehe ich, wie Ma ihre Sonnenbrille abnimmt und sichtlich zusammenzuckt.
»Warum macht er dauernd diese Geräusche, si-ge si-ge?«, fragt sie nach ungefähr drei Sekunden. »Ist ihm irgendwas im Hals stecken geblieben?«
Ich ersticke fast an meinem unterdrückten Lachen.
»So klingt Musik heutzutage nun mal«, sagt Ba auf Mandarin, stets der Diplomat.
»Ich finde es irgendwie ganz cool«, werfe ich ein und bewege den Kopf zum Beat.
Ma blickt sich mit einem halbherzig finsteren Stirnrunzeln zu mir um. »Wackle nicht so mit dem Kopf, Ai-Ai. Du siehst aus wie ein Huhn.«
»Meinst du so?« Ich wackle noch doller.
Ba versteckt ein Lächeln hinter seiner Hand, während Ma mit der Zunge schnalzt und Emily, die, davon bin ich überzeugt, in Wirklichkeit eine achtzigjährige Großmutter ist, gefangen im winzigen Körper einer Neunjährigen, ein langes, dramatisches Seufzen ausstößt. »Teenager«, grummelt sie.
Ich knuffe sie mit dem Ellenbogen in die Seite, und sie knufft natürlich zurück, was zu einer ganz neuen Runde Gezanke führt, das erst endet, als Ma damit droht, uns zum Abendessen nichts als trockenen Reis zu servieren.
Aber wenn ich ehrlich bin, sind es diese Momente – wenn Musik das Wageninnere erfüllt und der Wind vor den Fenstern rauscht, während die Spätnachmittagssonne golden zwischen den Bäumen aufblitzt und meine Familie ganz nah bei mir ist –, in denen ich mich … glücklich fühle. Wirklich und wahrhaftig glücklich, trotz all der Umzüge und Abschiede und Neuanfänge. Trotz allem.
Kapitel 2
Meine gute Laune hält nicht lange an.
Sobald wir vor den Gebäuden der Westbridge School vorfahren, erkenne ich meinen Fehler.
Alle tragen normale Klamotten. Hübsche Sommerkleider, Crop Tops und Jeansshorts. Niemand aus dem Lehrkörper hat uns ausdrücklich darauf hingewiesen, wie wir heute Abend zu erscheinen haben, deshalb habe ich naiverweise angenommen, wir müssten in der standardmäßigen Schuluniform auflaufen, weil genau das an meiner vorherigen Schule erwartet worden wäre.
Meine Familie steigt aus dem Wagen und ich zwinge die Woge der aufsteigenden Panik hinunter. Es ist nicht so, als würde ich Ärger kriegen, weil ich anhabe, was ich anhabe – ich weiß nur jetzt schon, dass ich wie eine Idiotin dastehen und auffallen werde wie ein bunter Hund. Ich werde aussehen wie die ahnungslose Neue, die ich tatsächlich bin – aber deshalb ist es auch nicht leichter zu ertragen.
»Ai-Ai.« Ma klopft ans Fenster. »Kuaidian. Beeil dich.«
Ich bedanke mich kurz bei unserem Fahrer und steige aus. Wenigstens ist das Wetter gut. Der Wind ist zu einer sanfteren, seidigen Brise abgeflaut, eine willkommene Erholung von der Hitze. Und der Himmel. Der Himmel ist wunderschön, eine Mischung aus pastellblauen und gedämpften Rosatönen.
Ich atme ein. Atme aus.
Es ist alles okay, beruhige ich mich selbst. Alles bestens.
»Komm mit, Baba«, sagt Emily und zerrt Ba bereits in Richtung des Grundschulgebäudes, wo sämtliche Wände in bunten Farben gestrichen sind. Unausstehlich bunten Farben, wenn man mich fragt.
»Du musst mit Ms Chloe sprechen. Ich hab ihr erzählt, dass du Dichter bist und Autogrammstunden und so was in Buchläden gibst, und sie war soooo beeindruckt. Zuerst hat sie mir nicht geglaubt, schätze ich, aber ich hab ihr gesagt, sie soll dich googeln und dann …«
Emily sieht aus, als wäre bei ihr alles bestens, weil es das tatsächlich ist. Ganz gleich, wo wir hinziehen, meine kleine Schwester hat nie ein Problem damit, sich einzugewöhnen. Wir könnten sie wahrscheinlich in die Antarktis schicken und sie würde nach spätestens zwei Wochen ganz gechillt mit den Pinguinen abhängen.
Ma und ich gehen in die entgegengesetzte Richtung, in der sich die Klassenzimmer der höheren Stufen befinden. Die breiten grauen Korridore sind bereits ziemlich voll mit Eltern, Schülerinnen und Schülern, einige kommen gerade herein, andere bahnen sich einen Weg nach draußen. Genau wie ich erwartet hatte, wandern die Blicke einiger Leute zu meinem steifen Rock und dem zu großen Blazer, und es blitzt eine Mischung aus Mitleid und Erheiterung auf ihren Gesichtern auf, bevor sie ihre Blicke wieder abwenden.
Ich hebe das Kinn. Gehe schneller.
Es ist alles bestens.
Wir können mein Klassenzimmer gar nicht schnell genug erreichen.
Drinnen ist es laut. Überall sind Kinder aus meiner Klasse, die Lehrerinnen und Lehrer warten hinter den Tischreihen. Keiner von ihnen begrüßt mich und ich sage auch zu niemandem Hallo.
Obwohl die Schule vor fast einem Monat begonnen hat, hab ich noch nicht wirklich jemanden kennengelernt. All die verschiedenen Namen und Gesichter und Klassen verschwimmen irgendwie miteinander. Ich meine, wir werden sowieso in weniger als einem Jahr unseren Abschluss machen. Es gibt keinen Grund für mich, mich ein bisschen unters Volk zu mischen, wie es mir diverse Lehrerinnen und Lehrer in der Vergangenheit gerne empfohlen haben, nur um eine Verbindung zu jemandem aufzubauen, wenn wir ein paar Monate später sowieso wieder getrennte Wege gehen. Da wir dank Mas Job andauernd umziehen müssen, ist mir das sowieso schon öfter passiert, als ich mitzählen kann: dieser langsame, schmerzliche, viel zu vorhersehbare Übergang von Fremden zu Bekannten zu Freunden und wieder zurück zu Fremden, sobald ich die Schule verlasse.
Ich wäre eine Masochistin, wenn ich mir das selbst noch mal antun würde.
Außerdem sind wir in meiner ganzen Stufe nicht mal zu dreißigst und es haben sich natürlich bereits alle Cliquen gebildet. Zu meiner Rechten quietscht eine Gruppe von Mädchen laut und fällt sich in die Arme, als hätten sie sich seit Jahren nicht mehr gesehen, nicht nur seit Stunden. Irgendwo hinter mir ist eine andere Gruppe in ein Gespräch vertieft und wechselt in jedem Satz permanent zwischen drei Sprachen – Englisch, Koreanisch und noch einer anderen – hin und her, als wäre es die natürlichste Sache der Welt.
Ziemlich markentreu für eine internationale Schule, schätze ich.
»Ah! Schaut mal, wer hier ist!«
Mein Englisch- und Klassenlehrer, Mr Lee, winkt mich zu sich, seine Augen leuchtend hinter der dicken, übergroßen Brille. Er ist mit einem runden Milchgesicht und nicht zu bändigendem grau meliertem Haar geschlagen, eine ziemlich verwirrende Kombination, dank der sich unmöglich sagen lässt, ob er Anfang dreißig oder Ende fünfzig ist.
»Setz dich, setz dich«, sagt er rasch und zeigt auf zwei vor seinem Schreibtisch stehende Stühle. Dann richtet er seine Aufmerksamkeit auf Ma, und seine Miene wird gütiger, wie bei jemandem, der im Park ein besonders niedliches Kind sieht. »Und das ist … Elizas Mutter, nehme ich an.«
»Ja. Eva Yu«, stellt Ma sich vor und verfällt sofort in ihren heiter-professionellen Tonfall, den sie auch im Umgang mit Weißen immer benutzt, ihr Akzent zurückgenommener, damit sie amerikanischer klingt. Sie streckt ihm eine manikürte Hand hin. »Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Mr Lee runzelt ein wenig die Stirn, als er sie schüttelt, wobei die Falten sich noch tiefer eingraben, als er spürt, wie kräftig ihr Handschlag ist. Ich kann sehen, dass er versucht, seinen ersten Eindruck von Ma mit der vorgefertigten Meinung, die er – allein auf der Basis des nicht-westlichen Nachnamens – bereits von ihr hatte, in Einklang zu bringen.
Ma lässt zuerst los und nimmt mit einem flüchtigen, selbstzufriedenen Lächeln Platz.
Sie genießt das, das weiß ich. Sie hat es schon immer genossen, andere zu überraschen, was ziemlich oft passiert, weil alle sie ständig unterschätzen. Einer der Gründe, warum sie sich überhaupt für eine Karriere als Firmenberaterin entschieden hat, war, weil ein Freund von ihr scherzte, sie würde in der harten Geschäftswelt niemals überleben.
»Nun …« Mr Lee räuspert sich. Wendet sich wieder mir zu. »Da das alles noch neu für dich ist, lass uns einfach kurz die Regeln besprechen, ja?« Er wartet meine Antwort nicht ab. »In den nächsten rund zehn Minuten werde ich mit deiner Mutter über deine bisherigen schulischen Leistungen im Englischunterricht sprechen, über deine Lerneinstellung, über Bereiche, in denen du dich noch verbessern könntest, und so weiter. Du wirst uns weder unterbrechen noch Fragen stellen noch irgendwie Aufmerksamkeit auf dich lenken, bis wir fertig sind und ich dich direkt anspreche. Ist das klar?«
Und die Leute wundern sich, warum Teenager ein Problem mit Autorität haben.
»Ah, wie ich sehe, hast du bereits verstanden, wie es läuft«, sagt Mr Lee fröhlich und winkt mit einer Hand vor meinem versteinerten Gesicht herum.
Ich lasse den Blick mitsamt meiner Aufmerksamkeit abschweifen.
Dann, auf der anderen Seite des Zimmers, entdecke ich die paar Leute hier, die ich kenne.
Caz Song.
Obwohl ich keinerlei Anstrengungen unternommen habe, wäre es so gut wie unmöglich, nicht wenigstens eine Ahnung zu haben, wer er ist: Model. Schauspieler. Gott – wenn man danach geht, wie alle ihn anschmachten und jeden einzelnen seiner Schritte verfolgen, obwohl er nie irgendetwas tut, außer rumzustehen und unausstehlich hübsch auszusehen. Selbst hier, in dieser deprimierenden, hermetisch überwachten Umgebung, hat sich bereits eine nicht unerhebliche Traube von Schülerinnen um ihn versammelt, allesamt mit offen stehenden Mündern. Eine von ihnen krallt sogar eine Hand in ihre Seite und lacht hysterisch über einen Witz, den Caz wahrscheinlich nie gemacht hat.
Ich widerstehe dem Drang, mit den Augen zu rollen.
Ich habe diesen ganzen Hype um Caz Song nie wirklich verstanden, es sei denn, er hätte rein ästhetische Gründe. Es liegt eine gewisse Eleganz in der gemeißelten Linie seines Kiefers, dem leichten Schmollmund, der kantigen, schmalen Form seines Körpers. In seinem dunklen Haar und den noch dunkleren Augen. Er sieht nicht unmenschlich perfekt aus oder so, aber alles zusammen funktioniert einfach.
Trotzdem habe ich das sehr bestimmte Gefühl, er ist sich dieser Tatsache ebenso bewusst wie all seine ihn anhimmelnden Fans, was die ganze Wirkung irgendwie ruiniert. Und natürlich liebt die Presse ihn. Erst neulich bin ich über einen Artikel gestolpert, in dem er als einer der »aufgehenden Sterne am chinesischen Unterhaltungshimmel« bezeichnet wurde.
Er lehnt sich gegen die hintere Wand des Raumes, die Hände in die Hosentaschen gesteckt. Das scheint sein natürlicher Zustand zu sein: an irgendwas lehnend – Türen, Spinde, Tische, was auch immer –, so als hätte er keine Lust, sich die Mühe zu machen, aus eigener Kraft zu stehen.
Aber ich starre schon zu lange, zu auffällig. Caz hebt den Kopf, scheint meinen Blick zu spüren.
Ich gucke hastig woanders hin. Folge wieder dem Gespräch am Tisch, gerade noch rechtzeitig, um Mr Lee sagen zu hören:
»Ihr Englisch ist ziemlich gut …«
»Ja, na ja, ich habe Englisch als Kind gelernt«, werfe ich ein, bevor ich mich zurückhalten kann. Jahre voll vage herablassender Bemerkungen darüber, wie gut mein Englisch doch sei und dass ich noch nicht mal einen Akzent habe – fast immer begleitet von einem Hauch von Überraschung, wenn nicht gar Verwirrung –, haben diese Reaktion zu einem natürlichen Reflex werden lassen.
Mr Lee blinzelt mich an. Rückt seine Brille zurecht. »Richtig …«
»Das wollte ich nur kurz klarstellen.« Ich lehne mich auf meinem Stuhl zurück, plötzlich unsicher, ob ich wegen meiner Unterbrechung ein Triumphgefühl empfinden oder sich mein schlechtes Gewissen melden sollte. Vielleicht hat er es ja im Sinne von »sie kennt sich mit Konjunktionen wirklich gut aus« gemeint und nicht im Sinne von »ich erwarte von Leuten, die so aussehen wie Eliza nie, dass sie überhaupt Englisch sprechen«.
Ma scheint ganz offensichtlich Ersteres zu glauben, denn sie schießt mir einen scharfen Blick zu.
»Entschuldigung. Fahren Sie fort«, murmle ich.
Mr Lee sieht wieder Ma an. »Ich würde daher, falls es Ihnen nichts ausmacht, gern ein wenig mehr über Elizas Hintergrund erfahren, bevor sie hierherkam …«
Ma nickt, bestens darauf vorbereitet, und spult ihr übliches Skript ab: geboren in China, weggezogen, als sie fünf war, ging auf diese und jene Schule und lebte in verschiedenen Ländern …
Ich versuche, nicht zu zappeln oder gar zu fliehen. Wenn ich höre, wie sie so über mich redet, beginnt meine ganze Haut zu jucken.
»Ah, aber das Beste daran, dass sie schon überall gelebt hat, ist, dass sie überall hingehört.« Mr Lee breitet in einer ausladenden Geste, von der ich annehme, sie symbolisiert »überall«, die Arme aus – und wirft dabei eine Box mit Taschentüchern um. Er hält inne, völlig aus dem Konzept gebracht. Hebt die Box auf. Dann, unglaublicherweise, setzt er genau da wieder an, wo er aufgehört hat. »Wissen Sie, Eliza ist keine Bürgerin eines Landes oder eines Kontinents, sondern vielmehr eine …«
»Wenn du jetzt wahreWeltbürgerin sagst, muss ich mich übergeben«, grummle ich so leise, dass nur ich es hören kann.
Mr Lee lehnt sich vor. »Entschuldige, was war das, bitte?«
»Nichts.« Ich schüttle den Kopf. Lächle. »Nichts.«
Ein Herzschlag Stille.
»Nun, da wir gerade von Elizas persönlichen Umständen sprechen«, fährt Mr Lee dann vorsichtig, zögernd fort, und ich habe das schreckliche Gefühl, genau zu wissen, was jetzt kommt. »Ich mache mir ein wenig Sorgen, weil Eliza sich damit schwerzutun scheint, sich … einzugewöhnen.«
Mir schnürt sich die Kehle zu.
Das. Das ist genau der Grund, warum ich Eltern-Lehrer-Sprechtage hasse.
»Sich einzugewöhnen?«, wiederholt Ma mit einem Stirnrunzeln, obwohl sie nicht allzu überrascht aussieht. Nur traurig.
»Sie scheint sich noch niemandem in ihrer Klasse angenähert zu haben«, führt Mr Lee aus. Die dreisprachige Gruppe, die im hinteren Teil des Zimmers auf ihre Eltern wartet, wählt ausgerechnet diesen Moment, um über irgendetwas in schallendes Gelächter auszubrechen, das von allen vier Wänden widerhallt. Mr Lee spricht lauter, schreit beinahe: »Ich will damit sagen, es ist ein wenig besorgniserregend, dass sie hier noch immer keine Freunde hat.«
Zu meinem Pech schwillt der Lärmpegel nach der Hälfte seines Satzes wieder ab.
Und natürlich hören alle jedes einzelne Wort klar und deutlich. Es folgt ein Moment der unbehaglichen Stille. Ungefähr dreißig Augenpaare brennen Löcher in meinen Schädel. Mein Gesicht fängt an zu glühen.
Ich stehe von meinem Stuhl auf und zucke innerlich zusammen, als die Stuhlbeine auf dem polierten Fußboden quietschen und durch die Stille scharren. Ich murmle irgendetwas davon, auf die Toilette zu müssen.
Dann mache ich, dass ich verdammt noch mal verschwinde.
Zu meiner Verteidigung: Ich bin normalerweise ziemlich gut darin – eine wahre Expertin sogar –, meine Gefühle zu verdrängen und mich von allem abzukapseln, aber manchmal trifft es mich einfach knallhart. Dieses schreckliche, erdrückende Gefühl, anders zu sein, falsch, ganz gleich, ob ich die Asiatin in einer katholischen Mädchen-Eliteschule in London bin oder die einzige Neue in einem winzigen Jahrgang an einer chinesischen internationalen Schule. Manchmal bin ich überzeugt davon, ich werde den Rest meines Lebens so verbringen: allein.
Manchmal glaube ich, Einsamkeit ist meine Grundeinstellung.
Zu meiner Erleichterung ist der Korridor leer. Ich ziehe mich in die hinterste Ecke zurück, beinahe zusammengekauert, und hole mein Handy heraus. Scrolle eine Minute lang durch eigentlich gar nichts. Taste intuitiv nach dem rauen Kordelarmband an meinem Handgelenk, ein Geschenk von Zoe, lasse mich davon trösten.
Es ist alles okay, ich bin okay.
Dann rufe ich die Craneswift-Website auf.
Ich habe Craneswift vor ein paar Jahren entdeckt, als ich einen ihrer Newsletter an einem Bahnhof in London mitgenommen habe. Seither lese ich alles von ihnen. Sie haben keine riesige Leserschaft, was sie jedoch durch Qualität und Ansehen wieder wettmachen. Im Prinzip hat jeder, der das Glück hatte, etwas über Craneswift zu veröffentlichen, genau den Erfolg, von dem ich nur träumen kann: journalistische Auszeichnungen, ein prestigeträchtiges Stipendium für ein Journalistik-Studium in New York, internationale Anerkennung. Und das alles, weil sie etwas Schönes, Tiefgreifendes geschrieben haben.
Worte bewegen mich einfach. Ein schöner Satz geht mir direkt unter die Haut und öffnet mein Herz so weit, wie es sonst vielleicht nur eine Musikzeile oder der dramatische Höhepunkt eines Films könnte. Eine gut geschriebene Geschichte kann mich zum Lachen bringen, nach Luft schnappen lassen oder dafür sorgen, dass ich mich in Tränen auflöse.
Während ich auf Craneswift in einen erst kürzlich geposteten Beitrag darüber eintauche, dass man Seelenverwandte an den unmöglichsten Orten finden kann, das vertraute blaue Banner der Website auf meinem Bildschirm leuchtend, spüre ich bereits, wie sich die Last von meinen Schultern zu heben beginnt und sich die Anspannung in meinem Körper löst …
Eine Tür öffnet sich knarrend und Lärm dringt in den Flur.
Ich versteife mich, blicke mit zusammengekniffenen Augen den Korridor hinunter. Caz Song kommt allein heraus, sein Blick huscht an mir vorbei, als wäre ich gar nicht hier. Er wirkt abgelenkt.
»… warten alle auf dich«, sagt er, eine seltene Falte zwischen seinen Augenbrauen, eine noch seltenere Schärfe in seiner Stimme. Caz hat auf mich immer den Eindruck gemacht, er wäre direkt einem Zeitschriftencover entsprungen: glänzend, makellos retuschiert, leicht verdaulich, vermarktbar und unanstößig. Im Augenblick geht er jedoch angespannt im Kreis, seine Schritte so leicht, dass sie kaum ein Geräusch machen. »Es ist Eltern-Lehrer-Sprechtag. Ich kann das nicht einfach allein machen.«
Einen verwirrenden Moment lang glaube ich, er redet mit sich selbst oder versucht sich an irgendeiner seltsamen Schauspieltechnik, aber dann höre ich die gedämpfte Frauenstimme, die aus seinem Handylautsprecher dringt:
»Ich weiß, ich weiß, aber meine Patientin braucht mich dringender. Kannst du deiner Lehrerin nicht einfach sagen, dass mir im Krankenhaus etwas dazwischengekommen ist? Hao erzi, tinghua.« Braves Kind. Benimm dich. »Vielleicht können wir für nächste Woche einen neuen Termin machen – beim letzten Mal ging das doch auch, richtig?«
Ich beobachte, wie Caz einatmet. Aus. Als er wieder spricht, klingt seine Stimme bemerkenswert beherrscht. »Nein, schon okay, Mom. Ich … Ich sage es ihnen. Ich bin sicher, sie werden es verstehen.«
»Hao erzi«, wiederholt seine Mutter, und selbst aus dieser Entfernung kann ich im Hintergrund eine seltsame Unruhe hören. Schepperndes Metall. Das Piepsen eines Monitors. »Oh, aber nur kurz, bevor ich auflegen muss: Was haben sie wegen der Collegebewerbungen gesagt?«
Bewerbungen.
Ich lasse diese unerwartete Information sacken. Das ist mir neu. Ich hatte angenommen, jemand wie Caz würde den Umweg übers College einfach auslassen und direkten Kurs auf eine Schauspielerkarriere nehmen.
Doch nun streicht sich der aufgehende Stern höchstpersönlich über den Kiefer und antwortet: »Es ist … okay. Sie denken, wenn mein Bewerbungsaufsatz fürs College richtig gut ausfällt, sollte ich damit meine Noten und meine mangelnde Anwesenheit wettmachen können …«
Ein Seufzen zischt aus dem Lautsprecher. »Was sage ich dir immer, hm? Noten zuerst, Noten zuerst. Glaubst du, die Bewerbungskomitees am College interessiert, ob du die Hauptrolle im Schultheater spielst? Glaubst du, sie kennen überhaupt irgendwelche asiatischen Stars außer Jackie Chan?« Bevor Caz antworten kann, seufzt seine Mutter erneut. »Vergiss es. Jetzt ist es ohnehin zu spät. Konzentrier dich einfach auf diesen Aufsatz … Bist du nicht ohnehin schon fast fertig?«
Es könnte auch eine optische Täuschung aufgrund der spärlichen Beleuchtung im Korridor sein, aber ich könnte schwören, ich sehe Caz zusammenzucken. »Mehr oder weniger.«
»Was heißt mehr oder weniger?«
»Ich …« Er spannt den Kiefer an. »Es heißt, ich muss noch ein paar Ideen sammeln, einen Rahmen festlegen und … ihn schreiben. Aber ich krieg das schon hin. Ich werde ihn schreiben«, fügt er hastig hinzu. »Versprochen. Vertrau mir, Mom. Ich … Ich werde dich nicht enttäuschen.«
Es folgt eine lange Pause. »Na schön. Gut, also, meine Patientin ruft nach mir, aber wir unterhalten uns bald, okay? Und du kümmere dich um diesen Aufsatz. Wenn du dir dabei nur halb so viel Mühe gibst wie beim Auswendiglernen deiner Drehbücher, dann …«
»Ich hab’s kapiert, Mom.«
Etwas wie Besorgnis huscht flüchtig über sein Gesicht, als er das Gespräch beendet.
Dann, als er sich zum Gehen wendet, sieht er, dass ich mich wie eine Flüchtende in den Schatten des Korridors verstecke, und erwischt mich schon zum zweiten Mal an diesem Abend dabei, wie ich ihn anstarre.
»Oh«, sagt er im selben Moment, als ich mich erhebe und rausplatze: »Tut mir leid!«, und dann überschneiden sich unsere Sätze.
»Ich hab gar nicht gesehen …«
»Ich schwöre, ich hab nicht versucht zu …«
»Schon okay …«
»Wollte gerade wieder reingehen …«
»Du bist Eliza, stimmt’s? Eliza Lin?«
»Ja«, antworte ich zögernd und kann den misstrauischen Unterton in meiner Stimme selbst hören. »Warum?«
Er zieht eine dunkle Augenbraue hoch, sämtliche Anzeichen von Besorgnis aus seiner Miene verschwunden. So schnell, dass ich mich frage, ob ich sie wirklich gesehen habe. »Nur so. Wollte nur nett sein.«
Eine unverfängliche Antwort. Absolut vernünftig.
Und dennoch …
Sie hat hier immer noch keine Freunde.
»Hast du … gehört, was Mr Lee vorhin gesagt hat?« Sobald mir die Worte über die Lippen gekommen sind, würde ich sie am liebsten wieder zurücknehmen. Sie vollkommen auslöschen. Es gibt gewisse Dinge, auf die man schlicht keine Aufmerksamkeit lenken sollte, selbst wenn sich alle des Problems definitiv bewusst sind. Dazu gehört zum Beispiel ein übler Ausbruch von Akne. Oder dass dein Klassenlehrer dich vor der versammelten Klasse als freundlos bezeichnet hat.
Denn auch die Tatsache, dass du keine neuen Freunde brauchst, macht das Ganze nicht weniger peinlich.
Caz denkt eine Sekunde lang über meine Frage nach. Lehnt sich gegen die nächstbeste Wand, wodurch sein Körper halb zu mir zeigt. »Ja«, gibt er zu. »Ja, hab ich.«
»Oh, wow.«
»Was?«
Ich lache verlegen. »Ich hatte irgendwie erwartet, du würdest deswegen lügen. Du weißt schon. Aus Rücksicht auf meine Gefühle oder so.«
Anstatt direkt etwas zu erwidern, neigt er den Kopf zur Seite und fragt in wachsamem Tonfall: »Hast du mein Telefonat gehört?«
»Nein«, antworte ich ohne nachzudenken und zucke dann zusammen. »Ich meine … na ja …«
»Sehr nett von dir, dass du Rücksicht auf meine Gefühle nimmst«, sagt er, aber in seiner Stimme schwingt ein Anflug von Ironie mit, bei dem ich am liebsten auf der Stelle im Boden versinken würde. Und dann kommt mir ein noch viel grauenvollerer Gedanke: Was, wenn er mich für einen Fan hält? Oder eine Stalkerin? Nur eine weitere überenthusiastische, rehäugige Mitschülerin, die ihm wie eine Jüngerin überallhin folgt und die nur hier draußen gewartet hat, um ihn endlich allein zu erwischen? Ich hab es schon ein Dutzend Mal selbst gesehen: Schülerinnen, die sich hinter Mülleimern oder Mauern verstecken und in dem Moment hervorspringen, in dem er um die Ecke biegt.
»Ich schwöre, ich wollte nicht lauschen«, sage ich panisch und hebe beide Hände. »Ich wusste ja noch nicht mal, dass du hier rauskommen würdest.«
Er zuckt mit den Schultern, seine Miene ungerührt. »Okay.«
»Ehrlich«, sage ich. »Ich schwöre hoch und heilig.«
Er schaut mich sehr lange an. »Ich hab doch gesagt, es ist okay.«
Aber er klingt auch nicht, als würde er mir hundertprozentig glauben. Meine Haut kribbelt, Verlegenheit und Verärgerung wärmen meine Wangen. Und dann beschließt mein Mund, alles nur noch schlimmer zu machen, indem er das Lächerlichste überhaupt sagt: »Ich bin … ich bin noch nicht mal ein Fan.«
Eine knappe Sekunde verstreicht und über seine Miene huscht flüchtig etwas, das ich unmöglich deuten kann. Überraschung, vielleicht. Ich kann spüren, wie sich meine Eingeweide auflösen.
»Gut zu wissen«, erwidert er schließlich.
»Ich meine, ich bin auch kein Anti-Fan oder so«, plappere ich weiter, mit diesem entsetzlichen, hilflosen Außerkörperliche-Erfahrung-Gefühl, als würde ich der Hauptfigur in einem Horrorfilm zusehen: wenn man sie anschreien will, stehen zu bleiben, sie aber immer weitergeht, direkt in ihr eigenes Verderben. »Ich bin einfach neutral. Sonst nichts. Ein … ein ganz normaler Mensch.«
»Eindeutig.«
Ich presse den Mund fest zusammen, meine Wangen brennend heiß. Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch mit Caz Song hier stehe, der ganz offensichtlich ein einzigartiges Talent dafür hat, mich noch verlegener zu machen als ohnehin schon. Ich kann nicht glauben, dass wir immer noch miteinander reden, dass Mr Lee immer noch mit Ma in diesem überfüllten Klassenzimmer ist und sie beide denken, ich wäre auf der Toilette.
Das hier ist der reinste Albtraum. Zeit, mir einen Fluchtplan zu überlegen, bevor ich mich noch mehr blamiere.
»Weißt du, was?« Ich recke den Hals, als hätte ich gerade jemanden nach mir rufen hören. »Ich bin mir ziemlich sicher, das war meine Mom.«
Diesmal zieht Caz beide Augenbrauen hoch. »Ich hab nichts gehört.«
»Ja, na ja, sie hat eine sehr leise Stimme«, brabble ich und gehe bereits an ihm vorbei. »Schwer auszumachen, wenn man nicht wirklich daran gewöhnt ist. Also, ähm, ich sollte wahrscheinlich gehen. Bis dann!«
Ich gebe ihm keine Gelegenheit, zu antworten. Stattdessen stürme ich zurück ins Klassenzimmer, entschlossen, mir Mom zu schnappen und Li Shushu anzuflehen, uns so schnell wie möglich abzuholen. Nach dieser ebenso qualvollen wie demütigenden Einlage kann ich mich auf keinen Fall jemals – niemals – wieder mit Caz Song unterhalten.
Kapitel 3
Am nächsten Morgen wache ich schon vor Sonnenaufgang auf, in meine Bettdecke verheddert, die Hitze schwer auf meiner Haut.
Mein Handy blinkt.
237 neue Benachrichtigungen.
Mit zusammengekniffenen Augen betrachte ich es eine Minute lang verständnislos, mein Hirn vom Schlaf noch ziemlich benebelt. Aber der Bildschirm leuchtet immer wieder auf, wirft einen blassblauen Schein auf den Nachttisch, und leise Panik schneidet sich durch meine Müdigkeit. Um diese Zeit schreibt mir sonst nie jemand. Und ganz sicher würde mir niemand – noch nicht mal Zoe – so viele Nachrichten nacheinander schicken.
239 neue Benachrichtigungen.
240 neue …
Ich strample meine Decke weg, jetzt hellwach, checke meine iMessages, während meine Verwirrung schnell von schlimmsten Befürchtungen verdrängt wird.
Dann lese ich Zoes Nachrichten:
Heilige Scheiße.
Heilige verfluchte Scheiße!!!!!!
Ok ich weIß ESISTMITTENINDERNACHT
ABER
BITTESCHNAPPDIRDEINHANDY
asdfghjkklkll
Süße hast du DASGESEHEN was zur HöLLE verdammt
Darunter hat sie einen Screenshot eingefügt: einen Artikel. Beinahe hab ich zu viel Angst, ihn zu öffnen, aber nachdem ich zwei Sekunden auf den Bildschirm gestarrt habe, hämmert mein Herz Löcher in meinen Brustkorb und ich gebe nach.
Eine riesige, fett gedruckte Schlagzeile springt mir von der Seite entgegen:
»Die nächste romantische Komödie: Der Blogpost dieser Schülerin über ihr Liebesleben lässt uns wieder an die Liebe glauben.«
Mein Pulsschlag beschleunigt sich.
Zuerst verstehe ich nicht, was ich sehe. Ich weiß nur, dass da ein Auszug aus meinem persönlichen Aufsatz steht – dem Aufsatz, den ich mindestens dreimal Korrektur gelesen und erst gestern gepostet habe –, und mein Name, und … über allem das BuzzFeed-Logo. Dasselbe BuzzFeed, durch das Zoe und ich immer stundenlang gescrollt und auf dem wir irgendwelche albernen Tests gemacht haben, um herauszufinden, welcher Partysnack wir sind oder so. Es ergibt alles keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, wie oder warum BuzzFeed meinen Aufsatz überhaupt hat.
Es ist, als würde man bei jemand anders zu Hause ein Foto von sich selbst entdecken, diese beunruhigende Mischung aus »Hey, das kommt mir bekannt vor« und »Was zur Hölle macht das hier?«. Es fühlt sich an, als würde ich träumen.
Aber, o Gott – da ist noch mehr. So viel mehr.
Anscheinend hat sich mein Aufsatz schon gestern Abend verbreitet, aber als irgendwer Halbberühmtes dann einen Screenshot und einen Link zu meinem Post im Schul-Blog getwittert hat, ist das Ganze so richtig explodiert. Ich sichere hastig meine VPN, gehe rüber zu Twitter, und mein Herz springt fast aus meiner Brust.
Gestern Nacht hatte ich insgesamt fünf Follower auf meinem selig schlummernden Twitteraccount – und ich bin mir ziemlich sicher, zwei von ihnen waren Bots.
Jetzt habe ich bereits mehr als zehntausend Follower.
»Heilige verfluchte Scheiße, in der Tat«, murmle ich, und der Klang meiner eigenen Stimme, leise und ein wenig kratzig nach der nächtlichen Nichtbenutzung, macht das Ganze nur umso surrealer. Das ergibt alles keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, dass ich hier auf meinem Bett sitze, die kahlen Wände meines Zimmers vom Licht meines Smartphones erhellt, und dass dieser Tweet, in dem mich ein paar Leute freundlicherweise getaggt haben, eine halbe Million Likes gesammelt hat, Tendenz steigend.
Meine Hände zittern, als ich durch ein paar der jüngsten Kommentare scrolle.
alltoowell13: Vielleicht haben Typen doch Rechte verdient???
@jiminswife: Ich muss echt heulen omg das ist SO. SÜSS. (bitte, noch mehr so wunderbaren Content, meine Seele braucht das) ((falls sie je Schluss machen, höre ich auf, an die Liebe zu glauben, das schwör ich))
@angelica_ b_ smith: Lmao wieso können Teenies heutzutage Aufsätze in Shakespeare-Niveau über die Liebe ihres Lebens schreiben … in dem Alter konnte ich noch nicht mal einen geraden Satz zu Papier bringen
@drunklanwangji: Ich will ja nicht dramatisch klingen, aber ich würde echt dafür sterben, dass die beiden einfach für immer zusammen bleiben, Händchen halten und glücklich sind.
@user387: Kann bITTE jemand einen Film daraus machen – ich FLEHE euch an –
@echoooli: Bin ich als Einzige verflucht neugierig, wer der Freund ist? (und wo finde ich auch so einen??)
Ich lasse das Handy sinken, bevor ich noch mehr lesen kann, während eine beunruhigende Mischung aus Panik und Euphorie durch meine Adern rauscht.
Okay.
Das ist lächerlich.
Ich hab das Gefühl, mein Hirn hätte eine Funktionsstörung. Als wäre es überhitzt. Menschen in aller Welt lesen meinen Aufsatz und stellen sich vor, wie ich mit irgendeinem Typen auf seiner Couch kuschle, ihn auf einem Balkon küsse, während wir Dinge flüstern wie Ich vermisse dich, selbst wenn du mir ganz nahe bist und Du bist so wunderschön, dass ich in deiner Nähe manchmal gar nicht klar denken kann.
All diese Menschen haben meinen Aufsatz gelesen … und er hat ihnen tatsächlich gefallen. Meine Worte, meine Geschichte, meine Gedanken. Sie haben ein Stück von sich selbst darin erkannt. Trotz aller Verlegenheit kann ich nicht verhindern, dass sich ein Lächeln auf meinem Gesicht ausbreitet. Fühlt es sich so an, berühmt zu sein? Und ich kann auch nicht anders, als mich trotz aller Ungläubigkeit zu fragen: Fühlen sich Leute wie Caz Song andauernd so?
Aber nein – ich muss mich am Riemen reißen. All das, so aufregend es auch ist, ist nicht der Punkt. Denn mit etwas viral zu gehen, das ich geschrieben habe, ist eine Sache – und zwar eine gute, der Stoff, aus dem moderne Märchen sind. Aber viral zu gehen mit einer »heilsamen Liebesgeschichte aus dem wahren Leben« (@therealcarrielos Worte, nicht meine), die in Wahrheit frei erfunden ist, ist eine völlig andere.
Ich kann mir nur allzu lebhaft vorstellen, wie der nächste BuzzFeed-Artikel aussehen würde, wenn die Wahrheit ans Licht käme: »Das nächste kriminelle Genie: Der virale persönliche Aufsatz über ihre wahre Liebe dieser Schülerin erweist sich als gewaltige Lüge.«
In der nächsten Stunde oder so, während auch der Rest der Wohnung langsam erwacht, die Wasserhähne im Bad knarren und Ma in die Küche schlurft, um die Sojamilchmaschine anzuschalten, ist es alles, woran ich denken kann. Die BuzzFeed-Schlagzeile. Die Kommentare. Wie sehr die Leute bereits in die Geschichte involviert zu sein scheinen, wie viele mir wegen neuer »Updates« gefolgt sind, die ich nicht habe …
Die Schuldgefühle kriechen inzwischen tief in meine Brust und ich würde am liebsten schreien.
Doch wie durch ein Wunder – oder vielleicht auch dank jahrelanger Übung – gelingt es mir beim Frühstück, so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Es kommt mir einfach nicht richtig vor, mit so was rauszuplatzen, wie: Oh, übrigens, es könnte sein, dass ich meinen persönlichen Aufsatz in eine Übung in kreativem Schreiben verwandelt habe und er irgendwie viral gegangen ist und jetzt über eine Million Leute glauben, ich wäre in Peking der Liebe meines Lebens begegnet, und das noch vor acht Uhr morgens. Also trinke ich meine hausgemachte Sojamilch, esse mein Tee-Ei und versuche, nicht über die Tatsache nachzudenken, dass sich mein Leben womöglich im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht unwiderruflich verändert hat.
»… bringt mich um«, sagt Ma, während sie ihr Ei gegen eine Schüssel haut und die Schale mit einem befriedigenden Krachen knackt. »Es ist eine einzige Katastrophe.«
Ich muss noch nicht mal richtig zuhören, um genau zu wissen, von wem sie spricht: Kevin aus der Marketingabteilung. Irgendein frisch gebackener Harvard-Absolvent mit dem IQ eines Genies und, laut Ma, null gesundem Menschenverstand.
»Tut mir leid – was ist eine einzige Katastrophe?«, frage ich, in der Hoffnung, sie führt es näher aus. Ein paar Katastrophenmanagement-Tipps könnte ich im Moment definitiv gut gebrauchen.
»Mein Leben«, antwortet Emily vom anderen Ende des Esstischs. Sie hat ihre Schuluniform verkehrt herum an und ihr schulterlanges rabenschwarzes Haar zu etwas zusammengefasst, von dem ich vermute, es sollte ein Pferdeschwanz sein, das aber eher wie ein Vogelnest aussieht. Ganz offensichtlich hatte Ba heute die Aufgabe, Emily dabei zu helfen, sich fertig zu machen.
Ma rollt mit den Augen. »Spar dir diese Einstellung für Mitte vierzig auf«, tadelt sie Emily, bevor sie sich wieder zu mir umdreht. »Und seit wann interessierst du dich so für meine Arbeit?«
»Schon immer«, versichere ich unschuldig.
»Ich dachte, du findest meinen Job verwirrend«, erwidert Ma und reicht mir einen Teller mit fluffigen runden Mantous, frisch aus dem Dampfgarer und noch warm.
»Ja, na ja, aber das liegt nur daran, dass deine Firma darauf besteht, sich als ›kreativer Erschaffer und Anführer‹ zu beschreiben, der ›die Kultur beeinflussen und inspirieren‹ und dabei ›bahnbrechende Initiativen für Marketingprojekte‹ liefern will oder was auch immer.« Ich zerpflücke ein halbes Mantou in mundgerechte Stücke und der Teig wird weicher zwischen meinen Fingern. »Ich meine, das sind nichts weiter als Worte. Aber ich verstehe, was du tust. Mehr oder weniger.«
Ma sieht nicht allzu überzeugt aus, seufzt jedoch und erklärt: »Kevin hat diesen riesigen Investor davon überzeugt, bei uns zu unterschreiben.«
»Und das ist ein Problem, weil …?«
»Sie haben nur unterschrieben, weil er behauptet hat, wir hätten ein ganz ausgezeichnetes Verhältnis zu diesem beliebten neuen Technologie-Start-up, SYS.« Sie nimmt sich auch ein Mantou, isst es jedoch nicht. Sieht nur zu, wie es neben dem Ei kalt wird. »Nur, dass wir nie auch nur mit jemandem bei SYSgesprochen haben. Wir haben überhaupt keine Verbindung zu ihnen.«
»Ah.« Ich nicke langsam und schlucke eine kleine Blase der Hysterie hinunter angesichts der offensichtlichen Parallelen zwischen Kevins Krise und meiner. »Ich verstehe, dass das eine Herausforderung sein könnte.« Dann, in der Hoffnung, nicht übereifrig zu wirken, trinke ich einen Schluck von meiner Sojamilch und frage ganz beiläufig: »Also, ähm, wie sieht der Plan aus? Wollt ihr alles gestehen oder …«
»Gott, nein. Natürlich nicht.« Ma lacht tatsächlich, als wäre allein die Vorstellung völlig absurd. »Nein, wir versuchen schon seit Jahren, diesen Investor ins Boot zu holen. Wir werden einfach nur rückwärts arbeiten müssen: einen Dialog mit SYS beginnen, eine Verbindung zu ihnen aufbauen und so tun, als stünden wir uns schon ewig total nahe. Wir müssen mit jemandem aus ihrem Marketingteam Kontakt aufnehmen oder mit diesem Typen von der Cartier-Kampagne …« Sie hat wieder diesen abwesenden, beinahe begierigen Glanz in den Augen, wie so oft, wenn sie über einem Jobproblem grübelt. Dann fällt ihr wieder ein, mit wem sie spricht. »Aber Lügen ist nicht gut«, fügt sie hastig hinzu und bedenkt Emily und mich mit einem strengen Blick.
»Ist notiert«, erwidere ich und schlucke den Rest meiner Milch mit einiger Mühe hinunter. Der Sojabohnenbrei kratzt in meinem Hals wie Sand.
Als alle aufgegessen haben, helfe ich Ma, den Tisch abzuräumen, und wir gehen gemeinsam zum Wagen des Fahrers hinunter, während mein Smartphone förmlich ein Loch in meine Blazertasche brennt. Ich hab seit heute früh nicht mehr wirklich darauf geschaut, aber die Benachrichtigungen trudeln weiter munter ein. Als wir an der Schule abgesetzt werden, warten 472 ungelesene Nachrichten auf mich und Gott weiß wie viele Twitter-Erwähnungen.
Und dann wird alles noch deutlich seltsamer.
Ich bin die Erste im Matheunterricht, wie üblich.
Nicht, weil ich von Natur aus besonders pünktlich wäre oder weil ich mich in irgendeiner Weise für quadratische Gleichungen begeistern könnte, sondern weil es keinen besseren Ort gibt. In den freien Minuten vor und zwischen den Kursen hängen alle gern an den Spinden ab, blockieren die Flure und plaudern und lachen so laut zusammen, dass die Wände zu beben scheinen.
Ich hab auch mal versucht, dort abzuhängen, an meinem dritten Tag hier, aber ich kam mir dabei nur total lächerlich vor. Lächerlich und irgendwie traurig, weil ich niemanden hatte, auf den ich warten konnte. Am Ende stand ich einfach mitten im Korridor, meine Tasche fest mit den Händen umklammert, und hab gebetet, die Schulklingel möge sich beeilen und endlich läuten.
Danach kam ich zu dem Schluss, ich könnte auch ebenso gut im Klassenzimmer warten, meine Bücher und Stifte auf dem Tisch, als würde ich tatsächlich lernen.
Ich gebe vor, mir meinen Aufschrieb zur Differenzialrechnung von neulich noch mal anzuschauen, als ich höre, wie sich Schritte nähern. Und stehen bleiben, direkt vor meinem Tisch.
»Hey, Eliza.«
Ich reiße überrascht den Kopf hoch.
Diese beiden Mädchen, mit denen ich in meinem Leben noch kein einziges Wort gesprochen habe, lächeln – nein, strahlen – mich förmlich an, als wären wir die besten Freundinnen. Ich weiß noch nicht mal, wie sie heißen.
»Hi?«, erwidere ich. Es klingt wie eine Frage.
Sie verstehen es als Einladung, sich auf die beiden freien Plätze neben mir zu setzen, noch immer so strahlend lächelnd, dass ich all ihre perlweißen Zähne sehen kann. Eine der beiden knufft die andere in die Seite, sie wechseln einen schnellen, bedeutungsschweren Blick, und ich fange allmählich an, zu ahnen, warum sie hier sind.
»Wir haben deinen Aufsatz gelesen«, platzt die Größere, Braungebranntere links von mir heraus und bestätigt meine Vermutung.
»Oh«, sage ich, nicht sicher, wie ich darauf reagieren soll. »Ähm, gut. Das freut mich.«
»Ich wollte nur – Gott, ich fand ihn so großartig«, fährt sie freudig fort, auf eine Art, als würde sie zu einer großen emotionalen Rede ansetzen. »Ich war echt die ganze Nacht auf und hab ihn immer wieder gelesen und …«
»Er war so süß«, stimmt die andere ein und legt eine zitternde Hand auf ihr Herz.
Okay. Das hatte ich definitiv nicht erwartet. Ebenso wenig wie das leise, unfreiwillige Lächeln, das an meinen Lippen zieht.
Aber schon im nächsten Moment gestikulieren sie beide wie wild und reden durcheinander, ihre Stimmen vor Aufregung immer lauter:
»Meine Lieblingsstelle war im Supermarkt, o mein Gott …«
»Ich hatte ja keine Ahnung, dass du mit jemandem zusammen bist! Du hast nie was gesagt …«
»Hast du ein Foto von ihm? Ich meine, du musst es uns nicht zeigen, wenn du nicht willst, aber …«
»Wie heißt er? Geht er auch auf unsere Schule?«
»Ist er in unserem Jahrgang?«
»Ist er in unserer Klasse?«
Sie drehen sich beide mit weit aufgerissenen Augen zur Klassenzimmertür um, durch die der Rest aus unserem Kurs hereinkommt, so als könnte einer der Jungs jeden Moment vortreten und sich selbst als meinen heimlichen Freund enttarnen. Natürlich passiert nichts dergleichen, aber die Hereinkommenden werden langsamer und starren mich an, als hätten sie mich vorher noch nie wirklich gesehen. Als hofften auch sie, ich würde irgendetwas aus meinem erfundenen Liebesleben mit ihnen teilen.
Der Einzige, der direkt auf seinen Platz ganz hinten zusteuert, ist Caz Song. Die Hände in den Hosentaschen, ein AirPod im Ohr, einen Ausdruck unendlicher Langeweile auf dem Gesicht. Genau wie gestern. Er schaut in meine Richtung, flüchtig, ungerührt, und wendet sich dann wieder ab.
Und obwohl das wirklich die geringste meiner Sorgen ist, zieht sich mein Brustkorb förmlich zusammen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, worauf ich gehofft hatte oder warum ich mir eingebildet habe, er würde nach dieser ersten und einzigen Anomalie einer Unterhaltung im Korridor gestern meine Existenz anerkennen. Caz Song und ich sind so verschieden, dass wir genauso gut auf getrennten Planeten leben könnten.
»Also?«, bohrt die Linke nach und zieht meine Aufmerksamkeit wieder auf sich und ihre Freundin. »Ist er?«

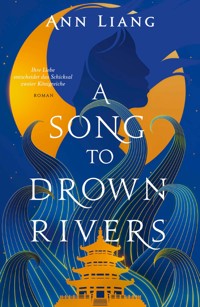














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












