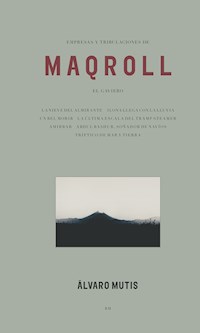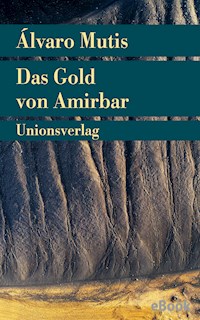8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Als das Schiff des Gaviero Maqroll wegen finanzieller Schwierigkeiten beschlagnahmt wird, strandet er beinahe mittellos in Panama. Notdürftig kommt er über die Runden, zieht von einer miserablen Unterkunft zur nächsten – bis er die abenteuerlustige Ilona trifft. Schon bald wird sie zur Freundin und Geliebten, und kommt schließlich auf die rettende Idee: Gemeinsam eröffnen sie ein Bordell in der Bucht von Panama, die Villa Rosa. Es beginnt eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die durch die Ankunft der geheimnisvollen Larissa eine unwiderrufliche Wende erfährt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Ähnliche
Über dieses Buch
Mittellos strandet der Gaviero Maqroll in Panama. Notdürftig kommt er über die Runden, bis er die abenteuerlustige Ilona trifft. Sie hat die rettende Idee: Gemeinsam eröffnen sie ein Bordell, die Villa Rosa. Es beginnt eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die durch die Ankunft der geheimnisvollen Larissa eine unwiderrufliche Wende erfährt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Álvaro Mutis (1923–2013) verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Brüssel, kehrte jedoch jedes Jahr nach Kolumbien zurück. Das Land ist die Inspirationsquelle seines Schreibens. Seit 1956 lebte der Autor in Mexiko. 2001 wurde er mit dem Premio Cervantes geehrt, 2002 mit dem Neustadt-Literaturpreis.
Zur Webseite von Álvaro Mutis.
Katharina Posada wuchs in Bogotá, Kolumbien, auf. Sie studierte Germanistik, Romanistik und Philosophie und lebt in Heidelberg.
Zur Webseite von Katharina Posada.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Álvaro Mutis
Ilona kommt mit dem Regen
Roman
Aus dem Spanischen von Katharina Posada
Die Abenteuer und Irrfahrten des Gaviero Maqroll
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1988 bei Mondadori, Spanien.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1990 im Elster-Verlag, Bühl-Moos.
Ein Band im Zyklus der Maqroll-Romane: Der Schnee des Admirals, Ilona kommt mit dem Regen, Ein schönes Sterben, Die letzte Fahrt des Tramp Steamer, Das Gold von Amirbar, Abdul Bashur und die Schiffe seiner Träume, Triptychon von Wasser und Land.
Originaltitel: Ilona llega con la lluvia
© by Álvaro Mutis 1988 und seinen Erben
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Cyrus Pellet (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31065-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.06.2024, 20:18h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ILONA KOMMT MIT DEM REGEN
An den LeserCristóbalPanamaIlona›Villa Rosa‹ und ihre BewohnerLarissaDas Ende der LepantoAnmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Álvaro Mutis
Mutis über Mutis
Georg Sütterlin: Unheldische Helden
Über Katharina Posada
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Álvaro Mutis
Zum Thema Panama
Zum Thema Lateinamerika
Zum Thema Liebe
Qedeshim qedeshoth1, stolzes Weib,
verrückte Theologin, Bronzestatue, bronzener Schrei,
nicht einmal Augustinus von Hippo,
der auch unstet und Sünder war in Afrika,
hätte auch nur für eine Nacht
den Körper der leuchtenden Phönizierin zu rauben gewagt.
Ich beichte meine Sünden vor Gott.
Qedeshim qedeshoth
Gonzalo Rojas
Son amour désintéressé du monde m’enrichit
et m’insuffla une force invincible pour les jours difficiles.
Maxim Gorki, »L’enfance«
An den Leser
Wollte Maqroll der Gaviero seinen Freunden Geschichten aus seinem Leben erzählen, so zog er jene Episoden vor, die mit einer gewissen Dramatik, einer gewissen Spannung versehen waren, die bisweilen lyrische Züge annahmen, sofern sie nicht in ein Geheimnis mit der dazugehörigen metaphysischen und damit unbeantwortbaren Frage mündeten. Wir allerdings kennen ihn schon seit vielen Jahren näher und wissen deshalb, dass es gewisse Abschnitte in seinem bewegten Leben gab, die zwar nie ganz jener Merkmale entbehrten, die dem Erzähler so sehr am Herzen lagen, die aber eher einen verborgenen Aspekt seiner Persönlichkeit betrafen, wobei oft die Grenzen dessen gestreift wurden, was das Strafgesetz zum Wohle der Gesellschaft festlegt, sofern sie nicht sogar rücksichtslos und unverhohlen überschritten wurden. Die Moral war für den Gaviero eine äußerst formbare Materie, die er den jeweiligen Umständen anzupassen pflegte. Er verschwendete keinen Gedanken an das, was ihm die Zukunft als Folge seiner Verfehlungen, die er problemlos vergaß, bescheren würde, und auch all diejenigen, die er in der Vergangenheit begangen haben mochte, plagten nicht im Geringsten sein Gewissen. Zukunft und Vergangenheit waren übrigens keine Begriffe, die unseren Gaviero sonderlich hätten belasten können. Stattdessen vermittelte er stets den Eindruck, sein ausschließliches Ziel, das ihn ganz erfüllte, bestehe darin, die Gegenwart mit all dem zu bereichern, was ihm über den Weg lief. Es war offenkundig, und diese Einschätzung haben andere geteilt, die ihn mindestens so gut wie wir kennen, dass Verordnungen, Prinzipien, Anweisungen und Vorschriften, deren Gesamtheit man als ›das Gesetz‹ zu begreifen pflegt, für Maqroll keine weitere Bedeutung besaßen und ihn in keinem Moment seines Lebens beschäftigten. Ihre Anwendung lag außerhalb des Bereiches, den er sich für seine Angelegenheiten vorbehalten hatte, und es gab keinen Anlass, sich durch sie von seinen persönlichen, etwas eigenwilligen Vorhaben abbringen zu lassen.
Auf den hohen Wogen seiner weinseligen und von Erinnerungen erfüllten Stunden hörte ich meinen Freund gewisse Vorfälle seines Lebens erzählen, die nicht zu denen gehörten, die er immer wieder dann erzählte, wenn ihn die Sehnsucht oder, wie ich es eher nennen würde, der Durst nach dem Unbekannten überkam. Einige dieser Vorfälle werden hier mit der Stimme des Protagonisten selbst erzählt. Sie schienen mir recht geeignet, um jene andere Seite dieser Person kennen zu lernen, und ich bemühte mich, so lange immer wieder mit ihm auf diese Episoden zurückzukommen, bis ich sie mir samt dem Tonfall seiner Stimme und den für den Gaviero so typischen Abschweifungen eingeprägt hatte.
Es muss wohl nicht ausdrücklich gesagt werden, dass Maqroll meines Erachtens diese Episoden nicht für sich behielt, weil er selbst sie wegen ihrer offenkundigen Frevelhaftigkeit für peinlich oder unsagbar gehalten hätte. Ich glaube, er wollte vielmehr vermeiden, andere Beteiligte in Dinge zu verwickeln, die sie aus Gründen der Scham oder der Angst vergessen oder verheimlichen wollten, die zwar nicht für den Gaviero, aber vielleicht für sie Gültigkeit besaßen. Kurzum, ich merke, dass ich mich schon zu lange mit diesen unnötigen Erklärungen aufgehalten habe, doch der einmal gedruckte Buchstabe hat so endgültig zeugnishaften und kompromittierenden Charakter, dass es nicht leichtfällt, ihn so ohne weiteres der Aufmerksamkeit der möglichen Leser dieser Seiten zu überlassen. Das war alles, was ich sagen wollte, und nun lassen wir unseren Freund zu Wort kommen.
Cristóbal
Als ich das graue Boot der Hafenzollbehörde mit der stolz im Winde flatternden Fahne Panamas näherkommen sah, wusste ich auf einmal, dass unsere bewegte Schiffsreise hier zu Ende ging. Ehrlich gesagt, hatten wir in den letzten Wochen jedes Mal, wenn wir in einem Hafen anlegten, einen Besuch wie diesen hier erwartet. Allein die Laxheit, mit der in der Karibik solche bürokratischen Angelegenheiten gehandhabt werden, hatte uns bisher davor bewahrt. Das Schiff bahnte sich den Weg durch eine graue Sumpflache, auf der undefinierbare Müllreste und tote Vögel schwammen, die allmählich schon zerfielen. Der Schiffskeil durchfurchte die ölige Oberfläche des Wassers, wobei eine langsame Welle aufkam, die in kurzer Entfernung träge wieder versank. Wir waren weit weg von den immer wechselnden Launen des Meeres. Drei Beamte in kakifarbener Bekleidung, mit großen Schweißflecken unter den Achselhöhlen und auf dem Rücken, stiegen mit feierlicher Langsamkeit das Fallreep hinauf. Der, der wie ihr Chef aussah, einer von diesen Schwarzen, die man dort Jamaikaner nennt, weil sie von denen abstammen, die die Yankees von der Insel importierten, um sie als Arbeitskräfte für den Bau des Panamakanals einzusetzen, fragte uns in einem Spanisch, das von Anglizismen wimmelte, wo der Kapitän sei. Ich führte sie zur zweiten Kommandobrücke und klopfte mehrmals an die Tür des Kapitäns. Endlich antwortete eine klanglose und müde Stimme: »Sie sollen hereinkommen.« Ich ließ sie eintreten und kehrte, nachdem ich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, an das Fallreep zurück, wo ich mich mit dem Bootsmann unterhalten hatte. Der Motor des Bootes ratterte mit plötzlichen Rhythmusschwankungen, während eine unerbittliche Hitze vom wolkenlosen Himmel herunterstrahlte und den Geruch der fauligen Pflanzen und der sumpfigen Mangrovenwälder verstärkte, die in der Sonne trockneten und auf die nächste Flut warteten.
»Hier endet es also. Jetzt wird jeder seiner Wege gehen, und mal abwarten, was passiert«, meinte der Bootsmann und schaute indessen in Richtung der Mole von Cristóbal, als erwarte er von dort eine beruhigende Antwort. Cornelius war ein Holländer von untersetzter Gestalt, der pausenlos an einer Pfeife zog, die mit der übelsten Sorte Tabak gefüllt war. Er sprach ein tadelloses Spanisch, das er mit den verschiedensten exotischen Flüchen bereicherte. Er schien sich vorgenommen zu haben, diese im Laufe seiner Fahrten von Insel zu Insel zu sammeln, denn sie bildeten einen regelrechten Musterkatalog karibischer Fäkalsprache. Zu Beginn unserer Reise schien er mir ein gewisses Misstrauen entgegenzubringen, das in jener Reizbarkeit wurzelt, die Seefahrer befällt, wenn sie in eine führende Position gelangen. Sie hegen Argwohn gegen jeden Fremden, der in das von ihnen beherrschte Revier eindringen könnte. Es gelang mir sehr bald, diese ersten Bedenken zu zerstreuen, und wir knüpften am Ende eine zwar distanzierte, aber durchaus herzliche und feste Beziehung, die wir dank der Erinnerungen an Anekdoten und gemeinsame Erfahrungen aufrechterhielten, die entweder mit einem lauten Gelächter endeten oder sich in träumerische und resignierte Sehnsucht auflösten.
»Wito hat keine Chance, der Beschlagnahmung des Schiffes zu entgehen. Es ist, als habe er das schon seit Langem gewollt. Wenn er das Schiff aufgibt und damit auch seine bisherige Lebensweise, wird sich für ihn alles wie von selbst regeln. Als würde er nur Gewohnheiten ablegen, in denen er schon lange keinen Sinn mehr sieht. Seit geraumer Zeit langweilt ihn das alles hoffnungslos. Zumindest schließe ich das aus seinem Verhalten während dieser Fahrt. Was denken Sie, Cornelius? Sie kennen ihn doch besser. Seit wann arbeiten Sie zusammen?« Ich gab mir Mühe, das Gespräch, an dem ich kein großes Interesse hatte, in Gang zu halten, während sich dort oben die düstere juristische Zeremonie vollzog, die uns schon seit so vielen Wochen drohte.
»Elf Jahre arbeiten wir schon zusammen«, antwortete der Bootsmann. »Was dem armen Wito das Leben verpfuschte, war die Flucht seiner einzigen Tochter mit einem protestantischen Pfarrer aus Barbados, der verheiratet war und sechs Kinder hatte. Er verließ Gemeinde, Kirche und Familie und nahm das Mädchen mit nach Alaska. Die Arme, sie ist nicht nur hässlich, sondern auch halb taub. Daraufhin stürzte sich Wito in seine haarsträubenden Unternehmungen. Er ließ sich auf Hypotheken ein, die das Schiff und, wie ich glaube, auch ein Haus in Willemstad belasten. Sie wissen ja, wie das ist. Ein Loch aufreißen, um das andere zu stopfen. Es ist gar nicht abwegig zu behaupten, dass diese Scheißkerle gerade im richtigen Augenblick kommen, um ihm die Angelegenheit in Ordnung zu bringen.« Er zuckte mit den Schultern, und während er gierig an seiner Pfeife zog, schaute er in Richtung Kajüte, wo ein Gespräch seinen Lauf nahm, dessen Ergebnis nur allzu genau vorauszusehen war. Kurz darauf kamen die Uniformierten heraus. Sie steckten einige Papiere in ihre Aktentaschen, legten zum Gruß die Hand nachlässig an den Schirm ihrer Mützen, stiegen das Fallreep hinab und betraten das Boot. Es nahm Kurs auf Cristóbal und durchfurchte leicht das Wasser der Bucht.
Der Kapitän erschien in der Tür der Kajüte und rief mir zu: »Maqroll, könnten Sie einen Augenblick heraufkommen?« Diesmal klang seine Stimme fest und ruhig. Wir gingen hinein, und er bat mich, vor dem Tisch Platz zu nehmen, der ihm als Schreibtisch diente. Es war derselbe, den wir auch zum Essen benutzten. Er schien sich einer schweren Last entledigt zu haben. Wito war von durchschnittlicher Statur, schlank, besaß feine, fuchsartige Gesichtszüge, und seine Augen wurden von den dichten, leicht ergrauten und zottigen Augenbrauen fast verdeckt. Das Erste, was einem an ihm auffiel, war, dass er keinerlei Merkmale eines Seemanns besaß. Keine seiner Gesten erinnerte an einen Matrosen. Es fiel leichter, sich ihn als Schuldiener in einem Internat vorzustellen oder als Professor für Naturwissenschaften. Er sprach langsam, korrekt und fast ein wenig feierlich; er betonte jedes Wort und machte am Ende jedes Satzes eine kurze Pause, als warte er darauf, dass jemand das notiere, was er sagte. Dennoch konnte man hinter diesem Dozentengehabe ohne weiteres ein leichtes Durcheinander von Gefühlen erkennen, das ängstliche Bemühen, eine Art geheime und schmerzende Wunde zu verbergen. Das veranlasste uns, die wir ihn schon länger kannten, zu einem milden, nachsichtigen Umgang mit ihm, der im Übrigen nie eine tiefere und dauerhaftere Beziehung zur Folge hatte. Irgendwo in seinem Wesen lag das Stigma der Verlierer, das sie am Ende unweigerlich von ihren Mitmenschen isoliert.
»Nun gut, Maqroll«, begann er langsamer denn je zu sprechen. »Es handelt sich, wie Sie sicher schon vermuten, um das Schiff. Eine Reihe von Banken mit Filialen in Panama haben es beschlagnahmt.« Er schien sich im Voraus entschuldigen zu wollen. Damit versetzte er mich in die peinliche Lage dessen, der eine Vertraulichkeit anhören soll, von der er lieber nichts wüsste. Ein kleiner Ventilator, der an der gegenüberliegenden Wand hing, summte, er drehte sich langsam, ohne jedoch die drückende Luft zu erfrischen, in der noch der Geruch von den verschwitzten Kleidern und Zigarettenkippen der vorigen Nacht hing. »Nun ist geschehen«, fuhr er fort, »was ich schon seit Monaten befürchtete. Ich habe das Schiff und ein Haus, das ich in Willemstad besaß, verloren. Eine vom Gerichtsvollzieher eigens angeheuerte Mannschaft wird das Schiff nach Panama bringen. Sie und der Bootsmann können mit ihnen zusammen den Kanal durchfahren, wenn Sie möchten, und in Panama von Bord gehen. Dort wird man Sie gemäß der Vereinbarungen des Arbeitsvertrages auszahlen, den Sie mit mir geschlossen haben. Wenn Sie aber lieber hierbleiben möchten, können Sie auch hier schon entlohnt werden. Sie müssen es denen nur mitteilen. Wie Sie wollen.«
»Und Sie, Kapitän, was werden Sie tun?«, fragte ich ihn besorgt angesichts der Tatsache, dass er alles so gelassen und kühl hinnahm.
»Machen Sie sich keine Sorgen um mich, Maqroll. Sie sind sehr freundlich. Ich habe schon alles vorbereitet, um …« Und hier zögerte er kurz, aber deutlich verschämt, »um weiterzukommen. Eines der erfreulichsten Dinge in meinem Leben war, mit Ihrer Freundschaft rechnen zu dürfen. Ich habe Ihnen viele Lehren zu verdanken, von denen Sie wahrscheinlich noch nicht einmal etwas ahnen. Mit Ihnen hielt ich mich mehr oder minder aufrecht, blieb aber doch immer empfänglich für ›die Geschenke, mit denen uns das Leben überrascht‹, wie Sie es nennen. Man könnte noch viel darüber sagen, aber ich glaube, es ist nicht der Augenblick für Vertraulichkeiten. Außerdem nehme ich an, dass Sie da besser Bescheid wissen als ich.« Er erhob sich fast ruckartig, reichte mir die Hand und drückte sie, wobei er die ganze Herzlichkeit hineinzulegen versuchte, die er in seinen Worten vermied. Als ich hinausging, bat er mich noch, Cornelius heraufzuschicken, er wolle mit ihm sprechen.
Mit dem Bootsmann nahm sich Wito noch weniger Zeit als mit mir. Als der Holländer zurückkam, war ich in den Anblick des Hafens versunken, während in mir eine stumme Beklemmung wuchs, je länger die Stille dieses toten und sumpfigen Gewässers andauerte; eine Stille, die der Hitze des Nachmittags zu entspringen schien und in dem Maße zunahm, wie diese sich am Himmel ausbreitete und zarte, trügerische Dunstwolken bildete. Cornelius lehnte mit dem Rücken zum Meer an der Reling aus glänzendem Kupfer. Er äußerte sich mit keinem Wort über sein Gespräch mit dem Kapitän. Er wusste, dass es sinnlos war, da es sich kaum von dem unterscheiden konnte, das ich mit Wito geführt hatte. Er zog beinahe zwanghaft an seiner Pfeife, als wolle er damit einen fixen und schädlichen Gedanken verdrängen.
Der Schuss klang wie das trockene Bersten eines Holzstückes. Das Möwenpaar, das auf der Antenne döste, flog auf und davon. Ein Gewirr von Flügelschlägen und Gekrächze verlor sich mit ihnen am Himmel, der sich sekundenlang verdunkelte.
Wir rannten hinauf. Als wir in die Kajüte eintraten, schlug uns ein intensiver Pulvergeruch entgegen, der im Hals kratzte. Der Kapitän, der auf seinem Stuhl saß, kippte allmählich vornüber. Er hatte den gläsernen und verlorenen Blick der Sterbenden. Blut rann seine Stirn hinab und vermischte sich mit dem, das aus seiner Nase floss. Sein Mund war zu einem schmerzlichen Lächeln verzogen, das sich von seiner sonstigen Mimik völlig unterschied. Wir spürten ein eigentümliches Unbehagen, als würden wir gewaltsam in den Intimbereich eines Menschen eindringen, der uns immer fern und unbekannt gewesen war. Der Leichnam fiel schließlich mit einem dumpfen Geräusch gänzlich zu Boden, während das Summen des Ventilators sich inmitten der Stille wieder bemerkbar machte, die der Tod verbreitet, um sich unter den Lebenden zu erkennen zu geben.
Über Funk verständigten wir die Hafenbehörde, die kurz darauf eintraf. Sie kamen in demselben Boot angefahren, mit dem sie uns zuvor aufgesucht hatten. Diesmal waren es drei weiß gekleidete Polizisten und ein Arzt, der seinen ebenfalls weißen Kittel ungeschickt zurechtzog, um sich ein einigermaßen professionelles Aussehen zu geben, das allerdings nicht im Geringsten zu der äußeren Erscheinung dieses lebenslustigen, Cumbia-tanzfreudigen und krausköpfigen Mulatten passte. Die Formalitäten dauerten nicht lange. Die Polizisten trugen die Leiche in einem grauen Plastiküberzug hinunter. Dann ließen sie sie wie einen Postsack auf den Boden des Bootes fallen. Als sie sich entfernten, war es Nacht geworden. Die Lichter der grellen Neonreklamen im Hafen gingen an. Die Musik der Nachtklubs leitete die dröhnende und traurige Fiesta der karibischen Tropen ein.
Wir hatten uns in New Orleans getroffen, nachdem wir lange nichts mehr voneinander gehört hatten. Dort betrat ich einen Laden in der Decatur Street, vor dem ein angeberisches und hochstaplerisches Schild mit der Aufschrift ›Gourmet Boutique‹ prangte. Eine Sammlung nutzloser und unsinniger Artikel, die für die Kneipe oder die Küche taugen sollten, war dort ausgestellt, außerdem noch eine große Auswahl an Nahrungsmitteln und Gewürzen unterschiedlichster Herkunft und Marken, deren Verpackung irgendwelchen Exklusivprodukten in den Geschäften in London, Paris oder New York verdächtig glich. Ich wollte dort etwas gezuckerten Ingwer kaufen. Das ist eine meiner geheimen Leidenschaften, der ich mich selbst in Zeiten bitterster Armut hingebe. Der auf dem Glas angegebene Preis war so hoch, dass ich zur Kasse ging, um mich zu vergewissern, ob er stimmte. Dort stand Wito und kaufte gerade zwei Kisten von seinem Lieblingsgetränk, nämlich Darjeelingtee. Bevor wir auch nur ein Wort wechselten, lächelten wir uns wie zwei alte Verbündete an, die ihre gegenseitigen Schwächen kennen und sich gerade dabei ertappen, wie sie diesen erliegen. Wito bestand darauf, meinen Ingwer zu zahlen, nachdem der Besitzer sich salbungsvoll über den unmäßigen Preis, der auf dem Glas stand, ergangen hatte. Er besaß jenen Brooklyner Akzent, der uns warnend darauf hinwies, dass wir hier auf verlorenem Posten standen. Wir verließen zusammen den Laden. Nachdem mein Freund seine Zweifel über die Echtheit sowohl des Tees als auch besagten Ingwers geäußert hatte, lud er mich zum Essen ein. Er hatte einen Schiffskoch aus Jamaika, der eine Schweinshaxe in Pfirsichsoße zubereiten konnte, die ihm alle Ehre machte. Das Schiff lag an der Mole von Bienville vor Anker, genau gegenüber dem Laden, wo wir uns begegnet waren. Es war ein Frachtschiff mit einem schreiend gelben Anstrich, einer Farbe, die ich sonst nur an der Halskrause der Tukane des Carare gesehen habe. Die Kommandobrücke sowie die Kajüten und Büros waren weiß getüncht und hätten längst einen neuen Anstrich gebraucht. Der Name des Schiffes stand in keinem Verhältnis zu seinem bescheidenen Ladegewicht und seiner noch bescheideneren Erscheinung. Er lautete Hansa Stern. So hatte es Susana, die Frau meines Freundes, getauft. Sie hatte in ihrer Jugend einige Zeit in Hamburg verbracht, und in ihrer Begeisterung verherrlichte sie die Nordseestädte beträchtlich. Wito wollte den Namen aus sentimentalen Gründen nicht ändern. Seine Erklärungsversuche waren eigentlich völlig überflüssig, aber das war nun einmal typisch für ihn: ein professoraler und germanischer Eifer, alles mit übertriebener Genauigkeit zu erklären, als hätte die übrige Menschheit eine besondere Anleitung nötig, um die Welt zu verstehen.
Winfried Geltern. Seine Geschichte verdiente durchaus ein ganzes Buch. Sie war reich an Episoden aller Art, und da er über einige davon wie über glühende Kohlen hinwegzueilen pflegte, fand man sich schließlich in ihren labyrinthischen Verwicklungen nicht mehr zurecht. In den Häfen und letzten Winkeln der Karibik kannte man ihn nur unter dem Namen Wito. Weiß der Himmel, woher diese absurde Abkürzung seines Namens rührte, der von so stolzer Wikingerherkunft zeugt. Aber in dieser Gegend reduziert sich am Ende eben alles auf Maßstäbe, die zwischen einem faden Karneval und der traurigen Ironie schwanken, die ein Ergebnis des Klimas dieser Inseln und der elenden, alles zerstörenden Schäbigkeit der Karibikküste ist. Das fuchsartige Profil und sein zerstreutes Gehabe verhinderten mit einer gewissen dramaturgischen Folgerichtigkeit, dass man seinem Spitznamen auch noch den Titel des Schiffskapitäns hinzufügte. Man nannte ihn folglich einfach Wito. Es fiel ihm nie auf, wie lächerlich und unpassend diese Abkürzung wirkte. Er war in Danzig geboren, aber seine Familie stammte aus Westfalen. Er sprach alle Sprachen dieser Welt mit entwaffnender Sicherheit. Niemals erzählte er Anekdoten oder Einzelheiten aus seinem Leben auf dem Meer. Es schien, als stünde das Meer seinen sonstigen Gewohnheiten, Gedanken und Vorlieben fern. Sein Gang war aufrecht und fast ein wenig steif, was seinen Reden, die er mit der peinlichen Genauigkeit eines Uhrmachers vortrug, noch größere Wirksamkeit verlieh. Er hatte Augenblicke sarkastischen Humors, und seine Pointen explodierten immer wie ein Feuerwerk, um dann ebenso schnell wieder zu erlöschen. Eines Tages hörte ich ihn todernst sagen: »Das mit dem Klima ist eine rein subjektive Angelegenheit. Es gibt kein kaltes oder warmes, gutes oder schlechtes, gesundes oder schädliches Klima. Es sind die Menschen, die in ihrem Bewusstsein diesen Mythos erzeugen, den sie Klima nennen. Es gibt nur ein einziges Klima auf der ganzen Erde, aber die Menschen entziffern die Botschaft, die ihnen die Natur übermittelt, nach streng subjektiven und nicht übertragbaren Regeln. Ich habe in Finnland Lappen schwitzen und einen Schwarzen auf Guadeloupe vor Kälte zittern sehen.«
Nachdem er diese Weisheiten ausgesprochen hatte, unterstrich er seine Worte noch mit einer mehrmaligen, soldatischen Verbeugung, als hätte er gerade die Zukunft des Universums prophezeit. Man wusste nie, ob man diese Pointen mit einem Lächeln quittieren sollte oder mit dem braven Ernst des Schülers, der soeben von der Wahrheit erleuchtet worden ist.
Wir aßen in seiner Kajüte, und ich musste zugeben, dass die Künste des Kochs aus Kingston dem guten Ruf gerecht wurden, den sein Herr über sie verbreitete. Dann zündete er sich eine Zigarette aus schwarzem Tabak an, die ein saures Aroma nach verkohlten Sträuchern verströmte, und bei einer starken Tasse Kaffee begannen wir Neuigkeiten darüber auszutauschen, was aus uns in der langen Zeit geworden war, die wir uns nicht gesehen hatten. Anschließend erklärte ich ihm, dass ich gerade wieder eine dieser Zeiten durchlebte, in denen alles schief geht. Ich säße hier in New Orleans fest, und die wenigen Dollars, die mir noch geblieben wären, nachdem ich jenes wundervolle Geschäft mit Hochseefischereizubehör, das ich den Leuten von Grand Isle in den Cayuns verkaufte, aufgelöst hatte, seien demnächst verbraucht. Ich hätte schon mehrere SOS-Rufe an Freunde auf den fünf Kontinenten gesandt, ohne je eine Antwort zu erhalten. Es sei so, als wären sie alle gestorben. »Ja«, unterbrach mich Wito, »später trifft man sie in irgendeiner Bar, und dann setzen sie ein völlig überraschtes Gesicht auf und fragen dich, wo du denn die ganze Zeit über geblieben wärst, sie hatten schon geglaubt, dass du nicht mehr am Leben seist.« Nun gut, jedenfalls sei gewiss, dass mir kaum noch genügend Scheine in der Tasche blieben, um das Zimmer in jener zwielichtigen Pension in einem Viertel von Türken und Marokkanern zu bezahlen, wohin es mich mit einer Bauchtänzerin, Nichte der Inhaberin selbiger Spelunke, verschlagen hatte. Die Tänzerin sei kurz darauf nach San Francisco gegangen, und ich wäre dort geblieben und hätte mit mehr oder minder großer Geduld die entnervende Litanei von Vorwürfen des böswilligen Weibsstückes ertragen müssen, das mir die Schuld an der Flucht ihrer angeblich ›unschuldigen‹ Nichte gab. Ein Schatz, das gute Mädchen, ein Schatz, der vielversprechender sei, als sich die gute Frau träumen ließ. Sie besitze schon mehr als zehn Uhren der teuersten Marken, die sie den Kunden entwendet habe, wenn diese sich ihr während des Tanzes näherten, um ihr einen schmierigen Fünf-Dollar-Schein oder gar irgendeine dieser entwerteten südamerikanischen Währungen in den Gürtel oder in den Büstenhalter zu stecken. Wito schaute mich durch das dichte Gestrüpp seiner Augenbrauen an, während auf seinem harmlosen Fuchsgesicht ein zufriedenes Lächeln lag.
»Kommen Sie mit mir«, sagte er am Ende meiner Geschichte. »Ich brauche einen Buchhalter; ich weiß zwar, dass Rechnen nicht Ihre Stärke ist, aber die Sache ist so einfach, dass sogar Sie dazu taugen. Mein bisheriger Buchhalter erkrankte an Malaria und musste in Guayana in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Reglement der Handelsmarine verlangt, dass immer ein Buchhalter an Bord sein muss. Sie würden mir aus der Klemme helfen. Aber ich muss Ihnen gestehen, dass es mir im Augenblick nicht besser geht als Ihnen, Gaviero. Schon vor einem Jahr begann ich mich zu verschulden. Ich zahlte die Schulden, so gut es ging, ab, aber plötzlich verkomplizierte sich alles. Es gibt kaum noch Fracht, und es entstehen immer neue, piratenartige Fluggesellschaften, die mit drei alten DC